Romane & Erzählungen
Das Monster
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
...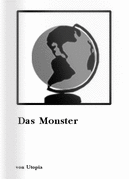
Das Monster
Beschreibung
Auf einem Schiff macht die Besatzung eine spektakuläre Entdeckung. Einige reagieren euphorisch, andere panisch, andere verfolgen ihre eigenen Ziele. Am Ende steht die Frage, wer ist das wahre Monster.
Zusammengekauert sa√ü es in dem Lager des gro√üen Schiffes. Die bleiche Brust hob und senkte sich; dass Atmen fiel immer schwerer. Jegliches Gef√ľhl wich langsam aus der m√§chtigen, lilafarbenen Schwanzflosse, die die H√§lfte des Wesens einnahm und schon lange aufgeh√∂rt hatte, energisch zu zucken. In diesem j√§mmerlichen Zustand brachen, in immer k√ľrzeren Abst√§nden, Wahnvorstellungen √ľber die Kreatur herein. Sie sah, wie sie im Meer, umgeben von hunderten Fischen, in allen erdenklichen Farben, weiter nach unten schwamm; so tief bis das Blau der See langsam von schwarzer Dunkelheit aufgesogen wurde. Aufgeregt und euphorisch schwamm es weiter. Doch immer wieder brach die Erinnerung ab und das Ungeheuer fand sich in der Realit√§t wieder, die mit einem gro√üen Schritt in die Gedankenwelt des keuchenden Wesens trat.
Mit jeder Minute, jeder einzelnen Sekunde die verging, lie√üen sich seine Kiemen, die sich links und rechts an dem langen, d√ľnnen, schneewei√üen Hals befanden, schwieriger mit Sauerstoff f√ľllen. Anf√§nglich hatte es noch versucht, einen Ausweg zu finden, doch konnte sich das Wesen ohne Beine nicht bewegen, nicht aufstehen, umherwandern, sich frei bewegen. Nur mit den Armen hatte es hierhin und dorthin kriechen k√∂nnen. Eingekesselt von Kisten, die aber dennoch keinen Schutz boten, vor dem, was die gr√∂√üeren, allem Anschein nach st√§rkeren Wesen, mit der Kreatur machten. Sie brauchte das Wasser, das es vorher permanent umgab und das lebensnotwendig war. Das Monster konnte nicht sagen, wie lange es sich schon auf diesem Schiff befand, das Zeitgef√ľhl hatte es schon verloren. Doch ohne den geliebten Ozean, in dem es vorher frei umher schwimmen konnte, w√ľrde es nicht mehr lange leben. Es ging ein.
Von der Besatzung des st√§hlernen Unget√ľms wurde es zwar alle halbe Stunde lang mit Wasser √ľbergossen, aber das reichte nicht mehr aus. Ihm fehlte der Sauerstoff, den es aus klarem Salzwasser filtern konnte. Die hellblauen Venen und Adern waren durch die Haut zu sehen. W√ľrde es nicht ab und zu die schuppige Schwanzflosse bewegen, h√§tte die Besatzung des Schiffes l√§ngst angenommen, dass das Wesen tot w√§re. Es sah sich in dem dunklen Raum ein weiteres Mal um. Hinter Kisten hatte es sich verstecken wollen, doch nun konnte es selbst keinen Weg mehr herausfinden.
Es pochte laut an der Stahlt√ľr. Der Riegel wurde mit einem lauten Knall zur Seite geschoben. Die T√ľr musste schwer zu √∂ffnen sein, denn jedes Mal war ein angestrengtes Keuchen zu h√∂ren, wenn sein W√§rter sich gegen das robuste Metall lehnte und den Kraftakt vollf√ľhrte. Mit dumpfen, durch die Gummistiefel quietschenden Schritten, kam der Mann immer n√§her. Ob es Verschiedene, oder jedes Mal der Gleiche war, konnte die Kreatur nicht sagen; f√ľr sie sahen alle gleich aus. Die Gestalt bahnte sich einen Weg, verschob ein paar Kisten und packte die Schwanzflosse des Wesens. Mit einem unglaublich festen Griff zog sie es aus seinem Versteck. Vorher hatte es immer mal wieder um Gnade gefleht, doch die finsteren Henker schienen es nicht zu verstehen. Nachdem der Riese einen Eimer Wasser √ľber das Ding gekippt hatte, verschwand er auch schon wieder.
Als sie es baumelnd in ihrem Netz fanden, erschraken sie; doch schnell verloren sie die Furcht vor dem Monster, das noch nicht einmal dazu f√§hig war aufrecht zu stehen. Bed√§chtig traten sie auf es zu, tippten mit Vorsicht auf die schuppige Haut, die wei√ü, nass und kalt war. Sie f√ľhlte sich an wie die eines Fisches, doch es sah auch aus wie ein Mensch. So etwas hatte die Besatzung noch nie zuvor gesehen.
Au√üer der riesigen Schwanzflosse, hatte es noch weitere Flossen an den Unterarmen, sie waren kleiner und mit einem gelblichen Schimmer; als auch drei auf dem Kopf, die sich vom Hinterkopf bis zum Nacken zogen – alle hatten eine dunkellilanen Farbton und schimmerten leicht gelb im Licht. Auch die Schultern waren ebenfalls mit den dunklen Schuppen √ľberzogen. Der Torso war dem eines Menschen gleich, mit breiten Schultern und einer muskol√∂sen Brust, weshalb die Besatzung davon ausging, dass das Wesen m√§nnlich war.
Nach dem die Matrosen die Angst vor dem Wesen verloren hatten, fingen sie an, sich einen Spa√ü aus ihm zu machen. Die M√§nner verzogen ihr Gesicht zu Grimassen und machten Fotografien von sich und der Kreatur; ansonsten w√ľrde diese Geschichte niemals irgendjemand glauben. Schrie das Wesen oder flehte es um Gnade, schien es die Seem√§nner nur noch mehr anzuspornen.
So wie es die Stimmen der Menschen nicht verstand, konnten sie wahrscheinlich die Laute des Wesens nicht verstehen.
Die gleichaussehenden Gestalten mussten sich wohl dar√ľber gestritten haben, was sie mit ihm machen sollten, denn nicht selten schrien sie, mit unglaublich tiefen Stimmen und zeigten mit dem Finger auf es. Die Mannschaft musste den halben Frachtraum des kleinen Transporters zur Seite r√§umen, um dem Passagier mitnehmen zu k√∂nnen.
Das einzigartige Ungeheuer, welches sich nun kurz vor dem Sterben befand, wurde in den Frachtraum gesperrt und gefangen gehalten. Seitdem sa√ü das Wesen nun in diesem Gef√§ngnis fest, hungernd und durstig, gequ√§lt und allein. Es wusste, dass es nicht mehr lange ohne den grenzenlosen Ozean aushalten w√ľrde.
Der Seemann, der eben seine Pflicht beendet hatte und den nun leeren Wassereimer zur Seite legte, wurde von einem Zweiten, der gerade den Raum betrat an der Schulter gepackt; mit ein paar Worten hinaus gezogen. Man konnte Panik aus deren monoton tiefen Stimmen heraushören.
Sie lie√üen es in der Zelle alleine zur√ľck. Von drau√üen konnte es die vertrauten Ger√§usche des Meeres h√∂ren und die Stimmen der streitenden, schreienden Menschen.
 
•
 
Als sie das Wesen im Netz entdeckten, hatte die Besatzung lange √ľberlegt, was sie mit ihrem Passagier machen sollten. Und obwohl es nun schon einige Stunden her war, berieten sie immer noch dar√ľber, was nun zu tun w√§re. Denn zur√ľckwerfen, wollten sie es nicht.
„Das Vieh bringt uns einen Batzen Bargeld ein.“, sagte Fred, der sich als erster dem merkw√ľrdigen Wesen gen√§hert hatte, als es entdeckt wurde.
„Ja, die Universit√§ten, werden sich um es streiten. Die werden uns mit Gold √ľbersch√ľtten.“, pflichtete ihm Samuel bei.
„Scheine w√§ren mir schon genug.“, Angus lachte und schlug auf die Schulter Sam. Alle drei trugen die gleichen, orange-roten Jacken.
Der alte Morgan trat an sie ran. Seine Augen waren aufgerissen, seine Mimik zeigte Angst.
„Dies ist Gottes Gesch√∂pf, wir m√ľssen es freilassen, oder der Zorn des Herrn wird √ľber uns kommen!“, er hob drohend den Zeigefinger und fiel auf die Knie; hob die Arme, als wolle er den Himmel umarmen.
„Verzeih uns Herr! Wir wandeln auf falschen Pfaden. Zeige uns den Weg!“, er packte sein Taschenmesser aus. „Ich leide f√ľr den Schmerz, den ich deinem Wesen zuf√ľge!“, nun begann, sich dem Arm entlang Schnitte zuzuf√ľgen. Die anderen Matrosen, verloren keine Zeit und st√ľrzten sich auf ihren Kollegen.
„Lasst mich!“, schrie der alte Mann. „Ihr werdet in der alle in der H√∂lle enden!“, br√ľllte er. „Vertraut auf Gott, er wei√ü, was zu tun ist! H√∂rt nur nicht weg!“
Ein Blitz erhellte die Umgebung. Schon vor seinem Ausbruch, hatte Morgan sich schon dagegen ausgesprochen, das Wesen √ľberhaupt an Bord zu behalten, doch ihn so weit gehen zu sehen, war f√ľr alle eine √úberraschung. Er hatte eine stille Diskussion entfacht, die jeder mit sich selbst austrug. Die Mannschaft fragte sich, ob es wirklich richtig war, dieses Wesen einzusperren; ob es nicht mehr Mensch war, als Tier. Sie hatten es in den Frachtraum geworfen, da keiner den verst√∂renden Anblick ertragen konnte; wollten es an ein Museum verkauften, um gemachte M√§nner zu werden. Doch nun keimten Zweifel in einigen von ihnen. War es richtig, was sie taten, oder Unrecht? Das wehrlose Ding, so zu behandeln wie einen Verbrecher. Ein Schlag, Metall auf Metall, durchdrang die Gedanken der Seem√§nner. Richard hatte mit einem Eisenrohr, gegen die Rehling geschlagen. Kleine Regentropfen trafen auf die Stahlkonstruktion, deren Ger√§usche von der brausenenden See verschluckt wurden.
„Seid ihr alle bescheuert oder was?! Kaum redet ein Wahnsinniger von Gott, schon vergesst ihr alles. Denkt an das Geld. Das Geld, das wir bekommen werden, wenn wir dieses nichtsnutzige Vieh verkauft haben.“, er ging einige Schritte auf die anderen zu. „Einen Sportwagen f√ľr alle! Gesicherte Zukunft f√ľr eure Kinder. Ihr k√∂nnt es schlie√ülich auch spenden, wenn ihr etwas Gutes tun wollt, aber was auch immer ihr wollt, es k√∂nnte euch geh√∂ren.“, er hatte es geschafft, die Aufmerksamkeit von einigen zu erregen.
„Er hat Recht!“, br√ľllte Simon. „Warum sollten meine Kinder benachteiligt werden, nur weil die anderen Eltern eine bessere Ausbildung finanzieren k√∂nnen. Richard hat Recht!“, er stellte sich vor ihn.
„Nein. Kein Mensch hat das Recht, Gottes Kreatur gefangen zu nehmen, denn schlie√ülich sind auch wir seine Gesch√∂pfe.“ Die √ľbrigen stritten auch, wer nun Recht hatte, ob Morgan, der sicher verwahrt wurde, oder Richard, der ein goldenes Funkeln in den Augen hatte. Viele w√§hlten die Seite von Richard, der das gro√üe Geld versprach und nur wenige stimmten Morgan zu. Zwei von ihnen machten sich auf, um Morgan zu befreien; was, nach Richards Meinung, einfach nicht toleriert werden konnte. Zwar war er nicht der Kapit√§n, der war damit besch√§ftigt, das Schiff nicht kentern zu lassen, denn der Sturm wurde mit jeder Minute heftiger, doch hatte er gen√ľgend M√§nner hinter sich. Bis auf vier Personen an Bord, hatten sich alle ihm angeschlossen.
„Die werden uns in den R√ľcken fallen, wenn wir ihnen nicht zuvor kommen.“, sprach Richard.
„Was ist mit dem Kapit√§n?“, fragte Michael.
„Der wird sich schon f√ľr uns entscheiden.“, sagte Richard zu dem ver√§ngstigt klingenden Matrosen.
„Und was machen wir, wenn er das nicht tut?“ Richard machte eine eindeutige Bewegung mit seinem Daumen an der Kehle.
„Du kannst doch nicht den Kapit√§n umbringen!“, emp√∂rte sich Michael.
„Ach, wer soll mich denn aufhalten? Ihr alle habt euch auf meine Seite geschlagen und nun habt ihr keinerlei Rechte, mir zu sagen, was ich tun oder lassen soll! Ihr TUT, was ich sage!“, br√ľllte der Seemann. „Also, auf geht es zum Kapit√§n.“, Richard ging, mit festem Schritt, auf die Treppe zu, die zur Br√ľcke f√ľhrte. Die anderen folgten ihm und das Getrippel von hundert Stiefeln war auf dem Metall zu h√∂ren.
Der Sturm wurde indes immer schlimmer; war es am Anfang nur leicht bew√∂lkt gewesen, ging nun der Wind so stark, dass die Treppe zu erklimmen, ein unglaublicher Kraftakt wurde. Leichter, nieselnder Regen, f√ľhlte sich auf dem Gesicht an, wie kleine Nadeln, die in die Gesichter gestochen wurden.
Der Gang, die Treppe hinauf, wurde schwieriger, je weiter sie kamen. Es waren nur zwei Meter, doch diese zogen sich f√ľr die meisten der M√§nner ins Unendliche. Sie wussten nicht was sie taten, folgten nur ihrem neu gek√ľrten Anf√ľhrer. Der stellte sich vor die T√ľr, klopfte einige Male fest gegen die T√ľr und trat sofort ein.
„Was ist denn?“, fragte der Kapit√§n, der einen gelben Regenmantel trug, dessen Plastikkapuze herunterhing.
„Hugh, wir m√ľssen dir etwas zeigen.“, Richard sah ihn ernst an.
„Ich kann, bei so einem Sturm, doch nicht das Steuer aus der Hand geben.“
„Es ist wichtig.“, die Stimme des Matrosen, lie√ü keinen Widerspruch zu. „Um das Steuer, kann sich auch Gerald k√ľmmern.“, es klang nicht wie ein Vorschlag. Der Kapit√§n sah zu seinem Stellvertreter. „Traust du dir das zu? Der Sturm wird heftig werden, es wurde gerade gesendet.“, das Funkger√§t erhellte den dunklen, engen Raum, mit orangenem Licht.
„Ja und ich werde mich sofort melden, wenn es irgendwie Probleme geben sollte.“
Hugh nickte. „Also, wenn es so wichtig ist.“
War der Gang die Treppe hinauf, beschwerlich und anstrengend gewesen, so war der Kapit√§n schnell unten und durch das halbe Schiff gelaufen. Die M√§nner √∂ffneten die schwere T√ľr. Der Kapit√§n trat ein, konnte seinen Augen nicht trauen, als er dieses unwirkliche Wesen vor sich sah. Es bewegte sich nicht, die Adern traten hervor, allgemein musste es in einem j√§mmerlichen Zustand sein; doch war es das Beeindruckendste, was Kapit√§n Hugh jemals gesehen hatte.
Das sp√§rliche Licht der Taschenlampe, die der Kapit√§n bei sich hatte, brachte die schuppige Haut zum Gl√§nzen. Das Monster tat nichts, lag nur auf dem Boden, atmete gerade mal ein und aus, die einzige T√§tigkeit, die es ausf√ľhrte; doch der so erfahrene Seemann, war gleichzeitig ergriffen, √§ngstlich – und neugierig.
Er trat an das Wesen näher heran, langsam, bedacht darauf, es nicht zu verschrecken. Bei jedem Schritt, zuckte es jedoch wieder neu zusammen.
Der Kapit√§n wollte es anfassen, das gl√§nzende Schuppenkleid ber√ľhren, mit der Hand entlang fahren, wissen, wie sich diese Einmaligkeit anf√ľhlt. Er stellte die Taschenlampe auf eine der Kisten und trat noch einen Schritt n√§her, der hallte durch den metallischen Raum. Das Wesen hob den Kopf und sah den Kapit√§n mit schwarzen Augen an. Hugh sp√ľrte regelrecht die Traurigkeit in den Blicken, sie durchbohrte ihn, umh√ľllte jeden Gedanken. Dem Menschen rann eine Tr√§ne √ľber die Wange, ihm wurde klar, dass es ein Verbrechen sein musste, eine solche Kreatur einzusperren und an einer solchen Teufelei wollte sich der Kapit√§n nicht schuldig machen.
„Lasst es frei!“, br√ľllte er zornig. Hugh stand auf und sah seien M√§nner an. Richard machte ein entt√§uschtes Gesicht und sch√ľttelte seinen Kopf.
„Ich hatte mir wirklich ein anderes Ende gew√ľnscht, aber wenn sie es so wollen.“, der Seemann schnippte einmal mit den Fingern und die restlichen Matrosen, sahen sich an. Sie kamen auf ihren Kapit√§n zu, packten ihn an seinen Armen und Beinen, trugen ihn auf das Deck. Der Sturm war noch schlimmer als zuvor. Das Deck war nass und rutschig, Regen prasselte auf das Metall, Wind kam aus allen Richtungen und meterhohe Wellen schlugen gegen das Schiff. Der Kapit√§n wehrte sich verzweifelt; schlug um sich, fluchte und schrie sie an, doch half es ihm nicht. Seine ehemals treuen M√§nner und freunde, warfen ihn √ľber Bord, ungesch√ľtzt in das Unwetter.
Richard nickte seinen M√§nnern zu. „Ich gehe und informiere unseren neuen Steuermann.“
Nach der Tat, zogen sich die Meisten in einen Aufenthaltsraum zur√ľck; er war nicht gro√ü, doch hatten sich die Seem√§nner l√§ngst an ihn gew√∂hnt und mit Kalendern von M√§nnermagazinen versch√∂nert. Die Stimmung war bedr√ľckend, die M√§nner konnten nicht fassen, was sie getan hatten; manche arbeiteten schon seit Jahren auf dem Schiff, mit Hugh als Kapit√§n; doch ein Wort von Richard hatte ausgereicht und die M√§nner hatten nur noch Geld im Sinn. Der Sturm, der drau√üen tobte, verschlimmerte sich von Sekunde zu Sekunde. Im Normalfall, herrschte auf einem Schiff ein gesch√§ftiges Treiben, wenn sich die ersten dunklen Wolken zusammenrafften, die Wellen h√∂her wurden; doch dieses Mal, schien es keinen zu interessieren. Der Raum bewegte sich von einer Seite auf die andere; es k√ľmmerte keinen. Die Worte von Morgan, hallten durch ihre K√∂pfe.
„Denkt ihr, er hat Recht?“, begann der junge Paul. „Denkt ihr Morgan hat Recht und wir tun etwas Falsches? Ich meine…“
„Warum sollten wir, okay, den Kapit√§n ins Meer zu schmei√üen war nicht freundlich, doch es war n√∂tig, sonst h√§tte er eine Gefahr f√ľr unsere Ordnung dargestellt.“, Eric lie√ü dem Jungen, der gerade seinen Mund aufmachen wollte, keine Chance etwas zu erwidern.
„Spar dir die Worte, egal was du sagen wolltest, getan ist getan und du hast mitgemacht, also halt deinen Mund.“
„Beruhige dich.“, versuchte einer der anderen dazwischen zu gehen. „Du brauchst ihm ja nicht gleich den Mund zu verbieten.“
„Ich kann und ich werde, der Kleine hat eh nichts von Interesse zu sagen, da kann er gleich seine Klappe halten, schlie√ülich hat Richard, mir die Verantwortung √ľbertragen.“, stolz schlug er auf seine Brust.
Damit war das Thema f√ľr Eric beendet; doch Paul war noch jung, dynamisch und lie√ü sich nur ungern etwas verbieten – au√üerdem wurde ihm etwas bewusst: Morgan musste einfach Recht haben. Schon Eric f√ľhlte sich wie ein Gefangener, wenn er nicht selbst entscheiden konnte, was er tat – h√§tte er das, w√§re der Kapit√§n wom√∂glich noch am Leben und werde nicht hilflos im Wasser treiben –, wie f√ľhlte sich dann erst die Merkw√ľrdigkeit, die sie weggesperrt hatten? Trauer erf√ľllte die Gedankenwelt des jungen Seemanns; doch da war noch etwas anderes – Wut. Eine Wut auf alle, vor allem aber auf Richard, der Schuld an allem war. Die Anderen, befolgten zwar seine Befehle, doch er erteilte sie. Der Junge musste etwas tun. Er sprang auf.
„Ich gehe mal kurz raus.“ „Aber Richard hat gesagt, dass niemand diesen Raum verlassen soll.“, beschwerte sich Eric, mit und fuhr mit der Hand, seinem Drei-Tage-Bart entlang.
Bestimmt war er misstrauisch, dachte sich Paul, der nun allerdings, nicht mehr von seinem Weg abweichen wollte. Die, die anderer Meinung waren, hatten sie eingesperrt und Hugh, ohne Z√∂gern √ľber Bord geworfen; was sie mit einem Verr√§ter machen w√ľrden, wollte sich der junge Mann gar nicht ausdenken. W√ľrde er das Wesen freilassen, w√§ren sie von Richards Griff befreit, er h√§tte keine Macht mehr, denn im Moment, war er die personifizierte Gier und redete sie den anderen ein. Es war erschreckend f√ľr Paul, mit anzusehen, wie seine Freunde, zu willenlosen Sklaven wurden und er wusste, dass wenn er nichts tat, das Wesen nicht freilassen w√ľrde, die ganze Geschichte nicht gut ausgehen wird. Den Fehler, nicht widersprochen zu haben, musste er wieder gut machen.
Er musste das Wesen freilassen, schlich sich durch das gesamte Schiff, zu den Frachträumen. Der Sturm draußen wurde immer schlimmer, Paul hatte Schwierigkeiten sich auf den Beinen zu halten und stolperte fast bei jeder Bewegung. Er war zu einem Spielball geworden, doch wehrte er sich so gut es ging gegen den drohenden Fall.
Ein schepperndes Geräusch ertönte hinter dem Gang links, in den man gehen musste, um zum Frachtraum zu kommen. Richard lag auf dem Boden und zwei Gasflaschen lehnten an der Wand.
„Was machst du hier?“, fragte er. „Ich... ich will nur....“, stotterte Paul. Er sah sich im Raum um. Als das Wesen in den Lagerraum gebracht wurde, mussten sie Platz schaffen und hatten einige kleine Metallrohre an die W√§nde gelehnt, die nun verstreut auf dem Boden lagen. Der junge Matrose griff sich eines der Rohre und hielt es fest in seinen H√§nden. „Ich werde das Ding freilassen und du wirst mich nicht aufhalten!“, schrie er Richard entgegen.
„Du wirst was?“, sprach der √§ltere Mann mit einer ungl√§ubigen Stimme. „Ich dachte du w√§rst einer von uns?“, sagte er noch ein wenig zorniger. „Unser Freund.“
„Nein! Du hast gedacht ich w√§re dein Anh√§nger, w√ľrde alle deine Befehle befolgen, die du gibst.“
„Du schl√§gst dich also auf die Seite der Verr√§ter, wie schade. Hat dich Morgan dazu angestiftet? Dieser Fanatiker, der alles unbesehen glaubt, was man ihm sagt? Der ein willenloser Sklave ist?“
„Nein, niemand auf diesem Schiff ist frei. Wir waren es, bis du Gr√ľnde gefunden hast, sie uns wegzunehmen. Aber bald sind es wieder, wenn wir das Monster los sind. Dich zerfrisst die Gier, die anderen sind so naiv, dass sie alles tun was man ihnen sagt und der Rest wird weggesperrt.“
„Die einzigen Monster hier, sind Verr√§ter wie du.“ Ein Blitz erhellte das Deck, f√ľr eine Sekunde, in der Richard gespenstisch blass aussah, mit einem irren Blick, der bewies, dass er nicht mehr der Herr seiner Sinne sein konnte. Er sah in dem Zwielicht aus wie eine lebende Leiche, unmenschlich, unwirklich. Noch nie hatte der Paul solche Angst erlebt, wie in diesem Moment.
„Du hattest eine Wahl, Junge.“ Richard hob ein Stahlrohr auf. „Du hast die falsche getroffen und nun musst du auch die Konsequenzen tragen. Genau wie der gottesf√ľrchtige Narr.“
„Du bist nicht besser.“, schrie Paul ihm entgegen. Richard sah ihn mit Unschuldsaugen an. „Ich habe hier jedem die freie Wahl gelassen. Aber sie...“ „Hast du nicht!“, unterbrach ihn Paul. „Du hast sie manipuliert, ihnen das versprochen, was sie sich am Meisten w√ľnschen und schon hatten sie keine eigene Meinung mehr! Und wer die nicht hat, andere einsperrt, nur weil sie unbequem sind oder sogar t√∂tet, ist kein Mensch mehr und verdient es nicht zu leben! Denn nur ein freier Mensch...“ Das Metallrohr traf Pauls Gesicht. Er ging zu Boden.
„Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen! Ich bin kein Unmensch, ich folge nur meiner Natur!“
„Selbst du bist also nichts weiter als eine Marionette.“ Die Raserei in Richards Augen, wurde nun zu blankem Irrsinn. Drau√üen donnerte und blitzte es. Das Schiff wurde so hart von einer Welle getroffen, dass sich der Wahnsinnige nicht mehr auf den Beinen halten konnte und gegen eine Wand geschleudert wurde. Paul nutzte seine Chance, sprang auf und lief, so gut es ging, in Richtung Ausgang. Vorbei an der Kaj√ľte, in der Morgan und seine Leute gefangen gehalten wurden. „Vertraut Gott, er wei√ü alles.“, h√∂rte man selbst durch die Stahlt√ľr.
Vorbei an dem Aufenthaltsraum, in dem gestritten wurde, ob sie nicht doch raus gehen sollten, um dem Sturm entgegen zu wirken.
„Vertraut Richard, er hat uns gesagt, was wir tun sollen“, beruhigte Eric seine Freunde.
Drau√üen im Freien, machte Paul ein Beiboot klar. Richard¬† griff seine Beine und warf ihn √ľber Bord. Er sah das Beiboot an und sagte: „Ich verschwinde von hier.“
 
•
 
Hohe Wellen krachten gegen die H√ľlle des Transporters; das Schiff hatte gro√üe Probleme nicht zu kentern, Es wurde in alle Richtungen geschleudert, war nur noch ein Spielball der Naturgewalt, die mit dem metallenen Ger√ľst spielte. Ruckartig √§nderte es die Lage, fast in Querlage liegend, trieb das Schiff auf dem Meer, das Innere, unvertaute Kisten und das Ungeheuer, welches sich auf dem Boden wand, wurden von einer Ecke in die andere geschleudert. Doch das Ger√§usch des Stahls, das Verziehen jedes einzelnen Teils des Schiffes, welches sich gegen sie Wassermassen wehrte, konnten dem Wesen keine Angst einjagen, denn durch die uns√§glichen Ger√§usche des grauen Gef√§ngnisses; dem Getrampel der schwarzen Stiefeln, den panikartigen Rufen der Besatzung, h√∂rte es etwas Vertrautes – etwas, dass es kannte und liebte; etwas, dass die Gabe besa√ü, Sehnsucht zu wecken, dass der Kreatur das Gef√ľhl gab, der eigene Herr zu sein: Das Meer. Unendliche Tiefen, die es noch nicht erkundet hatte. Das dunkle Blau, welches es erst vor ein paar Stunden verloren hatte, dennoch aber vermisste, wie nichts anderes auf der Welt. Es war mehr als Heimat f√ľr das Biest, das die Fischer in ihrem Netz fanden – es war die Erf√ľllung seiner Tr√§ume.
Von drau√üen kamen, trotz der dicken H√ľlle gut h√∂rbare, Schreie der Mannschaft an die Ohrl√∂cher der Kreatur; eindeutig war Panik in ihren Stimmen, obwohl es die Sprache nicht verstand. Die Turbulenzen wurden immer st√§rker, das Wesen wurde immer h√§rter gegen die W√§nde seines Gef√§ngnisses geschleudert. Nach einem besonders harten Treffer, ging das Licht aus. Nur eine Taschenlampe, die von einem der Riesen im Raum gelassen worden war, brannte noch. Mit einem lauten Knall sprang die T√ľr auf. Ein w√ľtender, angst erf√ľllter Seemann stand im Raum; hinter ihm nur Dunkelheit. Mit Worten in der harten Sprache, die das Wesen qu√§lte, kam er, Schritt f√ľr Schritt, immer n√§her. Irgendwetwas sagte der W√§rter etwas, doch die Kreatur verstehte kein Wort.
Dehydriert und verletzt, lag das einzigartige Unget√ľm in der Ecke. Der Wahnsinn in den Augen des Menschen, jagte ihm Angst ein. Eine Angst, die es niemals zuvor geglaubt h√§tte f√ľhlen zu k√∂nnen.
Nun befand sich das Ungeheuer ihm gegen√ľber. Ein lauter Knall war auf einmal zu h√∂ren, ein Schlag, Wasser gegen Metall, der das ganze Schiff zum Beben brachte. Die Taschenlampe, die auf einer Kiste lag, fiel durch den Schlag auf den Boden; die Gl√ľhbirne zerbrach. Der Seemann griff in die halboffene Kiste und nahm eine Phosphorfackel heraus, die mit einem Zischen angez√ľndet wurde. Die Szenerie wurde in ein gef√§hrlich aussehendes Rot getaucht.
Ein weiterer Schlag ersch√ľtterte den Kahn und brachte ihn zum Kentern. Die ungesicherten Kisten flogen durch den Raum. Der muskol√∂se Mann wurde von ihnen an die Wand, welche nun den Boden darstellte, geschleudert. Er schien ohnm√§chtig zu sein, da er sich nicht mehr bewegte.
Das Ger√§usch des Meeres, das Rauschen der Wassermassen, wurde immer st√§rker, es wurde lauter, es kam n√§her, das Monster konnte es h√∂ren, ganz klar und rein. Das Herz der Kreatur, welches unter der blassen, wei√üen Haut schlug, pochte heftiger, Rettung w√ľrde kommen, das war nun kein Traum mehr, sondern Gewissheit. Die Hilfe, auf die das Biest hoffte, brach in den Raum herein, √ľberflutete alles, verschlang jeden einzelnen Zentimeter, in den es vordrang.
Der Matrose war allem Anschein nach doch noch am Leben gewesen, denn das Ungeheuer, konnte noch den Todeskampf beobachten, den er ausgefochten hatte, bevor das Wasser die Lungen f√ľllte. Der vor einer Sekunde noch so starke und Angst einjagende Mann verwandelte sich in ein rotes Etwas, das nur noch leblos im Frachtraum herum trieb.¬† Es sah gespenstisch aus, doch war der Meeresbewohner gerettet. Er hatte es √∂fters schon erlebt, mehr Gl√ľck als Verstand zu haben; doch dieses Abenteuer war f√ľr seinen Geschmack, zu knapp gewesen.
Der befreite Gefangene mobilisierte seine letzten Kräfte, schwamm aus dem Raum, durch das gesamte Schiff, durch die engen Gänge, das labyrinthartige Geflecht des Schiffes; immer wieder traf er auf die toten Körper der Besatzung, die im kalten Wasser umher trieben.
Einer von ihnen schien noch am Leben zu sein, denn er hielt die Schwanzflosse fest, br√ľllte etwas und das letzte, was der Meeresbewohner sah, waren die Luftbl√§schen, die das Gesagte in tausend Teile nach oben trugen, ohne dass jemand jemals erfahren konnte, was die letzten Worte des Toten waren. Der Griff lockerte sich und der unfreiwillige Passagier war wieder frei. Das kalte Gef√§ngnis lag nun in einer Schieflage und leblose K√∂rper trieben im Wasser. Nur Drei zuckten und schwammen noch um ihr Leben. Bei jedem Zug mit den Armen, bildeten sich hunderte Luftbl√§schen, die nach oben trieben und durch die das Mondlicht wie Perlen aussahen.
Den Ausgang zu finden war einfacher als der Befreite angenommen hatte. Als er endlich den Weg aus dem Schiff fand,fiel sein erster Blick auf das vermisste, tiefe, dunkle Blau. Auf die Fischschw√§rme, die sich als Gruppe bewegten. Nun war er wieder in seinem Umfeld, in dem Gebiet, das er kannte. Hier f√ľhlte er sich daheim, wusste, wo er hingeh√∂rte. Hier war er ein Jemand. Er schwamm in den Ozean hinein, weiter nach unten und verschwand im Meer.
 
•
 
„Sind sie wirklich sicher, dass es hier war?“
„Ja, ganz sicher. Die Koordinaten stimmen.“ Hugh kontrollierte noch einmal den Bildschirm. „Hier bin ich von Bord gegangen und hier ist das Schiff gesunken.“
„Ich kann niemanden entdecken, es ist wahrscheinlich letzte Nacht¬† gesunken. Bei dem Sturm ist w√§re es nichts ungew√∂hnliches, au√üerdem erreichte uns das SOS, als es schon zu gef√§hrlich war hinauszufahren. Sie haben wir auch nur mit Gl√ľck gefunden.“
Der kleine Kutter tuckerte durch √úberreste von Kisten, die im Meer herumtrieben. „DA!“, br√ľllte Hugh. „Da ist einer!“ Er lief schnell aus dem Steuerhaus, griff sich einen Rettungsring und sprang ins Wasser. Paul kam langsam wieder zu sich. Noch benommen versuchte er etwas zu sagen, aber keiner konnte ihn verstehen.
„Du hast mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt Junge.“ Paul atmete schwer ein und aus. „Kein anderer hat es geschafft. Falls du es wissen willst.“ Hugh stand auf und lie√ü den Jungen auf dem Deck liegen. „Ich besorg dir mal was zu essen. Und es w√§re besser, wenn du niemandem etwas erz√§hlen w√ľrdest. Ich bin froh, dass es wenigstens wir beide geschafft hat.“
Kommentare
Kommentar schreiben
| Utopia Re: Eine tolle Geschichte... - Zitat: (Original von Fianna am 03.12.2011 - 14:19 Uhr) Wirkungsvoll finde ich, dass du mehrmals die Perspektiven wechselst. Das macht alles noch viel interessanter. Au√üerdem regt dieser Text zum Nachdenken an (mich jedenfalls). Liebe Gr√ľ√üe Fianna Da sitz ich doch gerade mit einem L√§cheln vor dem PC ^^ |