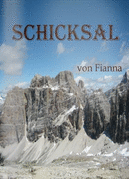Glaubt ihr an Schicksal?
Ihr wisst schon, diese unerklärliche Kraft, die euch dazu veranlasst euren morgendlichen Kaffee auszukippen, ohne den ihr unausgeschlafen zur Arbeit kommt, wo euch schon die stichelnden Kollegen erwarten, die natürlich sofort den kleinen dunklen Fleck auf eurer Hose bemerken, der, von euch unbemerkt durch das verschüttete Getränk dorthin gelangt ist. Ihr ärgert euch fürchterlich, kommt dadurch zu spät zum Arzt, da ihr den Bus verpasst, nur um dort zu erfahren, dass euer Termin ohnehin um eine Stunde verschoben wurde.
Um allem noch die Krone aufzusetzen erklärt euch dann der Doktor, dass ihr weniger Kaffee trinken und besser auf eure Gesundheit achten solltet.
Alles nur Zufall? Möglich, sogar wahrscheinlich. Nur Esoteriker glauben, dass alles im Leben vorherbestimmt ist und einen Sinn hat.
Aber jetzt einmal ehrlich: Glaubt ihr wirklich, dass es einen tieferen Sinn hat, wenn ihr euch in der Früh beim Aufstehen den Kopf anschlagt, wenn ein Tornado einen ganzen Landstrich verwüstet, wenn ihr auf der eisigen Straße ausrutscht, oder wenn ein gewaltiger Erdrutsch ein ganzes Dorf unter sich begräbt?
Im Grunde könnte man sich dann doch immer auf das Schicksal hinausreden, oder?
Dann war es wohl auch Schicksal, dass der Nationalist, Gavrilo Princip, den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand erschoss. Wäre es nicht vorherbestimmt gewesen, hätte ihn die Kugel wohl verfehlt. Ist der Serbe also Schuld am Tod des Thronfolgers? Ist seine Tat also der Auslöser für den Ersten Weltkrieg? Kann ein einziger Mensch überhaupt das Schicksal so vieler bestimmen?
Nein. Nicht der Mensch bestimmt das Schicksal, sondern das Schicksal bestimmt sich selbst. Jedenfalls, wenn man an das Schicksal glaubt.
Ich selbst glaube ja nicht daran, nicht mehr, seit jenem verdammten Tag im Januar, an dem mein ganzes Leben völlig aus dem Ruder lief.
Dabei hatte der Tag so gut angefangen. Weder hatte ich den Wecker überhört, noch hatte mein Vermieter an die Tür gepocht um mich an die überfällige Zahlung der Miete zu erinnern. Nicht einmal der Bettler war mir über den Weg gelaufen, der mir alltäglich vor dem Haus auflauerte und um eine kleine Spende für etwas zu Essen bat, in Wirklichkeit - seinem Geruch zufolge - aber alles für Alkohol ausgeben würde. Ich hatte ihm zwar noch nie auch nur einen Cent überlassen, trotzdem ging er mir langsam gewaltig auf die Nerven.
Der Schaffner hatte mich übersehen und bemerkte somit nicht, dass mein Ticket schon seit Tagen abgelaufen war.
Alles in allem hätte es also ein wunderbarer Tag werden können, besser als alle, die ich schon erlebt hatte, zusammen. Doch das Schicksal, an das ich zu diesem Zeitpunkt noch hartnäckig glaubte, schien anderes mit mir geplant zu haben.
Mit bester Laune – ein ziemlich ungewohntes Gefühl – betrat ich meinen Arbeitsplatz, ohne mir irgendwelche Sticheleien anhören zu müssen. Es hätte nicht besser laufen können. Niemand schien Notiz von mir zu nehmen, was mir mehr als nur Recht war.
Voller Elan startete ich meinen Computer und, während die Startmelodie von Windows erklang, drang zufällig das Gespräch zwei meiner Arbeitskollegen an meine Ohren. Eigentlich hatte ich da gar nicht hinhören wollen. Die Belange anderer interessierten mich überhaupt nicht, doch irgendetwas veranlasste mich dazu, den Worten doch zu lauschen.
Kaum hatte ich ein paar der gesprochenen Sätze vernommen, da wurde mir bereits klar, dass sie über mich sprachen. Natürlich, worüber auch sonst? Mein völlig verkommenes Leben war hier Gesprächsthema Nummer Eins. Schon seit langem. Stunde für Stunde, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, seit ich eingestellt worden war, kannten diese Menschen keine bessere Beschäftigung als hinter meinem Rücken über mich her zu ziehen, oder mich mit falscher Freundlichkeit auf zu ziehen.
Mit der Zeit hatte ich mich daran gewöhnt; hatte ich gelernt, nicht hin zu hören, ihren Worten keinerlei Bedeutung beizumessen; ihrer falschen Freundlichkeit mit Abweisung zu begegnen. Seit der Grundschule hatte ich diese Fähigkeiten perfektioniert. Ich war ein Meiser des Verleugnens geworden, sodass der Spott anderer mir nichts mehr anhaben konnte. Ihre Gemeinheiten konnten den Panzer nicht mehr durchdringen, den ich mir in all den Jahren zugelegt hatte, der nach jeder Beleidigung, nach jedem bösen Grinsen, nach jeder heuchlerischen Anteilnahme, ein klein bisschen weiter gewachsen war.
Jedenfalls glaubte ich das, bis zu jenem Tag, an dem ich diesem Gespräch gelauscht hatte, das eine Saite in mir zum Klingen brachte, die kurz darauf Risse in meinen Panzer schlug und all die aufgestaute Wut und den Hass in meine Blutbahnen entließ. Wilder Zorn durchflutete mich und nichts hielt mich mehr auf meinem Stuhl.
Unter den missbilligenden Blicken meines Chefs und meiner so genannten Kollegen, stürmte ich aus dem Gebäude, lief, ohne Rücksicht auf Verluste, über die Straße, wo mir so mancher Autofahrer hupend einen Fluch hinterherschickte. Doch ich war nicht mehr zu bremsen. Für mich existierte die Welt um mich herum nicht mehr. Es gab nur noch mich, meinen Zorn, den Hass auf mich selbst und die Frage, warum ich nicht anders war.
Wieso ging alles, was ich anfing in die Brüche? Wieso war alles, was ich sagte, falsch? Wieso musste ich ein Mensch sein, der einfach keinen Sinn ergab. Nichts, was ich tat, brachte mich weiter. Nichts, was ich tat, half sonst jemandem. Ich war ein Niemand, der es verdient hatte, von allen verhöhnt zu werden. Sie hatten es geschafft. Sie hatten ihr Leben gemeistert, trugen etwas dazu bei. Ich konnte ihren Spott beinahe verstehen.
Meine Füße hatten mich aus der Stadt geführt, die diese Bezeichnung wegen ihrer Größe eigentlich gar nicht verdient hatte. Alter Schnee knirschte unter meinen Schuhen, als ich in den Wald eindrang. Kleine Äste schlugen mir ins Gesicht, fügten mir kleine Kratzer zu, doch ich spürte es nicht.
Selbsthass war das einzige Gefühl, zu dem ich imstande war. Nicht einmal Schmerz konnte es übertrumpfen. Von Sekunde zu Sekunde wuchs der Hass in mir an und damit auch die Entschlossenheit es zu Ende zu bringen, allen einen Gefallen zu tun.
Schlitternd kam ich zum Stehen. Ich atmete schwer und Dampfwolken bildeten sich vor meinem Mund.
Es begann zu regnen.
Eigentlich hätte es schneien sollen, so kalt, wie es war, doch das tat es nicht.
Als ich also so dort oben stand, allein, völlig verzweifelt und zum Äußersten entschlossen, schienen die Naturgesetzte außer Kraft gesetzt worden zu sein und es regnete. Kühle Tropfen benetzten mein Gesicht, die einzige Stelle, die nicht von Stoff bedeckt war. Der Regen vermischte sich mit meinen Tränen, die mir unbewusst über die Wangen rollten. Ich tat noch einen Schritt und hielt erneut inne.
Hier würde es enden, hier an dieser Klippe, ein für alle Mal. Alles würde vorbei sein, für immer. Ich war der festen Überzeugung, dass es so richtig war. Mein ganzes Leben hatte mich auf diesen Moment vorbereitet. Das war meine Bestimmung, mein Schicksal. Das einzige, was ich zu tun brauchte, war, noch einen Schritt zu machen, einen einzigen und mein Leben hätte einen Sinn gehabt, das Ziel wäre erreicht.
Plötzlich brachen die Wolken auf und ein Lichtstrahl erhellte die Umgebung. Ein Regenbogen bildete sich, jedoch nur für einen kurzen Moment, dann schoben sich die Wolken wieder zusammen und es wurde dunkel.
Ich tat einen kleinen Schritt nach vorne. Eine Schneelawine von einem Ast, der die Last einfach nicht mehr tragen konnte, fiel mir auf die Schultern, als wolle die Natur mich ermutigen, den letzten Schritt zu tun, meiner Bestimmung zu folgen.
Und das tat ich auch.
Doch, ehe ich meinen Fuß auch nur heben und mich vorlehnen konnte, kam ein so starker Wind auf, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Ich lehnte bereits nach vorne, war kurz davor, in die Tiefe zu stürzen, doch der Wind hielt mich mit aller Macht zurück. Für einen kurzen Augenblick, der mir wie eine Ewigkeit vorkam, hing ich so in der Schwebe.
Halb am Leben.
So gut wie tot.
Und nach einem letzten Aufbäumen setzte der Wind aus.
Sekunden vergingen, in denen ich da stand, bereits so weit nach vorne gelehnt, dass ich fast schon das Gleichgewicht verlor. Ein kleiner Schubs, ein leichter Windhauch hätte mich zu Fall gebracht.
Doch ich zögerte und unter gewaltiger Anstrengung spannte ich alle meine Muskeln an und zog mich zurück, machte einen vorsichtigen Schritt rückwärts, fort von der Klippe, fort vom Tod und hin zum Leben.
Ich schwankte nicht, ich zitterte nicht. Eine nie gekannte Standhaftigkeit hatte von mir Besitz ergriffen. Wärme durchflutete meinen Körper und mit einem Mal fühlte ich mich, als wäre ich aus einem bösen Traum erwacht.
Ohne auch nur noch einen Blick zurück zu werfen, lief ich los. Noch am selben Tag kündigte ich und machte mich auf den Weg nach Hause, um zu tun, was ich schon längst hätte tun sollen.
Kaum sah ich mein Haus vor mir, da erblickte ich auch schon den Bettler, der zusammengekrümmt auf einer Bank saß. Als wüsste er, wer sich ihm näherte, hob er, kaum, dass ich vor ihm zu stehen kam, den Kopf und stierte mich aus blutunterlaufenen Augen an. Wortlos streckte er mir seinen Becher hin, in dem neben wenigen Euros auch ein bereits gekauter Kaugummi lag.
Kurzerhand entriss ich ihm den Becher, ergriff seine Hand und zog ihn hoch. „Es wird Zeit, zu leben“, erklärte ich ihm und führte ihn schnurstracks in meine Wohnung, wo ich ihm eine Tasse Tee und alles an Essen hinstellte, das ich finden konnte.
Mit einigen wenigen erklärenden Worten ließ ich ihn allein und ging zu meinem Vermieter, um ihm sein Geld zu geben, auf das er schon seit langem zu warten hatte.
Ein völlig verwirrter Mann öffnete mir die Tür und nahm erst bei der zweiten Aufforderung meinerseits das Geld entgegen, das ich ihm hinhielt.
Als ich ihn verließ rief er mir ein „Vielen Dank“ hinterher.
Ich betrat meine Wohnung und wollte zu dem Bettler zurückkehren, den ich zuvor allein gelassen hatte. Doch, als ich die Küche betrat, war dort niemand. Verwirrt sah ich mich um, doch alle Zimmer blieben leer.
Vorsichtig ließ ich mich auf einem Stuhl nieder. Da fiel mein Blick auf das Fenster, das durch die Kälte angelaufen war. Überrascht erblickte ich dort Buchstaben, die fein säuberlich in das Kondenswasser geschrieben worden waren.
„Jetzt, da du dich selbst gefunden hast, pass auf, dass du dich nicht wieder verlierst.“
Lange stand ich einfach nur da und betrachtete diese Worte. Dann geschah etwas, das schon seit Ewigkeiten nicht mehr passiert war. Mit einem Mal breitete sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus.
Zum ersten Mal in meinem Leben schien ich etwas richtig gemacht zu haben und es war so einfach.
Man musste nur aufhören zu glauben, dass man nichts konnte und anfangen, es zu versuchen.
Ich habe meine Meinung über das Schicksal von diesem Tage an geändert und ich glaube, dass es auch gut so ist. Wenn man nämlich immer glaubt, dass man an seiner Lage ohnehin nichts verbessern kann, wird sich auch nichts ändern. Mag sein, dass es einen vorgegebenen Pfad gibt, dem wir folgen müssen, doch an diesem Tag im Januar vor vielen Jahren wurde mir ganz klar gezeigt, dass ich entscheiden konnte, wohin dieser Weg führt und das ist auch gut so.
© Fianna 24/12/2011