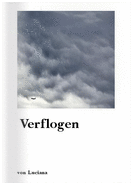„Hast du einen guten Platz erwischt?“ Mia blickte erst zu dem dicken Mann, der jetzt schon sein Gesicht gegen das Fenster lehnte und schnarchte, und dann zu dem anderen Mann neben ihr, der an seiner Armbanduhr fummelte und leise betete. „Ist in Ordnung“, sagte sie dann in den Lautsprecher ihres Handys. Am anderen Ende hörte sie das leise Rappeln der Waschmaschine. „Ist bei euch soweit alles gut gelaufen?“ erkundigte sie sich, und ihr Mann lachte leise. „So einigermaßen. Es wird Zeit, dass du nach Hause kommst.“
„Ja, die Putzfrau kehrt bald zurück.“
„Du weißt genau, dass es nicht darum geht.“ Sie hörte sein beleidigtes Schweigen am anderen Ende der Leitung.
„Schon gut, Steven. Es war nicht so gemeint.“
„Ich liebe dich.“
„Ich dich auch.“
„Ich habe dich wirklich vermisst, Mia.“
Bevor sie darauf antworten konnte, hörte sie einen empörten Ausruf ihres Mannes. Dann war eine andere Stimme in der Leitung.
„Mama! Wo bist du?“ Ihr Sohn klang aufgeregt und seine Stimme zitterte.
„Ich bin im Flugzeug, Schatz.“
Sie hörte, dass er anfing zu weinen. „Komm nach Hause, Mama!“
„Ich komme nach Hause. Das Flugzeug fliegt gleich los, und dann bin ich da.“
„Heute noch?“
„Ja, heute Abend bin ich wieder bei dir.“ Er schluchzte immer noch, und sie beschloss, ihre Überraschung jetzt schon zu offenbaren.
„Pass auf, weißt du eigentlich, dass heute Nacht ganz viele Sternschnuppen auf die Erde fallen sollen?“ Sofort hörte er auf zu weinen. „Echt?“ Er liebte die Sterne, die Planeten und den Weltraum. Mia lächelte. „Ja. Und wenn ich da bin, dann sehen wir sie uns an, du und ich. Solange, wie du Lust hast. Ist das gut?“
„Ja!“ rief der Kleine, und sie wusste dass seine Wangen vor Freude glühten.
„Meine Damen und Herren, ich heiße sie an Bord dieses Flugzeugs willkommen. Wir werden in Kürze starten. Bitte klappen sie die Tische nach oben, legen sie die Sicherheitsgurte an und achten sie darauf, dass alle Mobilfunkgeräte ausgeschaltet sind. Ladys and Gentleman, welcome…“
„Schatz? Wir fliegen los. Ich muss auflegen. Bis heute Abend. Ich hab dich lieb.“
„Ich dich auch, Mama.“ Dann klickte es. Mia ließ das Telefon in ihre Tasche gleiten und legte den Sicherheitsgurt an. Sie sah zu dem Mann mit der Armbanduhr. Ihm stand Schweiß auf der Stirn. „Flugangst?“ fragte Mia fürsorglich. Er fuhr zusammen und nickte dann hysterisch. „Kein Grund zur Beunruhigung“, sagte Mia tröstend. „Wir werden schon nicht abstürzen.“ Er lächelte schief.
„Mein Herr? Hier ist jemand, der sie sprechen will.“
„Ich habe keine Zeit. Wie sie sehr wohl wissen, sitze ich in einer Besprechung.“
„Ich bedauere. Aber er sagte es sei wichtig.“
„Nicht jetzt!“
„Sehr, sehr wichtig!“
„Was soll das sein?“
„Das wollte er mir nicht sagen. Es sei zu katastrophal.“
„Immer das Gleiche. Irgendwer glaubt doch immer, er wüsste mehr als der Staat. Ich werde mit ihm reden, sobald ich hier fertig bin. Keine Diskussion.“
„Wie Sie wünschen.“
Mia erwachte aus unruhigem Schlaf, weil das Flugzeug hin und her schwankte. Sie durchflogen schon seit einiger Zeit eine Schlechtwetterfront. Ihr persönlich machte das wenig aus, aber der Mann mit der Armbanduhr griff sich an den Kragen, als müsste er gleich ersticken. „Fühlen Sie sich unwohl?“ fragte Mia, aber er winkte ab. Das Flugzeug fiel einige Meter tief, und er keuchte. Von diesem plötzlichen Höhenverlust wurde der dicke Mann am Fenster wach und begann ab da fröhlich zu quasseln. Er heiße Martin, wohne in Hamburg, er sei Künstler, na ja, fast. „Ich habe nicht viel aus meinem Leben gemacht, wissen Sie. Ich habe mich gehen lassen, na ja, meine Frau verließ mich. Aber jetzt will ich mich ändern, jawohl. Ich war in einer Abspeckklinik, 30 Kilo runter, da staunen sie, was? Und das ist noch nichts alles! Ich zieh das durch, ich mach weiter. Ich hab ein Atelier gekauft in Hamburg, und dann werde ich meine Frau zurückerobern!“ Mia hörte ihm aufmerksam zu und stellte lächelnd fest, dass sie ihn mochte. Wie er sich für seine Träume einsetzte, gefiel ihr. Als die Stewardess vorbeikam und ihm Schokolade zum Kauf anbot, lehnte Martin entschieden und mit einem stolzen Lächeln ab. Er teilte sich mit Mia einen Obstsalat. Sie redeten noch mindestens zwei Stunden. Dann schrieb Mia ihm ihre Adresse auf, und er gab ihr seine Telefonnummer. Freudig versprach man sich, sich sehr bald nach der Ankunft wieder zu treffen. Der Mann mit der Armbanduhr hörte auf, an dieser herumzuspielen, und blickte zur Abwechslung auf das Ziffernblatt. Dann stand er auf, murmelte etwas von Toilette und stolperte den Gang in die völlig falsche Richtung entlang. Mia und Martin waren sich einig, dass der arme Mann einem nur leid tun konnte.
„Was ist denn schon wieder?“
„Es tut mir leid, er lässt sich nicht abschütteln!“
„Fräulein Fasgade, sie werden ja wohl…“
„Aber er weint so fürchterlich!“
„Jetzt weint er auch noch?“
„Ja, und ich kann ihn nicht beruhigen.“
„Na meinetwegen. Schicken sie ihn eben rein.“
„Sehr wohl. Danke!"
Dirk Kramm war zufrieden. Er hatte seine Wohnung abgedunkelt und Kerzen angezündet. Der Rauchgeruch störte ihn nicht. Er saß in seinem alten Sessel vor dem Fernseher, dieser war jedoch ausgeschaltet. Seine Finger spielten mit der Fernbedienung. Dabei ließ er den Blick durch seine Wohnung kreisen. Es war unordentlich. Marie war noch nicht zum Aufräumen dagewesen. Na ja. Das machte nichts. Er sah die Fotos an der Wand ihm gegenüber. Er, wie er als Kind mit seiner Schwester im Sandkasten spielte. Er, wie er eine Frau auf den Mund küsste. Er, im Anzug, mit der Frau im weißen Kleid. Er, vor dem Grabstein seiner Mutter. Er, mit seinem Kind auf dem Arm. Er und seine Familie vor einem kleinen Häuschen. Er, mit seinen Freunden beim Bowlen. Dann fiel sein Blick in den Spiegel. Er, ausgezehrt und mit dunklen Augenringen. Er, in einer Wohnung voller Kartons. Er, zitternd und die Fernbedienung umklammernd, als wäre sie seine letzte Hoffnung. Er sah auf die Uhr. Er lachte nervös. Alles in allem war er zufrieden. Dennoch stand er auf und nahm die Fotos von den Wänden. Er legte sie alle mit der Bildseite nach unten auf die Kommode. Den Spiegel ließ er hängen.
„Nun, Sie waren sehr hartnäckig. Was gibt es denn so Dringendes? Nun reden Sie schon. Mein Gott, beruhigen Sie sich. So schlimm wird es doch wohl nicht sein. Hier, nehmen Sie das Taschentuch. Nehmen Sie. Und dann sagen sie, was los ist. Nur zu. Haben Sie etwas ausgefressen? Nein? Ja? Was denn nun? Sie müssen sich schon entscheiden. Sie sind in eine Sache hineingeraten? Kriminell? Ich verstehe. Aber damit sollten sie zur Polizei, wissen sie. Es gibt keine bürgermeisterliche Schweigepflicht. Sie wissen? Aber warum…? Wie war das? Die Sicherheit der ganzen Stadt? Nun übertreiben Sie aber nicht! Was können Sie schon angestellt haben? Sie können es mir ins Ohr sagen, natürlich. Also dann. Aha…ähm…ja… Warten Sie. WAS HABEN SIE GETAN?!“
Martin war wieder eingeschlafen, und Mia langweilte sich. Also beobachtete sie, genau wie alle anderen Leute im Flugzeug, den Mann mit der Armbanduhr. Er hatte sich vor der Tür zum Cockpit postiert und schien so angsterfüllt zu sein, dass er weder vor noch zurück konnte. Da stand ein Mann aus der vordersten Reihe auf und ging zu dem Mann. Er redete lange auf ihn ein. Endlich will jemand diesen armen Menschen beruhigen, dachte Mia erleichtert. Aber der Mann mit der Armbanduhr wurde immer nervöser und blasser. Schließlich packte der Andere ihn am Ellenbogen und zog ihn hinter sich in das Cockpit. Was wollen die denn beim Piloten, fragte sich Mia. Wahrscheinlich wollen sie von ihm selbst hören, dass alles in Ordnung ist. Es verstrich eine halbe Stunde. Dann flog die Cockpittür auf. Zwei Männer stolperten keuchend und leichenblass heraus, aber es waren keinesfalls die beiden, die hineingegangen waren.
Das Telefon klingelte. Das tat es so gut wie nie. Manfred Fink blickte unentschlossen auf das Gerät. Wenn man ihn persönlich anrief, musste es wichtig sein. Er nahm ab und meldete sich. „Kommen Sie, sofort!“ rief eine energische Stimme, dann wurde aufgelegt. Ratlos starrte Manfred auf den Hörer. Dann stand er seufzend auf, griff seinen Mantel und verließ sein Büro. Seine Sekretärin fragte ihn nicht, wohin er ging. Sie sah noch nicht einmal auf. Manfred lief zu seinem Auto hinunter, aber eine Horde Reporter verstellte ihm den Weg. „Herr Fink, sagen Sie, sind Sie für oder gegen den Einsatz von…“
„Keine Zeit, es ist wichtig, muss weiter“, keuchte Manfred und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Er war körperliche Anstrengung nicht gewohnt. „Worum geht es?“ rief eine Reporterin. „Geben Sie Einzelheiten!“ verlangte ein Anderer. Er zuckte nur mit den Schultern, sprang in sein Auto und fuhr los. Er sah im Rückspiegel, wie die Journalisten ebenfalls in ihre Autos sprangen und ihm folgten. Er war so nervös, dass er an der nächsten Ampel den Motor abwürgte. Gelächter und Hupen jagten ihn nach dem dritten Versuch, das Auto zu starten, von der Kreuzung. Das erste Mal in seinem Leben hielt sich Manfred an keine Geschwindigkeitsbegrenzung, und die Journalisten taten es ihm gleich. Endlich war er an seinem Ziel angekommen. Er parkte schief hinter einem Lastwagen ein, sprang aus dem Auto und keuchte zum Eingang des imposanten Gebäudes, die Reporter in seinem Nacken. Es war ihm egal. Er führte sie unfreiwillig durch die Gänge und Hallen, bis er schließlich eine Stahltür erreichte. Er drückte ein paar Mal dagegen, dann wurde sie von innen geöffnet. Ohne, dass man nach den fünf Menschen fragte, die hinter ihm in das Zimmer schlüpften, wurde er hereingeführt. Man reichte ihm einen Bericht, den er panisch überflog. Dann sah er die Frau ihm gegenüber voller Entsetzen an. Sie war ebenfalls sehr ernst. „Wir brauchen eine Entscheidung von ihnen, Herr Fink.“ Ihm wurde schlecht.
Mia hielt Martins Hand umklammert. Dieser betonte zum dritten Mal flüsternd, es könne sich doch alles nur um einen schlechten Scherz handeln. Mia hätte gern daran geglaubt. Aber sie wusste, dass das hier echt war. Sie wandte sich an Martin. „Glaubst du an den Himmel?“ fragte sie ihn leise. Er sah sie an und schluckte. „Ich…ich weiß nicht. Ich musste noch nicht darüber nachdenken. Wie steht es mit dir?“
Sie zuckte mit den Schultern. Dann dachte sie an ihre Kindheit zurück, an ihren Mann, ihr Häuschen und an ihren Sohn. „Mama! Guck mal!“ hörte sie ihn rufen. Sie stellte sich vor, wie er durch alle Räume lief und nach ihr suchte. „Mama!“ hallte es durch ihren Kopf. Sie begann zu schluchzen. Dann schrie sie auf, verzweifelt hallte ihre Stimme durch das Flugzeug. „Ich will nicht sterben! Ich will leben!“
Steven schlug ein paar Mal ungehalten gegen die Waschmaschine, aber natürlich tat sich nichts. Sie mussten wirklich ein neues Gerät kaufen. Sein Sohn zupfte zum hundertsten Mal an seiner Hose. „Kommt Mama bald?“
„Ja, mein Großer, ganz bald. Ein paar Stunden noch, dann kommt Mama wieder.“ Er nickte zufrieden und wandte sich wieder dem Bild zu, an dem er gerade malte. Steven gab es auf, die Maschine wieder ankriegen zu wollen. Stattdessen setzte er sich zu seinem Sohn und schaltete den Fernseher ein. Er zappte durch die Programme und beschloss, sich die Tagesnachrichten anzusehen. Man sprach über einen gestrandeten Wal, die gestiegenen Benzinpreise und die Hungersnot in Afrika. Dann plötzlich gab es eine Eilmeldung. Gespannt starrte Steven auf den Bildschirm.
„Soeben bekommen wir eine dramatische Nachricht. Ein Flugzeug auf dem Weg nach Hamburg ist von seinem Kurs abgekommen. Wie wir aus erster Hand erfahren haben, ist es auf dem Weg nach München. Zwei Terroristen haben mit Waffengewalt die Maschine übernommen. Angeblich sind Sprengladungen an Bord, die ganz München zerstören sollen. Manfred Fink ist mit der Entscheidung betraut, ob man das Flugzeug noch in der Luft zerstören solle, um die Menschen in München vor der Katastrophe zu bewahren. Neue Einzelheiten berichten wir ihnen in einer Stunde.“ Steven sah wie paralysiert auf den flackernden Bildschirm. Man zeigte ein Bild des Flugzeugtyps. Man zeigte die eigentliche Route. Man zeigte die Abflugszeiten. Dann tauchte das Gesicht von Manfred Fink auf. Er war rot und schweißnass. „Es ist eine Entscheidung, die ich kaum zu treffen wage“, presste er hervor. Steven spürte die Berührung seines Kindes. „Guck mal, Papa!“ rief er und zeigte ihm das Bild. Es zeigte ihn und seine Mutter in einem Sternenregen. „Wenn Mama kommt, schenke ich ihr das!“ freute der Kleine sich. Dann sah er seinen Vater verwundert an. „Papa? Warum weinst du denn?“
Dirk Kramm spürte das Vibrieren seines Handys in der Hosentasche. Er hatte sich seit Stunden nicht von der Stelle bewegt. Jetzt aber zog er sein Handy hastig aus der Tasche und las die Textnachricht auf dem Bildschirm. Er lächelte. Dann drückte er den Einschaltknopf seiner Fernbedienung. Der kleine Fernseher ging an, und auf dem Bildschirm erschien ein Flugzeug. „Die 250 Passagiere bangen um ihr Leben“, berichtete eine ernst dreinblickende Frau. Dirk Kramm strahlte jetzt. Dann begann er zu lachen, erst leise, dann immer lauter, so laut und hysterisch, dass die Nachrichtensprecherin nicht mehr zu verstehen war. Er ging ans Fenster und spähte durch die Vorhänge. Nach einigen Minuten hörte er Sirenen und Blaulicht. Es war soweit. Rasch ging er zu der Kommode mit den Fotos darauf. Er öffnete die erste Schublade, schob die Socken zur Seite und nahm die Pistole heraus, die darunter zum Vorschein gekommen war. Ein Schuss war noch darin. Er legte sie auf die Kommode, drehte die Fotos um und legte sie nacheinander auf einen Stapel. Dabei besah er sich die Bilder ein letztes Mal. Sein Lachen brandete von Neuem auf, er warf die Bilder in einen der Kartons und nahm die Pistole. Dann stellte er sich vor den Spiegel. Er hörte, wie unten die Tür aufgestoßen wurde und mehrere Personen die Treppe hinauf rannten. Man hatte ihn also doch verraten. Er betrachtete sein lachendes Gesicht im Spiegel. „Gut gemacht, Dirk!“ lachte er. Dann hielt er urplötzlich inne. Seine Augen rollten sich nach oben, seine Hände verkrampften sich. Noch einmal wurde im Fernsehen die Flugzeugentführung gezeigt. Man interviewte Angehörige der Flugzeuginsassen. Ein Mann stand mit einem Kind an der Hand vor seinem Haus und bedeckte seine Augen mit der anderen Hand. Tränen liefen über seine Wangen. Ein Gefühl tiefster Zufriedenheit erfüllte Dirk Kramm. Dann setze er den Lauf der Pistole an seine Schläfe und drückte lächelnd ab.
Manfred Fink war allein. Er hatte darum gebeten. Sein Magen schmerzte, sein Kopf pochte. Er griff nach dem Telefon und wählte eine Nummer. „Fink?“ meldete sich eine weibliche Stimme.
„Eris. Ich bin’s.“
„Manfred! Ich hab’s im Fernsehen gesehen. Wie weit bist du?
„Ich kann das nicht entscheiden!“
„Mein Schatz, ich weiß, wie schwer das ist, aber mach halt! Und komm bitte pünktlich zum Essen, ja?“
„Eris, ich…“ Doch seine Frau hatte bereits aufgelegt. Manfred Fink saß noch eine Stunde so da. Er dachte an die vielen Menschen in München, die um ihr Leben bangten. Er dachte an seine Frau. Wie viele Menschen da draußen mussten gerade erfahren, dass ihre Liebsten in diesem Flugzeug in den Tod flogen? Gab es nicht doch eine minimale Chance? Irgendeinen Ausweg? Später würde Manfred Fink ein Buch schreiben. Es würde sein Leben erzählen, und es würde dieses Erlebnis nicht ausschließen. Das letzte Kapitel würde den Menschen im Flugzeug gewidmet sein. Und es würde mit dem Satz enden: „Jede Entscheidung wäre die Falsche gewesen.“