Fantasy & Horror
Krank
Kategorie Fantasy & Horror
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
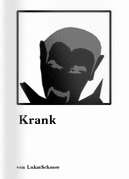
Krank
Beschreibung
Kein ganz normaler Junge.
Kapitel I
Plötzlich drang die Schärfe meiner Klinge tief in sein Fleisch. Ich sah, wie es durch sein
hellblau-weiß-kariertes Hemd sickerte. Ich spürte, wie das Blut meinen Unterarm verschlang. Mein Ärmel begann sich zu färben, wie das Augenlicht der Unschuldigen, die aus irgendeinem Grund leiden mussten. Das Bild begann sich zu drehen und ich nahm ein unangenehmes Dröhnen im motorischen Bereich wahr. Es wurde immer stärker.
Warum habe ich das getan? Aus welchem Grund habe ich diesen Menschen umgebracht?
Und wieder stach ich auf ihn ein. Und noch einmal. Ich spürte die Leere, die mich umgab. Man konnte förmlich sehen, wie jegliches Leben aus jeder einzelnen Zelle seines Körpers wich. Ich fühlte die Isolation, die mich von dem Rest der Welt trennte. Es war so ruhig geworden. So still. Zu still. Es war schon fast unheimlich. Man konnte kein Geräusch wahrnehmen. Keinen einzigen Muckser. Ich hoffte auf Erlösung. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich musste weg hier, einfach weg, an einen besseren Ort. Also entschied ich zu verschwinden. Ich zog die Kapuze meiner Weste über den Kopf und rannte einfach los. Überall, an jeder Ecke konnte man Menschen sehen. Ich wunderte mich darüber, denn es war mittlerweile schon ziemlich spät geworden. Es schneite. Der Boden war nass und schmutzig. Ich wollte nicht daran denken, woran mich diese Bilder erinnerten. Gedanken stießen mir in den Kopf, die ich versuchte zu unterdrücken. Ich überquerte die Hauptstraße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, da ich den Menschen aus dem Weg gehen wollte. Ich hielt das Lauftempo, versuchte den auf mich zukommenden Menschen auszuweichen und stieß dabei einen jungen Mann zu Boden. Er rief mir nach: „Hey! Was soll das?“ Ich reagierte nicht, senkte den Kopf und setzte meinen Weg fort. Ich dachte nun wieder an seinen Leichnam. Wie er da leblos am Boden lag, blutüberströmt.
Und plötzlich waren sie wieder da, die Stimmen. Sie waren nicht zu überhören. Der Rest der Welt schien still zu stehen und sie wurden immer lauter. Ich schlug mir solange gegen mein eigenes Haupt bis ich anfing zu bluten. Es tat weh, aber ich wollte, dass es endlich aufhört. Alles um mich herum verschwamm.
Kapitel II
Ich war angekommen. Ich stand vor einer weiß-gläsernen Haustüre, die sich selbst mit Gewalt nicht öffnen lies. Nach dem zweiten Tritt riss eine alte hysterische Frau sie auf: „Was machen sie denn da? Sind sie verrückt?“ Mit vollkommen durchnässter Kleidung stand ich vor ihr. Ich musste lächeln, denn irgendwie schmeichelte mir diese Frage, auch wenn ich wusste, dass sie das nur aus dem Affekt heraussagte.
Ich wollte niemals so sein, wie die anderen waren. Doch all das ist nur ein Schein, der trübt. Jeder von uns stirbt irgendwann, ob früher oder später macht doch im Endeffekt keinen Unterschied, oder? „Oder?“
Wir verzögern nur das Unvermeidliche, unser eigenes Schicksal.
Ich legte meinen Kopf auf meine Schulter, zückte mein Messer und rammte es ihr mit einem unheimlichen Lächeln in die Magengegend. Ein weiteres mal. Drei ganze male. Alles, was ich hören konnte, war ihr lautes Stöhnen. Die Klinge steckte tief in ihrem Leib und ich zog sie nicht heraus. Sie litt daran, wie schon so viele zuvor leiden mussten und mir machte es Spaß, um ehrlich zu sein. Nein, vielleicht bin ich nicht normal, aber wer ist das denn schon. Normal ist relativ. Niemand ist normal. Niemand ist anders oder besonders, niemand speziell. Wie jeder andere Mensch bestehe auch ich bloß aus Fleisch, Arterien und Knochen.
Kapitel III
Ich träume und es ist lange her, seit dem ich das letzte mal geträumt habe. Im Traum sitze ich in meinem Bett, völlig durchnässt aufgrund meines Schweißes. Vor mir auf einem weißen Schieberegal sitzt eine schwarze Katze. Sie kommt mir nicht außergewöhnlich vor. Es fühlt sich so an, als säße sie immer dort. Merkwürdigerweise besitzt sie keine Augen, zumindest kann ich sie nicht sehen. Alles scheint so real, als würde es gerade, in dem Moment passieren. In der rechten Ecke des Raumes befindet sich eine Schräge, jedoch gibt es hier weder eine Tür, noch ein Fenster. Ich fühle mich nicht eingeschlossen, nein. Im Gegenteil, eher wohl, aus welchem Grund auch immer. Die Katze sitzt noch immer an Ort und Stelle. Sie öffnet jetzt langsam den Mund. Die Öffnung scheint so riesig und wird immer größer. Ich kann fühlen, wie sich die nackte Angst langsam in meinem Körper ausbreitet. Plötzlich wachte ich auf.
Kapitel IV
Heute war ein beschissener Tag. Meine Euphorie erblasste mit jedem weiteren Dreckstag, den ich auf dieser Welt verbringen musste. Ich grüßte nichts und niemanden mehr, wobei man den Menschen auch schon fast mit dem Adjektiv „das“ betiteln könnte. Leute starrten mich an. Ich hatte bereits zwei Menschen auf dem Gewissen und fühlte keine Reue. Was war nur los mit mir? Mittlerweile war das Ganze nicht mehr tragbar. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Und ich würde auch nicht mehr ... lange.
Kapitel V
Ich lebte alleine, doch Ruhe hatte ich trotzdem nicht. Nie. Diese Schmerzen in meinem Gehirn ließen nicht nach. Sie zwangen mich zu töten. Ich musste es tun, ansonsten hörten sie nicht auf.
Mein Magen knurrte und so nahm ich mir die letzten Reste eines Eintopf's aus dem Kühlschrank um nicht zu verhungern. Doch wenn ich ehrlich wäre, war mir das ebenfalls gleichgültig gewesen. Ich stellte den vollen Teller in die Mikrowelle und drehte den Zeiger zum Aufwärmen ein Stückchen nach rechts. Das Aussetzen des Mikrowellenmotors verriet mir, dass mein Mahl nun aufgewärmt sein musste. Ohne Rücksicht auf meine Gesundheit griff ich nach dem erhitzten Teller und verbrannte mich logischerweise am Daumen. Ich war außer mir vor Wut und schlug mit meiner linken geballten Faust gegen die nicht-verputzten Wände. Ich blutete.
Ich nahm ein Küchenmesser, steckte es mir durch meinen schwarzen Ledergürtel und hängte mir meine Weste um. Ich setzte die Kapuze auf und verließ mein Haus. Das Essen blieb stehen und die Tür unverschlossen, doch darauf legte ich keinen Wert.
Ich begab mich in die letzte Reihe des Busses. Die Sitze waren bereits aufgerissen, beschmiert und quietschten beim Hinsetzen. Wie gewohnt wurde ich von all den fremden Menschen bestarrt.
Ich sah aus wie ein Drogenjunkie. Meine Haare waren fettig, mein Gesicht schmutzig. Sogar verschmiertes Blut war an meiner Weste zu sehen. Es widerte mich an, dass fremde Körperflüssigkeiten an meiner Kleidung klebte.
Heidenkeplatz.
Ich stieg aus, atmete tief durch. Gänsehaut. Mir war schon während der Fahrt schlecht geworden, kotzübel. Mein Körper sackte zusammen. Einige Minuten später war ich wieder bei Bewusstsein. Ein Paar kümmerte sich um mich. Sie hatten mittlerweile die Rettung gerufen und die Frau sagte zu mir: „Ist alles okay bei ihnen? Die Rettung wird sie gleich holen und versorgen.“ Ich schrie sie an: „Nein! Verpisst euch. Sie können mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen.“ Ich half mir an einem Parkzaun wieder auf die Beine und rannte die Straße hinunter, einfach weg von jeglicher menschlicher Anwesenheit. Jeder drehte sich nach mir um. War ich wirklich so komisch gewesen?
Kapitel VI
Irgendwie kam ich vor dem Haus an, dass mich bereits in damaligen Alpträumen heimsuchte, doch es wirkte viel friedlicher, harmloser. Es war von außen in einer beigen Farbe gestrichen und wirkte sehr natürlich. Rechts neben der Haustüre befand sich ein langes Fenster, dass sich bis in den zweiten Stock hinauf zog. Man konnte dadurch einen Teil der Küche sehen. Schmutzige Teller und leere Gläser standen auf dem Geschirrspüler.
Diesmal klopfte ich an und versuchte mir meine Aggressionen nicht anmerken zu lassen. Ein Junge im Alter von ungefähr vierzehn Jahren machte mir die Türe auf. Ich fragte ohne ihn zu begrüßen: „Kann ich telefonieren …?“ Noch bevor er antworten konnte stürmte ich in die Wohnung und stieß ihn dabei zur Seite. „Sir, Sie können doch nicht einfach …!“
Plötzlich war es still. Einen Moment später schrie er laut auf. Er atmete tief auf und übergab sich. Mindestens die Hälfte der Klinge meines Messer steckte zwischen seinen Rippenknochen. Ich konnte sogar spüren, wie sie beim Eindringen an seine Knochen stießen. Ich musste lächeln. Es fühlte sich so gut an. Dann fing ich ihn auf und hielt ihn mit meinem Arm vom Fallen ab. Mit voller Wucht drückte ich meinen Dolch ein zweites mal in seinen mittlerweile leblosen Körper. Ich spürte genau, wie sich erneut ein langes, tiefes Loch in seiner Haut bildete und sein Fleisch entzwei riss. Diesmal war kein Treffen meiner Waffe mit seinen Knochen wahrzunehmen. Sein Leichnam fiel auf den kalten Marmorboden. Er war eine einzige Blutlache gewesen. Der Junge erinnerte ein bisschen an eine umgekippte Gießkanne, die Flüssigkeiten flossen einfach aus seinem Leibe. Mir war wieder schwindelig geworden. Ich drückte mich vor Erschöpfung gegen eine Mauerecke und ließ mich einfach fallen. Ich saß jetzt am Boden, neben mir der aufgeschlitzte Körper des Jungen. Irgendwie bedauerte ich mein Handeln nun, aber es war zu spät gewesen. Aufgrund dieses Anblicks verfiel ich einer Stasis, die von meiner Kindheit handelte. Oder sollte ich besser Alptraum dazu sagen?
Damals war mir nicht bewusst, dass das Leben an mir vorbei zog. Es war so anders. Nein, ich vermisse sie nicht, das könnt ihr mir glauben …
Kapitel VII
Ich konnte die Polizeisirenen draußen hören. Ich lag auf dem Boden, meine Kleidung war blutgetränkt. Ich hoffte nur, dass sie nicht meinetwegen gerufen wurden. Ich versuchte mir wieder auf die Beine zu helfen und schwankte ein wenig durch die Zimmer. Ich trat den blutüberströmten Kadaver zur Seite und verschwand durch ein offenes Fenster an der Rückseite des Hauses. Zuerst zündete ich mir eine Zigarette an, doch dann wurden die Töne der Polizeiautos lauter. Ich schnipste die Zigarette in den Rasen und rannte in Richtung Busstation.
Kapitel VIII
Ich bestieg nun die Treppen zu meiner Wohnung. Die Tür stand offen … aus irgendeinem Grund. Die Klinke war blutverschmiert. Irgendwie wunderte ich mich nicht über das Blut, obwohl ich keinen blassen Schimmer hatte, wie es da hingekommen war. Ich stand jetzt in meiner Wohnung. Eine dunkelrote Blutspur zog sich durch den gesamten Raum. Ich wusste nicht, wie das passiert war. Ich schlüpfte mit beiden Armen nacheinander aus meiner völlig von Blut durchnässten Weste und schleuderte sie in die Nische, die sich zwischen Geschirrspüler und den Wänden befand. Ich sackte zusammen und lies mich auf das „Bett“ fallen, das übrigens bloß aus einer Matratze und einem Polster bestand. Ich versank in Gedanken und vergaß vorerst den Zustand meiner Räumlichkeiten.
Ich töte drei Menschen und verspüre keine Reue. Im Gegenteil, ich kann nicht damit aufhören. Ich verfolge im Kopf schon das nächste Opfer, ich stelle mir vor, wie ich das Mädchen aufschlitze, ihr sämtliche Organe rausreiße, ihr die Haare aus dem Gesicht streiche … sie stören mich. Wäre ich nicht ich, fände ich sie bestimmt hübsch, jedoch lege ich keinen Wert mehr auf diese oberflächliche Scheiße. Ich musste das zu lange ertragen. Dieser jungendliche Leichtsinn, diese Naivität, die jede von euch Schlampen besitzt. Die einzigen Emotionen, die ich noch zeigen kann sind Hass und Leid. Ich will, dass ihr alle wisst, wie sich das anfühlt. Jetzt müsst ihr dafür büßen.
Ich rieb mir meine Augen und starrte nun wieder in den Raum. Sie waren völlig verklebt und irgendwie hatte ich das Gefühl, nicht alleine zu sein. Mir fiel nun wieder die Blutlache auf dem Boden auf, die merkwürdigerweise einen „Pfad“ in den Keller darstellte. Er war nicht all zu groß gewesen, jedoch reicht er für den Zweck, den er erfüllen musste. Ich folgte der Spur natürlich und bemerkte die offenstehende Kellertüre. Ich betrat ihn und fand einen vom Kopf abgetrennten Rumpf vor. Es kreisten Fliegen um ihn herum. Es war ein Mädchen gewesen. Ich dachte nun wieder an meinen Traum und war völlig außer mir.
In der linken Ecke neben dem Eingang lag eine durchsichtige Plastiktüte. Meine Befürchtungen bestätigten sich. In ihr befand sich der Rest des Leichnams … der Kopf. An ihm hingen lange blonde Haare, die mit Blut überströmt waren. Über den gesamten Raum legte sich ein Gestank, der mich fast dazu zwang, mir meine eigene Lunge herauszureißen, in der Hoffnung nicht mehr einatmen zu müssen. Es war fürchterlich. Mir wurde kotzübel, jedoch konnte ich meinen Blick nicht abwenden. Man konnte sogar noch die Adern und Arterien aus der zerfleischten und aufgerissenen Unterseite des Haupts heraushängen sehen. Das Mädchen musste die Hölle betreten haben. Die Wände spiegelten ein einziges Blutbad wieder.
Wie zum Teufel kam dieser scheiß Kadaver in meine Wohnung? Wer zur Hölle tut so etwas? Was war passiert?
Ich war außer mir und gleichzeitig fühlte ich Angst. Mir blieb wohl nichts anderes übrig als diese Sauerei selbst zu beseitigen, denn hätte ich die Polizei gerufen, hätten die mir bestimmt alles in die Schuhe geschoben. Ich wusste weder wer der Täter, noch das Mädchen war. Ich konnte mir ebenfalls das Motiv nicht ausmalen. Wobei bei diesem Anblick die Wortwahl 'ausmalen' wohl eher unpassend gewählt worden war. Ich hörte nicht mehr auf zu zittern. Ich packte den Leichnam an den Gliedmaßen und drückte ihn in einen riesigen Plastiksack. Danach hob ich den Behälter gefüllt mit dem Kopf noch hinein und drückte die beiden Henkel ineinander, denn ich konnte den Anblick nicht länger ertragen. Es widerte mich an und ich fing vor Angst beinahe an zu weinen. Durch die Hintertür, die ich normalerweise niemals benutzte, brachte ich sie nun zu dem Mistkübel. Ich trat auf das Pedal um den Deckel zu öffnen, warf den Sack hinein und lief wieder in meine Wohnung. Danach kotzte ich mich an, es war wiederwertig.
Kapitel IX
Und wiedereinmal wachte ich auf … leider. Hätte ich geträumt, hätte ich mir im Traum gewunschen, nicht aufzuwachen. Ich dachte wieder an gestern und fühlte mich immer noch unwohl. Meine Hände zitterten und ich war kaum im Stande dazu, mein Glas mit kaltem Wasser zu füllen. Ich warf einen Blick auf den Kalender und mir fiel sofort das mit Faserstift rot angekreuzte Feld auf. Es war der heutige Tag gewesen.
Mein Geburtstag.
Ich wurde heute 24 Jahre alt … kaum zu fassen. Selbst ich vergaß es beinahe. Niemand meldete sich, aber das war ich gewohnt. Niemand scherte sich einen Dreck um mich. Ich war ein Niemand.
Ich beschloss nun einen Spaziergang zu machen. Ich musste an die frische Luft, denn mir ging es nicht gut. Kreislaufprobleme, sowie starkes Dröhnen in meinem Kopf plagten mich und meinen Körper. Ebenfalls konnte ich jedes einzelne Pochen hinter meinen Rippenknochen spüren. Es war merkwürdig.
Ich beobachtete all die Menschen, wie sie Spaß hatten, lachten und herumhüpften. Es macht mich auf irgendeine Weise wütend. Ich konnte nun wieder das Leid fühlen, das ich diesen Menschen zufügen wollte … musste. Ich starrte auf den Boden … ich konnte praktisch sehen, wie meine Adern versuchten, sich durch die blasse Haut meines Armgelenks zu fressen.
Ich spürte wie mich die Erinnerungen der letzten Tage verschlungen, wie sie mich in einen dunklen Abgrund zerrten, mir meine Haut vom Gesicht rissen und meine Seele zerfetzten. Ich musste irgendetwas tun, so ging es nicht mehr weiter.
Das Mädchen litt, weil ich es so wollte. Ich fühlte mich so mächtig, obwohl ich wusste, dass es für solche Gefühle keinen Platz in dieser Welt gibt. Weder für Gefühle, noch für Emotionen oder Gedanken. Ich wuchs in einer von Hass und Leid geprägten Gesellschaft auf. Der tägliche Druck nahm meine Hand und tat Dinge, von denen ich niemals dachte, zu denken, dazu überhaupt im Stande zu sein. Ich konnte allmählich spüren, wie sich diese Seuche, diese Leere in mir ausbreitete, wie ich innerlich zerfiel und das Fleisch sich von meinen Knochen löste.
Ich musste es tun. Ich hatte einfach keine andere Wahl.
Kapitel X
Dunkelrote Tropfen trafen ihr leicht rosafarbenes Kleid. Das Schauspiel erinnerte an das Fallen der Regentropfen in einer schaurigen, dunklen Nacht, die jegliche Hoffnung verblassen lies. Die Zeit verging nicht. Das ganze wirkte wie ein „Slowmotion-Videoclip“, ein furchtbar grausamer um ehrlich zu sein. Doch mir gefiel das ganze. Es erinnerte mich an alte Dokumentationen über Serienkiller, die ich damals gerne 'schaute. Sie waren früher noch in schwarz-weiss gedreht worden.
Zum wiederholten male kollidierte das Blatt meiner blutigen Axt mit ihrem unberührten Körper. Sie schrie vor Schmerzen laut auf … nachvollziehbar. Es schien als spaltete sich ihr Körper entzwei …
… in meinen Gedanken.
Die Realität, die ich kaum noch vom Traum zu unterscheiden wusste, bestand daraus, dass ich in einem dunklen Raum saß. Ich wusste weder, wie ich hier herkam, noch, wie ich wieder hier weg kommen würde. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, alleine zu sein, aber das auch nur aufgrund der Stille. Tränen rannten über mein Gesicht. Doch was hatte das schon zu bedeuten? Wer sagt denn, dass man nur weint, wenn man glücklich oder traurig ist. Tränen sind bloß ein unnötiger Mechanismus unseres Körpers, die weder Gefühle noch Emotionen widerspiegeln. Als ich sie mir aus dem Gesicht wischte, schmierte ich mir Blut über meine Augenhöhlen und über die Haut, die sich bereits vor meiner Geburt über meinen Wangenknochen bildete. Das merkte ich aufgrund des stechenden Eisengeruches, der mir beinahe meine Nasenscheidewand wegätzte. Anscheinend waren meine Hände voller Blut gewesen. Nach kurzer Zeit, in der sich meine Augen an die Dunkelheit gewohnten, konnte ich Umrisse eines Mädchens erkennen, das zusammengerollt den Boden zierte. Durchlebte ich gerade persönlich einen Horrorfilm? Die nackte Angst verschlang mein Gedächtnis. Das Mädchen hatte die Augen weit aufgerissen … wahrscheinlich noch vor ihrem Tod. Und weil es auch nicht anders möglich war, trug sie ein rosafarbenes Kleid. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich entdeckte die aufgerissene Stelle ihrer Kleidung und hätte ich nicht gewusst, dass sie durch die Anwendung einer Axt entstanden ist, wäre ich mir sicher gewesen, dass die Kleine gerade kurz vor dem Ausdärmen stand. Der gesamte Raum war bluttapeziert und ich war froh darüber, ihn und seine Gegebenheiten nicht bei Licht betrachten zu müssen. Hier musste ein einziges Blutbad stattgefunden haben, wobei ich mit dieser Wortwahl wahrscheinlich noch maßlos untertrieb. Ich hatte Angst, dass das Mädchen noch lebte und mich gleich zu Tode erschrecken würde … welch Zynismus. Jedenfalls sah sie noch so lebendig für ihren Zustand aus … wie gefroren, als hätte man einfach die Zeit angehalten. Und würde nun jemand beispielsweise schnipsen, dann würde das ganze einfach weitergehen. Sie würde sich einfach weiterhin vor Schmerz die eigene Seele herausschreien. „Sie muss so gelitten haben, dieses arme Ding.“ Und wieder fiel mir auf, wie geisteskrank ich eigentlich sein musste … ich sprach zu mir selbst. Der Anblick hielt mich fest … er lies meine Hand nicht los, und so griff ich nach ihrer. Ihre Finger waren kalt und bestanden beinahe nur noch aus Knochen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich noch Blut in ihnen befand, oder in dem Rest ihres Körpers. Jedoch bin ich mir sicher, dass sie noch nicht lange tot war. Nichts deutete daraufhin. Sie sah einfach noch so „frisch“ für einen Toten aus. Die Angst verging mit der Zeit. Ich drückte mich einfach gegen die blutbedeckten Wände und setzte mich.
Ich dachte nicht an mein Zuhause … oder an sogenannte Freunde, meine Familie … Ich vermisste all das nicht. Mein Leben war ein einziger Scherbenhaufen, ein einziger Abgrund, der drohte, alles zu verschlingen. Doch ich gab keinen Wert mehr auf andere Menschen, deren Wohlbefinden oder deren Gefühle. Es was mir gleichgültig.
Ich wusste nicht wo ich mich befand, noch wer ich war oder wie ich einmal enden würde, jedoch interessierte mich all das auch nicht. Nein, im Gegenteil, ich wollte es gar nicht wissen und ihr versteht es nicht … versteht mich nicht und würdet mich auch nie verstehen können. Doch auch das war unwichtig, denn wenn wir ehrlich sind, was ist denn schon wichtig in dieser verfickten Welt?
Ich drückte jetzt ihre Hand fest und schloss meine Augen … ich versank tief in meinen Autositz. Kurz bevor ich meinen Träumen das letzte mal zum Opfer fiel, hörte ich meinen Vater flüstern: „Valentin?“
Kapitel XI
Ich wachte auf.