Fantasy & Horror
Träumer
Kategorie Fantasy & Horror
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Bin leider immer nur mal so mal so online und schreibe auch in letzter Zeit eher unregelmäßig. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht gefallen euch ja auch die eine oder andere meiner Geschichten :)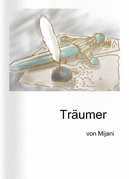
Träumer
Beschreibung
Weil ein Krieg ausbricht, muss Träumer von zu Hause fort, obwohl er eigentlich nicht in der Lage ist, allein klarzukommen. Als er dann auf Schatten trifft, muss er ihm erklären, dass er kein Attentäter ist, und als das fehlschlägt, wird er von diesem mysteriösen Kerl mitgeschleppt. Am Ende gerät er dann doch zwischen die Fronten und alles kommt anders als er es zunächst dachte. - die Story ist noch unfertig ;) -
1. Träumer
Schwarzer Nachtglanz
Roter Samt
Jede Stille
ist gebannt
Leises Wispern
in der Nacht;
Denn ein Monster
ist erwacht.
Schwarzer Nachtglanz
schwaches Licht;
Nur der Tod
erwartet mich.
1. Träumer
Die Prozession näherte sich dem Ende. Leise fiel der Regen und weichte langsam den Boden auf; man hatte sich zu beeilen. Zwei Männer traten aus der Menge, die noch vor wenigen Sekunden andächtig den Worten gelauscht hatten, die demjenigen galten, der vor einiger Zeit schon verschieden war und den sie nun zur letzten Ruhe geleiten würden. Der Sarg, in dem sein erkalteter Körper lag, war grob gearbeitet, zwar mit Mühe, aber offensichtlich von jemand, der kein Talent in Holzbearbeitung hatte. Das massive Eichenholz wies einige Schönheitsfehler auf, die zu vermeiden gewesen wären, wenn die Zeit gereicht hätte. Doch niemand hätte ahnen können, dass der Tod so schnell wieder ins Dorf kehren würde, um sich jetzt auch noch das Kind zu nehmen, für das die Mutter bei der Geburt ihr Leben gab. Sie hatte nicht wissen können, dass sie ihrem Kind nur zu fünf Lebensjahren verhelfen konnte, sie hatte nicht voraussehen können, dass ihr Kind von wilden Tieren gerissen werden würde wie ein Reh.
Sie konnte nicht wissen, dass es ihr schon so bald nachfolgen würde.
Ihr Mann, der Vater des Kindes, hatte bei dem Tod des Kleinen nicht geweint, nicht eine Träne verloren, er hatte auch nicht gegessen, nicht geschlafen, saß stundenlang am Totenbett und immer wieder murmelte er: „Er ist nicht tot... ist er nicht, er ist nicht tot...“ Nach zwei Tagen war er aufgestanden, wortlos und hatte eine Eiche geschlagen, das beste Holz, das er hatte finden können. Niemals war der Mann Handwerker gewesen, er hatte keine Begabung dafür gezeigt und bald aufgegeben. Doch er hobelte und feilte den Sarg seines Kindes allein, er schliff ihn so gut er konnte und obwohl er kein Geschick dazu hatte, wurde aus dem Baum ein Sarg. Er bat den Priester darum, seinem Kind die letzte Ruhe zu geben, neben der Mutter, der Platz, der eigentlich ihm gebührt hätte.
Ein letztes Mal hatte er sein Kind in den Armen gehalten, den toten Körper, das letzte, was ihn noch an seine Frau erinnerte, das einzige, was ihn in dieser Welt glücklich gemacht hatte. Er weinte nicht. Die Kinder des Dorfes pflückten Blumen, banden sie zu Kränzen und warteten geduldig auf den Tag der Bestattung.
Eine Blüte fiel aus dem Apfelbaum des Friedhofs in ein leeres Loch. Der Sarg wurde behutsam hineingelegt, vier Fuß war das Loch tief, die Männer mussten den Sarg vorsichtig herunterlassen, damit er nicht beschädigt wurde. Als der Sarg auf dem Boden des Loches lag und der Priester die letzten Worte sprach, die es noch zu sagen gab, war Stille. Der Priester schloss mit ein paar Worten, die zu belanglos schienen, um beweisen zu können, wie die Trauer des Mannes tatsächlich war, wie er tatsächlich fühlte. Langsam ging man zurück ins Dorf, holte das Brot aus den Backöfen und unterhielt sich über den banalen Alltag. Der Vater blieb allein zurück. Er holte einen Spaten und schaufelte das Grab zu, mit jedem Schaufelzug wurde er schneller, die dunkle Erde knallte auf den Eichensarg und blieb liegen. Der Mann begrub alles mit dem Kind. Seine Hoffnung, seine Liebe, sein Glück. Als er den letzten Schaufelzug machte und abgesehen von dem frischen Grab nichts mehr darauf hinwies, dass hier ein Kind lag, das einen schmerzvollen Tod gestorben war, nahm er die Schaufel und ging zurück ins Dorf, um seine Sachen zu packen, das Dorf zu verlassen und nie mehr zurückzukommen.
Seine Stiefel hinterließen einen traurigen Abdruck im nun völlig durchnässten Erdboden.
*
Ein Flüstern lief durch die rauschenden Blätter. Irgendwo knisterte und knackte es, vermutlich ein Tier, das durch den Wald streifte. Die Sonne kitzelte die Grashalme, sie kicherten und gaben dabei raschelnde Laute von sich. Ameisen kletterten die Bäume hoch und stahlen die Eier einer Schnecke von einem Buchenblatt. Ein junger Mann lag im hohen Gras, lauschte dem Lachen der Halme, hörte den zwitschernden Vögeln zu und genoss die leichte Brise, die der Wind zu ihm hinauftrug und ihn an das Meer denken ließ. Mit einem Grashalm zwischen den dünnen Lippen lag er da, den Kopf auf die schlanken Arme gestützt, den großen Federhut tief ins Gesicht geschoben, damit die Sonne nicht in die dunkelgrünen Augen scheinen konnte und er so geblendet werden würde. Das dünne Leinenhemd hatte er bis etwas unterhalb des Brustbeins aufgeknöpft, die Ärmel nach oben geschoben. Er atmete regelmäßig, ab und zu gähnte er oder blinzelte, die meiste Zeit hielt er seine Augen geschlossen, ein Zustand, der dem des Schlafes sehr nahe kam, aber kein Schlaf war. Mag man es Halbschlaf nennen. Es war ein schöner Spätfrühlingstag, die Sonne schien angenehm warm und man hatte das Gefühl, nichts besseres tun zu können, als im Gras zu liegen und zu träumen, obwohl es viele Dinge gab, die man eigentlich hätte tun müssen. Schritte erklangen. Der junge Mann horchte auf, schob seinen Hut gerade und knöpfte sein Hemd zu. Er hatte die Knöpfe selbst geschnitzt und vernäht. Er schnitzte gern. Es war eine Beschäftigung, in der man nicht schwer arbeiten musste und bei der Fingerfertigkeit und Talent gefragt waren. Nachdem der Hut seine Augen nicht mehr verdeckte und er der Sonne entgegen blinzelte, entdeckte er einen älteren Mann den Weg hinaufkommen. Ein unangenehmes Gefühl durchströmte ihn, als er merkte, dass er den Mann sehr genau kannte. Es war Thome, sein Ziehvater. Er setzte sich auf und ließ Thome herankommen, auch wenn er nicht wusste, was dieser Besuch zu bedeuten hatte, so glaubte er jedenfalls, dass es auf keinen Fall etwas Gutes heißen konnte. Mit einem Schnaufen kam er alte Mann zum Stehen. Er blickte auf ihn herunter, was den jungen Mann dazu bewegte, sofort aufzustehen und eine gerade Haltung einzunehmen. „Hier steckst du also, Träumer“, sagte der alte Mann mit grimmiger Miene. Der junge Mann nickte. „Hab dich schon überall gesucht. Ich brauche dich zum arbeiten, aber du bist ja nie da. Hast wieder mal geschlafen, was? Oder deine Proletik verfasst, wie?“ Der junge Mann fuhr beleidigt zusammen. „Poetik“, sagte er nur. „Es ist Poetik.“ „Alles das Gleiche!“, schnaufte Thome. „Schreiben bringt dir nichts Junge, versteh das doch einfach. Wenn du weißt, wie du ein Reh erlegst, dann kannst du überleben, wenn du weist, wie man ein Schwert oder einen Degen schwingt. Aber du schwingst höchstens die Feder!“ Der junge Mann schwieg. Es hätte auch nichts geändert, wenn er ein Wort von sich gegeben hätte. Thome hatte Recht, er hatte immer Recht. Mit seinem rationalen, vernünftigen Denken kam es selten vor, dass er Unrecht hatte, und selbst dann behielt er am Schluss Recht. „Nun, komm mit mir!“, sagte Thome. „Die Pferde müssen neu beschlagen werden und ich brauche einen zweiten Mann. Mathilda hat mir ihre Hilfe angeboten, aber ich lasse mir doch nicht von einer Frau helfen!“ Thome murmelte etwas, aber der Inhalt ging in den Tiefen seines Bartes verloren. Schließlich drehte er sich um und ging den Pfad wieder hinunter, den er gerade heraufgekommen war. Der junge Mann schüttelte den Kopf und folgte Thome zurück ins Dorf, um beim Beschlagen der Pferde zu helfen.
Das Dorf, in dem er mit Thome wohnte, hatte keinen Namen, aber das traf auf viele Dörfer in der Nähe zu. Man nannte sie einfach Dorf und wenn man es näher beschreiben wollte, dann hieß es „Das Dorf im Süden“ oder „Das Dorf im Südwesten, links von dem Dorf im Süden“. Thomes Ziehkind war etwa genauso: Er hatte keinen Namen. Eines Tages lag er vor Thomes Tür und seitdem kümmerte er sich um den Kleinen, gab ihm zu Essen und Kleidung und beobachtete ihn dabei, wie er größer wurde und zum Mann heranreifte. Er bekam immer mehr Aufgaben und Verantwortung, doch Thome merkte bald, dass er nicht zu harter Arbeit geschaffen war. So gab er ihm den einzigen Namen, der ihm auf eine solche Eigenschaft zu passen schien und nicht negativ gefärbt war: Träumer.
Träumer lief hinter Thome her. Man konnte sofort sehen, dass die beiden nicht blutsverwandt waren, aber dennoch befand sich zwischen den beiden ein Band, als wären sie wirklich Vater und Sohn. Träumer überragte seinen Ziehvater um fast zwei Ellen, er war dünner und knochiger als Thome und seine Haare waren viel heller als die des alten Mannes, der, obwohl er schon über 60 Jahre war, noch immer pechschwarzes Haar und gut gebräunte Haut vorweisen konnte. Die Zwei erreichten das Dorf. Nahe dem Hügel, wo Träumer gelegen und geträumt hatte, gab es eine Schmiede. Sie gehörte Thome, denn er war Schmied. Er konnte alles schmieden, war sowohl Hufschmied als auch Goldschmied und Schmied für den Hausgebrauch. Hatte man ein Problem mit einem fehlenden Nagel, kam man zu Thome und er machte einige weitere, die von den eigentlichen nicht mehr zu unterscheiden waren.
Als Thome Träumer die Tür öffnete, stand dort ein ungeduldiger Kunde. „Beeilen sie sich, Meister Thome, ich muss noch weiter in die anderen Dörfer und die Nachricht verbreiten!“, drängelte ein Mann in auffälliger Kleidung, die man normalerweise nur bei Hofe trug, dennoch wusste Träumer, dass dieser Mann keinen gewöhnlichen Hofdienst verrichten musste: Er war Kurier. Träumer schloss das aus einer großen Schriftrolle, die sich der Mann auf den Rücken geschnallt hatte. „Was macht ein Kurier so weit weg vom Hof?“, fragte er deshalb neugierig. „Kuriere bringen natürlich“, antwortete der Kurier entrüstet. „Was sonst?“ Träumer nickte zustimmend und betrachtete nun das Pferd eingehender. „Schönes Pferd“, murmelte er. Mit Pferden kannte er sich recht gut aus, er wusste, wie man eines beruhigte, wenn ein vorheriger Hufschmied die Eisen falsch angebracht hatte und das Pferd Schmerzen litt, während die Hufeisen entfernt wurden. „Ein Araber“, sagte der Kurier. „Aber das Tier ist zu launisch für meinen Geschmack.“ Träumer nickte. Er fuhr dem Pferd langsam durch die Mähne. Es spielte keine Rolle, was für eine Rasse ein Pferd hatte, nicht für ihn. Das Tier war zutraulich, es ließ ihn gewähren, als er den Huf anhob, um sich die Eisen einmal anzusehen. „Da dürften wir etwas haben“, ließ sich Thome vernehmen. Träumer zuckte zusammen und ließ den Huf los, hob ihn dann aber erneut an.
Es ging schnell und präzise, Thome entfernte die alten Eisen und schlug neue an. Als er fertig war, lächelte er zufrieden: ein schiefes Grinsen mit fehlendem Schneidezahn. „Das macht dann 30 Gulden bitte.“ Der Kurier wirkte überrascht. „Das ist zu viel!“, sagte er. „Ich gebe dir 20.“ Thome grunzte böse. „Wir sind hier nicht auf dem Markt, KURIER! Bei mir gibt es nur erstklassige Ware und die wird angemessen belohnt, oder ich schlage deinem Gaul die alten Eisen wieder an!“ Nach einigem Hin- und her stimmte der Kurier ein, die Gulden zu bezahlen, zumindest 25 (denn mehr hatte er nicht bei sich), und für die restlichen fünf Gulden würde er ihnen die Nachricht zu lesen geben, die er bei sich trug und im ganzen Land innerhalb einer Woche ausschreien sollte. Thome erklärte sich einverstanden und er ließ den Kurier seine Botschaft Träumer geben, Thome war außerstande zu lesen. Träumer räusperte sich und las dann mit seiner leisen, melodischen Stimme die Zeilen vor, die auf der Schriftrolle zu lesen waren:
„An das Volk des Königreiches.
Mit Bedauern bringe Ich die Botschaft, dass euer geliebter König von euch gegangen ist. Die Krönung unserer neuen Königin steht bevor und jedes Dorf ist verpflichtet, ihr einen Tribut in Höhe von 10.000 Gulden zu zahlen, um seine Demut gegenüber seiner neuen Herrscherin zu bezeugen. Zusätzlich werden alle Männer im Kampffähigen Alter aufgefordert, die Reihen des Heeres zu verstärken, um die Grenzen des Reiches zu sichern.
Mit dem Wissen, dass alle Befehle eingehalten werden
Die Regierung“
Träumer ließ den Brief sinken. Sein Gesicht hatte eine ungesunde Farbe angenommen, er rollte die Schriftrolle wieder zusammen und reichte sie dem Kurier wortlos. Thomes Gesicht war nachdenklich in Falten gezogen und verlieh ihm ein bedrohliches Aussehen. „Möge er in Frieden ruhen“, murmelte Thome und schlug sich ein Kreuz vor der Brust. „Was soll das bedeuten?“, fragte Träumer fast tonlos. „Wieso eine Königin? Wir haben ein weibliches Oberhaupt?“ Frauen waren ihm immer als unvollständige Wesen vorgekommen, die keinen eigenen Willen hatten. „Was geht im Land vor?“ Der Kurier verstaute die Schriftrolle wieder, er setzte eine regungslose Miene auf. „Es wird nicht damit aufhören“, sagte er in einem traurigen Ton, sein Gesicht allerdings verriet keine dieser Regungen. „Das wird es nicht. Ich bin mir sicher, dass wir uns noch viele Male sehen werden, mit anderen Kurieren, die ich zu verbreiten habe.“ er räusperte sich und sagte dann mit lauter, fester Stimme: „Ich werde mich nun auf den Weg machen. Ich hoffe, ihr habt gute Arbeit geleistet, Thome, sonst werde ich zurückkommen und Gott soll dir beistehen, wenn ich dich dann hier treffe.“ Thome lächelte grimmig, er öffnete die Doppeltür der Schmiede und entließ das Pferd in die Freiheit. Der Kurier stieg auf und tippte sich zum Gruß an den Hut, bevor er seinem Araber die Sporen gab. Träumer stand eine Weile da und sah zu, wie der Staub wieder zurück auf den Boden rieselte.
2. Phaelandriel
Phaelandriel lächelte böse. Er war tot. Nach den ganzen Versuchen, den dauernden Mordversuchen, den Attentätern und Söldnern, die sie heimlich auf ihn angesetzt hatte, war er nun endlich aus dem Weg geräumt. Sie hatte ihn niemals geliebt, nicht eine Sekunde, aber er war ihrem Charme erlegen gewesen, von ihrer Schönheit betört und verzaubert, seit sie sich das erste Mal sahen. Jetzt war sie endlich das, was sie schon immer werden wollte: Königin über all die Ländereien ihres ehemaligen Mannes, Herrscherin über alles, über alles und jeden. Dieses Machtgefühl erregte sie. Ihr Verstand hatte sie zu dem gebracht, wo sie jetzt war. Er hatte sie zu dem gemacht, was sie jetzt war. Königin, und unglaublich mächtig. Ein Fingerschnippen genügte, um dem unschuldigsten Kind einen Märtyrertod zu verschaffen und sie konnte alles, alles erreichen, verändern und formen, wie es ihr beliebte. Sie war nicht mehr nur eine Königin, sie war mehr. Sie war eine Göttin. Durch ihre Intelligenz war sie mächtig geworden und jetzt würde sie ihr zu Unverwundbarkeit helfen.
Sie saß auf ihrem Thron und blickte in die große Halle. Ihr Platz war nun nicht mehr der Platz der Königin, sondern der Platz des Königs, sie war zur wichtigsten Person des Landes geworden, durch einen einfachen Jagdunfall. Sie lächelte. Es war schade, dass sie nicht selbst diejenige gewesen war, die ihren lieben Gatten ins Jenseits befördert hatte, aber der Zufall und das Schicksal schienen mit ihr zu liebäugeln, es lief alles gut. Sehr gut. Besser, als sie erwartet hatte. Sie hatte mit Problemen gerechnet, mit Protesten, dass eine Frau nicht in der Lage sein würde zu regieren, aber nichts dergleichen war geschehen. Sie wusste, man hoffte darauf, dass sie erneut heiraten würde, aber das würde sie nicht tun, sie würde diesen egozentrischen Männern nicht den Gefallen tun und eine weitere Ehe schließen, sie würde sich nicht wieder in Fesseln zwängen, wo sie doch erst vor wenigen Tagen ihre jetzigen Fesseln verloren hatte. Sie würde sich diese Freiheit erhalten, sie würde diese Macht für sich behalten. Nie wieder würde ihr ein Mann zu nahe kommen, den sie nicht liebte. Nie wieder würde sie aus politischen Gründen einen dieser widerwärtigen Männer heiraten, damit er ihr nicht zu nahe kam.
Einmal hatte er es geschafft, bis zu ihr vorzudringen, ein Moment, in dem sie unachtsam gewesen war. Normalerweise war es ihr gelungen, ihn auf Abstand zu halten, ihn davon abgehalten, ihre Gemächer zu betreten. Doch dieser eine Abend war es gewesen, der sie verwundbar gemacht hatte. Er hatte sie angetrunken gemacht, ihr mit Rosen, gutem Essen und Unterhaltung imponiert und sie hatte zu viel getrunken, er hatte es ausgenutzt. Wenige Zeit später merkte sie erst, dass sie schwanger war und bekam Panik. Es waren Monate des Stresses gewesen und sie wünschte sich jeden Tag, das Kind zu verlieren. Doch sie verlor es nicht. Sie gebar ein gesundes Kind. Dennoch schienen ihre Gebete erhört- es war ein Mädchen. Der König war enttäuscht, sie überglücklich. Ein Mädchen würde ihre Pläne, einmal den Thron zu erreichen, nicht vereiteln. Doch als das Mädchen in das Alter kam, das sie für Männer interessant machte und der König, ihr Gatte, es verheiraten wollte, fasste Phaelandriel einen Entschluss. Er musste verschwinden. Sterben, bevor das Mädchen verheiratet war. Denn sonst wäre ihr ganzer Plane zunichte gemacht und das durfte nicht passieren. Sie hätte es nicht ertragen, mit ihm zusammen leben zu müssen und zu wissen, dass ihre Hoffnung, jemals Königin zu werden, niemals in Erfüllung gehen würde.
Doch das war jetzt in weite Ferne gerückt. Solange ihre Tochter keinen Mann bekam, würde sie ihre Macht nicht verlieren. Der Gedanke beruhigte sie zunehmend. Phaelandriel stand auf, sie ging im Thronsaal umher, blickte an den Bildern umher, die in Reihe und Glied hingen, alles Bilder von früheren Herrschern. Sie musste bei dem Gedanken, selbst einmal dort zu hängen, selbstgefällig lächeln. Sie war eine unglaublich intelligente Frau, das wusste sie selbst besser als kein anderer. Das war ihre Geheimwaffe, die sie zu nutzen gedachte, wann immer es ihr gefiel. Dass jeder Mann eine Frau für dumm und untergeordnet hielt, kam ihr dabei gerade recht. Es war leichter, jemanden einen Dolch in die Brust zu stechen, wenn er dabei in den Himmel sah, weil er von unten keine Gefahr erwartete.
Sie wischte sich eine Strähne ihres ellenlangen blonden Haares aus dem Gesicht und schnürte ihr Korsett etwas enger. Sie hatte eine perfekte Figur, auch jetzt noch mit etwas mehr als 32 Jahren. Die Geburt ihrer Tochter hatte sie noch schöner und begehrenswerter gemacht, das wusste sie. Es amüsierte sie, zu sehen, wie sehr Männer auf die Äußerlichkeiten achteten, den Frauen es aber gleich war, wie ihre Männer aussahen. Sie schätzte bei Männern ein bestimmtes Aussehen, das sie erst bei einem Mann erkannt hatte. Ein Mann, der ihr ewigen Hass und ihren Tod geschworen hatte. Er würde kommen und sie töten, früher oder später, das wusste sie genau, aber es machte ihr keine Angst. Es erheiterte sie und sie fragte sich, wie sie ihn das zeitliche segnen lassen sollte; oder ob sie ihm nur die Arme brechen sollte und ihn als Lustsklaven behalten sollte? Sie wusste es nicht. Aber über die Frage nachzudenken, erfüllte sie mit Freude. Anderer Leute Schmerzen waren ihre Freude. Und jetzt hatte sie einen riesigen Spielplatz, auf dem sie sich austoben konnte. „Mutter?“, fragte eine hohe, leise Stimme. Phaelandriel drehte sich um. „Was gibt es, mein Kind?“, fragte sie gespielt liebenswürdig. Sie liebte ihr Kind nicht, sie war zu keiner Liebe fähig, aber sie hasste sie nicht und das Mädchen war ihr zu einem Bestandteil ihres Lebens geworden, anders als ihr Gatte schien sie ihr etwas zu bedeuten. „Dieses Kleid“, sagte das Mädchen und deutete auf das hellblaue schlichte Kleid. „Es ist zu eng, kann man es nicht weiter machen? Es betont meine Hüften zu sehr und ich habe keine Luft zum atmen.“ Das Mädchen war 16 Jahre alt, die hellblonden Haare waren zu einer aufwendigen Frisur geflochten. Ihre Zierlichen Hände fuhren die zierliche Figur nach, die in dem engen Kleid stark betont war. „Es ist so sehr schön“, befand Phaelandriel. „Etwas anderes, Phenelope?“ Das Mädchen schüttelte den Kopf, verneigte sich und verließ ohne jegliche Geräusche den Thronsaal, einzig ihr Kleid raschelte leise.
Phaelandriel zog die Stirn in Falten. Sie musste sich eine schwere Prüfung ausdenken, wenn sie wollte, dass ihre Tochter keinen Gatten fand. Es gab zu viele Bewerbungen und eine einfache Absage wäre zu kränkend und zu simpel gewesen, sie brauchte eine Idee, die kein Mann lösen konnte, etwas, dass jedem Mann vor Augen führen würde, wie dumm und hilflos er eigentlich war. Sie lächelte Böse. Ihr würde etwas einfallen, da war sie sich sicher. Sie wusste noch nicht was, aber sie wusste, dass es ihr einfallen würde. Nicht umsonst war sie das Lieblingskind des Schicksals. Es hatte einen Sinn, dass sie nun Königin war und sie würde alles tun, um es lange zu bleiben. Phaelandriel schritt zurück zum Thron und setzte sich hin. Sollte die Audienz beginnen, sie hatte die Kraft, eine Menge von Bittstellern abzuweisen und genau das würde sie heute auch tun. Die Tür ging auf und der erste Bittsteller verneigte sich vor seiner neuen Königin.
3. Träumer
Träumer saß auf einem Stuhl in Thomes Küche. Er blickte auf den Boden, die Hände auf den Buchenholztisch gelegt. „Was soll ich tun?“, fragte er verwundert. „Von hier fortgehen“, sagte Thome nun zum zweiten Mal seit zwei Minuten. „Du musst weg hier. Die Königin beruft das Heer ein, alle kampffähigen Männer sollen sich melden. Du musst fort von hier!“ Träumer blickte hoch. „Aber warum denn?“, fragte er irritiert. „Weil du nicht zum Kämpfen geeignet bist! Du bist ein Dichter, kein Kämpfer, du kannst Reden schwingen, aber keine Waffe halten, du bist weder muskulös noch dick genug, um den Strapazen dort gewachsen zu sein! Flieh solange du noch kannst! Besser bist du allemal dran, wenn du als wandernder Träumer dein Glück machst, als wenn du tot auf einem Schlachtfeld liegst!“ Thomes Stimme war lauter geworden. Träumer nickte, aber er konnte es sich dennoch schwer vorstellen. „Weg... von hier?“, fragte er fassungslos. „Ja doch“, sagte Thome ernst. „Hier kannst du nicht bleiben!“ Träumer blickte ihn an. „Das hier ist mein Zu hause. Ich wohne hier, jeder kennt mich und ich kenne jeden. Ich will nicht fort von all dem hier, ich will nicht fort von meiner Arbeit, ich will nicht fort von dir...:“ Thome schüttelte energisch den Kopf. „Du gehst, und wenn ich persönlich dafür sorgen muss.“ Träumer blickte wieder zu Boden. „Was soll ich allein da draußen? Ich kann doch nicht einmal jagen. Wieso kann ich nicht einfach hier bleiben?“ Thome hob die Stimme. „Begreifst du es immer noch nicht?“, donnerte er. „Sie werden dich mitnehmen, wenn du hier bleibst, du wirst sterben und ich kann nichts tun, um dich vor diesem Schicksal zu bewahren! Jetzt ist deine Chance, zu gehen. Jetzt kannst du nicht hier bleiben, wenn du leben willst. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dich tot auf einem Schlachtfeld zu finden! Also geh jetzt! Du warst nie dafür geschaffen, in einer Schmiede zu arbeiten, das war niemals deine Bestimmung. Jetzt tue das, was das Schicksal dir rät, und dein alter Herr kann sich sicher sein, dass es dir gut geht.“ Thome war aufgestanden, er musste sich bei den Worten an der Stuhllehne festhalten. „Du gehst“, wiederholte er noch einmal. Auch Träumer stand jetzt auf. „Ich kann wohl nicht hier bleiben, wenn es gegen deinen Willen ist. Dann werde ich meine Sachen holen.“ Thome nickte. „Das ist das beste“, stimmte er zu. Träumer nickte. Er verließ die Küche durch die Tür, die einen in den übrigen Wohnraum führte. Er nahm die wenigen Dinge, die ihm gehörten, zwei weitere Hemden und zwei Hosen sowie einiges, dass sein persönlicher Besitz war, wie etwa eine Flöte, die Thome ihm aus dem Herz eines Baumes mit weißen Blättern geschnitzt hatte. Immer, wenn er auf der Flöte spielte, durchströmte ihn ein Gefühl unendlicher Traurigkeit und Einsamkeit. Er steckte sie zwischen seine Sachen. Thome kam herein, er hielt einen Lederrucksack in der Hand. „Früher hat der mir immer gute Dienste erwiesen, als ich selbst viel herum gereist bin, bevor ich mich hier niedergelassen habe. Dir soll er jetzt auf nützlich sein. Nimm ihn.“ Träumer sah ihn an. „Werden wir uns je wieder sehen?“, fragte er ihn. „Du kommst doch irgendwann zurück“, lachte der alte, bärtige Mann, aber es klang nicht so, als glaubte er recht daran. „Ja, das werde ich“, sagte Träumer, nahm dankbar den Rucksack an und füllte ihn mit den Sachen. Er holte die Flöte wieder heraus, betrachtete sie kurz und wickelte sie dann in einen Fetzen Stoff ein, damit sie nicht beschädigt werden würde. „Ich werde wohl bald aufbrechen müssen“, sagte er, dann nahm er den Rucksack und blickte sich um, ob er etwas vergessen hatte. Nein, da war nichts Wichtiges mehr. „Nimm dir Proviant mit“, sagte Thome. „Ich habe ihn für dich zusammen gepackt, damit du nichts vergisst. Und jetzt geh, du wirst das Beste aus deinem Leben machen, das weiß ich.“ Träumer nickte tonlos. Erst jetzt wurde ihm bewusst, was es bedeuten würde, wegzugehen. Er würde Thome vielleicht niemals wieder sehen. Er würde vielleicht nie wieder den gutmütigen, aber mürrischen alten Mann sagen hören, dass er ein Taugenichts war. Die Tränen stiegen ihm in die Augen. „Ich werde zurückkommen“, sagte er noch einmal, um seine eigene Aussage zu kräftigen, aber es klang nicht mehr so sicher wie beim letzten Mal.
„Lebe wohl, Thome“, sagte er, als er in die Küche ging. Auf dem Tisch lag ein Tuch, das mit Lebensmitteln gefüllt und zugeschnürt worden war. Träumer packte es in den Rucksack und verließ das Haus. Bevor er sich endgültig auf den Weg machte, wollte er das Dorf noch einmal sehen. Er ging durch die Straßen und betrachtete die Häuser, grüßte die kleine Emma, die ihrer Mutter wie jeden Tag bei der Gartenarbeit half. Das Mädchen konnte nicht sprechen, dennoch strahlte sie jedes Mal, wenn er vorüber ging. Er lächelte zurück. Sie war ein süßes Wesen, er konnte sich gar nicht vorstellen, dass aus ihr jemals ein willenloses Wesen wie eine Frau werden würde. Die Straße führte ihn noch an mehreren Häusern vorbei, doch er sah niemanden mehr. Niemanden, dem er Auf Wiedersehen sagen musste, niemand, bei dem er sich erklären musste. Er musste fort von hier, es gab keine Möglichkeit im Dorf zu bleiben. Thome würde dafür sorgen, dass er ging, dass wusste er besser als er es sich gerne eingestanden hätte. Das Dorf war nicht lang, nur noch wenige Häuser säumten den Weg, er konnte bereits die Wiesen sehen, die sich an das Dorf anschlossen. Vielleicht war es möglich, wenn er sich nur im Nachbardorf niederlassen würde, aber Thome hatte gesagt, dass er hier nicht mehr sicher war. Zwar war Träumer nicht der Überzeugung, dass er einen Krieg nicht überleben könnte, das konnte er, aber er würde töten müssen, etwas, das seiner Natur widersprach. Er konnte keinen Menschen töten, schon allein beim Gedanken an den Tod fuhr ihm ein Schauer über den Rücken. Zu töten ist leicht. Aber wer denkt dabei an all die Menschen, die um den Verstorbenen weinen werden? Selbst zu sterben stellte er sich nicht so schmerzhaft vor, wie der Schmerz, geliebte Menschen zu verlieren. Wenn man selbst starb, war der Schmerz irgendwann vorbei, doch den Tod eines geliebten Menschen trug man bei sich, dauernd, bis zum Tag, an dem man selbst vom Tod erlöst wurde.
Träumer verließ das Dorf. Er drehte sich noch einmal um, sah zu den Hütten und Häusern herüber. Er konnte etwas weiter abseits die kleine Kirche sehen, die letztes Jahr vom Blitz getroffen und nun nur provisorisch abgedeckt worden war, er sah den Rauch, der aus dem Schornstein von Thomes Schmiede stieg und er mischte sich mit dem Rauch der kleinen Bäckerei zwei Straßen weiter. Das Dorf war eine Wohngemeinschaft gewesen, in der jeder jedem half und alles genau abgesprochen und geplant gewesen war. In seinem eigenen chaotischen Leben war ihm diese genaue Ordnung und Struktur zu pass gekommen, es hatte ihm immer geholfen klar zukommen. Jetzt fragte er sich, ob er allein überhaupt leben konnte. Träumer schob seinen Rucksack gerade. Er würde es müssen, es führte kein Weg daran vorbei. Die Straße wurde zu einem Feldpfad, schlängelnd wand er sich durch die Landschaft wie eine wütende Schlange in einem grünen Netz. Er ging langsam, jeder Schritt war schwer, als er sich erneut umdrehte, sah er, dass er nichts geschafft hatte: Das Dorf lag noch immer sehr nah hinter ihm. Er würde nicht weit kommen, wenn er das Dorf noch lange hinter sich sehen konnte, deshalb fasste er kurzerhand einen Entschluss: er verließ den Weg, hinein in das hohe Gras und schwor sich, sich nicht mehr umzudrehen, bis die Sonne verschwunden war. Das sollten, wenn er es richtig abgeschätzt hatte, etwas mehr als drei Stunden Fußmarsch sein. Er beschleunigte sein Tempo ein wenig, seine Schritte wurden federnd, entschlossener und das Gras unter seinen Füßen raschelte und knisterte leise, immer wenn er einen Fuß hochhob oder senkte. Der Himmel war blau, vereinzelte Schäfchenwolken hingen in der Luft und kündigten eine Veränderung des Wetters an. Allerdings waren es zu wenig, um bedrohlich wirken zu können. Träumer lief, immer weiter querfeldein und er sah sich nicht um. Bald hatte er die Wiesen hinter sich gebracht, vor ihm befand sich ein Wald. Wie auch die Dörfer hatte dieser Wald keinen Namen, aber Träumer kannte ihn. Thome hatte ihn einmal hierher mitgenommen, um ihm das Jagen beizubringen. Träumer war noch sehr klein gewesen zu dieser Zeit. Er erinnerte sich deshalb auch nicht mehr genau daran, was den ganzen Tag geschehen war, aber als die zwei ein Reh aufgespürt hatten und Träumer es erlegen sollte, war der kleine so in Panik geraten, dass er das Tier verscheucht hatte. Am selben Abend gab es zwar kein Wildbraten, dafür aber die besten Pilze, die er zur damaligen Zeit gegessen hatte.
Er schritt durch die ersten Bäume. Im Wald war es kühler und ruhiger, als es auf den Wiesen gewesen war. Allmählich begann er, sich einsam zu fühlen. Es machte ihm nichts aus, allein zu sein, wenn er allein sein wollte. Aber der Zustand, in dem er sich gerade befand, hatte nichts mit Freiwilligkeit, vielmehr mit Zwang zu tun. Er war nicht freiwillig auf der Flucht, er nicht auf der Flucht, weil er es wollte. Am Liebsten wäre er sofort umgekehrt und hätte Thome davon überzeugt, ihn wieder aufzunehmen. Aber nein. Das kam nicht infrage. Laub klebte unter seinen Lederstiefeln, die Geräusche waren verstummt, hier und da hörte er den Gesang eines Vogels, dann war wieder Stille, nur das Geräusch seiner Stiefel und das Rascheln des Laubes, das er aufwirbelte, war zu hören. Er war von jeglichem menschlichen Wesen weit entfernt. Er kramte in seinem Rucksack und holte die kleine Flöte hervor. Als die ersten Töne erklangen, schien die Welt ein wenig dunkler und trauriger zu sein. Die Sonnenstrahlen standen nicht mehr für Helligkeit, sondern für die Gegner der gemütlichen und trägen Dunkelheit, als aggressives Leuchten, das Kopfschmerzen hervorbringen konnte und als Notlösung für angenehmes Kerzenlicht schien. Er setzte die Flöte wieder ab und ging weiter, immer tiefer in den Wald hinein. Es war noch hell, dennoch kam Träumer der Wald unheimlich vor, er dachte an Monster, die sich hier verborgen hielten, an die kleinen Waldtrolle, die Giftpilze suchten und kochten und sie dann an Hexen verkauften, die sie dazu benutzten, um Könige zu töten oder Liebende auseinander zu bringen. Ihm fielen tausende von den Schauermärchen ein, die man kleinen Kindern erzählte, um sie davon abzuhalten, nachts in den Wald zu gehen, er dachte an kleine Wichtel, die nachts mit Laternen herumliefen, um Wanderer in die Irre zu locken. Schließlich bildete er sich ein, selbst solche Wesen gesehen zu haben. Er hielt an, suchte in seinem Rucksack nach den Dingen, die ihm gehörten und fand einige Pergamentrollen, die Thome für ihn gefertigt hatte. Er hütete sie wie seinen eigenen Augapfel und wollte sie nur zu besonderen Ereignissen beschreiben. Dies schien ihm der passende Moment zu sein. Er nahm seinen Federkiel und ein sorgsam verschlossenes kleines Gefäß mit nachtschwarzer Tinte und begann:
Dunkelheit
Wo Schatten wohnen, schwarz und kalt
Wo kleine Tiere Lichter tragen
Wo Bäume stehen, groß und alt
Wohin sich nur die Mutigen wagen.
Das scheint der Ort zu sein,
Wo Fürchten Tagesordnung ist
Wo jeder gleich ist, einsam, allein
Wo man das Tageslicht vermisst.
Dort herrscht sie weit und breit:
Dichte, Schwere Dunkelheit.
Die Worte schrieben sich wie von allein, er musste selbst nicht viel dazu denken, es war, als gäben Flöte und Wald die Stimmung vor, als würden sie ihm die Worte in den Kopf schmuggeln. Eine weile saß er stumm da und ließ die Tinte trocknen, dann rollte er vorsichtig das Pergament zusammen. Er hatte klein geschrieben, es sollten noch weitere Gedichte darauf passen. Träumer lehnte sich an einen Baum und lächelte glücklich. Es war ein Wunder, dass er lesen und schreiben konnte, im Grunde war er es nicht wert, er war ein Waisenkind und der Adoptivsohn eines Schmieds, Aber der Priester hatte sich seiner erbarmt und ihm die heilige Kunst gelehrt, weil „Gott zu ihm gesprochen habe“. Träumer hatte kurz danach entdeckt, dass er einen Hang zum reimen hatte und jede Prosa und jedes Gedicht, das ihm unter die Finger gekommen war, hatte er begierig verschlungen, auswendig gelernt und sich die Melodien eingeprägt. Nun war er selbst in der Lage, diese Meisterwerke zu verfassen, zwar waren seine eigenen Werke bei weitem nicht so gut wie die seiner Idole, aber er gab sich Mühe und versuchte, möglichst viel zu lernen und dabei möglichst wenig Pergament zu verschwenden. So waren die Gedichte schon lange in seinem Kopf, bevor er sie aufschrieb. Träumer setzte seinen Rucksack wieder auf und marschierte weiter. Schritt für Schritt, die Augen geradeaus gerichtet, immer im Stadium höchster Aufmerksamkeit. Er merkte, dass er schon vor langer Zeit die Orientierung verloren hatte, aber da er selbst ja kein Ziel hatte, war das eigentlich nicht von Bedeutung. Dort, wo er herauskommen würde, würde er weitergehen, er würde irgendwo sein Glück finden, das hatte er Thome versprochen. Mittlerweile war es so finster, dass man kaum etwas erkennen konnte. Träumer entschloss sich, zu rasten. Er setzte seinen Rucksack ab, lehnte sich an einen großen Baum und schloss die Augen. Die Geräusche von Käuzchen und Eulen heulten ihn in den Schlaf.
4. Drorn
Drorn der Schatten war auf der Suche. Er suchte nach einem Weg, sie aus dem Weg zu räumen, zu töten, sie zu eliminieren. Er konnte tausend Wörter finden, die umschreiben würden, sie zu töten. Sie war eine verabscheuenswerte Frau. Jetzt war sie auch noch Königin geworden. Er wusste nicht, ob es sein Schicksal war, für immer nur mit dem Gedanken spielen zu können, sie zu töten, aber es sah danach aus. Er war vom Schicksal verflucht, so wie sie das Lieblingskind war. Er war die Nacht, sie der Tag. Aber nur er wusste wirklich, wie tödlich ein zwölf Stunden Sonne sein können und wie entspannend und erholsam ein Spaziergang durch einen vom Mond beschienenen Wald. Nun, für die die es glaubten, war die Nacht voll mit Werwölfen, Vampiren und Räubern. Aber wer in der Nacht töten kann, kann es auch am Tag und die wirklich unangenehmen Gestalten begegneten einen nicht nachts, sondern am Tag. Sie hatte die hellsten Haare und zeigte gerne offen ihre grausame Schönheit, seine pechschwarzen Haare waren unscheinbar und dunkel, er verbarg sein Gesicht. Sie war die begehrtestes Person des Königreiches, die Königin mit der unendlichen Macht. Er war nichts wert, ein Kopfgeldjäger. Aber er wusste, dass sie ihm nicht gewachsen war, dass er die Macht hatte sie zu stürzen. In ihm loderte unbändiger Hass auf die Frau, die ihm sein Leben zerstört hatte, weil er sie abgewiesen hatte. War er noch vor einem Jahr ein angesehener Bürger gewesen, so war er bald darauf vogelfrei und nun kriminell und an seinen Händen klebte Blut. Es war nicht sein Blut. Es war das Blut von vielen Menschen, die im Weg standen, von Menschen, die mehr oder weniger schuldig waren. Mochten sie doch unschuldig sein. Es spielte keine Rolle. Es hatte noch nie eine Rolle gespielt. Er wusste, wie das lief. Es zählen die Beziehungen, nicht einmal das Geld, aber wenn man keines hatte, dann war man sofort schuldig. Es gab keine Alternative. Wer hatte jemals behauptet, dass es gerecht war? Die Gerechtigkeit war eine Idee, die wahnsinnige Köpfe erschaffen und dann auf die Menschheit losgelassen hatte. Drorn lief durch den Wald, der Wald, in dem sich sein Quartier befand. Er lebte hier erst ein paar Monate, mochten es zwei oder drei sein, das interessierte ihn nicht. Er hatte es ziemlich lange hier ausgehalten, das war seltsam. Normalerweise fanden sie ihn früher, das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt wurde zog sie an. Sie liebte es, zu spielen und er wusste, dass er ihre Lieblingsfigur war. Aber so einfach würde er es ihr nicht machen. Sie mochte ihn in der Hand haben oder das zumindest glauben. Noch war er nicht tot, nicht gefangen, er war frei. Er lief zu seinem Versteck, ein Haus in den Bäumen, das man im Grunde nicht sehen konnte. Er stutzte, als er ankam. Da lag jemand. Hatten sie ihn entdeckt? Der Mann schlief. Drorn grinste höhnisch. Er löste das Tau von seinem Gürtel und band ihn fest. „Ich wünsche einen gesunden Schlaf“, lachte er leise. Zog das Seil stark an. Hieraus konnte sich niemand befreien. Dann kletterte er den Baum in wenigen geschickten Zügen hoch. Heute würde er sicher schlafen können, er hatte einen Schoßhund unten, der ihn bewachen würde.
5. Träumer
Träumer erwachte aus einem tiefen Schlaf. Er wollte aufstehen, aber sein Körper war brutal gegen den Baumstamm gedrückt worden. „was bei allen guten Geistern...?“, fragte er stöhnend. Er wollte sich aufrichten, konnte aber nicht. Dann wurde seine Sicht schärfer und er blickte nach unten, auf die Fesseln, die ihn umgaben. Was war geschehen? Er hätte nicht fortgehen sollen. Gerade war einen Tag fort, schon war er in Gefahr, schon war er in Gefangenschaft und von jemand abhängig. Er sah keine Möglichkeit, wie er da wieder herauskommen sollte. „Du bist wach?“, hörte er eine Stimme über sich. Erschreckt blickte er nach oben. Dort saß ein Mann auf einem breiten Ast, etwa drei Meter über ihm. „Mein Versteck hast du ja gefunden. Dachtest wohl, das hier würde einfach werden, was? Dachtest wohl, du könntest mich einfach töten und das Geld einsacken, was? Leider muss ich dir deine Traumblase zerplatzen. Du wirst hier nicht einmal mehr lebend herauskommen. Aber weißt du was? Selbst du stehst sicher auf irgendeiner Liste und es sollte dich freuen zu hören, dass ich mit deinem Kopf ein wenig Geld verdienen werde.“ Träumer verstand kein Wort, aber er ahnte, dass das hier böse enden würde. „Wer seid ihr?“, fragte er deshalb erst einmal. „Warum habt ihr mich gefesselt? Und was soll dieses Gerede über Geld?“ Der Mann lachte höhnisch. „Du hättest zum fahrenden Volk gehen sollen, an dir ist ein Schauspieler verloren gegangen. Aber ich habe hier deine Sachen, siehst du? Es wird ein leichtes sein, hiermit herauszufinden, wer du bist und was genau du von mir wolltest, das verspreche ich dir.“ Träumer schrie auf. „halt das vorsichtig! Lass den Rucksack nicht fallen! Ich bitte dich!“, vor lauter Angst vergaß er die höfliche, aber distanzierte Anrede. „So?“, fragte er Mann gespielt überrascht. „Was ist denn da so wichtiges drin?“ Träumers Stimme überschlug sich. „Meine Pergamentrollen! Sie sind wertvoll! Und pass auf meine Flöte auf! Sie ist aus dem Holz den Baums mit weißen Blättern!“ Der Mann stutzte kurz und schob das Tuch zu Recht, das Nase und Mund verdeckte. „Eine Flöte aus dem Baum... Es gibt eine Flöte aus dem Holz des Baums der Tränen? Interessant. ich glaube, diese Flöte werde ich in meinen Privatbesitz nehmen, nachdem ich dich getötet habe.“ Träumer keuchte. „Töten? Warum? Ich habe nichts verbrochen! Ich bin doch nur Dichter!“ er starrte zu dem Mann nach oben, die Panik breitete sich in ihm aus, sein Hals wurde starr.
„Dichter!“, sagte der Mann ungläubig und lachte dann unnatürlich. „Ja, doch. In Wirklichkeit bin ich auch Schäfer und suche hier oben ein entlaufenes Schaf!“ Träumer machte ein trauriges Gesicht. „Wäre doch möglich?“, sagte er. „Schäfer ist ein schöner Beruf. Er ist ruhig, man kann träumen und dichten, solange und soviel man möchte und Schafe sind so friedliche Geschöpfe.....“ Der Mann zog die Augenbrauen hoch, sie verschwanden unter seinen pechschwarzen Haaren. Er sprang, mit dem Rucksack in der Hand und landete sicher auf dem Waldboden. „Lüg mich nicht an. Du...“ er sah Träumer verwirrt an. „Wie alt bist du eigentlich?“ Träumer blickte dem Mann in die eisblauen Augen. „19 Jahre“, sagte er. Der Mann pfiff durch die Zähne. „Mit 19 schon ein Kopfgeldjäger? Du lebst ja ganz schön gefährlich!“, er lachte. „Ich bin nur Dichter. Ich kann gar nicht töten“, sagte Träumer leise. Der Mann nickte zustimmend. „Ach ja... stimmt ja, du bist ein DICHTER. Dann dichte jetzt etwas für mich, nur um zu beweisen, dass du es wirklich kannst.“ Träumer schluckte, wenn das seine Chance zum Überleben war, dann musste er sie nutzen. Dennoch schüttelte er den Kopf. „Ich kann nicht“, sagte er. „Ich kann nicht einfach so dichten. Da brauche ich den passenden Moment, die richtige Stimmung. Wenn ich ängstlich bin, kann ich es nicht.
Was nicht von Meisterhand geschmiedet,
Wird leider nie perfektes Werk.“
Er schloss verwirrt den Mund. Waren das gerade Zeilen gewesen? Hatte er gerade gedichtet, ohne es zu wollen? Auch der Mann schien überrascht. „Weiter!“, forderte er. „Ich kann nicht!“, sagte Träumer hilflos. „Ich kann so nicht dichten, meine Hände sind gefesselt, ich kann mich nicht bewegen und meine Gedanken erst recht nicht aufschreiben, ohne meine Feder kann ich nicht dichten!!“ Seine Stimme wurde lauter, so laut, dass er selbst zurückschreckte, vom Klang seiner eigenen Stimme eingeschüchtert. Sein Kopf schlug unsanft gegen den Baum, sein Kopf fühlte sich weicher an als es normal war. Träumer versuchte sich zu befreien, er musste jedoch schnell feststellen, dass dies nicht im Bereich des Möglichen lag. Der Mann betrachtete ihn nachdenklich. „Du bist kein Dichter“, sagte er schließlich. „Du siehst nicht danach aus, als hättest du Talent. Höchstens ein zweitklassiger Straßenpoet und das scheint dir schon geschmeichelt zu sein.“ Träumer schnappte nach Luft. Er wusste, dass er ein Dichter war, er wusste, dass er dichten konnte, dass er in der Lage war, gute Gedichte zu verfassen. Was sah dieser Mann in ihm, dass ihn denken ließ. Er wäre unbegabt?
„Hinterm verschlossenen Fenster,
Zwischen leeren Räumen,
Leben tote Gespenster,
die vom Leben träumen.
Sitzen auf unvollständigen Seelen,
Liegen unter den Sternen,
Sie werden den Tod nicht wählen;
doch auch sie werden lernen.“
Die Zeilen sprudelten aus ihm heraus. Zugegeben, keine gute Prosa, sie ergab nicht einmal Sinn, aber hinterließ Platz für die nötige Interpretation. Er spuckte die Worte aus, eines nach dem anderen und sie hinterließen den sauren Nachgeschmack von nicht reifen Äpfeln. Er hatte gedichtet! Er hatte gedichtet, weil der Ärger über die Furcht gesiegt hatte, weil er sich beleidigt gefühlt hatte. Seine Zeilen waren nicht schlecht gewesen, nicht gut, aber auch nicht schlecht. Nun hatte er beweisen, dass er es konnte, das würde ihn vielleicht vom Tod erretten. Vielleicht. Seine Augen wanderten zu dem Mann, der dasaß und ihn anstarrte. Sekundenlang, minutenlang, bis es unerträglich wurde. Er wandte den Blick ab, doch er konnte die Augen des Mannes immer noch auf sich spüren, dieser hatte den Blick nicht abgewendet. „Das ist nicht perfekt gewesen...“, sagte der Mann schließlich. Träumer wusste nicht, ob sein Blick noch auf ihm ruhte, aber vom Gefühl her würde er das nicht ausschließen. Der Mann stand auf. „Ich dachte, dass du, um deinem Tod zu entkommen, irgendein Gedicht vortragen würdest, dass es verdient, auch so genannt zu werden, ein Meisterstück, dass du auswendig gelernt hast, um deine Rolle besser spielen zu können. Wahrscheinlich hattest du auch Tinte und Pergament eingesteckt, damit es besonders authentisch wirkt. Aber das war weit von perfekt entfernt. Dennoch... interessant. Aus dir könnte etwas werden, wenn du den Beruf des Kopfgeldjägers an den Nagel hängst.“ Träumer blickte den Mann an und seine Augen wurden starr vor Schreck. Er glaubte ihm dennoch nicht. Er glaubte ihm nicht! Er hatte gedichtet und damit bewiesen, dass er es konnte und trotzdem glaubte dieser Mann ihm nicht! Nun würde er sterben. Der Mann zog sein Schwert. Er holte aus- und zerschlug mit einem Schlag Träumers Fesseln. Überrascht fuhr der junge Mann sich mit den Händen über die Arme, berührte die Stellen, wo das Seil tief in sein Fleisch geschnitten war und er jetzt sicherlich dunkelrote Abdrücke gesehen hätte, wenn der Stoff seines Hemdes den Blick nicht versperrt hätte. Die Abdrücke würden erst nach Wochen verschwunden sein, vielleicht würden sie nie verschwinden, dann hätte er wenigstens etwas, dass ihn an den Tag erinnerte, an dem er fast gestorben war. Obwohl er diesen Tag schwerlich vergessen würde. Falls er noch lange genug leben würde, um in die Möglichkeit zu kommen, ihn zu vergessen. Vorsichtig stand er auf, der Mann betrachtete ihn misstrauisch. Ein falscher Schritt und er würde sterben, das wusste Träumer. „So, wie heißt du?“, fragte der Mann ihn und warf Träumer seinen Rucksack zu. „Ich sollte das wissen, denn du wirst mit mir kommen.“ Träumer zuckte zusammen. „Wie? Ich werde was tun?“, fragte er entsetzt. Sein Leben würde in Gefahr sein, wenn er mit diesem Mann ging und zwar jede Minute, jede Sekunde. Doch er war nicht in der Position, zu bestimmen, was er tat, wenn er nicht im nächsten Moment sterben wollte. Er konnte sich nicht wehren, das wusste der Mann zwar nicht, machte die Situation allerdings auch nicht angenehmer. „Du wirst mit mir gehen“, wiederholte sich der Mann. „Wir können das gerne ausdiskutieren, wenn du möchtest. Wähle die Waffe, die du benutzen willst.“ Seine Hand fuhr zu seinem Schwert, dass er wieder in die Scheide gesteckt hatte und nun am Knauf herumspielte, sodass Träumer befürchten musste, er würde es gleich herausziehen und ihn exekutieren. „Ich habe nichts gegen deine Idee“, sagte er deshalb. „Mir gefällt sie eigentlich recht gut.“ Der Mann nickte zustimmend, seine Hand entfernte sich vom Schwertknauf. Träumer atmete auf. „Dann sag mir deinen Namen“, sagte der Mann. Träumer schluckte, er brachte kein Wort heraus. Konnte er seinen Namen wirklich verraten? Aber es war ja nicht nur ein Name, es war der Name, der verriet, was er war. Dass er kein Krieger war, nur ein Dichter. Vielleicht konnte er den Mann so überzeugen, von dem Träumer nichts weiter kannte als die Stimme, die eisblauen Augen und die schwarzen Haare, der Rest war entweder verschleiert oder von Stoff umhüllt, als müsse der Mann sich für sein Aussehen schämen. Träumer kam in den Sinn, dass der Mann vielleicht Gedanken lesen konnte, aber er verwarf den Gedanken wieder, er erschien ihm zu abstrakt. Dagegen sprach außerdem, dass er, wenn er wusste, was Träumer über ihn dachte, den jungen Mann bestimmt töten würde ohne mit der Wimper zu zucken. Schließlich gab Träumer sich einen Ruck und sagte: „Man nennt mich Träumer, das ist mein Name.“ Der Mann lachte leise. „So ein Unsinn“, sagte er und schüttelte den Kopf. „Nur weil die anderen dich so nennen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass dies dein Name ist. Träumer, hm? Interessant, wirklich sehr interessant...“ Der Mann starrte nachdenklich auf den Baum, unter dem die zerschnittenen Fesseln lagen. „Wie ist euer Name?“, wagte sich Träumer zu fragen. Der Mann lächelte, zumindest vermutete Träumer das, denn seinen Mund konnte er unter dem Tuch nicht erkennen. „Ich habe so viele Namen, dass ich nicht mehr zu zählen wage. Manche nennen mich den Dämon aus den Nebelsümpfen, obwohl ich noch nie in den Nebelsümpfen gewesen bin. Manche nennen mich den Rächer, aber du solltest mich eher unter dem Namen „Schatten“ kennen. Das ist der gebräuchlichste Name. Aber es wundert mich, dass du meinen Namen nicht kennst, obwohl du doch Kopfgeldjäger bist. Kannst wohl nicht lesen, was?“, er lachte böse. „Ich kann lesen“, antwortete Träumer ruhig. „Ich kann es wohl besser als viele andere. Vielleicht sogar besser als du.“ Mit diesen Worten öffnete Träumer den Rucksack, er musste überprüfen, dass alles heil geblieben war. Er kramte etwas hektisch darin herum, dann atmete er erleichtert auf. Der Flöte war nichts passiert und auch die anderen Gegenstände schienen nicht sonderlich beschädigt worden zu sein. Träumer verschloss ihn wieder ordentlich. Schatten war zu ihm getreten. „du kannst aber auch einfach Ted zu mir sagen. Das ist zwar nicht mein Name, aber er gefällt mir und solange du bei mir bleibst, kannst du diesen Namen benutzen.“ Träumers Augen wurden groß, er blickte Schatten verwirrt und erstaunt an, dann schließlich nickte er. „Einverstanden.“ Schatten nickte zustimmend. „gut. Wie ich schon sagte, wirst du mich begleiten. Wir haben einen reichlich gefährlichen Weg vor uns, aber ich denke, es ist machbar. Da wir jetzt zwei Leute sind, müssten wir gut durchkommen. Du wirst mir doch keinen Ärger machen, oder?“ Er legte die rechte Hand auf sein Schwert. Träumer schüttelte hastig den Kopf. „Das ist gut. Das ist sogar sehr gut.“ Schatten ging zu dem Baum, an den er Träumer in der vorigen Nacht festgebunden hatte und begann zu klettern. Er war in Sekundenschnelle in den Ästen verschwunden und Träumer vermutete dort ein gut verstecktes Lager des Kopfgeldjägers. Jetzt, wo ihm nicht mehr direkte Lebensgefahr drohte, war er viel entspannter, doch wenn er daran dachte, wie sein Leben noch vor einigen Tagen gewesen war, drehte sich ihm der Magen um und der Schweiß brach aus.
Schatten lief oben ziellos herum. Er nahm seinen Wanderrucksack, den er einmal einem sterbenden Mönch abgenommen hatte und stopfte alles hinein, was er wert war, mitgenommen zu werden. Ein kleiner Spiegel, ein Seil, Nahrungsmittel, Eine Dose mit getrockneten Fliegenpilzen, die er von einer Hexe im Tausch gegen eine tote schwarze Katze bekommen hatte. Die Katze war der Hexe entflohen und sie wollte sie zurück- tot oder lebendig. Nachdem das Tier ihm einige Kratzer zugefügt hatte, war Schatten zum seinem Lieblingsmotto übergegangen: Nur eine tote Katze ist eine gute Katze. Er steckte auch einige Dingen ein, von denen er nicht wusste, was sie waren oder bedeuteten, die er aber erbeutet und zu wertvoll oder interessant gefunden hatte, um sie weg zuwerfen.
Träumer wartete unten. Ihm kam der Gedanke, davon zu rennen, aber er wusste, dass Schatten ihn finden würde, überall, wo er hingehen würde und wenn er diesem Mann das nächste Mal begegnete, würde er ihn töten. Keine angenehme Vorstellung und Träumer zwang sich, an etwas anderes zu denken, damit er nicht dauernd seinen eigenen Tod vor Augen hatte. Er wollte sich nicht eingestehen, dass dieser Mann ihm Angst machte, ihn einschüchterte, ihn zu Tode ängstigte. Ihn beschlichen Zweifel, ob er diesem „Schatten“ überhaupt entfliehen konnte, es schien ihm unmöglich, Dann, endlich, nach vielen quälenden Minuten, stieg Schatten den Baum wieder herunter, mit einem Rucksack auf dem Rücken, der seinem eigenen nicht im Entferntesten ähnelte. Auf dem Stoff des Rucksacks war ein großes Kreuz gemalt in einem Rotbraunton, von dem Träumer vermutete, dass er Blut nachempfunden worden war.
Er betrachtete noch eine Weile den Rucksack, der so überhaupt nicht zu Schattens Gesamtbild passen wollte. Schatten bemerkte den Blick und lachte ein tiefes, kehliges Lachen, äußerte sich aber nicht, sagte kein einziges Wort. Träumer sah Schatten eine Weile zu, dann wagte er, erneut zu sprechen. „Wohin... wohin werden wir reisen?“ Schatten sah Träumer an. Lange sagte er nichts, kein einziges Wort, blickte ihn nur an. „Wir werden jemanden aufsuchen“, sagte er. „Hast du schon einmal etwas vom See der Träume gehört?“ Träumer dachte nach. Der Name kam ihm bekannt vor, obgleich kein Bild in seinem Kopf auftauchte. „Ich denke schon“, antwortete er zögerlich und wartete darauf, dass Schatten ihm eine Erklärung gab. Schatten erwies ihm den Gefallen. „Der See der Träume ist ein Gewässer, wie du dir bestimmt Hier lebt eine Person, zu der wir gehen werden. Es ist von dringender Wichtigkeit und der Weg dorthin ist nicht einfach. Wir müssen dazu das Gebirge überqueren. Ob du willst oder nicht, du wirst mit mir kommen. Aber überleben musst du selbst, dabei kann ich dir nicht helfen.“ Schatten blickte Träumer an. „Ich habe aber keinen Mantel, um mich vor Kälte zu schützen“, gab Träumer zu bedenken. „Das macht nichts, wir werden vorher in einer Stadt halten. Ich habe dort noch etwas zu erledigen“, sagte Schatten kurz und trat dann näher an Träumer heran. „Jetzt beweg dich, kleiner Meuchelmörder, sonst werden wir niemals rechtzeitig dort ankommen.“ Träumer wollte fragen, wofür sie rechtzeitig da zu sein hatte. Aber er traute sich nicht. Schatten wartete geduldig, bis Träumer in Bewegung gekommen war und die ersten unsicheren Schritte in irgendeine Richtung gemacht hatte, bis er sich entschloss, den jungen Mann zu führen. „Hier entlang“ sagte er und ging los, Träumer hatte das Gefühl, Schatten würde seine Orientierungslosigkeit amüsant finden. Schattens Schritte waren, schnell leise und federnd, Träumer konnte kaum mithalten. Dauernd stolperte er über Wurzeln oder am Boden liegende Äste, in dem Versuch, nicht zu weit hinter Schatten zurückzubleiben, denn er wusste nicht, was dann passieren würde, aber er fürchtete sich davor.
Schatten war immer vor ihm, es schien, als könnte Träumer ihn niemals einholen, als würde er immer hinter ihm laufen und immer weiter zurückfallen. Schatten blieb stehen und sah sich nach Träumer um. „Du bist zu langsam“, sagte er mit abwertender Stimme. Träumer schnaufte als Antwort nur. Er blickte sich um. Noch immer waren sie im Wald, die Blätter der Bäume glänzten in unterschiedlichen Farben auf eine seltsame Art und Weise, als wäre jedes einzelne Blatt mit größter Sorgfalt von kleinen Spinnen mit unsichtbaren Fäden überzogen worden. Er blinzelte zweimal, dann sah er noch mal zu den Blättern herüber. Die Fäden blieben. „Schatten...“, sagte er leise, doch dieser hatte es ebenfalls bemerkt und zog scharf die Luft ein. „Etwas stimmt hier nicht“, sagte er leise. „Sei vorsichtig, kleiner Kopfgeldjäger, und halte deine Waffe bereit. Es könnte sein, dass wir ungebetenen Besuch bekommen. In diesem Bereich des Waldes bin ich selten, aber ich habe gehört, dass es hier von Riesenspinnen nur so wimmelt.“ Träumer nickte wie in Trance, dann zuckte er zusammen, als er es knacken hörte, doch es war nur sein eigener Fuß, der einen vertrockneten Ast durchgebrochen hatte. „Ich habe keine Waffe“, sagte er zu Schatten und deutete auf seinen Leeren Gürtel. Schatten zog überrascht die Augenbrauen hoch. „Wie wolltest du mich dann umbringen, wenn du nicht einmal eine Waffe hast? Erwürgen? Du dachtest wirklich, ich wäre ein alter Greis, was? Oder bist du etwa ein Magier?“ misstrauisch blickte Schatten Träumer an. Dieser lachte und sagte: „Es gibt doch keine Magier. Ich dichte gerne über sie, aber es gibt sie doch nicht.“ Schatten schüttelte über so viel Unverstand den Kopf. „Sage nicht, dass es sie nicht gibt“, murmelte er. „Das mögen sie nicht besonders gern. Es gibt schon manchen, der das behauptet hat, aber sie haben ihm vom Gegenteil überzeugt. Unglücklicherweise hatte er nicht viel davon. Sie haben ihn mit einem magischen Blitz geröstet. Traurige Geschichte.“ Schatten lachte, aber Träumer wusste nicht, ob es aus Freude oder Verbitterung entstanden war.
„Wie auch immer“, sagte Schatten urplötzlich. „lass uns besser weitergehen, wenn du nicht einmal eine Waffe hast.“ Er ging los. In diesem Moment hörte Träumer es knacken und er wusste, dass er es nicht gewesen war.
6.
Er drehte sich zu dem Geräusch um und blickte direkt in eins von sechzehn Augen der riesigen Spinne, die sich von einem dünnen, durchsichtigen Faden herunter gehangelt hatte. Speichel tropfte von ihren riesigen Mundwerkzeugen und bevor Träumer auch nur darüber nachdenken konnte, wie wahrscheinlich sein Überleben sein würde, spritzte die Spinne ein durchsichtiges Sekret auf ihn. Er schrie auf und sprang zur Seite, das einzig Richtige, was ihm in diesem Moment einfiel. Die Spinne machte ein schrilles Geräusch und von den Bäumen seilten sich weitere Spinnen ab, eine größer und widerlicher als die nächste. Träumer wich immer weiter zurück, er hatte Angst, hier wollte er nicht sterben. Wo war Schatten? Träumer blickte sich um. Niemand. Er war allein. Panik ergriff ihn. Er nahm panisch seinen Rucksack ab und suchte nach etwas, das ihn retten konnte. Seine Feder? Wohl kaum. Auch sein Proviant schien ihm nicht geeignet. Da bekam er die Flöte in die Hand. Er dachte kurz nach, aber es blieb ihm keine zeit, sich etwas anderes auszudenken; eine der Spinnen kam auf ihn zu, die andere kam von der Seite. Träumer setzte in Verzweiflung die Flöte an die Lippen und spielte den höchsten Ton, den man erzeugen konnte. Es schrillte und Träumer war das Geräusch genauso unangenehm, wie es den Spinnen war. Sie machten schrille Geräusche und zogen sich einige Meter zurück. Erleichtert setzte Träumer die Flöte ab. Wenige Sekunden später bemerkte er, dass er einen Fehler gemacht hatte: jetzt kamen die Spinnen wieder auf ihn zu. Er blies erneut die Flöte, aber sie schienen sich dieses Mal nichts aus dem Ton zu machen und kam zielstrebig immer näher. Wahrscheinlich waren sie lernfähig, hatten die Quelle des Tones erkannt und beschlossen, den Urheber so schnell wie möglich zu beseitigen. Träumer schloss die Augen. Er würde sterben. Erneut. Vorhin wäre er fast gestorben, er hatte es überlebt, doch jetzt würde er mit Sicherheit sterben. Er hatte keine Waffe. Er hörte einen sehr schrillen, spitzen Schrei. Der Schrei einer Spinne. Überrascht öffnete er die Augen- und atmete erleichtert auf. Zwischen den Spinnen stand Schatten und er kämpfte. Erstaunt, erleichtert und erschreckt verfolgte Träumer das Schauspiel und er zuckte bei jedem Hieb zusammen, den Schatten ausführte und der jedes Mal einer der Spinnen den Tod schenkte. Der Mann wusste, wie man kämpfen musste, das sah Träumer sofort. Er zwang sich, diese Szene im Gedächtnis zu behalten, um später darüber ein Gedicht schreiben zu können. Es war wichtig, dass dies in Erinnerung blieb. Minuten später stand keine der Spinnen mehr und Schatten war über und über mit blauen Spinnenblut bespritzt. Angeekelt blickte Träumer auf die Blutbesudelte Kleidung, dann auf die Spinnen und riss sich zusammen. Schatten hatte ihm das Leben gerettet, er sollte das nicht mit Verachtung danken.
Doch Schatten sah ihn gar nicht an, er blickte mit traurigem Blick auf die toten Körper, so als sähe er darin nicht den Körper eines Monsters, sondern den eine kleinen Kindes, eines kleinen Kindes, dass sein eigenes gewesen war. Träumer wusste nicht, warum ihm dieser Vergleich in den Sinn kam, aber nichts anderes schien ihm passender zu sein. Schatten stand lange einfach da und blickte auf den Boden.
Träumer wartete geduldig ab, er sah zu wie sich Schatten das Schwert an seinem Mantel abwischte und den Mantel ohne groß zu überlegen abschnallte und ihn über den Körper einer Spinne legte. Dann blickte er Träumer an, mit einem langen, traurigen Blick. „Lass uns weitergehen“, sagte er, tonlos, gefühllos. Träumer nickte stumm. Er folgte Schatten an den Leichen vorbei und er blickte noch einmal auf den toten Leichnam einer Spinne. Wie dieses Kind wohl gewesen war? War Schatten einmal verheiratet gewesen? War er glücklich gewesen? Träumer wurde melancholisch, er dachte an die vielen Möglichkeiten der Vergangenheit, die Schatten gehabt haben könnte und schluckte. Er dachte an seine eigene Zukunft. Würde er jemals eine Familie haben? Würde er dann glücklich sterben können, wenn es an der Zeit war? Oder würde er so enden wie es Schatten ergangen war, würde er verlieren? Würde er als Rastloser enden, der niemals am selben Ort bleiben konnte? Als Mörder, als Gejagter? Der Gedanke versetzte ihn in Angst. Würde er genauso enden? Würde er? Die Eventualität dieser Gedanken ließ ihn lächeln. Es würde kommen, wie es kommen würde. Sich jetzt schon in Angst vor der Zukunft zu verkrümmen war sinnlos, zumal sein Tod schneller eintreffen konnte als es ihm lieb war. Schon allein an diesem Tag war er dem Tod zweimal so nah gekommen wie er es eigentlich erst im Alter von mindestens 70 Jahren tun wollte. Er wollte eine eigene Familie haben. Nicht weil er eine Frau haben wollte, sondern weil er die Idylle und die Harmonie liebte, die manche Familien ausstrahlten. Er wollte so eine Harmonie für sich selbst. Doch er war meilenweit davon entfernt. Wieder lief er durch den Wald, immer weiter, scheinbar immer tiefer in den Wald. Er wagte nicht, zu fragen, wie weit sie gekommen waren und wie weit sie noch zu gehen hätten. Schatten ging immer noch voraus, seine Miene war versteinert, er war mit den Gedanken irgendwo, aber nicht in der Nähe seines Körpers, er wirkte verlassen und todunglücklich, strahlte aber immer noch die Gefährlichkeit eines wilden Raubtiers aus, dem man gerade das Junge gestohlen hatte, ein Vergleich, der auf eine traurige Art und Weise sehr gut zu passen schien. Träumer folgte Schatten immer weiter in den Wald und langsam kamen Zweifel auf, wo sie überhaupt waren und ob Schatten wusste, wohin er ging. Stunden mochten vergangen sein, Träumer wusste es nicht mehr, er wusste nichts mehr. Es gab seinen Verstand nicht mehr, da waren nur seine Beine, seine Beine, die laufen wollten, die laufen mussten. Er war nicht mehr er selbst. Er schien nicht mehr richtig denken zu können, um ihn herum war Nebel. Aber er konnte laufen, das genügte. Er musste laufen, er musste Schatten nachfolgen. Schatten war der einzige, der den Weg kannte, nur er konnte Träumer aus diesem Wald herausführen. So folgte Träumer Schatten. Er folgte ihm durch die Bäume, die immer milchiger wurden. Es wurde nebelig um ihn herum und bald schon wusste Träumer nicht mehr, in welche Richtung er ging, er sah Schatten und das genügte. Dann blieb Schatten stehen. „Wir können nicht mehr weitergehen“, sagte er leise. „Wir müssen hier rasten.“ Träumer sah ihn an, er war irritiert. „Aber ich kann noch laufen“, sagte er. „Wir sollten weitergehen, wir müssen diese Stadt doch so schnell wie möglich erreichen!“ Schatten blickte zu Träumer, die Augen suchten die des jungen Dichters. „Wir müssen jetzt rasten. Im Dunkeln kommen wir nicht durch diesen Teil des Waldes, das wäre Selbstmord. Wir werden hier rasten. Wenn es dir nicht passt, geh weiter. Geh weiter und stirb, weil du in irgendeinem unsicheren Teil des Erdbodens versunken bist. Das hier ist der Teil des Waldes, der in das Moor übergeht.“ Schatten ging einige Schritte weiter und blickte prüfend einen Baum an. Er befand ihn scheinbar für unbedenklich, denn ersetzte sich darunter und sagte dann zu Träumer: „Komm her. Setz dich. Wir übernachten hier, mach es dir irgendwie bequem. Aber du weißt ja: ich habe dich im Auge. Ohne mich kommst du im Übrigen nicht aus diesem Wald heraus. Also überlege dir zweimal, ob sich dein Vorhaben wirklich lohnt. Wo du doch nicht einmal eine Waffe hast.“ Träumer verstand erst beim letzten Satz, was er meinte. Jetzt taute sein verstand allmählich auf und er bemerkte, dass Schatten immer noch davon redete, dass Träumer versuchte, ihn umzubringen. Träumer lächelte. Misstrauen machte einen Menschen vielleicht weniger anfällig für Gefahren, aber ungerechtfertigtes Misstrauen ließ Schatten albern wirken. Träumer erheiterte es, dass Schatten immer noch von Träumers Gefährlichkeit überzeugt war. Das verschaffte Träumer zwar einen gewissen Respekt in Schattens Augen, war aber nicht zuträglich, wenn Träumer Schattens Vertrauen gewinnen wollte. Er musste andere Mittel auffahren, um ihn zu überzeugen. Er holte aus seinem Rucksack Feder, Tinte und Pergament, doch eine dunkle Wolke schob sich in diesem Moment über die eh schon fast untergegangene Sonne und ließ das letzte Licht verlöschen. Träumer seufzte und steckte seine Schreibutensilien wieder ein. Er würde heute nicht schreiben können, darum schob er die Erinnerung an den Kampf zurück und versuchte, ihn sich so einzuprägen, dass er die Einzelheiten, die er gesehen hatte, nicht vergessen konnte. Besseren Schreibstoff hatte er noch nie gehabt, aber er war sich sicher, dass das nicht das Einzige war, das er zusammen mit Schatten sehen würde. Er war nicht scharf darauf, die Dinge selbst zu erleben - dazu war er Dichter geworden und kein Abenteurer, Er wollte über Abenteuer schreiben, selbst aber eigentlich keine erleben. Doch da es sich eh nicht vermeiden ließ, wollte er wenigstens Dinge erleben, über die sich das perfekte Gedicht schreiben ließ. Er schloss die Augen und dachte an Thome. Fragte sich, wie das Leben im Dorf gehen würde. Ob alles so wie immer war? Friedlich? Ob das Mädchen auch heute wieder ihrer Mutter im Garten geholfen hatte? Ob Thome endlich das Schwert vollendet hatte, von dem er gesagt hatte, dass es ein Meisterstück, sein Meisterstück, werden würde? Ob er der alten Frau ihre Bettpfanne repariert hatte, damit sie nicht mehr mit kalten Füßen schlafen musste? Ob alles seinen gewohnten Gang ging? Und schließlich, die Frage, die am meisten auf seinem Herzen lastete: Ob sie ihn wohl vermissten? Träumer merkte in diesem Moment, dass das Dorf sein ein und alles war, der Grund, warum er glücklich sein konnte. Er wusste, dass es ihnen gut ging; zumindest hoffte er es. Es gab ihm Kraft. Er würde ebenfalls das Beste aus seiner Situation machen und irgendwann würde er zurück nach Hause kommen und eins von den Brotlaiben probieren, wenn sie frisch gebacken waren. Er lächelte. Dann kullerte eine kleine Träne aus seinem Auge. Er vermisste sie. Er vermisste sie alle. Jedes einzelne Haus, jeden einzelnen Menschen, jedes einzelne Tier. Sie waren seine Familie gewesen, 19 Jahre lang waren sie seine Familie gewesen. „Ich werde zurückkommen“, flüsterte er leise, dann schlief er neben Schatten ein.
7.
Als Träumer aufwachte, schien die Sonne durch die Baumwipfel der großen, dunklen Tannen. Er rieb sich die Augen und stöhnte leise. Er war es nicht gewohnt, auf so harten und unebenen Untergrund zu schlafen. Gestern war er beim Erwachen zu geschockt gewesen, um es wahrzunehmen, dafür schlug der Schmerz jetzt zu. Ein Stechen fuhr durch seinen Rücken, er vermutete, dass sich einige blaue Flecke gebildet hatten, wollte sich aber nicht ausziehen, um Schatten nachsehen zu lassen. Er hatte immer noch Angst vor dem Mann und außerdem wollte er sich keine Blöße geben, denn aller Ansicht nach hatte Schatten gut geschlafen. Er saß neben Träumer und blickte geradeaus, bemerkte gar nicht, dass der junge Mann aufgewacht war. „Wohin werden wir heute gehen?“, fragte Träumer leise. Schatten regte sich nicht. Er antwortete mit leiser Stimme: „Wir gehen durch den Sumpf.“ Träumer blickte zu Schatten, blickte auf den Boden, dann wieder zu Schatten. „Wie bitte?“, fragte er verständnislos. Schatten seufzte genervt. „Das war doch nicht so schwer zu verstehen, oder? Wir werden durch den Sumpf gehen.“ Träumer nickte, doch dann fragte er verwirrt: „Warum? Ist das nicht zu gefährlich?“ Schatten lachte kalt. „Für dich allein vielleicht. Ich kenne mich hier gut aus, vertrau mir. Das ist der kürzeste Weg.“ Träumer schüttelte erneut den Kopf. „Aber gestern hast du“, setzte er an. „Gestern war es zu spät!“, blaffte Schatten ihn an. Träumer zog den Kopf ein. „Niemand wagt sich bei Dunkelheit in ein Moor! Das ist Wahnsinn! Wo bist du eigentlich aufgewachsen, wenn du nicht einmal so etwas weißt?! Das muss ja eine isolierte Zone gewesen sein. Durftest du das Haus überhaupt verlassen? Ein Wunder, dass du Kopfgeldjäger geworden bist, du verstehst ja überhaupt nichts von der Welt!“ Träumer hatte die Beleidigungen stumm ertragen, er war wütend und gekränkt, aber er war nicht imstande, Wiederworte zu geben. Er war nicht gut genug, um dem zu widersprechen. Er senkte den Kopf. War er wirklich so dumm? Das konnte er nicht glauben. „Ich bin ein gutgläubiger Mensch“, entschuldigte er sich deshalb. Schatten erwiderte nichts, er schnaubte nur und stand dann auf. „lass uns gehen. Klopf dir vorher die Blätter ab; vor allem die aus deinen Haaren solltest du loswerden. Und vergiss diesen merkwürdigen Hut nicht.“ Schatten zog sein Tuch vor dem Mund wieder gerade. Die Blutspuren an seiner Kleidung waren verschwunden. Träumer runzelte die Stirn. Hatte er sich den Angriff der Spinnen eingebildet? Oder hatte Schatten einige Geheimnisse, von denen Träumer nichts wusste? Das letztere schien ihm sehr wahrscheinlich. Er stand auf und fischte sich ein paar Blätter aus den Haaren, dann sah er sich nach seinem Hut um. Er lächelte. Merkwürdig, dass er ihn noch nicht verloren hatte, er hatte sich in letzter Zeit gar nicht um seinen Hut gekümmert, er hatte nicht einmal einen Gedanken an ihn verschwendet. Was wäre passiert, wenn er den Hut verloren hätte? Träumer lächelte. Vermutlich hätte er sich einen anderen gekauft, damit seine Haare nicht nass wurden. Aber das wäre etwas anderes gewesen. Der Hut war etwas besonderes, er erinnerte ihn an zu hause, an Thome. Er spürte, dass es lange dauern würde, bis die Zwei sich wieder sehen würden. Sehr, sehr lange.
Schatten stand da und wartete. „Was ist?“, fragte er ungeduldig. „Wir wollen weiter, schlag hier keine Wurzeln. Du bist schließlich kein Baum.“ Träumer nickte und folgte Schatten. Dieser lief los, geradewegs auf den Teil des Waldes zu, aus dem am gestrigen Abend der Nebel aufgestiegen war; jetzt war es nur noch ein leichter Dunst, der in den Bäume zu kleben schien. Träumer wandte den Blick von den Bäumen ab und beschloss, seine Aufmerksamkeit jetzt in erster Linie auf Schatten zu richten, schließlich schien er de Weg zu kennen. Schatten ging immer gerade aus, seine Schritte waren sicher. Träumer selbst folgte den Schritten, doch er merkte wie der Boden immer weicher wurde. Bald musste er seine Stiefel mit Gewalt aus dem Boden ziehen, mit einem Schmatzen lösten sich die Sohlen. Zurück blieben Löcher, in denen sich Wasser sammelte. „Jetzt beginnt der Sumpf“, erklärte Schatten. „Wir könnten zwar auch den Sumpf umwandern, dabei würden wir allerdings mehrere Tage verlieren und das ist es nicht wert. Im Übrigen solltest du nicht versinken, wenn du immer in meine Fußstapfen trittst. Das bekommst du doch wohl hin, nicht wahr?“ Schatten drehte sich nicht um, er ging davon aus, dass Träumer seine Anweisungen befolgen würde. Träumer seufzte. Er sah in ihm nichts weiter als eine Person, die keinen eigenen Willen hatte. Dieser Gedanke machte ihn traurig. Würde sich an dieser Situation jemals etwas ändern? Vermutlich erst dann, wenn Schatten begriffen hatte, dass Träumer ihn nie töten wollte, und das würde einige Zeit dauern.
Er folgte Schattens Schritten, hatte jetzt die Augen auf den Sumpfboden gerichtet, Schattens Fußabdrücke waren tief in die Erde eingedrückt worden, das Wasser sammelte sich in manchen, aber andere, die etwas höher gelegen schienen, waren trocken. Träumer blieb für einen kurzen Moment stehen und hob den Kopf. Was er sah, erschreckte ihn zutiefst. Um ihn herum war Sumpfgebiet, er blickte nach hinten und konnte den Wald nicht mehr sehen, es gab nur Nebel. Überall Nebel, der an der Kleidung zog und an toten Bäumen hing, als wären es die Häuser von Gespenstern. Der Boden war dunkelgrün bis hellbraun, ab und an wuchs etwas Moos auf der Erde, hier und da lugten ein paar Grasbüschel hervor. Sonst nichts. Gar nichts. Auch kein Schatten. Träumer geriet in Panik. War Schatten erneut verschwunden, wie bei dem Kampf mit den Spinnen? Doch das war in einem Wald gewesen, hier war der Sumpf. Ein falscher Schritt und er würde versinken. Er blickte wieder nach unten zu den Fußspuren; doch da waren keine Fußspuren mehr. Kein Zeichen deutete darauf hin, dass jemand vor ihm dort entlang gegangen war. „Schatten?“, rief Träumer fragend. „Bist du hier irgendwo?“ Er stolperte vorwärts; er konnte nicht auf der Stelle stehen bleiben, sonst würde er versinken. Also versuchte er, eine möglichst sichere Stelle zu finden und dort auf Schatten zu warten. Ohne es zu wollen sank er bei jedem Schritt, den er machte, tiefer. Verzweifelt zog er die Stiefel aus dem Morast, doch mit jedem Mal wurde es mühsamer und schwieriger, sich wieder zu befreien. Schließlich brachte er es nicht mehr fertig, sich aus eigener Kraft zu befreien. Es musste ein Wunder geschehen, wenn er hier lebend wieder herauskommen wollte.
Eine dunkle Gestalt näherte sich. Sie kam zielstrebig auf Träumer zu, doch erst, als er fast vor ihm stand, erkannte er sie. „Schatten“, flüsterte er, fast andächtig. Schatten schüttelte den Kopf und zog den jungen Mann mit einem kräftigen Ruck heraus. „Ich habe doch gesagt, du sollst auf meine Schritte achten“, herrschte er ihn an. Träumer nickte still. „Es tut mir leid“, sagte er und ließ den Kopf hängen. „Ich … ich war abgelenkt und deine Spuren waren weg. Es tut mir leid.“ Schatten schnaubte nur verächtlich, dann drehte er sich wieder um und ging los. „Folge mir“, sagte er in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete. Träumer gehorchte. Der Rest des Tages verstrich schleichend. Träumer ging Schritt für Schritt vorwärts, er bemühte sich, immer in die Fußstapfen von Schatten zu treten. So kamen sie langsam, aber ohne weitere größere Zwischenfälle durch den Sumpf. Als es dämmerte, konnte Träumer das Ende des Sumpfes sehen. Hier und da standen ein paar Bäume, die voll mit grünen Blättern waren. Erleichtert atmete er auf und blickte dann wieder auf den Boden, wo Schattens Schritte erneut zu verschwinden drohten. Er lief schneller, um den Weg noch finden zu können. Als die Nacht hereinbrach, war der Sumpf hinter ihnen gelassen. Schatten sagte: „Wir rasten hier. Leg dich hin, wir werden im Morgengrauen aufbrechen. Es wird ein langer Marsch, also spar deine Kräfte. Auch wenn du nicht besonders viele davon zu haben scheinst.“ Schatten lachte leise. Träumer nickte bloß, er war zu müde, um etwas zu erwidern. Er lehnte sich an einen Baum und war innerhalb von Sekunden eingeschlafen.
8.
Die Sonne strich mit einer Sanftheit über die Wipfel der wenigen Bäume, die der einer Mutter, die ein kleines Kind streichelte, ähnelte. Sie schob die Wolken vorsichtig zur Seite und ließ ihr helles, reines Licht über die Welt fließen, sie erweckte den Eindruck, als wäre die Welt ein hellerer Ort, als sie tatsächlich war. Träumer erwachte mit diesen Sonnenstrahlen und er erhaschte einen Blick über die Welt, die er noch niemals vorher gesehen hatte. Sie überraschte ihn mit einer Schönheit, die sie ihr niemals zugetraut hätte. Er saß eine Weile einfach da, genoss die Sonnenstrahlen auf seiner Haut, spürte die Wärme und ließ diese Wärme seinen Kopf, sein Herz und den Rest seines gesamten Körpers ausfüllen. Dann spürte er Schattens Hand an seiner Schulter. Er öffnete die Augen. „Wir müssen weiter“, sagte Schatten, der bereits in voller Montur vor ihm stand. Träumer stand auf. Er kam erstaunlich leicht auf die Beine, auf der Rücken schmerzte nicht mehr so stark wie gestern. Er nahm seinen Rucksack und seinen Hut und nickte. Er war bereit. Schatten ging los, dieses Mal schien Träumer mit ihm mithalten zu können. Die ersten Stunden gingen die beiden nebeneinander, Schatten gab die Richtung vor, Träumer hielt Schritt. Die Sonne begleitete die beiden mit ihren Strahlen, ließ die Tautropfen an den Blätter glitzern und dann langsam verdunsten, weckte die kleinen Tiere, die Eichhörnchen und Vögel, die Insekten. Träumer fühlte sich wohl. Es erinnerte ihn an das Waldstück, das am Dorf angrenzte, wo er stundenlang gelegen oder gesessen und die Wolken beobachtet hatte. Es gab ihm ein Gefühl von Heimat und in ihm wurde das bittersüße Gefühl von Heimweh wach, dass er schon vor zwei Tagen gehabt hatte. Er wollte nach Hause, obwohl er wusste, dass er nicht konnte. Er würde abgeordert werden. Doch war es besser, mit Schatten durch die Gegend zu wandern, als in den Krieg zu ziehen? Hatte er mit Schatten größere Chancen zu überleben? Er bezweifelte das stark, immerhin war er bereits in mehrere lebensgefährliche Situationen geraten, doch Schatten hatte ihn jedes Mal gerettet. Schatten war immer im letzten Moment da gewesen. Er marschierte weiter. Die Landschaft wurde lichter, die Bäume, die den Sumpf gesäumt hatten, nahmen nach und nach ab und die Landschaft floss in eine weite Ebene. Auf dem kurzen Gras weideten viele weiße Schafe; ab und zu war ein schwarzes dabei. Weiter hinten auf einem Stein konnte man einen Hirten sitzen sehen. Durch die Ebene schlängelte sich eine Straße. Schatten hielt darauf zu. Merkwürdig, dass die Straßen nie gerade sind, sondern sich immer schlängeln, dachte Träumer gerade, als die auf den Weg stießen. Der Weg entpuppte sich als mittel ausgebaute Handelsstraße. Weiter vorne konnte man eine Heukarre sehen, der von einem Tier gezogen wurde. Träumer konnte das Tier nur raten, aber er vermutete, dass es ein Stier war. Schatten und Träumer folgte dem Karren, der eine Spur aus Heu auf dem Boden hinterließ. Der Boden war trocken und man sah, dass er des Öfteren benutzt wurde. Die Spurrillen von großen Wagen waren auf dem Boden zu erkennen. In der Ferne konnte Träumer eine Stadt erkennen. Zumindest glaubte er, dass es eine Stadt war, denn die Umrisse sahen zu aus, wie er sich eine Stadt vorgestellt hatte: Groß und chaotisch, die Häuser in keiner erkennbaren Ordnung zusammengebaut.
Schatten zog sein Tuch vorm Mund gerade. „Dort wollen wir hin“, erklärte er. Träumer blickte erneut zu der Stadt in der Ferne und fragte: „Wie heißt diese Stadt?“ Er hatte gehört, dass Städte für gewöhnlich Namen zu haben pflegten, zumindest auf der anderen Seite des Waldes. Er hatte sogar gehört, dass sie sogar Namen für den Wald und die Dörfer hatten, die in der Umgebung seines eigenen lagen. Er bemerkte, dass die Leute in seiner Gegend wohl nicht viel Geschick im geben von Namen hatten, weswegen es wohl keine gab. Hier allerdings schien es anders. „Das ist Irgon“, sagte Schatten und der Name rief in Träumer etwas hervor, dass er selbst nicht zu deuten vermochte. „Irgon?“, fragte er und lächelte. „Ein interessanter Name. Sagt irgendwie gar nichts über die Stadt aus.“ Schatten lachte. „Das sagst du jetzt. Geh erst einmal hinein und du wirst wissen, was dieser Name bedeutet, das kann ich dir versichern. Wenn wir gehen, wird dieser Name etwas aussagen, aber ob er positiv oder negativ ist, kann ich dir nicht sagen.“ Träumer nickte. Sie näherten sich der Stadt unaufhörlich. Schon konnte er das Stadttor erkennen, dass weit offen stand. „nachts schließen sie das Tor“, erklärte Schatten. „Aber tagsüber ist es für die Menschen geöffnet, die in der Stadt übernachten wollen. Nachts kommst du nur herein, wenn du ein wichtiges Schreiben überbringen musst oder wenn du die Erlaubnis der Königin oder des hier wohnenden Herzogs hast.“ Träumer hob die Augenbrauen. „Ist ein herzog so etwas wie die Königin?“, fragte er. Schatten lachte. „So etwas in der Art, ja. Aber nicht so mächtig. Gibt es da, wo du herkommst, etwa keine Herzöge?“ Träumer schüttelte den Kopf. „nein“, sagte er. „Die gibt es in der Tat nicht.“ Schatten lachte und diesmal war es einzig fröhlich, ohne jeden Unterton. „Das gefällt mir irgendwie“, sagte er und blickte verträumt in die Wolken. Als die beiden weitergingen, schoben sich plötzlich Wolken vor die Sonne und es wurde finster. Leise setzte ein Nieselregen ein. Träumer blickte verwundert nach oben. Der Regen war warm und angenehm. „Es regnet hier immer“, sagte Schatten. „Jeden Tag im Jahr. Das ist normal in Irgon. Die Stadt wurde nach dem Mann benannt, der für diesen Dauerregen verantwortlich ist. Irgon, der erste Magier. Er hat die Stadt mit einem Fluch belegt, als er von einem Wirt kein Essen bekommen hatte, nur weil er kein Geld hatte. Das erzählt man sich zumindest.“ Träumer runzelte die Stirn. „Das hast du also gemeint mit „Sag nicht, dass es sie nicht gibt“. Es würde sie verärgern, nicht wahr?“ Auch wenn er immer noch nicht an die Existenz dieser Magier glaubte, so gefiel ihm dennoch die Geschichte. Sie erreichten im Nieselregen das Tor. Die zwei Wächter in Rüstung beäugten sie misstrauisch, aber keiner von ihnen machte Anstalten, ihnen den Eintritt zu verwehren. So betrat Träumer das erste Mal in seinem Leben eine Stadt.
Es heißt, der erste Eindruck einer Sache präge die Erfahrung vor. In einer gewissen Art und Weise war das hier ebenfalls so, Als Träumer die Stadt betrat, wirkte sie auf ihn, wie er sich die Stadt immer vorgestellt hatte: chaotisch und ungeordnet. Aber da war mehr. Dutzende von Menschen strömten durcheinander, Stimmengewirr war von überall zu hören. Träumer sah sich die Häuser an, die eng aneinander gebaut waren. Manche hatten zwei Stockwerke, andere waren windschief und wieder andere hatten keine Türen. Überall liefen kleine Kinder herum und spielten fangen oder alberten mit Stöcken herum. Hier und da lief ein streunender Hund herum, der allerdings mehr einem Wildtier als einem Haustier glich. Schon bevor sie in die Gasse einbogen, wo der Marktplatz war, hatte Träumer die wildesten und exotischsten Gerüche in der Nase. Sie rochen süß, salzig, scharf, blumig und nach Verwesendem Fleisch. Hier und da kam ihm ein bekannter Geruch unter die Nase, wie etwa Lavendel oder Zitronenmelisse, aber die meisten Gerüche konnte er nicht erraten. Hier und da standen Menschen unter Stoffdächern und priesen ihre Ware an, die von Kartoffeln bis zu exotischen Südfrüchten reichte. Schatten würdigte die Stände keines Blickes, doch Träumer verschlang alles und speicherte die Eindrücke als Erinnerungen. Alles war neu. Interessiert betrachtete er eine knollenförmige Frucht, als Schatten plötzlich neben ihm auftauchte und ihm laut ins Ohr sprach. „Du sollst nicht immer stehen bleiben! Ist ja kein Wunder, dass du mich dauernd verlierst.“ Träumer zuckte zusammen. Er senkte den Kopf schuldbewusst und folgte nun Schatten, dessen Weg vom Markt wegführte. Er führte Träumer durch mehrere Gassen und kam schließlich zu einer größeren Straße.
Hier war es ruhig, wenn man einen Winkel am Tag in einer Stadt so nennen konnte. Die Straße war von dunklen Häusern gesäumt, von Läden, in denen man alles Mögliche erwerben konnte: Mäntel, andere Kleidung, daneben Schwerter und Eisenwaren, dahinter Bögen, Armbrüste. Das Paradies für diejenigen, die sich ausrüsten wollten, um jemanden zu töten. Träumer fuhr unwillkürlich zurück. Es stieß ihn ab, eine Waffe zu kaufen, dass machte es offiziell, dass er jemanden töten wollte. Schatten schob ihn in den Laden für Mäntel und allerlei andere Kleidung. „Wir brauchen warme Mäntel“, sagte er. „Wir müssen durch das Gebirge, dafür sollten sie tauglich sein.“ Der Inhaber des Ladens, ein Mann, musterte Schatten eine Weile merkwürdig, dann schien er ihn nicht zu erkennen und nickte. „Sehr wohl“, sagte er und suchte zwei passende heraus. „Ich habe einige bereits fertige hier, für Kunden, die schnell weiter müssen. Vielleicht habt ihr Glück und sie passen euch.“ Der Mann holte einige Mäntel hervor und Schatten gebot Träumer, sie anzuziehen. Träumer widersprach nicht, er probierte einen nach dem anderen an und nach einiger Zeit hatte er einen passenden Mantel gefunden. Schatten nickte zustimmend, dann nahm er sich einen der Mäntel und er passte sofort perfekt. Der dunkle Mantel schmiegte sich ihm an, wie eine Katze sich an ein Bein schmiegte. „Wir nehmen sie“, sagte Schatten. „20 Gulden“, sagte der Mann. Schatten blickte auf und sein Blick schien den Verkäufer zu erdolchen, so scharf und kalt war er. „10 Gulden“, sagte er. Der Verkäufer erwiderte den Blick gelassen. „20 Gulden“, sagte er kühl. Scheinbar war er es gewohnt, bedroht zu werden. Schatten drehte Träumer den Rücken zu und ging auf den Verkäufer zu. Bevor der zur Waffe greifen konnte, knotete Schatten das Tuch los und nahm es in die Hand, sodass dem Verkäufer sein Gesicht offenbart wurde. Der Mann erbleichte, er schien Schattens Gesicht zu kennen. „Ihr... aber... Das ist nicht möglich.“ Schatten knotete das Tuch wieder fest. „Ich dachte, ihr seid tot!“, sagte der Mann entsetzt. „Wieso seit ihr hier? Wenn euch jemand entdeckt? Was wird passieren, wenn...“ Schatten hob die Hand und ließ den Mann verstummen. „10 Gulden“, wiederholte er. „Mehr werde ich nicht zahlen.“ Der Mann setzte ein grimmiges Gesicht auf. „Ich verliere damit an Umsatz, ich hoffe, dass ist euch bewusst.“ Schatten blickte ihn an und lachte leise. Er gab dem Mann die Zehn Gulden und verließ mit Träumer den Laden. Er betrat den Waffenladen und kaufte für Träumer einen Dolch. „Damit du dich wenigstens ansatzweise verteidigen kannst, du Möchtegernattentäter.“ Träumer steckte die Kritik wortlos ein, wie jedes Mal, wenn Schatten etwas Abfälliges über ihn sagte. Er nahm den Dolch dennoch nicht an sich, erst als Schatten ihn anfunkelte und sagte: „Jetzt nimm schon!“, konnte er sich ein Herz fassen und den Dolch mit Scheide an seinem Gürtel befestigen. Es fühlte sich ungewohnt und falsch an. Er war ein Dichter und Denker, kein Mörder. Er wollte nicht töten. Ein Dolch würde ihn dazu verleiten, es doch zu tun, dafür würde er sich ewig hassen. Doch er wollte sich Schatten nicht widersetzen. Er bemerkte, dass er schwach war. Er hatte einen zu schwachen Willen. Oder einen zu gesunden Menschenverstand. Es war nicht passend, sich zu widersetzen, wenn er dadurch gefährdet werden würde. Es war jetzt noch nicht die Zeit, ungehorsam zu sein. Er würde wissen, wann sie gekommen sein würde. Dieser Zeitpunkt war nur ganz sicher nicht jetzt. Die Zwei verließen den Laden wieder, Schatten bog in eine Seitenstraße ein. „Wir müssten alles soweit haben“, sagte er. „Jetzt suchen wir ein Gasthaus auf. Ich kenne eins, das den Erwartungen entsprechen dürfte. Komm mit.“ Es verwunderte Träumer, dass Schatten ihn jetzt immer darüber unterrichtete, was sie tun würden, doch er erwähnte es nicht. Schatten lief durch mehrere enge Gassen, in denen die halb zerstörten und teilweise verlassenen Häuser leise vor sich hin rotteten. Träumer sah zu einem Haus, in der die Tür zwar noch in den Angeln hing, aber nur noch zu einem viertel vorhanden war. Aus dem Hauseingang blickte ihn ein Kind misstrauisch mit großen Augen an. Die Haare waren verwuschelt, das Gesicht war voll mit Schmutz. Als es bemerkte, dass Träumer es ansah, lächelte es- und Träumer fühlte sich an das Mädchen erinnert, dass er in seinem Dorf so gemocht hatte. Zugegeben, das hier war ein Junge, doch es strahlte die gleiche kindliche Zuneigung aus. Er blickte, während er weiterging, immer wieder nach hinten, das Kind war aus dem Hauseingang getreten und sah ihm lange nach. Schatten bog in eine Gasse ein- und da war ein Gasthaus. „Zum trinkenden Dummkopf“ stand auf dem Schild, das in die Straße hineinragte. Träumer sah irritiert zu Schatten. „Ist es das?“, fragte er verwirrt. Schatten nickte. „Ja, geh rein. Das hier ist es tatsächlich.“ Träumer zog die schwere Holztür auf und ihm kam ein alkoholisch riechender Schwall Wasserdampf entgegen. Vorsichtig trat er ein und sah sich um. Hinter ihm trat Schatten ebenfalls ein. Vorsichtig machte Träumer ein paar Schritte in den Raum. Weiter hinten gab es einen Tresen und eine Bar, rechts von ihm glühten die Holzscheite in einem riesigen Kamin vor sich hin. Hier und da standen Tische, in keiner wirklichen Ordnung hingestellt, sondern einfach irgendwie zusammengewürfelt. Die Stühle schienen auch nicht richtig zu den Tischen zu passen. Eine Treppe hinter dem Tresen schien zu den Zimmern zu führen. Über dem Kamin hing ein Fuchskopf und schielte unglücklich aus dem einzigen Fenster des Gasthauses. Träumer blickte sich zu Schatten um, der allerdings schon zum Tresen gegangen war. „Hey!“, brüllte er. „Ist jemand zu Hause?“ Irgendeine Tür knarrte, Träumer drehte sich um. Da stand ein bulliger Mann am Tresen. Überrascht klappte Träumers Mund auf, aber er schloss ihn im nächsten Moment wieder. „Wer brüllt da?“, fragte der Mann schläfrig und auch ein wenig aggressiv. „Ich“, sagte Schatten mit tiefer Stimme. „Ich brülle. Du kennst mich doch noch?“ Der Mann runzelte die Stirn. Es schien, als dächte er nach. „Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen“, sagte er zweifelnd. Dann erhellte sich seine Miene. „Aber natürlich weiß ich, wer du bist!“ seine Miene verfinsterte sich. „Warum bist du wieder in der Stadt? Manche hielten dich schon längst für tot, du weißt ja, nach dem Vorfall hat dich niemand mehr zu Gesicht bekommen. Sie liegen beide in der Nähe nicht wahr? Frage mich immer noch, warum du danach hierher gekommen bist. Sie hat ein Kopfgeld auf dich angesetzt, nicht wahr? So eine Hexe. Aber man kann nichts machen, wo sie doch jetzt so mächtig ist... Aber was treibt dich her? Ich hoffe doch, dass du bei Nacht wieder verschwunden sein wirst.“ Der Mann ahnte nichts Gutes. „Wir- ich und mein Freund hier- werden diese Nacht bei dir übernachten“, sagte Schatten und schien damit zu bestätigen, was der bullige Mann befürchtete. „Du hast doch nicht etwa ein Problem damit, oder? Willst du wieder die Kopfgeldjäger auf mich ansetzen?“, Schatten lachte. Der bullige Mann lachte unruhig mit. „Ich habe diesmal meinen eigenen Kopfgeldjäger dabei. Ich weiß im Übrigen, dass du auch auf der Liste stehst. Du bist zwar nicht viel wert, aber es reicht, um damit ein maß trinken zu können.“ Schatten beugte sich vor, er schien zu grinsen, allerdings konnte man das wegen dem Tuch vor seinem Mund nicht erkennen. „Also, bekommen wir ein Zimmer?“ Der bullige Mann war erbleicht. „Sicher“, sagte er schnell. „nehmt diesen Schlüssel. Aber bei Morgengrauen müsst ihr verschwinden. Du ahnst gar nicht, was es für Probleme für mich werden, wenn sie erfahren, dass du hier gewesen bist.“ Schatten lachte dröhnend. „Dann ist es wohl besser, wenn du niemanden davon erzählst, nicht wahr?“, fragte er lauernd. Der bullige Mann schluckte, dann nickte er und reichte Schatten den Schlüssel. „Wir ziehen uns erstmal zurück“, sagte Schatten. „Sorg dafür, dass uns niemand stört!“ Schatten stieg die Stufen der Treppe hoch, Träumer folgte ihm. Dabei dachte er darüber nach, worüber Schatten und der Mann wohl geredet haben. Also wurde Schatten von einer Frau gesucht? War etwa verheiratet? Träumer blickte auf Schattens Rücken und schüttelte den Kopf. Wahrscheinlicher war, dass er den Mann einer Frau umgebracht hatte, die offensichtlich sehr mächtig war. Er kannte kaum mächtige Frauen. Im Grunde war es unmöglich, als Frau an die Macht zu gelangen. Es sei denn... Träumer erstarrte. War es etwa der König, den Schatten umgebracht hatte? War es die Königin, die ihn töten wollte? War er mit einem Königsmörder unterwegs- und wusste die ganze Zeit nichts davon? Das Zimmer, das die beiden bekommen hatten, entpuppte sich als ein angenehmes Nachtlager. Zwar waren die Betten nicht sonderlich bequem, aber alles war besser, als auf Wurzeln zu schlafen. Es gab auch ein Bad, also nutzte Träumer die Gelegenheit, um sich vom Schmutz der Reise zu säubern. Erst wusch er sich, dann seine Kleidung, schließlich nahm er die Ersatzkleidung, die er sich mitgenommen hatte und zog sie an. Die nasse Wäsche hängte er über das Waschbecken, damit sie trocknete. Als er wieder ins Zimmer ging, stand Schatten am Fenster und blickte gedankenverloren in die Sterne. Träumer setzte sich auf sein Bett und blickte zu Schatten. Nein, dieser Mann war kein Königsmörder, auch wenn er brutal und kalt war, so glaubte Träumer nicht, dass er einen Königsmord begehen könnte. Das war nicht ehrenhaft genug für ihn. Schatten hatte das Tuch losgemacht und ließ die Luft um seine freie Nase wehen. „Warum versteckst du dich eigentlich hinter diesem Tuch?“, fragte Träumer Schatten. Schatten blickte immer noch aus dem Fenster und fragte: „Weißt du das wirklich nicht?“ Träumer schüttelte den Kopf. „Nein.“ Schatten drehte sich um und blickte Träumer an. Er war ein außergewöhnlich gut aussehender Mann mit hellblauen Augen, schwarzen Haaren und glatten, ebenen Gesichtszügen. Unter dem linken Auge zog eine feine weiße Narbe in Richtung Ohr. „Ich bin der meist Gesuchteste Mann im ganzen Königreich“, sagte er.
9.
Der Morgen rückte immer näher und Träumer hatte noch kein einziges Mal die Augen geschlossen. Immer wieder kreisten seine Gedanken zu Schatten zurück. Sein Gespräch mit dem Besitzer des Gasthauses, seine Gespräch mit dem Verkäufer, die Aussage, dass er der Gesuchteste Mann war. Die Angst, dass er wirklich ein Königsmörder sein könnte- und damit extrem gefährlich. Träumer stand auf und ging zum Fenster. Hier hatte Schatten gestern gestanden und nach draußen gesehen. Man konnte von hier aus auf die andere Straßenseite schauen. Es war ruhig und immer noch dunkel. Nichts regte sich. Der Mond war schon lange wieder untergegangen, nicht einmal die Sterne konnte man noch sehen. Träumer blickte in den Horizont und fragte sich, was wohl dahinter liegen mochte. Was würde er sehen, wenn er hinter den Himmel schauen würde? Vielleicht war es einfach eine Wand, hinter der eine andere Welt steckte. Er lächelte. Er würde es gern einmal sehen. Vielleicht war dort alles anders. Vielleicht. Er blickte auf die Silhouetten der Häuser, die noch immer in tiefem Schlaf waren. Immerhin konnte er bei Gelegenheit darüber schreiben. Er blickte zu seinem Rucksack, den er neben seinem Bett hingestellt hatte. Er bemerkte, dass er schon lange Zeit nicht mehr etwas zu Papier gebracht hatte. Zu viel war geschehen, er war jedes Mal zu viel gelaufen und hatte zu wenig geschlafen. Doch jetzt konnte er es erneut wagen. Er ging zu seinem Rucksack und holte vorsichtig die Feder, die Tinte und ein Blatt Pergament hervor. Er setzte sich damit aufs Bett und dachte nach. Er überlegte lange, viel zu lange eigentlich, um etwas Gutes hervorbringen zu können. Die Gedanken sprudelten nicht aus ihm heraus, wie es normalerweise war. Sie blieben verborgen, als fürchteten sie sich vor etwas. Träumer versuchte, sie aus sich heraus zu locken, er dachte zurück an den Kampf mit den Spinnen, an die Sonne in seinem Gesicht, an das Land hinter dem Horizont. Nichts. Kein Wort näherte sich. Sie hockten zusammen gekauert in einer Ecke, hatten Angst vor dem, was sie erwarten könnte. „Du bist kein Dichter mehr“, flüsterten sie. „Du kannst jetzt töten.“ Träumer sah in die Ecke und er lächelte. Es war ein trauriges Lächeln. „Wieso könnt ihr sprechen?“, fragte er. „konnten wir schon immer, schon immer, aber es machte noch nie Sinn, zu sprechen, solange du nicht in Begriff warst, uns zu verlieren“, flüsterte ein kleines Wort, das gerade einmal drei Buchstaben ausmachte. Träumer spürte, wie seine Hoffnung, jemals ein berühmter Dichter zu werden, langsam von ihm wich wie die lebendige Farbe in einem sterbenden Körper. Ein Wort blickte zu ihm auf, wagte ein paar Schritte und setzte sich auf sein Blatt. Es war das Wort „Glück“. Träumer blinzelte verwundert, als seine Hand das Wort von allein aufschrieb und das Wort nun einzeln auf dem Pergament stand. Glück. Er schrieb:
So weit entfernt wie der Abendstern,
So selten wie Blüten im Schnee,
So hell wie warme Sonnenstrahlen,
So sprunghaft wie ein junges Reh.
Du bist für mich nicht zu erreichen.
Er ließ die Feder wieder sinken und blickte auf das, was er geschrieben hatte. Waren das wirklich seine Worte gewesen? Nach und nach waren sie angeschlichen gekommen und hatten sich mit leiser Furcht auf das Papier gesetzt. Sie hatten ihm tief in die Augen geblickt und dann war die Furcht gewichen. „Du bist noch der selbe“, flüsterte eines. „Du bist noch derselbe wie damals, als wir dich das erste Mal besuchten. Du bist noch derselbe.“ Ein weiteres Wort hatte geflüstert: „Aber du könntest jemand anders werden. Du könntest jemand anderes werden. Was wird aus uns, wenn du jemand anderes bist? Wenn du töten kannst? Wir könnten uns verlieren.“ Träumer wusste, was sie meinten. Er wusste es, so wie er wusste, dass es die Wahrheit war, was sie sagten. Sie würden ihn verlassen. Er lächelte sie traurig an. „Es wird kommen, wie es kommen muss. Wir werden uns wieder sehen, wenn es mir bestimmt ist, euch zu sehen. Doch ich denke, fürs erste werden wir uns verlieren.“ Eine Träne glitzerte in seinem Auge. Die Worte sahen ihn mit großen Augen an. „Du redest mit deinem Blatt Papier?“, fragte er. Träumer sah das Wort irritiert an- und wurde wach. Schatten hatte sich von seinem Bett erhoben und blickte Träumer an. „Du bist eingeschlafen und hast angefangen, zu murmeln“, sagte er besorgt. „Alles in Ordnung mit dir, du heimlicher Dichter?“ Träumer zuckte unwillkürlich zurück. Was hatte Schatten da gerade gesagt? Auch die Tonlage war ungewöhnlich und erregte sein Misstrauen. „Was... meinst du?“, fragte er deshalb. Schatten lachte. „Ich hätte wissen müssen, dass jemand, der so aussieht wie du, niemals ein Kopfgeldjäger sein kann. Du bist zu schwach, hast keine Waffen und du schreibst heimlich Gedichte, die nicht einmal schlecht sind. Ich selbst mag Gedichte. Wenn sie gut sind. Du scheinst einigermaßen Talent dazu zu haben. Das ist gut, allerdings dachte ich, dich für andere Dinge gebrauchen zu können. Mit dem Schwert kannst du also nicht umgehen, richtig?“ Träumer nickte verlegen. „Das habe ich mir gedacht“, sagte Schatten und band sich dann wieder das Tuch vor den Mund. „Nun, es wäre besser, wenn wie jetzt gehen. Pack deine Sachen zusammen, vor allem auch die, die du ins Bad gehängt hast, zumindest, wenn du sie behalten möchtest.“ Träumer nickte erneut. Immer noch widersprach er nicht. Er fragte sich, warum er das nicht tat. War es so, dass Schattens Autorität ihn einschüchterte? Das tat sie, ja, aber war das wirklich der Grund? War es wirklich das, was er als Achtung bezeichnen würde? Oder widersprach er einfach nicht, weil es nichts zu widersprechen gab? Das schien eher unwahrscheinlich. Also war es, weil er zu feige war, seine eigene Meinung zu vertreten? Träumer seufzte. Er würde sein ganzes Leben lang nicht entscheiden können, was er wollte, wenn das so weiterging. Er würde immer von irgendjemand gesagt bekommen, was er zu tun hatte. Aber in diesem Moment gab es nichts zu widersprechen. Schatten hatte schlicht und ergreifend recht, ein Umstand, den Träumer sich nur zu gerne eingestand, verschleierte er doch seine eigene Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Er war nicht in der Lage, vernünftig abzuwägen, was gut und was schlecht war. Träumer ging ins Bad und nahm seine Sachen. Sie waren glücklicherweise getrocknet, auch wenn Träumer sich nicht erklären konnte, wie das so schnell vonstatten gegangen war. Er steckte sie in seinen Rucksack, sie war wieder einigermaßen in Ordnung und der Geruch des Sumpfes war größtenteils verschwunden. Dann ging er zurück zu seinem Bett und schob seine Schreibutensilien ebenfalls in den Rucksack. „Ich bin soweit“, verkündete er schließlich. Schatten nickte zustimmend. „Gut. Wir müssen nämlich los, bevor dieser alte Knauser denkt, wir würden für sein Zimmer bezahlen!“ Schatten lachte leise. Träumer fand den Gedanken nicht sehr erheiternd, aber er schwieg anstatt es zu bemerken. Sie gingen die Treppe herunter. Schatten bewegte sich ohne ein einziges Geräusch zu verursachen und Träumer versuchte, es ihm gleichzutun. Allerdings gelang es ihm nicht richtig und ab und zu knarrten die Treppenstufen leise, aber bedrohlich. „Ihr wollt schon gehen?“, fragte da eine Stimme aus dem Schankraum. Träumer fuhr zusammen, aber Schatten schien etwas in dieser Art erwartet zu haben und war nur mäßig beeindruckt. „Ja“, sagte er. „So sieht es aus. Wir werden jetzt gehen.“ Ein Mann trat aus dem Dunkeln. Er war schwarz gekleidet, um in der Finsternis, die sich im unteren Teil ausgebreitet hatte, weniger aufzufallen. „Ich fürchte, dass ich das nicht zulassen kann. Auf deinen Kopf ist ein hübsches Sümmchen ausgesetzt.“ Dann erst bemerkte der Mann Träumer. „Wer ist das?“, fragte er verwirrt, aber dennoch mit einem merkwürdigen Unterton, als überlegte er, wie viel der Kumpane eines Schwerverbrechers wohl wert sein mochte. „Unerheblich“, sagte Schatten. „Unerheblich, wer er ist. Was bedeuten schon Namen? Du wirst ihn sowieso nicht auf deiner Liste finden, dort, wo er herkommt, gibt es so etwas wie eine Liste für Kopfgelder nicht einmal. Und außerdem ist es unerheblich, ob du uns gehen lassen willst oder nicht. Wir gehen dennoch. Tritt beiseite.“ Gelächter war zu hören. „oh nein, ihr seid das Geld für mein Abendessen. Ich werde endlich fürstlich speisen, so wie es einem wie mir gebührt!“ Träumer war sich nicht sicher, aber er glaubte zu sehen, wie Schatten die Augen verdrehte. Dann sprach Schatten: „Dummer Junge. Du hast dich sicherlich noch nie gefragt, warum so viel Kopfgeld auf mich angesetzt ist, nicht wahr?“ Der Mann stutzte kurz, dann antwortete er schlicht: „Jemand ist scharf darauf, euch in die Finger zu kriegen. Und scheinbar ist dieser jemand sehr reich.“ Schatten lachte. „Nach endlosen Versuchen, mich zu töten, hat man mein Kopfgeld erhöht und erhöht:“ Er zog sein Schwert und ging nach unten. „Bringen wir es hinter uns, wenn du jetzt sterben möchtest. Ich brauche … bei einem wie die... sagen wir: drei Sekunden.“ Schatten trat auf den Mann zu, den Träumer immer noch nicht richtig erkennen konnte. „Eins...“, sagte Schatten. Der Mann stürzte auf ihn zu, mir einem wütenden Zischen wollte er seine Waffe in Schattens Rippen stoßen. „zwei“, sagte Schatten. Er wehrte die Waffe ab, als wäre sie ein harmloses Stück Holz. „Drei.“ Er stieß sein eigenes Schwert durch den Brustkorb des Mannes. Träumer blickte entsetzt auf den Mann, der mit offenem Mund zusammen knickte. Er blickte auf das Blut und er erinnerte sich an den Kampf mit den Spinnen, nur dass hier ein Mensch gestorben war. Mit Leichtigkeit hatte Schatten dem Mann das Leben genommen. „Raus hier“, sagte Schatten, aber Träumer konnte sich nicht rühren. „Dieser... Mann... Er war ein Teil der Natur“, sagte Träumer geschockt. „Diese Spinnen... sie... sie ...“, er brachte kein weiteres Wort heraus, die Tränen schossen ihm in die Augen. Der Mann war tot! Es klebte Blut an Schattens Schwert und auch an seinen Händen. Schatten war ein Mörder. „Du bist... ein ...“, begann Träumer fassungslos. „Ich bin, wozu das Schicksal mich gemacht hat“, sagte Schatten. „Es ist nicht schön, das zu tun, um zu überleben, aber es gibt einen Grund, warum ich am Leben hänge. Nur werde ich ihn dir nicht erzählen.“ Schatten zog sein Tuch gerade. „Wir gehen. Jetzt. Ich will nicht, dass das hier noch einmal passiert.“ Träumer schüttelte den Kopf. Was war Schatten nur für ein Mensch? Egal, wie traurig seine Vergangenheit sein mochte, es war doch nicht richtig, einen Menschen zu töten. Er folgte dennoch dem Mann, dem er so viel Verwirrung entgegen brachte. Ein Wort lugte aus dem Rucksack und betrachtete Schatten. Ein leises Seufzen war zu hören, als das Wort auf das Blatt zurück glitt. Jedes Wort sandte ihm eine Vision von seiner Zukunft, wenn er weiter mit Schatten ging: Er selbst auf einem Schlachtfeld, mit einer blutigen Waffe in der Hand, unter ihm ein Berg von Leichen. Die Bilder ließen ihn würgen, aber er verdrängte den Brechreiz mit aller Macht. Er würde fürs erste mit Schatten gehen, weiter wusste er nicht. Er wusste nicht, was ihm das bringen würde, aber es interessierte sich erst einmal nicht. Solange er keine eigenen Ziele hatte, konnte er die Ziele Schattens verfolgen. Schatten brauchte ihn, das war jetzt von Entscheidung.
Sollte sich irgendwann ihr Weg trennen, dann war es auch gut. Er hatte sich entschieden, für den ungewissen Weg, aber weg vom gewissen Tod, der ihn als Soldat erwartet hätte. Thome hatte Recht gehabt, es war die einzige richtige Entscheidung gewesen. Dennoch schmerzte jeder Gedanke an die verlorene Heimat. Er wollte dort hin zurück, doch die Hoffnung, jemals wieder zurück zu kehren, schwand mit jedem Tag, den er weiter entfernt verbrachte. Jeden Tag gelangte er weiter weg von dort, wo alles begonnen hatte. Der Baum, der Schattens Zu Hause gewesen war. Ob er immer noch da stand, genauso wie sie ihn verlassen hatten?
Die Zwei verließen die Stadt. Immer noch war Träumer fasziniert von den Massen von Menschen, von den vielen Geräuschen und Gerüchen; doch das Ereignis dieses Morgens, der Tod eines ihm unbekannten Mannes verschleierte alles und ließ die Welt eine Spur dunkler scheinen, als sie es sonst tat. Träumer fragte sich zum ersten Mal in seinem Leben, ob Menschen nicht eigentlich von Grund auf böse waren. Das würde alles erklären. Den Neid, den Hass, den Krieg. Die sterbenden Leute, die hungernden Kinder, die Familien, die sich gegenseitig um die Ecke brachten wegen Besitz und Erbe.
Als sie aus dem Stadttor traten, war der Himmel genauso wie gestern von dunklen Wolken verdeckt. Eine düstere, triste Gegend, fiel es ihm plötzlich auf. Der Zauber war von der Stadt gewichen, er sah nicht mehr das große, geniale Chaos, er sah eine Ansammlung von verfallenen Hütten, die nicht zusammen passten, eine Notgemeinschaft aus unvollkommenen Menschen, die sich aus Angst zusammengeschlossen haben. Aus Angst davor, von anderen Menschen getötet, zerstückelt oder missbraucht zu werden. Dabei übersahen sie, dass sie sich mitten unter Menschen der Gefahr, von Menschen bedroht zu werden, nur noch mehr aussetzten. Er schüttelte den Kopf und dachte an sein eigenes Dorf. Jedes Haus hatte etwas eigenes, etwas, das einzigartig war, und dennoch bildeten sie eine Einheit, eine Einheit, die er für selbstverständlich gehalten hatte. Er dachte, es sei normal, dass diese Einheit vorhanden war, dieses innere Gefühl von Zusammenhalt. Er blickte zurück, als sie schon ein weites Stück den Weg entlanggegangen waren. Er blickte zurück auf die Silhouette der Stadt und er empfand keine freudige Erregung mehr, wenn er an die vielen verschiedenen Aspekte der Stadt dachte. Es war dort tagsüber immer laut gewesen. Man war etwas anderes gewohnt, wenn man vom Land kam, das sagte sich Träumer immer und immer wieder, aber dennoch konnte er sich nicht mehr für diese Stadt begeistern. Sie weckte nur noch seine Verachtung, seinen Ekel und sein Mitleid. Wie konnte man an so einem Ort leben? Die Nächte in den Städten waren ruhiger als auf dem Land. Es war unheimlicher, düsterer, dunkler, aber auch mysteriöser. Er erinnerte sich an den Blick aus dem Fenster, an die Dunkelheit. Er erinnerte sich an die Angst der Wörter und ihm fiel ein, dass sie nie zuvor in einer Stadt gewesen waren, ebenso wenig wie er. Vielleicht war es mehr, das ihnen Angst gemacht hatte, als seine bloße „Veränderung“. Vielleicht war es die Stadt selbst gewesen, voll mit ihren zwielichtigen Gestalten, wie der tote Mann oder der Gasthausbesitzer. Er folgte wieder Schatten. Fragte sich, wie lange das wohl so gehen würde. Wie lange würde er mit Schatten gehen? Was würde er wohl noch alles sehen? Träumer hatte das Gefühl, dass er noch eine Menge sehen würde, bevor er das Recht hatte, sich zurück zu ziehen. Nach Hause zurück zukehren, in eine Ordnung, die ihm jetzt, da er das schiere Gegenteil kannte, vollkommen erschien. Warum war ihm das früher niemals aufgefallen?
Schattens Schritte wirbelten Staub auf. „Wieso erzählst du nie etwas über dich?“, fragte Träumer den Mann vor sich. Schatten lachte leise, dann fragte er: „Warum denn? Aber was möchtest du denn wissen?“ Träumer überlegte kurz. „Hast du den König umgebracht?“, fragte er dann, die Angst musste endlich ausgesprochen sein. Schatten schwieg, Träumer wusste nicht, ob das aus Überlegung, Überraschung oder sonstigem entstand. Nach einiger Zeit antwortete Schatten und beendete die quälende Frage, indem er ihr eine Antwort verpasste. „Nein. Wie kommst du denn darauf?“ Träumer wurde rot. „Nun... äh... ich... Ich … Ich habe nur gedacht, weil du doch so gesucht bist … und der einzige, der so viel Geld zu Verfügung hat...“ Schatten lachte schallend. „Das ist aber eine reichlich naive Vorstellung. Allerdings ist sie nicht so weit von der ursprünglichen Geschichte entfernt.“ Träumer wurde neugierig. „Wie ist die Geschichte?“, fragte er nach, doch Schatten winkte ab. „Nicht jetzt, nicht heute. Vielleicht werde ich es dir erzählen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Noch etwas anderes?“ Träumer musste nicht lang überlegen. „wie alt bist du eigentlich?“ Schatten drehte sich kurz zu Träumer um. „Was schätzt du?“, fragte er lachend. „ich weiß nicht“, gab Träumer zu bedenken. „Ich weiß es wirklich nicht.“ Schatten grunzte. „Ich bin bald 32 Jahre alt“, sagte er. Träumer blickte erstaunt. „Wow“, sagte er. „Ich hätte dich für etwas jünger geschätzt. Nach deinem Aussehen... Du siehst so gut aus!“ Schatten lachte. „Ich sehe nicht besonders anders aus, als andere Männer auch. Ich habe eine Nase, ich habe Augen, ich habe Haare. Ich habe ein Gehirn und kann denken. Ich bin ein Mensch, wie jeder andere auch. Gutes Aussehen wird sehr oft überbewertet. Schließlich war es doch mein Aussehen, das mir zum Verhängnis wurde. Hätte diese Hexe mir nur das genommen und nicht alles andere stattdessen. Diese widerliche Schlampe.“ er spie das Wort aus und seine Verachtung war offenkundig. Träumer fragte nicht, wer diese Frau war, aber er wollte. Er wollte so sehr wissen, wer diese Frau war, was sie getan hatte und warum Schatten den Weg eines Mörders eingeschlagen hatte, wenn er doch so ein schönes Gesicht hatte. Er hätte glücklich sein können, eine Familie haben. Wie war es dazu gekommen, dass er keine hatte?
„Wo bist du geboren?“, fragte Träumer stattdessen. Vielleicht bekam er Schatten zum Reden, dann würde er schon noch zu dem Punkt kommen, der für Träumer bis jetzt ein heller, leerer Fleck war. Schatten blickte in den Himmel. „Ich bin in einem kleinen Dorf sehr weit weg von hier geboren. Dort war mein Aussehen übrigens nichts außergewöhnliches, es war normal, so auszusehen, wie ich es tat: dunkelhaarig und groß, die meisten waren sogar muskulös. Meine Mutter war eine kleine Frau, mein Vater dagegen ein Riese, er überragte sie um etwa drei Kopfhöhen. Meinen Namen habe ich von meinem Großvater bekommen. Er nannte mich Drorn, nach einem Vogel, den er einst gefangen hatte. Dieser Vogel hatte die Stäbe des Käfigs mit dem Schnabel geknackt und sich so den Weg in die Freiheit gebahnt- von allein. Er hoffte, dass ich so selbstständiger werden könnte. Ich wuchs auf, ohne jegliche Angst. Meine glücklichsten Jahre habe ich im Kinderdasein gehabt, ich lernte von meinem Großvater das Fischen und das Netze knüpfen, ich konnte ein Floß bauen, ich konnte Holz fällen, von meiner Mutter lernte ich kochen, für den Fall, dass ich mich einmal selbst ernähren musste. Ich lernte lesen und schreiben und besonders gut gefielen mir Gedichte von Dichtern, die gut Gefühle ausdrücken konnten und deren Reime sauber und nicht unrein waren. Ich war eines der Begabtesten Kinder. Dann wurde unser Dorf von Barbaren aus dem hohen Norden angegriffen. Alle starben, ich überlebte nur durch Zufall, weil unser Haus zusammen brach und mich unter sich begrub. Ich konnte kaum atmen und mich noch weniger bewegen, aber als die Barbaren weiter gezogen waren, hatte ich frei kommen können. Ich bin zurück ins Dorf gelaufen und habe alle dort gefunden. Tot. Wie durch einen Blitzeinschlag wusste ich nun, dass ich allein war. Vollkommen allein. Ich war so allein wie ein Bärenjunges, das von Menschen aufgezogen und dann freigelassen worden war und etwa genauso hilflos. Einige Zeit irrte ich einfach umher, aß nicht, trank nicht. Ich denke, ich wäre gestorben, wenn nicht etwas geschehen wäre, das mein Leben verändert hatte.“, Schatten machte eine Pause.
Träumer hatte den Worten gelauscht und jedes aufgenommen als wäre es ein Wassertropfen und er kurz vor dem Ertrinken. Er musste zuhören. Jetzt hatte die Neugier gesiegt. „was dann?“, fragte er. Schatten machte eine lange Pause. Er spannte Träumers Neugier bis zum Zerreißen. Schließlich fuhr er fort, während sein Gesicht von einer seltsamen Traurigkeit ergriffen worden war. „Ich war also auf mich allein gestellt: ich konnte alles, mich ernähren, eine Unterkunft bauen, alles. Alles, was ich benötigte. Aber ich wandte es nicht an. Es war so, als wäre ich gefangen unter einer Glaskuppel, in der sich nichts befand- außer mir. Und außerhalb der Kuppel war alles andere. Ich selbst war allerdings zu hoffnungslos, als dass ich versucht hätte, die Kuppel zu zerstören und den Weg ins Freie zu suchen. Doch es gab jemanden, der mir ein Loch hinein schlug.“ Träumer horchte auf. War hier eine Frau im Spiel? Ein Mentor? Etwas in der Art. Doch als Schatten fort fuhr, war Träumer überrascht. „Im Grunde war es nichts Großes. Ich tappte in eine Bärenfalle.“ Träumer sah ihn verblüfft an. Das war alles? Er war in eine BÄRENfalle getappt? Eine Falle, wodurch man letzten Endes an einem Seil hängt? Träumer schüttelte den Kopf. Er hatte etwas anderes erwartet, etwas... Tragischeres. Doch er schalt sich einen Tor und hörte dennoch weiter zu. Wieso sollten auch alle Geschichten tragisch sein, bis sie in Übertreibung enden? Und schließlich hatte sich Schatten am Ende nicht umgebracht, also konnte die Geschichte gar nicht zu tragisch werden. „ Ich hing in dieser Falle und beobachtete den Wald, den ich bis jetzt nur richtig herum gesehen hatte, in einem völlig anderen Licht. Ich sah etwas anderes, als ich bisher gesehen habe. Und mir fiel etwas auf, etwas, dass ich vorher gesehen habe. Nämlich, wie schön die Welt eigentlich war. Ich weinte nicht. Nicht eine Träne. Ich weinte nicht, als mir auffiel, dass meine Eltern, das ganze Dorf nie mehr in die Position kommen würden, etwas Derartiges zu sehen. Nie wieder. Sie waren fort, für immer. In diesem Moment begriff ich, dass die Welt, trotz der schönen Natur, trotz der Freude und dem Glück eigentlich ein böser Ort ist. Ein Ort der Trauer. Und wenn jemand sterben muss, ist das nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Es ist normal, das war das Traurige. Niemals vorher habe ich Menschen andere Menschen töten gesehen. Tiere, ja, weil man die Tiere aß und weil es wichtig war, genug Fleisch zu essen, um Muskeln aufzubauen. Menschen niemals. Ich begriff, dass ich selbst auch in dieser Welt gefangen war und dass es mir möglich war, auch zu töten. Die zu töten, die mir das angetan hatten, die mir diese Einsamkeit angetan hatten. Ich weiß nicht, wie lange ich herum gehangen habe, aber es schien mir eine sehr lange Zeit, eine zeit, in der ich viel nachdenken konnte. Und ich ließ die Zeit nicht sinnlos verstreichen, ich dachte so viel wie noch nie in meinem Leben. Bisher war es ja auch noch nicht notwendig gewesen, sich über viele Dinge Gedanken zu machen. Ein glücklicher Mensch denkt weniger nach als jemand, der sich in ständiger Gefahr befindet.“ Schatten ließ den Satz eine Weile im Raumstehen, Träumer fragte sich, ob er etwas dazu erwidern sollte, o er dieser Behauptung zustimmen oder ihr widersprechen sollte; eigentlich war er ja anderer Meinung. „Es konnten Stunden gewesen sein, die ich da hing, vielleicht auch nur Minuten, langsam begann mein Kopf zu dröhnen und mein Bein begann schmerzhaft zu pochen. Aber ich hing nicht lange dort, weil ein Mann mich fand. Er blickte mich ärgerlich an, fragte mich unwirsch, was ich im Wald verloren hätte. Ich sagte zu ihm nicht ein Wort. Er machte mich los und sagte, ich sollte mich zum Teufel scheren. Ich war schon so gut wie dort, aber das wusste der Mann natürlich nicht und ich hatte auch nicht vor, ihn aufzuklären. Die nächsten Jahre wanderte ich einfach herum. Fing Fische, wenn ich hungrig war, arbeitete für einige Zeit bei verschiedenen Bauern, die mir im Gegenzug dazu Essen und ein Dach über dem Kopf boten. Mein Leben bekam wieder einen regelmäßigen Ablauf, ich war immer unterwegs und dank der weiten Märsche, die ich zurück legte, wurde ich bald muskulöser, vor allem konnte ich mit der Zeit immer schneller und weiter gehen. Ich wanderte herum, bis ich in dieses Königreich kam. Da war ich etwa 17 Jahre alt.“ Träumer überlegte. So alt war er vor zwei Jahren gewesen. Damals hatte er noch wohl behütet bei Thome gelebt, hatte bei den Arbeiten in der Schmiede ausgeholfen und an nichts Böses gedacht. Damals war er noch klein gewesen, zumindest zu klein, um allein zu leben. Schatten hingegen war da schon auf sich allein gestellt gewesen und das eine ganze Weile. Er hatte den Ernst des Lebens so früh kennen gelernt. Träumer blickte ihn an. Die Geschichte schien doch noch dramatisch zu werden. Vielleicht sollte er ein Gedicht darüber verfassen. Aber vielleicht würde Schatten das auch überhaupt nicht gefallen. Schatten fuhr fort. „Mit 18 bin ich dann an einem Dorf angekommen, das mir wirklich gefallen hat. Es war dort ruhig, die Landschaft atemberaubend und die Atmosphäre erinnerte mich an die Heimat, die ich so früh verloren hatte. Ich blieb einige Zeit dort, ich kam in Bekanntschaft mit einem Schriftsteller und seiner Frau, die zwei boten mir an, für einige Zeit bei ihnen zu wohnen. Ich mochte die beiden sehr gern. Sie erinnerten mich, wie das Dorf auch, an meine eigene Heimat, an den Ort, in dem ich geboren worden bin. Es ist nicht wichtig, dass dies weder meine Heimat war, noch die Zwei meine Eltern. In mir wusste ich, dass das nicht zählte. Ich konnte bei den Menschen im Dorf arbeiten, sie hatten mich gern und vor allem die Mädchen waren ganz versessen darauf, mit mir befreundet zu sein oder mit mir zu reden. Wenn ich allerdings einmal mehreren gleichzeitig über den Weg lief und grüßte, wurde ich immer mit einem Kichern gegrüßt, dass ich nicht recht einordnen konnte. Manchmal beobachtete ich die Frau des Dichters dabei, wie sie zum Brunnen ging und Wasser schöpfte. Es war eine wunderschöne Frau, die schönste, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ihr Mann war der glücklichste Mann im ganzen Dorf. So jedenfalls schien es mir. Nach einigen Monaten, die ich dort war, bemerkte ich, dass die Frau schwanger war. Man sah es erst überhaupt nicht, weil sie gerne diese weiten Kleider trug, die ihr ausgezeichnet standen, aber dann immer deutlicher. Der Dichter, der Vater des Kindes, platzte innerlich fast vor Stolz. Bis etwas geschah, womit niemand rechnen konnte.“ Träumer hatte der idyllischen Beschreibung und der Schwärmerei über eine Frau, die er nicht kannte, einfach zugehört, doch bei dem letzten Satz horchte er auf. Unglücklicherweise hatte Schatten seinen Bericht abgebrochen und es schien, als würde er ihn nicht weiter fortsetzen. „Und dann?“, fragte Träumer. Schatten gebot ihm, zu schweigen. „Wir werden verfolgt, aber tu so, als wäre nichts. Ich werde dir die Geschichte ein andermal weitererzählen.“ Träumer sah sich erschreckt um, aber er konnte nichts erkennen. „Wieso werden wir verfolgt?“, fragte er. „Was ist dein Geheimnis? Warum wirst du überhaupt so gesucht? Warum erzählst du mir nichts von dir?“ Schatten fuhr herum. „Warum ich nichts von mir erzähle?“, fragte er erheitert. „Was soll das, ist das ein Kreuzverhör? Wieso erzähle ich nichts von mir? Hast du jemals etwas über dich erzählt? Nein. Also hör auf, Bedingungen zu stellen. Vielleicht erzähle ich alles zu Ende, damit du weißt, wer ich bin und warum ich so handele, wie ich handele. Vielleicht wirst du es nie erfahren.“ Träumer blickte Schatten an. „Mein Leben ist nie so aufregend gewesen, wie deines es war“, sagte er. „Meine Mutter ist bei meiner Geburt gestorben, mein Vater hat sich daraufhin das Leben genommen. So zumindest hat es mir Thome, mein Ziehvater erzählt. Ich lebte bei ihm und half ihm in seiner Schmiede. Aber jetzt plant die Königin einen Krieg und Thome hat mich gedrängt, zu fliehen und zu überleben. Ich bin widerwillig losgegangen, dann bin ich auf dich getroffen und du hast mich für einen Kopfgeldjäger gehalten. Den Rest kennst du genauso gut, wie ich ihn kenne.“ Schatten lachte und schüttelte dann den Kopf. „Nicht ganz. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum du die ganze Zeit behauptest, dass du ein Dichter seiest.“ Träumers Augen verengten sich zu Schlitzen. „Weil ich ein Dichter bin. Oder sein werde, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich werde einmal berühmte Werke schreiben. Die Worte...“, er brach ab. Was hatte er vor zu sagen? Das konnte er nicht, wenn er nicht wollte, dass Schatten ihn für verrückt erklärte. „Die Worte?“, fragte Schatten mit einer ungewöhnlich interessierten Stimme. „Die Worte? Du kannst sie sehen? Ich meine... du kannst sie sehen, bevor sie auf deinem Pergament sind?“ Träumer war irritiert. Woher kannte Schatten diese Wörter? Warum stellte er eine solche Frage? Es ergab überhaupt keinen Sinn. Dennoch war er gewillt, eine Antwort zu geben, eine Antwort auf die Frage, die er vermeiden wollte. „Ja“, sagte er. „Ich sehe sie überall. Auf den Bäumen sitzen, in Häuserecken, unter dem Bett- das heißt, wenn ich dort einmal nachsehen würde. Ich sehe sie auf Schritt und Tritt, wenn es etwas gibt, das sich zu notieren lohnt, dann sind sie da. Ich liege oft in der Sonne und schaue den Worten zu, die an den Wolken hängen. Das sind die schönsten, so frei und fern...“ Schatten starrte Träumer an.“ Kannst du... sie lesen?“, fragte er leise. „Ja“, erwiderte Träumer verwirrt. „Warum fragst du das? Ich konnte sie schon immer lesen, sogar bevor ich überhaupt lesen konnte.“ Das war zwar etwas schwer zu verstehen, auf der logischen Basis schon gar nicht, aber es war die Wahrheit. „Ich sehe sie auch“, sagte Schatten leise. „Ich sehe sie überall. Ich kann sie nur nicht lesen. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Ich kann zwar lesen, aber diese Wörter nicht.“ Träumer blickte Schatten verwundert an. „Du kannst sie nicht lesen?“, fragte er verwundert. „Warum kannst du sie überhaupt sehen? Kannst du sie denn sprechen hören?“ Schatten blickte Träumer verwirrt an. „Sie können sprechen? Sie können wirklich sprechen?“ Träumer nickte. „Du wirst bestimmt ein Schriftsteller, ein Dichter. Jemand, der die Wörter sehen kann, der ist dazu berufen, ein Schriftsteller zu werden. Du schaffst das. Davon bin ich überzeugt.“ Träumer wirkte überrascht. Aber kam nicht dazu, etwas zu sagen, denn hinter ihnen plötzlich waren sie umzingelt. „Wie...?“, entfuhr es Träumer überrascht. Schatten lächelte, zumindest vermutete Träumer es aufgrund Schattens Augenbrauen und den kleinen Fältchen, die sich an seinen Augen bildeten. „Habe ich es dir nicht gesagt?“, fragte er und deutete auf einen der Männer. Es waren sieben, alle nicht besonders groß, aber in dunkle Gewänder gewickelt. Träumer erinnerte es an den Mann im Gasthaus und er wurde gleichzeitig ruhig und nervös. Ruhig, weil er wusste, dass Schatten sie aus dieser Situation herausholen konnte. Nervös. Weil er wieder tote Menschen sehen würde. Schatten zog seine Waffe und Träumer griff ebenfalls zu seinem Dolch, aber weniger, weil er jemanden damit töten wollte, sondern vielmehr, damit er nicht als harmlos eingestuft werden würde und somit die Chance hatte, diesen Überfall ebenfalls zu überleben. Denn sollten sie merken, dass er nicht kämpfen kann, dann wäre es um ihn geschehen, sein Schicksal besiegelt, sein Sargdeckel schon fast zugenagelt.... Er schüttelte den Kopf und versuchte, nicht immer an die verschiedenen Weisen zu denken, wie man einen Menschen aufspießen konnte. Auch wenn er sie sich vermutlich schlimmer vorstellte, als sie eigentlich wirklich waren, so wollte er auf keinen Fall ausprobieren, wie es sich wohl anfühlen mochte. „Du bist doch der, auf den ein so hohes Kopfgeld ausgesetzt worden ist“, sagte einer der Männer und trat vor. Träumer starrte ihn entsetzt an. „Was?“, fragte er. „Nein. Bin ich nicht! Äh... ich meine, klar, bin ich. Oder... nein. Eigentlich nicht.“ Der Mann sah Träumer an. „jetzt drück dich endlich klar aus! Was soll das denn überhaupt bedeuten: Ja, aber irgendwie auch nicht?!“ Träumer zuckte zusammen, Schatten stellte sich zwischen Träumer und den Mann. „Du suchst mich. Was wollt ihr?“ Der Mann machte eine schnelle Handbewegung – und zog sich die Maske vom Kopf. Er strahlte. „ich wollte mich bei dir bedanken“, sagte er. Träumer sah hoch und starrte den Mann an. „Danken?“, fragte Schatten und verzog das Gesicht. „Warum das denn?“ Der Mann blickte beschämt zu Boden. „Es geht um Jacksat“, sagte er leise. „Wen?“, fragte Schatten irritiert. „Der Mann, den ihr getötet habt“, erklärte der Mann.„Wir sind Räuber, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist, nicht sonderlich viel, aber genug, dass man uns jagt. Jacksat hat von uns erfahren und war auf dem Weg hierher, das wissen wir von unseren Informanten, bis jemand ihm erzählte, dass ihr euch in der Gegend aufhalten sollt. Ich weiß nicht genau, wer das war, aber Jacksat reiste sofort los, um euch zu finden. Und er hat euch gefunden, das aber nicht überlebt. Ihr müsst unglaublich stark sein. Wir wären diesem Kopfgeldjäger sofort zum Opfer gefallen, deshalb möchte ich- das heißt, wir- dir danken. Und deinem Freund natürlich auch. Du hast uns das Leben gerettet.“ Die Situation wurde immer merkwürdiger. Träumer blickte von einem Mann zum anderen und nach und nach nahmen die Männer ihre Masken ab. „Wie können wir dir danken? Sagt es uns bitte, Drorn.“ Schatten zuckte beim Klang des Namens zusammen. „Woher wisst ihr...“, fragte er verblüfft. Dann verstand er. „Der Steckbrief, nicht wahr? Ihr habt die Liste gestohlen. Der Informant war auch aus euren Reihen. Ihr habt ihn auf meine Fährte angesetzt. Ich wusste doch, dass uns jemand beobachtet hat, als wir in die Stadt gekommen sind. Welche Wache war euer Spitzel? Ich vermute, es war die rechte.“ Der Mann wurde immer blasser um die Nase, je mehr Schatten sagte und je verachtender seine Stimme wurde. „Bitte“, flüsterte er. „Tut uns nichts. Wir hatten gehört, dass ihr ein fabelhafter Kämpfer seid und die Tatsache, dass euer Kopfgeld astronomisch hoch ist, sprach ebenfalls dafür. Ihr seid doch stark, ihr habt überlebt! Das allein zählt.“ Schatten hob die Augenbrauen. „Ich denke nicht, dass es etwas geben kann, womit ihr eure Tat entgelten könnt“, sagte er böse. „Wieso sollte ich euch jetzt nicht umbringen, das würde mir eine ganze Menge ersparen.“
Der Mann erbleichte. Ihr würdet doch nicht“, sagte er und er blickte entsetzt zu Träumer, wohl um zu sehen, ob Schatten das ernst meinte, oder eben nicht. Doch Träumer war ebenso ratlos, er wusste nicht, was gerade geschah. „Wir könnten uns doch irgendwie einigen?“, fragte der Mann. „Und was wäre euer Vorschlag? Es müsste etwas, sein, dass ich euren toten Körpern nicht auch noch hinterher entreißen könnte, also kommt mir nicht mit Geld oder anderen Wertgegenständen. Wenn ich das will, dann könnte ich mir das auch nehmen.“ Der Mann dachte angestrengt nach. Immerhin ging es hier um sein Leben. „Wir könnten euch führen“, bot er schließlich an. „Meine Männer sind die besten, wenn es darum geht, Wege zu finden. Wir kennen uns hier aus wie in unserer Manteltasche. Wir können euch dahin führen, wohin ihr nur wollt. Was haltet ihr davon?“ Schatten dachte einen Moment nach. „Ich erachte diesen Vorschlag für unbedenklich“, sagte er und nickte. Der Mann atmete erleichtert auf. „Das heißt, wenn ich mir die Person selbst aussuchen darf. Sie muss uns natürlich den ganzen Weg bis zu unserem Ziel führen, das gehört dazu.“ Der Mann nickte ernst. „Ich verstehe“, sagte er. „Wählt.“ Schatten ging an jedem Mann vorbei und blickte ihm in die Augen. Seine Blickte waren scharf, bedrohlich und mit jedem Schritt wurden die Männer unruhiger, niemand wollte derjenige sein, der diesem Plan geopfert wurde. „Ich nehme keinen von ihnen“; sagte Schatten schließlich. Der Mann blickte ihn überrascht und erleichtert an. Doch dann schlich sich Misstrauen in sein Gesicht. „Was wähl t ihr dann?“, fragte er. „Ich bin mir sicher, dass das nicht eure einzigen Männer sind. Ihr habt irgendwo ein Versteck und dort sind mehr. Eine Räuberbande hat doch nicht nur sieben Mitglieder. Ich werde einen von denen wählen. Hier erscheint mir keiner geeignet zu sein.“ Der Mann wollte widersprechen, doch ein blick von Schatten genügte, dass er es sich anders überlegte. „Wie ihr wollt“, sagte er leise und verneigte sich. „Folgt mir.“ Er drehte sich um und bedeutete seinen Männern, ihm zu folgen. Schatten und Träumer gingen immer noch in der Mitte des Kreises, so als wären die Räuber eine Eskorte, die den Befehl hatte, ihn zu schützen. Sie gingen eine Weile den Weg entlang, doch dann schlug der Mann eine andere Richtung ein, über eine Wiese, die weiter hinten in einen Wald mündete. Träumer nickte grinsend. Eine Räuberhöhle im Wald, das passte. In den Geschichten und Gedichten, die er gelesen hatte, waren die Räuberhöhlen ebenfalls immer in Wäldern gewesen. Ein witziger Zufall. Schatten bemerkte Träumers Erheiterung, sagte jedoch nichts dazu. Er folgte dem Mann mit wachsender Aufmerksamkeit. „Präge dir den Weg ein“, flüsterte er zu Träumer. „Es wäre möglich, dass sie ihren teil nicht einhalten wollen und uns deswegen töten müssen. In dem Fall müssen wir schließlich allein wieder aus dem Wald herausfinden. Er liegt nämlich nicht auf unserem eigentlichen Weg. Wir sind etwas davon abgekommen, aber ich musste herausfinden, wer diese Männer sind und was sie mit uns vorhaben. Vielleicht hätten sie uns getötet, während unsere Aufmerksamkeit einem anderen gewidmet wäre. Deswegen müssen wir einen finden, der nicht so scheint, als würde er uns töten. Am besten einen wie du.“ Schatten grinste, so zumindest Träumers Vermutung.
Er nickte. Schatten ging vor ihm, er folgte. Allmählich gelang es ihm, den Rhythmus zu finden. Die Bäume in diesem Wald hatten schon fast alle ihre Blätter verloren, Träumer vermutete, dass dies ein anderer Fluch war und er überlegte, was wohl geschehen sein mochte, dass dem Wald dieses Schicksal zuteil wurde. Sie gingen über den Laubboden und Träumer wusste nicht, wie lange sie schon gegangen waren. Als er sich umdrehte, konnte er die Wiese schon nicht mehr sehen. Sie waren mitten im Wald. Träumer fiel auf, dass er vergessen hatte, welchen Weg sie gegangen waren, er wusste nicht mehr, ob die einmal abgebogen wäre oder nicht. Er wusste gar nichts mehr. Sein Kopf war leer, nur einzig seinen Namen und den von Schatten waren dort noch verankert. Irgendwo, ganz weit hinten an seinem Kopf befestigt, war Thomes Name. Träumer fragte sich, warum er ausgerechnet jetzt an ihn denken musste. Sie gingen vorwärts. Die Vögel sangen Lieder, davon denen er sich nicht erinnern konnte, sie jemals gehört zu haben. Es war, als wäre dieser Wald etwas Besonderes, als gäbe es hier Vögel, die es sonst nirgendwo auf der Welt gab, als gäbe es hier Bäume, die entgegen jedem Prinzips wuchsen, die einfach existierten, ohne Blätter zu tragen. Außer den Vögeln gab es keine Tiere im Wald, zumindest keine, die man sehen konnte. Ab und zu hörte er einige Geräusche, aber sie waren nicht die von normalen Tieren. Es gab etwas anderes in diesem Wald. Er wusste nur nicht, was es war. Der Mann drehte sich urplötzlich um. „Wir müssen euch die Augen verbinden“, sagte er. Schatten knurrte böse. „Ihr müsst was?“, fragte er und blickte wütend zu dem Mann herüber. „Ihr müsst, so sind die regeln“, erklärte der Mann. „Wenn ihr nicht zur Bande gehört- und das tut ihr nicht- dann muss ich euch die Augen verbinden. So ist das nun einmal.“ Schatten blickte zu Träumer, der daraufhin mit den Schultern zuckte. Er wusste selbst nicht, was er davon halten sollte. Es war nicht das, was er erwartet hatte. Er wusste zwar, dass es die Räuber in den Büchern, die er gelesen hatte, ähnlich gehandhabt hatten, aber dieses Mal war er mit Schatten unterwegs. Er hatte gedacht, dass sie sich so etwas nicht trauen würden. Dennoch taten sie es. Träumer wusste nicht, was zu tun war. Er nickte und ergab sich in ihr Schicksal. Schatten blickte wieder zum Mann. „Einverstanden“, sagte er. Der Mann blickte zwei seiner Kumpane an, diese verließen ihre Position und holten aus ihren Hosentaschen zwei Bänder. Ein Mann stellte sich hinter Träumer, kurz darauf fühlte er groben Stoff in seinem Gesicht und das Augenlicht wurde ihm genommen. Es war dunkel. Ein Mann sagte: „ Halt dich an meiner Hand fest“, dann ging es weiter. Träumer stolperte ein paar Mal und er hörte Schatten auch einige Male fluchen, doch ansonsten verlief der weg ruhig. Es mochten einige Stunden gewesen sein, die sie so durch den Wald gelaufen waren, nach einiger Zeit hielt der Mann vor Träumer an, sodass er unweigerlich in ihn hinein lief. Die Binden wurden von seinen Augen genommen, er konnte wieder sehen. Und hielt den Atem an, als er bemerkte, wo er war. Es war ein Dorf. Ein Dorf mitten im Wald, es waren nicht nur einige Männer mehr, wie Schatten vorhin suggestiert hatte, nein, es waren dutzende mehr. Und nicht nur Männer; auch Frauen, die geschäftig hin und herliefen und hier und da Wäsche aushingen, Ziegen fütterten oder mit Kindern spielten. „Willkommen“, sagte der Mann etwas verlegen. „Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum wir euch nicht den Weg mit offenen Augen gehen lassen haben. Es wäre zu gefährlich für unsere Frauen und Kinder gewesen.“ Schatten nickte, doch Träumer glaubte ihm nicht, dass er es verstanden hatte. Er las in Schattens Augen, dass Schatten den Weg trotzdem einwandfrei wiedergeben konnte, die Augenbinde war für ihn kein Hindernis gewesen, den Weg auswendig zu lernen.
Träumer sah sich überrascht um. Die Harmonie, die ihm in der Stadt so sehr gefehlt hatte, fand er hier wieder. Er blickte zu ein paar kleinen Kindern, die lachend und spielen umher liefen. Hier war alles so friedlich. Er konnte verstehen, dass die Männer sie davon abhalten wollten, diesen Ort zu verraten. Es würde nicht nur die Heimat der Kinder zerstören, sondern auch diese Harmonie, diese Stille, dieser Frieden, den er nirgendwo anders so stark gespürt hatte wie in diesem Moment. Schatten sah sich um. „schön hier“, sagte er leise. Träumer nickte. Der Mann sagte: „Ihr könnt gern einige Zeit hier bleiben.“ Schatten schüttelte den Kopf. „Wir wollen nur Jemanden, der sich auskennt. Dann werden wir wieder gehen.“ Der Mann nickte verständnisvoll. „In Ordnung. Ich bin übrigens Kyle. Ich werde jetzt erst mal die Leute zusammenrufen und sie darüber aufklären, Ihr dürft dann von allen jemanden aussuchen.“ er blickte sich zu Schatten um. „Soll es ein Mann oder eine Frau sein?“, fragte er vorsichtig. Schatten blickte überrascht und erheitert zu Kyle. „Das ist mir völlig egal. Was sagst du dazu, Träumer?“ Träumer, überrascht und erschreckt, dass Schatten ihn ansprach, überlegte eine weile, bis er schließlich antwortete: 2Mir ist es auch völlig gleich.“ Insgeheim wollte er keine Frau, aber er wollte nicht zeigen dass er eine Abneigung gegen diese „schwächere Geschlecht“ hegte, eben weil sie keine eigene Meinung hatten. Er sah Kyle davon gehen und blickte noch einmal den Kindern nach. Sie waren so friedlich, dass er glaubte, im Himmel zu sein. Eine solche Harmonie war auf der Erde doch nicht möglich. Schatten beobachtete ihn. „Geh ruhig“, sagte er und atmete laut aus. „Geh ruhig los und schau dich um. Wir werden wohl eine Weile hier festsitzen, also kannst du dich gern eine Weile umsehen.“ Träumer lächelte dankbar, dann lief er davon. Abgesehen davon, dass das Dorf sich in einem Wald befand und hier und da einen Baum gab, der durch ein Haus ragte, war das Dorf eigentlich nicht sehr spektakulär. Es war ein einfaches, friedliches Dorf, das ein wenig Ähnlichkeit mit dem Dorf hatte, in dem er selbst einmal gewohnt hatte. Hier und da stand ein Haus mit Garten, dort wuchsen Kürbisse neben Rüben und hier und da eine Kartoffelplanze. Es gab Kirsch-- und Apfelbäume, die Zwar Früchte trugen, aber keine Blätter hatten, zumindest keine sichtbaren. Träumer blickte zum Boden, der von Blättern überfüllt zu sein schien. Wie konnte das sein? Wie konnten Blätter auf dem Boden liegen, wenn der Baum selbst keine hatte? Träumer erkannte die Form eines Blattes, es war das Blatt eines Kirschbaums, des Baums, den er eben noch betrachtet hatte. Lag ein besonderer Zauber auf den Blättern, und nicht auf den Bäumen? Er war sich nicht sicher, doch er merkte nun stärker, dass es so etwas wie Magie wohl geben musste. Wie sonst war so etwas möglich? „Suchen sie etwas?“, hörte er eine helle, weibliche Stimme. Ein junges Mädchen von etwa 14 Jahren stand verlegen neben ihm und blickte zu ihm hoch. Sie hatte helles, rotes Haar und grüne Augen. Träumer versuchte ein Lächeln. „Nein, nichts bestimmtes“, sagte er. „Ihr seid nicht von hier“, stellte sie fest und lächelte ein sehr schönes Lächeln. „In der tat nicht“, sagte Träumer. Er wollte sich entfernen, allmählich wurde ihm das Gespräch ihm unangenehm. „Man merkt das“, sagte das Mädchen und grinste. „Man merkt es an der Haarfarbe und an der Art wie sie Wörter betonen. Ich bin übrigens Nila“, sie streckte ihre Hand aus, um ihn zu begrüßen. Träumer gab ihr ebenfalls die Hand. Er war verwirrt. Normalerweise benahmen Mädchen sich nicht so. Sie benahmen sich nicht so offen, so direkt, so... männlich. Doch das Gespräch begann, ihm zu gefallen. „Ich bin Träumer“, sagte er und blickte Nila jetzt mit unverhohlenem Interesse an. Nila kicherte und streckte ihm die Zunge heraus. Träumer beobachtete sie irritiert. „Ihr steht in meinem Beet“, sagte sie und schob Träumer beiseite. Träumer blickte entsetzt zu Boden und sah- nichts. „Da ist nichts“, sagte er verwirrt. Das Mädchen verdrehte die Augen. „Erwachsene“, sagte sie. „Wo bleibt eure Fantasie? Ihr seht sie nicht, weil ihr sie nicht sehen wollt. Das ist es, das und nichts anderes. Es liegt nicht daran, dass es ein Beet eventuell nicht gibt. Ihr seht es einfach nicht, weil etwas in der Fantasie für euch nicht existiert.“ Träumer grinste. „Wie kann man denn in etwas pflanzen, dass nur in der Fantasie besteht?“, fragte er Nila. Sie seufzte. „Zu erwachsen. Dabei sollt ihr doch Dichter sein. Die müssten doch Fantasie haben.“
Träumer lachte. „Ach so. Na dann“, er grinste. Das Mädchen blickte ihn an. „Wie alt seit ihr eigentlich?“, fragte sie ihn gerade heraus. „19 Jahre“, sagte Träumer. Das Mädchen lächelte verschwörerisch. „Und, schon etwas gehabt?“ Träumer blickte sie an. „Gehabt?“, fragte er. „Was meinst du?“ Das Mädchen verdrehte die Augen. „Schon einmal etwas mit einem Mädchen gehabt?“, fragte sie. Träumer blickte sie irritiert an. „Nein“, sagte er. „Ich habe auch kein Interesse. Frauen sind so... anders.“ Das Mädchen erblasste. „Ihr wollt damit doch nicht sagen, dass ihr... anders herum seid?“ Jetzt sah Träumer sie noch irritierter an. „Dass ich „was“ bin?“, fragte er verwirrt. „Was meinst du damit: „anders herum“?“ Das Mädchen seufzte. „Es gibt gewisse Männer“, begann sie. „ Die neigen dazu, weniger Frauen zu mögen, sondern eher... andere Männer. Seid ihr so etwas? Wobei ich nicht sagen möchte, dass ich so etwas schlecht finde. Es wäre nur verschwendet...“, sie seufzte. Träumer fragte sich, was sie mit dem „verschwendet“ wohl gemeint hatte, aber er wollte es nicht so genau wissen. „Nein, ich bin nicht... Anders herum. Ich mag nur einfach keine Frauen, weil sie schwach in ihrer Meinung sind. Männer sind da anders. Ich habe noch nie über so etwas nachgedacht.“ Das Mädchen nickte, dann fragte sie: „Werdet ihr schwach, wenn ihr“, sie zog ihre Bluse etwas weiter auf, sodass Träumer einen Blick auf ihre Brüste hätte werfen können, „so etwas seht?“ Träumer blickte weg. Ihm war heiß geworden. „Was soll das?“, fragte er. „Du bist so jung. Wie alt bist du eigentlich?“ Das Mädchen grinste. „dreizehn“, sagte sie. „meine Mutter meinte, ich sollte mir einen Mann suchen, deshalb wollte ich einen, der gut aussieht, damit ich es wenigstens mit ihm aushalten kann. Ich will keinen, bei dem man davon läuft, wenn man ihn sieht. Dieser andere, Dieser Drorn, er sieht auch verdammt gut aus, habe ich gehört, aber er ist viel zu alt für mich. Du bist süß, deswegen wirst du mein Mann.“ Träumer sah zu ihr herunter, sie war etwa zwei Köpfe kleiner als er. „ganz sicher nicht“, sagte er. „Warum nicht?“, fragte das Mädchen enttäuscht. „Weil ich mit Schatten weiter ziehen werde“, sagte Träumer. „Wer ist Schatten?“, fragte das Mädchen. Dann verstand sie. „Aha, ihr habt euch also Spitznamen gegeben? Wie in einer echten Beziehung. Warum nimmst du nicht mich? Ich kann dir mehr geben, als dieser. als dieser Mann.“ Träumer schüttelte den Kopf. „Warum denkst du denn immer an dasselbe. Warum denkt ihr Frauen denn immer nur an dasselbe? Ich würde dich auch nicht heiraten, wenn ich nicht gehen müsste. Mein Herz wird dir nie gehören.“ Das Mädchen horchte auf. „Dann bist du schon versprochen?“, fragte sie ihn überrascht. Er überlegte, ob er lügen sollte. „Ja, das bin ich“, antwortete er. Das Mädchen zuckte mit den Schultern. „Da kann man nichts machen“, sagte sie und drehte sich um. Ihr rotes Haar wippte bei jedem Schritt, den sie machte, auf und ab. Ein hübsches Mädchen, dachte Träumer, dann machte er sich auf den Weg, um Schatten zu suchen. Irgendwo musste er stecken und vielleicht hatte er bereits ausgesucht und sie konnten diesen Ort wieder verlassen. Er wollte nicht, dass ein anderes Mädchen auf die Idee kam, ihn ebenfalls heiraten zu wollen. Er fragte sich, was dieses Mädchen an ihm fand. Mochte sie seine Blonden Haare? Seine Grünen Augen? Seinen Hut? Oder vielleicht seinen Körper? Sein Alter? Seinen Charakter wohl eher nicht. Sie hatte von gutem Aussehen gesprochen. Er sah also gut aus? Nun, so genau hatte er sich noch nie betrachtet, er wusste also nicht, ob das stimmte oder nicht. Sie hatte Schatten als gut aussehend bezeichnet. Er war es. Träumer schüttelte die Gedanken aus seinem Kopf, er ging zurück zu dem Platz, wo er mit Schatten angekommen war. Schatten stand dort noch und wartete geduldig. „Wie hat es dir gefallen?“, fragte er. Träumer zuckte mit den Schultern. „Ein Mädchen hat mich gefragt, ob ich sie heiraten will“, sagte er. Schatten lachte. „Ich hoffe doch du hast „Nein“ gesagt“, meinte er. „Sonst müsste ich zwei auswählen, die mit mir kommen. Auf deine Gesellschaft könnte ich nicht verzichten. Du bist schließlich ein Dichter und deine Gedichte sind gut. Verdammt gut, wenn ich das beurteilen kann.“ Träumer lächelte geschmeichelt. „vielleicht hast du aber auch einfach keinen Geschmack, Schatten“, lachte er. „Wen werden wir denn jetzt nehmen? Hast du schon jemanden ausgewählt?“ Schatten schüttelte den Kopf. „Noch nicht, Aber Kyle ist auch noch nicht zurückgekommen, um mir Bescheid zu sagen.“ Träumer nickte. „Wenn man vom Teufel spricht“, bemerkte er, denn genau in diesem Moment betrat Kyle den Platz. „Wir sind soweit“, sagte er. Schatten nickte und ging zu Kyle, Träumer folgte ihm. Die Zwei wurden durch die Straßen gelotst. Kyle ging voran, danach kam Schatten, danach Träumer.
Sie kamen an einem Großen platz an, etwas größer als der Platz, an dem sie angekommen waren. Mit einem Unterschied: Dieser Platz war voller. Überall saßen Menschen, standen herum und tuschelten miteinander, man sah angespannte Gesichter. Träumer fühlte sich etwas unwohl, aber er zwang sich, eine neutrale Miene aufzusetzen. Schatten blickte in die Runde und betrachtete jedes Gesicht einzeln; so jedenfalls schien es. „Wir haben uns, wie ihr alle wisst, hier versammelt, damit ein Führer für diese beiden ermittelt werden kann. Jeder von euch, die ihr hier anwesend seid, ist einverstanden seine Heimat zu verlassen? Wenn nein, dann soll er jetzt gehen.“ Ein, zwei Menschen standen auf und gingen, der Rest saß schweigend da und beobachtete. Kyle wandte sich an Schatten. 2Ihr dürft jetzt wählen“, sagte er. Schatten trat vor und näherte sich den Menschen, er blickte ihnen in die Augen und betrachtete sie eine Weile. Die meisten duckten sich und wichen seinem Blick aus, sie blickten auf den Boden oder in die Luft. Er ging weiter, blieb schließlich vor einer jungen Frau, um die 20 herum, stehen. Er betrachtete sie lange, eingehend, sie erwiderte seinen Blick furchtlos. „Ich wähle sie“, sagte er. Träumer blickte zu der Frau. Sie sah gut aus, keine Frage, aber warum hatte Schatten sie gewählt? Sie war eine FRAU! Er versuchte, seine Überraschung zu verbergen. „Wie ist dein Name?“, fragte Schatten sie. „ Chila“, antwortete sie mit einer festen Stimme. Sie blickte Schatten gerade an, es war kein Blick, der Unterwerfung heuchelte. Plötzlich empfand Träumer Respekt vor dieser Frau und ihm fiel ein, warum Schatten sie gewählt haben könnte. Sie war stark, geistig stark. Körperlich war sie vermutlich ebenfalls stärker als er selbst, aber man konnte nur spekulieren. Schatten drehte sich zu ihm um und er nickte. Er akzeptierte Schattens Entscheidung, auch wenn er wusste, dass er selbst anders gehandelt hätte, so empfand er die Entscheidung dennoch als richtig. Schatten musste wissen, was er tat.
Die Frau stand auf. „Ich werde euch führen“, sagte sie. „Ich werde das wieder gut machen, was wir euch angetan haben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, uns zu vergeben, doch ich hoffe, dass ihr es tut, wenn ich meine Aufgabe erfüllt habe.“ Schatten trat auf sie zu. „Es wird ein anstrengender und gefährlicher Weg“, sagte er. „Bist du bereit, ihn mit uns zu gehen?“ Sie blickte in seine Augen. „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe“, antwortete sie schlicht. Schatten nickte gewinnend. „Willkommen in unserer Gruppe“, sagte er. „Das dort ist Träumer.“ Träumer, der gerade noch zu Boden gesehen hatte, blickte erschreckt auf, als er seinen Namen hörte. Die Frau blickte zu ihm herüber, ohne dabei den blick zu senken, sah sie ihm in die Augen. Träumer zuckte zusammen. Seltsam. Das war nicht normal. Sie blickte wieder weg und ein Lächeln glitt über ihre Lippen. „wann werden wir los ziehen?“, fragte sie. Schatten musste angesichts so viel Elans lächeln. „Sofort, wenn du das willst“, sagte er. „Wenn Träumer ebenfalls bereit ist, heißt das.“ Träumer nickte. Er sah zu der Frau, dann zu Schatten und nickte. „Ich bin bereit“, sagte er. „Was?“, rief eine entsetzte Stimme. Es war das Mädchen, dem Träumer vorhin schon einmal begegnet war. „Du willst jetzt einfach gehen?“, fragte sie. „Du solltest bei mir bleiben!“ Träumer blickte zu ihr und wollte etwas erwidern, doch die Frau kam ihr zuvor. „Was hast du jetzt wieder angestellt, Nila! Du solltest zu Hause sein. Was treibst du dich nur auf der Straße herum und sprichst Fremde an!“ Nila zuckte zusammen und lächelte frech. „Aber er stand in meinem Beet“, sagte sie. Träumer verdrehte die Augen. Ging das erneut los? „halt den Mund“, sagte Chila streng. „geh jetzt.“ Das Mädchen nickte bloß, in ihren Augen lag ein Hauch von Trotz. Dann ging sie. Träumer blickte dem hübschen Mädchen nach. Er empfand keine Trauer, allerdings seltsamerweise keine Erleichterung, dass sie endlich ging. Er empfand einfach... nichts. Er war einerseits irritiert von seinem eigenen Verhalten, andererseits aber auch von dem des Mädchens. Wieso tat sie das, was sie tat? Wieso wollte sie ihn heiraten? Er selbst wäre nie auf so eine abstrakte Idee gekommen. Nicht dass er nicht wusste, dass es Männer gab, die durchaus so eine Art von Frau schätzten, ihn jedoch verwirrte sie nur. Träumer blickte zu Schatten, der zu der Frau blickte, die Chila hieß und anscheinend die Dritte in ihrem Team war. Er schüttelte den Kopf. Eine Frau. Schatten sah zu Träumer herüber. „Wir brechen dann wieder auf“, erklärte er. Träumer nickte und auch Chila schien bereit zu sein, da meldete sich Kyle zu Wort. „Wollt ihr nicht noch ein wenig hier bleiben?“, fragte er. Schatten sah ihn überrascht an, schüttelte dann aber den Kopf. „Nein“, sagte er. Wir können nicht hier bleiben. Es ist einfach nicht möglich, dass wie das tun. Schließlich haben wir ein Ziel, dass wir noch erreichen müssen.“ Kyles Blick verriet Enttäuschung. „Nicht einmal die Nacht?“, fragte er. „Wir könnten ein Fest geben.“ Schatten schüttelte den Kopf, er blieb hart. „Nein“, sagte er. Kyle ließ den Kopf hängen. Scheinbar hatte er sich darauf gefreut, sie länger beherbergen zu können- oder aufzuhalten. „Wie ihr wünscht“, sagte er und nickte. „Chila kennt alle Wege hier, wie jeder von uns. Sie kann euch führen.“ Chila nickte zustimmend, eine Geste, die eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Träumer schüttelte verständnislos mit dem Kopf. Was hatte diese Geste nur bedeuten sollen? Warum musste sie eine Aussage durch ihre eigene Handlung noch bekräftigen? Er verstand sie nicht. Er verstand sie einfach nicht.
Schatten ging zu Träumer und klopfte ihm auf die Schulter. Träumer blickte ihm in seine eisblauen Augen. „Du wirst es verstehen“, sagte Schatten nur und Träumer nickte, er hatte verstanden, was er meinte. „Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung“, sagte er. Schatten drehte sich grinsend zu ihm um. „Wenn es nicht die richtige Entscheidung momentan war, es wird bald die richtige gewesen sein. Sowie es erst keine gute Entscheidung schien, dich mitzunehmen, nicht wahr, kleiner Dichter?“ Träumer nickte. Er verzog das Gesicht. „Du vergleichst mich mit ihr?“, fragte er. Schatten lachte. „Ich weiß nicht, was du an ihr so schlimm findest. Sie ist eine starke Frau. Sie wird die Strapazen schon aushalten. Außerdem kennt sie den Weg.“ „Wie tausende von denen, die hier sitzen auch“, warf Träumer ein. „Das ist kein Argument. Sag mir, warum hast du sie gewählt? Sag mir den wahren Grund!“ Schatten sah ihn lange an. „Sie hat mich gerade angesehen“, sagte er. „Mehr nicht?“, fragte Träumer überrascht. „Nein. Das ist aber nicht wenig. Sie weiß um meine Gefährlichkeit. Sie weiß, dass sie mir möglicherweise unterlegen ist. Dennoch hat sie den Mut bewiesen, mich anzusehen. Ich will niemanden, der mich fürchtet. Du hast mich damals auch nicht gefürchtet“, sagte er. Träumer grinste. „Ich wusste nicht, wer ihr seid. Das ist etwas völlig anderes.“ Schatten schüttelte den Kopf. „Ist es nicht“, sagte er. “Du wusstest es nicht, aber du hättest es ahnen können. Du hättest er erahnen können, daran wie ich dich angesehen habe. So verächtlich“, er seufzte. „Ich kann Menschen vielleicht nicht sonderlich gut beurteilen, aber du warst doch auch eine gute Entscheidung. Warum sollte sie uns jetzt hintergehen?“ „Sie ist eine Frau“, gab Träumer zu bedenken. Schatten lachte laut. „Bist du besorgt um deine Unschuld?“, fragte er grinsend. Träumer errötete. „Nicht doch“, wehrte er ab und schielte zu Chila herüber, die die zwei mit einem seltsamen blick musterte, allerdings nichts zu hören schien. Sie war eine sehr hübsche Frau, mit den langen, braunen Locken und dem wilden Blick. Sie hatte eine runde, aber dennoch muskulöse Figur, wahrscheinlich die perfekte Mischung aus Muskeln und Weiblichkeit. Träumer nickte. „Sie wäre das wohl natürlich wert. Vom Aussehen her. Aber ich will sie nicht nur allein wegen ihres Aussehens beurteilen. Sie ist älter als ich.“ Schatten lachte. „So? woher weißt du das?“ Träumer zuckte mit den Schultern. „Sie sieht wie Mitte zwanzig aus“, sagte er leicht dahin. Schatten lachte. „Das ist sie aber nicht. 20 Jahre. Höchstens.“ Träumer sagte: „Das ist immer noch älter, als ich bin.“ Schatten gab sich geschlagen. „Okay, gut.“ Chila bemerkte, dass sie aufgehört hatten, miteinander zu reden, deshalb kam sie langsam heran. Ihre schmalen Beine bewegte sie elegant. Träumer wurde rot und er schalt sich selbst einen Idiot, weil er auf ihre weibliche Masche herein fiel. Er durfte sich keine Blöße geben, sonst musste er bald für sie entscheiden, was sie zu tun hatte. Er hasste Entscheidungen. Doch Chila ging nicht weiter auf ihn ein. „Wollen wir weiter?“, fragte sie. Schatten nickte ihr zu. Träumer beschloss, einfach nichts zu sagen. „Hast du alles bereit?“, fragte Schatten. Chila nickte. „Alles hier“, sie klopfte auf einen Rucksack, der auf ihrem schmalen Rücken saß. Träumer
10.
Chila war schnell, schneller als Schatten. Sie ging mit federnden Schritten voran, Schatten folgte ihr in einiger Entfernung und Träumer hatte das Gefühl, überhaupt nicht mitzukommen. Die Zwei hatten ein unglaubliches Tempo drauf, er hatte das Gefühl, dass er selbst, wenn er das Tempo halten könnte, rennen müsste, und dann wäre er schon innerhalb von Minuten außer Atem. So fiel er Stück für Stück zurück. Er blickte Schatten und Chila nach, langsam wurde es dunkler im Wald und er konnte die beiden nur noch als Silhouette am Horizont erkennen. Sie drehten sich nicht zu ihm um, vermutlich erwarteten sie von ihm, dass er ihnen folgte. Er würde ihnen auch folgen, aber er konnte nicht so schnell. Es war kein böser Wille, der ihn langsamer werden ließ, sondern schlicht und einfach die Erschöpfung. Er konnte nicht mehr. Schatten warf nun, zum ersten Mal, einen Blick zurück. Er sah erstaunt zu Träumer, der so weit weg von ihnen war und gebot Chila, zu warten, bis Träumer sie eingeholt hatte.
„Worauf wartest du?“, fragte Schatten ihn überrascht. „Ihr seid zu schnell“, erwiderte Träumer einfach nur und stellte sich neben ihn. „Ich kann einfach nicht mehr. Schatten sah ihn nachdenklich an. „Dann rasten wir hier“, sagte er nach einiger Überlegung. Chila schien protestieren zu wollen, aber sie überlegte es sich anders und nickte nur grimmig. Träumer sah sie an. War sie etwa wütend auf ihn, weil er es nicht schaffte, so viel und so weit zu Laufen? Oder würde sie am Liebsten sogar ohne ihn und nur mit Schatten gehen? Träumer stellte sich diese Fragen, ohne wirklich zu wissen, warum er das tat. Es war ihm ein Rätsel, genau so wie es ihm ein Rätsel war, warum er diese Frau leiden konnte. Warum er immer versuchte, ihr zu gefallen oder, warum er sich darum kümmerte, was sie über ihn dachte. Schatten hatte sich gegen einen Baum gelehnt. „Es wird diese Nacht ziemlich kühl“, verkündete Chila, der erste Satz, den sie nun zu ihnen sagte. Schatten nickte und auch Träumer fiel nichts Besseres ein, als dem zuzustimmen. Chila setzte sich vorsichtig auf den Erdboden, aber erst, nachdem sie ihren Mantel darüber ausgebreitet hatte. Träumer blickte sie verständnislos an, sie lächelte bloß- und schwieg. Schatten nickte Träumer zu. Er sollte sich ebenfalls setzen. Träumer nickte erneut. Er setzte sich, legte seinen Rucksack ab und holte etwas von den Vorräten heraus, die Thome ihm mitgegeben hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass er die letzten Tage so gut wie nichts gegessen hatte. Er schnitt sich mit dem Dolch, den er bis jetzt noch nicht ernsthaft benutzt hatte, eine Scheibe Brot ab und aß dazu etwas von dem Käse, den Thome in weiser Voraussicht dazugelegt hatte. Chila beobachtete das mit ihren Katzenaugen, Schatten nahm es zum Anlass, ebenfalls etwas zu essen. Träumer blickte zu Chila herüber, die ihn nicht mit einem Blick würdigte. Nachdenklich kaute er und schluckte. Er wurde aus dieser Frau nicht klug. Ihr Interesse schien Schatten zu gelten. Schattens Interesse galt allerdings auf alle Fälle eher Träumer als ihr. Und Träumers Interesse galt... Ja, wem eigentlich? Etwa dieser Frau, dieser Chila? Er musste lächeln. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Nach einiger Zeit, schlief er ein.
Schatten weckte ihn wieder. „bist du ausgeruht?“, fragte er Träumer. Träumer blickte ihn an und streckte sich. Seine Knochen knackten bedrohlich, ihm selbst tat der Rücken höllisch weh, aber ansonsten war alles in Ordnung. Träumer nickte. Er würde weiter laufen können. Schatten grinste. Chila stand geduldig einfach da und wartete. Träumer wurde bei ihrem Anblick nervös. Ob er wohl im Schlaf irgendwelche seltsamen Dinge getan hatte? Doch als er ihren Blick suchte, umspielte nur ein leises Lächeln ihre Gesichtszüge. Sonst nichts, nicht ein einziges Wort. Wörter waren für Träumer alles. Er brauchte sie, wie ein Fisch das Wasser brauchte, wie der Bär die Luft zum Atmen brauchte. Ohne Worte war ein Dichter nichts. Laute konnten nicht das ausdrücken, was er sagen wollte, nur in vollkommenen Worten wusste er zu sagen, was er meinte. Seine Körpersprache jedoch wurde immer fehl gedeutet, er beherrschte sie einfach nicht.
Chila drehte sich um und ging los. Schatten folgte, dahinter ging Träumer. Diesmal hatten sie das Tempo etwas gedrosselt, sie waren langsamer und Träumer kam besser mit ihnen mit. Einige Stunden waren sie schon gegangen, da erreichten sie endlich den Waldsaum. „Wo wollt ihr eigentlich hin?“, fragte Chila. Träumer notierte innerlich: Chilas zweiter Satz. Schatten sagte nur: „Wir wollen durch das Gebirge.“ Chile drehte sich zu ihm um und runzelte die Stirn. „Durch das Gebirge, wohin?“, fragte sie ihn. Schatten schüttelte den Kopf. „Führ uns erst mal dorthin, dort werde ich dir die weiteren Strecken noch genau erläutern.“
Chila schnaubte ungläubig, doch Schatten machte keine Scherze. „So hoch ist also euer Vertrauen in eure Führerin“, sagte sie leise und wütend. „In der Tat“, sagte Schatten. „Traue niemanden, der nicht in deiner Familie ist; und wenn er in deiner Familie ist, traue ihm erst recht nicht.“ Träumer blickte ihn verwundert an, aber er merkte, dass Schatten nur bluffte. Chila allerdings schien es für wahr zu halten und seine Meinung erschreckte sie. Sie hatte scheinbar mit mehr Vertrauen gerechnet, da sie diejenige war, die er ausgewählt hatte. Aber dem war nicht so. Träumer lächelte. Ihm selbst hatte Schatten zwar auch nicht gesagt, wohin sie gingen, aber einerseits hatte er nicht gefragt und andererseits interessierte es ihn mittlerweile herzlich wenig, wohin sie gehen würden. Er war es nicht gewohnt, irgendwelche Informationen zu bekommen, er tat einfach das, was Schatten sagte. In seinen Gedanken konnte er frei sein, wenn es sein Körper in Gefangenschaft schien. Träumer zuckte mit den Schultern und grinste. Dass Schatten sie mit keinerlei Vertrauen bedachte gefiel ihm. Er selbst hatte sich das Vertrauen ebenfalls erst verdienen müssen, mit seinem Verhalten und der Art, wie er war. Chila war einfach viel zu unbekannt, als dass er sie mit Vertrauen hätte auszeichnen sollen. Chila überlegte kurz. „Wir müssen da entlang gehen“, sagte sie bestimmt. „Zum Gebirge geht es in die andere Richtung“, sagte Schatten leise und tief. „Es ist ein kürzerer Weg. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was euer Endziel ist, kann ich euch verständlicherweise auch nicht den schnellstmöglichen Weg zeigen.“ Schatten nickte. „Dessen bin ich mir bewusst“, sagte er. Aber du wirst trotzdem den besten Weg finden, davon bin ich überzeugt- ohne zu wissen, was unser Hauptziel ist.“ Chila nickte verbissen, Träumer blickte auf die endlosen Weiten einer Ebene, die er noch nie zuvor gesehen hatte. „Aus welcher Seite des Waldes sind wir denn herausgekommen?“, fragte er erstaunt. „Auf der anderen“, sagte Chila. „Wenn ihr zum Gebirge wollt, ist es etwas kürzer. Es wäre auch einfacher, wenn wir meine Route gehen würden. Schließlich bin ich doch hier, um euch zu führen, oder etwa nicht?“ sie sah Schatten mit einem bohrenden Blick an. Er allerdings ignorierte sie oder hielt es nicht für nötig, ihr zu antworten. Sie schnaubte wütend und ging los. Träumer stand abwartend da, wartete auf eine Reaktion von Schatten. Schatten verdrehte die Augen und folgte Chila dann. Träumer folgte Schatten. So ging es eine ganze Weile durch hohes Gras, bis sie auf einen kleinen Pfad stießen. Chila folgte ihm eine Weile, dann, urplötzlich, ändere sie die Richtung. Sie schien es nicht für nötig zu erachten, den anderen beiden zu erklären, wo sie sich gerade befanden, aber Schatten schien es zu wissen und Träumer hätte mit den Informationen nichts anfangen können, die Gegend hätte ihm fremder nicht sein können. Doch davon ahnte Chila ja nichts. Träumer seufzte. Seine Füße begannen zu schmerzen, allmählich war er das dauernde Wandern leid. Warum besorgten sie sich nicht ein Fortbewegungsmittel? Er konnte war nicht reiten, aber man konnte es sicherlich lernen und so unbequem konnte es nicht sein. Zumindest würde er sich die Blasen an den Füßen sparen. Träumer seufzte. Seinen Begleitern allerdings schien es nichts auszumachen, diese vielen Meilen zu wandern. Sie gingen und gingen und gingen. Immer auf dem Weg in eine Richtung, die zwei von den dreien nicht genau kannten. Sie waren auf dem Weg, immer zu Fuß, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Woche um Woche. Träumer war so weit vom Dorf entfernt, dass er nicht einmal gewusst hätte, in welcher Richtung es sich befinden könnte.
Er hörte ein leises Knacken. Allmählich war es dunkel geworden, sie waren noch auf den Beinen. Seine Füße schmerzten immer noch, er konnte sich kaum noch aufrecht halten. Er wusste nicht, wie viele Tage schon vergangen waren; es waren viel zu viele gewesen. Viel zu viele, als dass er sie behalten konnte. Vielleicht waren sie erst eine Woche unterwegs, vielleicht schon einen ganzen Monat. Er wusste es schlicht und einfach nicht und einschätzen konnte er es erst recht nicht. Es knackte erneut. Träumer blickte sich überrascht um. Er konnte nichts erkennen. Dennoch, irgendetwas war dort, irgendetwas beobachtete sie. Er fröstelte und musste an die Geschichten über Dämonen denken, die ihm der Dorfpriester erzählt hatte. „Sie folgen den Wanderern, die kein Heim haben, wie ein Schatten“, hatte er ihm erklärt. „Sie warten, bis die Wanderer zu müde zum weiter gehen sind und fahren dann in sie. Weil die Dämonen böse sind, werden die Menschen dann auch böse. So müssen sie ihr Leben lang böse Dinge tun.“ Schatten schüttelte den Kopf. Das war nicht möglich. Oder vielleicht doch? Als Dichter glaubte er an vieles, das nicht wirklich war, er kannte den Beweis dafür, dass es Worte gab, die reden und laufen konnten. Worte, die Schatten ebenfalls gab. Er glaubte an riesige Spinnen, denen er selbst beinahe zum Opfer gefallen war. Letztendlich gab es da noch die Magier, dessen Existenz er zwar noch nicht hundert prozentig glaubte, aber für se3hr wahrscheinlich hielt, sie hatten die Stadt und den Wald verflucht. Wie konnte jemand etwas verfluchen, wenn er überhaupt nicht existierte? Träumer wusste es nicht. Er wusste es überhaupt nicht, aber es war ihm egal. Er wusste nur, dass es nicht viele andere Möglichkeiten gab, die in Frage kämen.
Es war stockdunkel. Man konnte kaum die Hand vor Augen erkennen und Träumer musste sich anstrengen, wenn er versuchte, Schatten oder Chila zu erkennen. Er überlegte, ob er Schatten nun Drorn nennen sollte, nach seinem eigentlichen Namen. Aber Schatten gefiel ihm. Es war ein Symbol für Sicherheit, weil er wie ein Schatten immer in seiner Nähe war, selbst wenn er ihn einmal nicht sehen sollte. Andererseits stand der Schatten auch für Mysterien, etwas, dass er eindeutig besaß. Er war eine zwielichtige, mysteriöse Gestalt. Plötzlich lief Träumer in jemanden hinein. Er hörte ein weibliches, überraschte und wütendes Geräusch; und er wusste, dass er Chila war, die er fast um gerannt hatte. Schatten stand einen halben Meter von ihr entfernt. „Es ist zu dunkel, um heute noch viel weiter zu gehen“, sagte Schatten zu Träumer, vielleicht auch zu Chila, oder aber nur zu sich selbst. Träumer seufzte erleichtert. Das würde bedeuten, dass er nun ausruhen konnte. Schlaf war jetzt das, was er am Dringendsten benötigte. Träumer ließ sich auf den Boden sinken. Das Gras war hoch, sie waren schon seit Tagen durch die Ebenen gewandert und allmählich merkte Träumer die Striemen, die die langen Halme an seinen Beinen geschlagen hatten. Sie schmerzten auf eine Art und Weise, die unangenehmer war, als alles, was er bisher erlebt hatte, allerdings würde er in seinem weiteren Leben wohl noch schmerzhaftere Dinge erleben. Er wusste nicht genau, wie er auf diesen Gedanken kam, aber er hatte so eine ungute Ahnung.
Die Müdigkeit übermannte ihn, er konnte nicht mehr. Nicht einen einzigen Schritt mehr. Sofort fielen ihm die Augen zu, und es kostete ihn extreme Anstrengung, sie offen zu halten. Schatten setzte sich direkt neben ihn, Chila hatte sich in einiger Entfernung niedergelassen. „was hältst du von ihr?“, fragte Schatten Träumer leise. Träumer zuckte mit den Schultern und gähnte. „Sie scheint ganz in Ordnung“, sagte er. „Vermutlich hattest du richtig gehandelt, als du sie mitgenommen hast.“ Schatten sah ihn schräg von der Seite an. „Sagst du das, weil du davon überzeugt bist? Oder bloß, weil ich mich dann besser fühle?“ Träumer lächelte. „Teils, teils“, sagte er. Schatten sah Träumer strafend an und seufzte. „Du willst doch sicher noch den Rest der Geschichte hören oder nicht?“, fragte er ihn. Träumer nickte. „Morgen, in Ordnung?“, fragte er. „Ich bin heute einfach zu...“ er brachte den Satz nicht zu Ende. Seine Augen fielen zu und er war Sekunden später eingeschlafen. Schatten sah ihm einige Zeit dabei zu, wie er seelenruhig und zufrieden schlief, dann legte er sich ebenfalls zur Ruhe.
11.
Das Wandern war das schlimmste, was Träumer jemals erlebt hatte. Wenn er damals den Kampf mit den Spinnen oder die Situation im Sumpf für schrecklich empfunden hatte, so war es nur ein winziger Teil von dem, was das Wandern ihm antat. Seine Laune wurde mit jedem Schritt, den er ging, schlechter; er wusste nicht genau, wohin sie gingen, er wusste nicht, wie lange es noch so gehen würde. Wusste er überhaupt etwas? Wer war eigentlich Schatten? Warum erzählte er ihm nichts? War er etwa nicht vertrauenswürdig genug? Träumer war es leid. Er wollte nicht mehr. Er würde keinen Schritt mehr gehen. Entschlossen blieb er stehen, nachdem sie diesen Morgen gerade einmal eine Stunde gewandert hatte. Schatten hatte ihm versprochen gehabt, ihm seine Lebensgeschichte zu ende zu erzählen, aber er hatte es nicht getan. Nicht am nächsten Tag, aber auch nicht am übernächsten. Er hatte es ihm bis jetzt nicht erzählt. Es waren schon fünf weitere Tage vergangen, an denen Schatten es nicht für nötig erachtet hatte, ihn über den Rest in Kenntnis zu setzten. Aber so lief es nicht mehr. Träumer würde nicht mehr mitspielen. Entweder erzählte Schatten jetzt alles, oder aber Träumer würde zurück nach Hause gehen. Ungeachtet dessen, dass er dort vielleicht in den Krieg einberufen werden würde. Dann würde er eben seine eigene Gruppe gründen und mit anderen Leuten umher reisen. Er hatte es gar nicht nötig, bei Schatten zu bleiben. Um ehrlich zu sein, er wollte es auch gar nicht mehr. Er war es einfach leid. So Leid. „Schatten“, rief er mit lauter Stimme und blieb wie angewurzelt mitten auf der Ebene stehen. Schatten drehte sich zu ihm um. „Ist irgendetwas?“, fragte er Träumer. Träumer schüttelte den Kopf. „Ich gehe keinen Schritt mehr weiter!“, rief er zurück. Träumer zog die Augenbrauen hoch. „Aha“, sagte er nur. Träumer konnte es nicht fassen. Schatten drehte sich einfach wieder um und ging weiter. „Ich werde nicht gehen!“, schrie er. Schatten hob die Hand und verlangte so Träumers Schweigen. Träumer schwieg, aber er ging nicht. Er wusste, dass Schatten erwartete, dass das Ganze nur ein Scherz war und er gleich wieder weitergehen würde. Doch das tat er nicht. Er würde nicht weiter gehen. Nicht einen Schritt. Nicht einen. Das sagte er sich immer und immer wieder. Er blieb stehen, auf derselben Stelle. Rührte sich nicht. Schatten und Chila gingen weiter, keiner der Beiden drehte sich um, sie waren es gewohnt, keine Schritte von ihm zu hören, da er immer in einiger Entfernung von ihnen ging. Aber dieses Mal würde er nicht hinterher gehen, wie groß der Abstand auch sein mochte. Er würde nicht gehen. Träumer schloss die Augen. Was für ein Gesicht würde Schatten wohl machen, wenn er letzten Endes feststellen würde, dass er und Chila allein waren? Träumer tat das hier nicht aus einer Laune heraus. Nun, vielleicht war es doch eine Laune, da war er sich nicht ganz sicher, aber diese Laune entsprach tiefster Enttäuschung über Schatten. Was war er eigentlich für ein Mann? Er war vielleicht groß und stark, aber er war nicht ehrlich. Er erzählte ihm nicht alles. Träumer wusste kaum etwas über ihn, vor allem nichts vom wichtigen Teil, nämlich den, warum Schatten so viel Geld wert war. Schatten kannte Träumer, er kannte ihn in- und auswendig. Aber Träumer wusste nichts, gar nichts, nicht das Geringste und es ärgerte ihn und verzweifelte ihn gleichzeitig. Er öffnete seine Augen wieder und blickte in den Himmel. Der Himmel war wolkenlos blau. Träumer schüttelte den Kopf. Wie konnte nur das Wetter so gut sein? Es hätte regnen sollen, regnen und jeder einzelne Regentropfen hätte auf Schattens Kopf fallen sollen und ihm Schmerzen bereiten sollen. Er hätte sich mit jedem Tropfen wünschen sollen, irgendwo anders zu sein, oder Träumers Zorn nicht so herauszufordern. Träumer schnaubte wütend. Wieso konnte er nur nicht zaubern wie der Magier, der Irgon verflucht hatte, oder wie der, der denn Wald mit einem Bann belegt hatte. Beide schienen mächtige Männer gewesen zu sein, aber er, er selbst, er konnte nichts. Er konnte schreiben, aber das nützte ihm nichts in gefährlichen Zeiten. Mit Wörtern konnte man keine Bären töten. Ihm fiel auf, dass Schatten nicht derjenige war, der jemanden brauchte. Er selbst, Träumer, brauchte Schatten. Er brauchte ihn, weil er nicht in der Lage war, sich selbst zu verteidigen, sein eigenes Leben zu verteidigen. Er konnte es nicht. Er konnte es einfach nicht. Er war nicht in der Lage, jemanden zu töten, zu verletzen, nur um sein eigenes Leben zu retten. Träumer ließ sich auf den Boden sinken. Es war eigentlich ein schöner Tag, die Sonne war gerade einmal über den Horizont geklettert und blickte nun müde um sich. Ein kleines Vögelchen hielt sich an einem Grashalm fest und versuchte, ein Würmchen zu bekommen, das aber so schnell es konnte davon robbte. Träumer beobachte den kleinen Vogel bei seinem Versuch, den Wurm doch noch zu erreichen. Es gelang ihm nicht, wütend stieß er ein schrilles Zwitschern aus und erhob den kleinen Körper in den Himmel. Weiter hinten ließ er sich wieder nieder, vermutlich hatte er einen anderen Wurm gefunden. Träumer legte sich ins Gras. Es war nicht so bequem wie bei ihm zu Hause, nicht so bequem wie das Gras auf dem Hügel hinter dem Dorf. Aber es herrschte eine Atmosphäre, die man als ähnlich bezeichnen konnte. Ähnlich friedlich. Er schob seinen Hut auf sein Gesicht. Den Hut hatte er auf dem Kopf kaum gespürt, doch jetzt, wo er groß und schwer auf seinem Gesicht lag und ihm die Sicht verwehrte, spürte er, dass er es vermisst hatte, so im Gras liegen zu können. Die letzten Tage, nein, die letzten Wochen waren zwar aufregend gewesen, aber nicht annähernd friedlich. Träumer war für aufregendes nicht zu gebrauchen, das war er noch nie gewesen. Er lag im Gras und genoss es, Die Stille, die durch viele kleine, leise Geräusche unterstrichen wurde, wie etwa das Zirpen von Grillen, die Geräusche von wandernden Ameisen oder die Kämpfe zwischen kleinen Vögeln und Würmern. Hier schien es, als wäre die Welt noch in Ordnung. Hier wäre er am Liebsten geblieben. Er dachte an Thome. In ihm stieg eine Woge der Verzweiflung auf. Er wollte zurück! Er wollte zurück zu ihnen, zu Thome und all den anderen. Er vermisste sie, er vermisste sie so sehr, doch es war ihm nie so bewusst gewesen wie jetzt, wie in diesem Moment der Stille, des Friedens. Eine Träne kullerte aus Träumers Auge. Sie lief über seine Wange und tropfte dann auf den dunklen Erdboden, der sie dankbar aufnahm. Eine weitere folgte, kleiner als die vorherige, aber sie strahlte größere Trauer aus. Der Erdboden nahm auch sie auf, der verschluckte mit der Träne auch jede Traurigkeit, die daran hing. Träumer währenddessen weinte. Er weinte, wie er noch nie geweint hatte. Nicht weil er körperlich verletzt war, nicht weil er um sich selbst Angst hatte, nicht weil er dem Tod ins Auge blicken musste. Nichts von dem. Einfach nur, weil er merkte, wie wichtig ihm die Leute waren, von denen ihn mehrere Meilen trennten. Er schüttelte sich leise in einem Weinkrampf. Zwar weinte er, doch er gab ansonsten keine Laute von sich, kein Geräusch, dass die Harmonie zerstören würde. Die Sonne ging langsam auf den Thron zu, der ihr gebührte: die höchste Stelle auf dem Himmel. Doch Träumer bemerkte es nicht, er lag unter seinem Hut und weinte, er bemerkte nichts davon. Schatten und Chila bemerkte es ebenfalls nicht. Sie waren beide immer weiter gewandert, niemand hatte bemerkt, dass Träumer nicht mit ihnen gegangen war. Dass er einfach zurück geblieben war. Was hätte das auch für einen Sinn ergeben? So liefen Schatten und Chila immer weiter, immer weiter weg von Träumer, immer näher ihrem eigenen Ziel, Schattens Ziel. Sie entfernten sich immer weiter von Träumer. Träumer jedoch blieb, wo er war: Auf der Ebene.
Nach einer Weile schob Träumer den Hut hoch. Er nahm ihn ab und betrachtete ihn. Die Feder war angeknickt, ein Zustand, der ihn aber nicht sonderlich störte. Es sah, wenn er es recht bedachte, sogar besser aus als vorher. Ansonsten schien der Hut nicht sonderlich in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Träumer setzte sich vorsichtig auf und hob dann den Hut hoch und setzte ihn sich wieder auf den Kopf. Er zog seinen Rucksack zu sich und nahm etwas vom Proviant heraus. Er aß etwas, von dem er sich nicht erinnern konnte, es eingepackt zu haben, aber es schmeckte nicht übel, auch wenn Träumer es nicht wirklich in eine ihm bekannte Kategorie einteilen konnte. Er kannte außerdem auch kein Wort dafür, was eigentlich merkwürdig war. Ein Stück davon in der Hand haltend drehte er es nachdenklich hin und her. Er suchte im Kopf einige Worte, die es beschreiben konnten. Leise murmelte er:
„Gelb wie Löwenzahnköpfe
scharf wie kaputte Tontöpfe
Merkwürdig wie'n Bild ohne Rahmen
Wieso hat es keinen Namen?“
Er drehte das Stück noch einmal nachdenklich, dann aß er den Rest. Er überprüfte seinen Proviant. Er hatte noch genug, in letzter zeit hatte er generell nicht sehr viel gegessen, aber einiges davon war verderblich und deswegen musste er es so schnell wie möglich essen. Träumer band das Tuch mit den Lebensmitteln wieder zusammen und kramte erneut in seinem Rucksack herum, bis er auf die Flöte stieß. Er nahm sie heraus und besah sie sich genauer. „Eigentlich eine sehr schön gearbeitete Flöte“, dachte Träumer nachdenklich. Er nahm sie zwischen die Finger und blickte etwas genauer. Er konnte kleinste Verzierungen erkennen. Er stutzte. Waren diese Verzierungen schon immer dort gewesen und er hatte sie bloß noch nie gesehen? Oder hatte sie jemand nachträglich hinzugefügt? Schatten etwa? Oder... Er hielt inne. Es war möglich, dass diese Flöte magisch war. Er musste in der Nähe von etwas sein, dass in der Flöte diese Maserungen deutlicher machte. Es könnten auch bloß Risse sein, beruhigte er sich. Risse? Er blickte noch einmal auf die Flöte. Vorsichtig blies er hinein und erhielt einen melancholischen Ton. Traurig, ja, aber noch der gleiche Klang, den er gewohnt war. Träumer lächelte erleichtert. Er wusste nicht, was er getan hätte, wäre diese Flöte kaputt gegangen. Sie war ein wichtiges Stück, er wusste nicht, woher er sie hatte, aber allein die Färbung des Holzes war außergewöhnlich. Thome hatte ihm erzählt, dass es nur einen Baum dieser Art gab. Einen einzigen, aus dessen Ästen man diese Flöte gefertigt hatte, vor mehreren Jahrzehnten. Die Flöte war nicht nur wertvoll, sie war auch alt. Für Träumer stellte sie zusätzlich noch ein familiäres Relikt da: Diese Flöte war zusammen mit ihm an Thomes Tür abgelegt worden. Zusätzlich ein Zettel: „Auf dass er irgendwann darauf spielen könne.“ Träumer setzte die Flöte erneut an die Lippen und schloss die Augen. Er spielte. Seine Finger fanden automatisch die Löcher und aus den vereinzelten Tönen wurde eine Melodie, die er erschuf. Er spielte immer weiter, eine leise, traurige Melodie. Plötzliches fuhr ein merkwürdiges Gefühl durch ihn. Es war, als konnte er die Musik spüren, wie sie leicht und sanft um ihn herum waberte und ihn voll und ganz einhüllte in einen Schleier der Melancholie. Dann wanderte die Melodie weiter, sie entfernte sich von ihm. Träumer setzte überrascht die Flöte ab, doch die Melodie verschwand nicht einfach. Sie blieb an der Stelle stehen, an der sie sich befand und wurde zu einer kleinen Gestalt aus Melodie. Die Gestalt winkte ihm zu, er sollte ihr folgen. Träumer nahm seinen Rucksack, schwang ihn sich über die Schulter und folgte der Gestalt. Sie führte ihn über die Ebene, viele Stunden lang und schließlich aus der Ebene heraus, einen Abhang hinauf, immer weiter und weiter. Träumer lief immer nach, wenn er nicht mehr konnte, hielt die kleine Gestalt an und wartete geduldig. Träumer war verwirrt. Wie war das nur möglich? Wie konnte etwas aus Melodie bestehen? Es faszinierte ihn. Er folgte der Gestalt immer weiter, bis in einen Wald hinein. Nachdem sie wohl eine Stunde in den Wald hineingegangen waren, verschwand das Wesen. Und Träumer merkte, dass er nicht wusste, wie er hier wieder herauskommen würde. Er war blind gefolgt, so wie er es bei Schatten auch immer getan hatte. Er war dem Wesen einfach nur gefolgt, ohne dabei nachzudenken. Aus Interesse, Faszination. Er schlug sich mit der Hand vor den Kopf. Wie konnte man nur so dumm sein? Wie konnte ER nur darauf hereinfallen? Er ging weiter durch den Wald. Langsam wurde es lichter, es standen immer weniger Bäume herum, vor sich erkannte er eine Lichtung. Er ging darauf zu und fand vor sich einen See. Das Wasser war kristallklar und glitzerte in einem unnatürlich schönen blau. Träumer blickte lange in das Wasser und bewunderte die kleinen Fische, die sich anmutig durch das Wasser schoben. Sie schienen so froh, so unbeschwert, dass der Gedanke, hier könnte etwas Böses lauern, sofort von Träumer ab fiel. Er blickte ans gegenüberliegende Ufer. Dort sah er zwei Dinge, die er für nicht möglich gehalten hatte. Ein Haus mit einem Steg und einem Boot- und ein großer weißer Baum. Der Baum trug keine Blätter, aber er war über und über mit Verzierungen und Maserungen überzogen. Er hob die Flöte in seiner Hand hoch und verglich sie mit dem Baum. Die Maserungen der Flöte waren nun dunkler und stärker zu erkennen; sie glich in der Art dem Baum perfekt. Träumer öffnete den Mund, aber es war niemand da, dem er etwas hätte sagen können. Also schloss er ihn nach einiger Zeit wieder. Er lief am Ufer entlang. Er musste unbedingt herausfinden, was das für ein Baum war. Das kurze Gras, das auf der Lichtung wuchs, peitschte zwar nicht um die Beine, war aber schleimig und rutschig, sodass Träumer aufpassen musste, nicht im See zu landen. Denn, so schön das Wasser auch schien, es war ihm dennoch nicht geheuer. Nach einiger Zeit hatte er das gegenüberliegende Ufer erreicht, vor ihm ragte der riesige Weiße Baum in die Höhe. Er ging vorsichtig zum Baum und legte seine Hand auf den Stamm. Ein knarren war zu hören, wie als würde der Baum seufzen - oder böse zischen. Träumer konnte nicht sagen, welches der beiden Zustände auf ihn passen könnte. Er fuhr die Maserung mit seinem Zeigefinger nach. Die Zeichen wirkten nicht natürlich, sondern eher hinein geschnitzt, als hätte sich jemand ein Messer genommen und den Baum an jeder einzelnen Stelle mit Stichen verletzt. Aus den Maserungen stieg etwas Baumharz. Baumblut. Träumer wich zurück. Die Worte in seinem Rucksack auf dem Papier wisperten laut und aufgeregt durcheinander. Sie spürten eine Gefahr, von der Träumer nichts bemerkte. „Der Baum, der Baum“, sagte ein Wort, das sehr klein zu sein schien. „Der Baum will ihn töten, weil er ein Teil von ihm hat. Weil er dieses Musikinstrument hat! Er hat ihn her gelockt!“ Ein größeres Wort zischte dem anderen Wort ein „psst!“ zu. Träumer wich einen Schritt von dem Baum zurück. In diesem Moment krachte ein Ast nach unten, genau auf die Stelle, wo er vor Sekunden noch gestanden hatte. Träumer blickte entsetzt nach oben. Ein Knarren war zu hören, dass er selbst sofort unter bedrohlich einordnete. Er wich zurück. Ein weiterer Ast brach nach unten. Der Baum schien keine Mühe zu scheuen, um ihn zu töten. Eine Hand berührte Träumer an der Schulter. Entsetzt fuhr er herum. „Hallo“, sagte eine Frau. Träumer blickte von ihr zum Baum, unsicher, welches wohl das kleinere Übel war. „Hallo“, sagte er schließlich. Die Frau war in eine Kutte gehüllt, er konnte nicht abgesehen ihrer Statur erkennen. „Komm mit mir“, sagte sie mit leiser Stimme und zog ihn vom Baum fort, in die Hütte. Sie Stieß die Tür auf und zog Träumer hinein. Träumer ließ es geschehen. Der Baum beruhigte sich, scheinbar schien er der Frau nichts Böses zu wollen. Oder er wusste, dass die Frau weitaus gefährlicher als er war und sie ihn effektiver umbringen konnte. Dieser Gedanke gefiel Träumer allerdings kein bisschen. Er ignorierte ihn und hoffte, dass er der erste Fall sein würde, der richtig war. „Wer bist du?“, fragte Träumer sie. Die Frau nahm die Kapuze ab, die vorher ihr Gesicht verdeckt hatte. Sie entblößte ein weißes, makelloses Gesicht. „Ich bin die Hüterin dieser Stätte“, sagte sie und lächelte, ein Lächeln, das Träumer wie magisch in seinen Bann zog. Er blickte sie an. Die Frau war in etwa so alt wie er, vielleicht etwas älter. Machte es einen Unterschied? Ihr Haar war schneeweiß, ihre Augen hatten eine dunkelbraune Färbung, die der der Maserung auf der Flöte ähnelte. Sie legte die ganze Kutte ab und Träumer konnte auf ihren makellosen Körper blicken, der von einem engen weißen Kleid besonders betont wurde. Er schluckte. Diese Frau war seltsam. Doch er empfand keine Abneigung für sie, eher... Zuneigung. Sie lächelte ihn an und er fühlte sich dazu genötigt, ebenfalls zu lächeln. Sie fuhr sich mit der Hand durch das Haar und er hatte das Bedürfnis, es ebenfalls zu berühren. Sie zog ihn magisch an. „Wie heißt ihr?“, fragte er sie. Die Frau blickte ihn an. „Ich habe keinen Namen“, sagte sie. „Was würde er mir hier denn auch nützen?“ Träumer nickte. Das ergab irgendwie Sinn. So weit weg von jeglicher Zivilisation brauchte sie natürlich keinen Namen. Außergewöhnlich war allerdings, dass sie ihre Sprache beherrschte. Er streckte seine Hand aus, um ihr Haar zu berühren, doch dann ließ er sie wieder sinken. Die Handbewegung überraschte ihn, sie schien es allerdings ziemlich gelassen entgegen zunehmen. Ein Lächeln legte sich auf ihre makellosen, vollen Lippen, ein Lächeln, das ihn magisch anzog. Er näherte seinen Mund vorsichtig dem ihren. Sie küsste ihn behutsam. Ein Gefühl stieg in ihm hoch, ein Gefühl, das er vorher noch nie gespürt hatte, etwas ungewöhnliches, neues, aber aufregendes. Er erwiderte den Kuss und ihm wurde warm. Vorsichtig legte er seine Hand unter ihr Kinn und zog sie näher zu sich. Sie kam seinem Drängen nach, näherte sich ihm und küsste ihn, immer und immer wieder, zärtlich, aber dennoch mit einer gewissen Forderung, die ihn wahnsinnig machte. Er küsste sie, dabei zog er ihren Körper näher zu sich, seine Gedanken waren vernebelt, er wusste nicht mehr, was er tat.
Plötzlich wurde die Tür aufgestoßen und ein großer Schatten fiel über Träumer und das Mädchen. Träumer blickte überrascht auf. Eine dunkle Gestalt blickte auf ihn herab. Sie kam Träumer bekannt vor. „Hier bist du ja, kleiner Dichter“, sagte Schatten mit einer lauten, drohenden Stimme Das Mädchen sprang auf, ihre großen Rehaugen blickten entsetzt Schatten an. „Was tust du hier?“, fragte sie. „Du bist doch ein Mörder! Wie hast du es geschafft, hierher zu gelangen? Niemand, der töten kann, darf sich hier aufhalten!“ In ihren Augen stiegen die Tränen hoch. Träumer blickte Schatten überrascht an. „Sie ist eine Nymphe“, sagte Schatten leise. Träumers irritierter Blick war Antwort genug. Er hatte nicht verstanden. „Ein Feenwesen“, sagte Schatten nachträglich. „Komm jetzt Träumer, hier ist nicht der richtige Ort für dich.“ Träumer blickte von Schatten zu dem Mädchen, das nun nach seiner Hand griff und ihn verzweifelt ansah. „geh nicht“, sagte sie leise und blickte ihn flehend an. Träumer ließ nur ungern ihre Hand los. „Wenn ich dir schwöre, zu dir zurückzukehren“, sagte er. „Wirst du mich dann gehen lassen?“ Sie überlegte kurz, dann nickte sie. „In Ordnung.“ Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. In ihm schoss sofort die Röte hoch und seine Wange pulsierte, sodass es fast schon wehtat. Schatten blickte Träumer überrascht an, als dieser ihr ebenfalls einen Kuss gab, obwohl er allerdings nur einen Kuss auf die Hand nahm. Dann ließ er die Hand der Nymphe los. Schatten zog ihn hoch und schob ihn aus der Hütte. Der Baum knarrte, als Träumer ins Freie trat. „komm jetzt“, sagte Schatten ungeduldig und schob Träumer weiter. Weg von dem See, weg von dem Haus, weg von dem Baum. Träumer ließ sich fort zerren, doch er dachte immer noch an die kleine Nymphe, an ihre Haare, an ihr Lächeln. Er seufzte. „Wie hast du mich überhaupt gefunden?“, fragte er, doch Schatten antwortete nicht. Er führte Träumer zu Chila, die ihn besorgt musterte. „Alles in Ordnung?“, fragte sie. Träumer nickte. „Nymphen sind gefährlich“, sagte Schatten. „Sie saugen einem jedes Verlangen ab. Wenn man einmal eine Nymphe liebt, ist man nicht mehr in der Lage, etwas für eine menschliche Frau zu empfinden.“ Träumer zuckte mit den Schultern. „Ist denn das wichtig?“, fragte er. Ihn interessierten menschliche Frauen nicht. Nur sie... er stutzte. Sie brauchte einen Namen. Magnolia klang schön. Vielleicht würde er ihr den Namen schenken, wenn er zurückkehrte. „wir müssen wieder unserem Weg folgen“, sagte Schatten streng. Träumer nickte, doch er hatte das Gefühl, nicht mitgehen zu wollen. Er wollte einfach nicht. Dennoch ging er. Stundenlang, tagelang. Die Sehnsucht blieb, er konnte nicht vergessen.
12. Phaelandriel
Phaelandriel atmete die kalte Luft ein, die sich im ganzen Raum ausgebreitet hatte. Es war still um sie herum, eine Stille, die sie einerseits genoss, andererseits aber für störend empfand. Sie zog einen Wachstift aus der Tasche ihres langen Gewandes. Mit einer geschickten Handbewegung malte sie einen Kreis in die Luft. Die Umrisse des Kreises leuchteten kurz blau auf. Dann legte der Kreis sich auf den Boden und verschmolz. Zurück blieb nur ein leichter Hauch von Wachs in der Luft und ein Kreis mit verkohltem Umriss auf dem Boden. Sie zeichnete erneut, diesmal war es ein Pentagramm. Wieder fuhr sie die Umrisse in der Luft mit ihrem Wachsstift nach, Sekunden später befand er sich auf dem Boden. Sie hob vorsichtig die Schleppe ihres Kleides an und stieg in den Kreis. Nun schloss sie die Augen. Es war wieder einmal soweit, sie würde ihre Kraft erneuern. Ihre Kraft, die ihr ein Dämon schenken würde. Die Leute hatten recht damit, wenn sie sagten, dass es keine Magier gab. Es waren nämlich keine Magier in dem Sinne, sondern Beschwörer. Sie war keine Hexe, sie war eine Beschwörerin. Sie beschwor Tote und den Teufel, Dämonen und was es sonst noch alles gab. Sie hatte die Macht, die sonst nur den Mächten des Bösen zuteil ward und sie konnte sie benutzen wie sie wollte, wie es ihr gerade einfiel. Sie hob die Hand und ließ sieben Kerzen heranschweben. Jede einzelne Kerze wurde an ihren Platz gesetzt, an die Ecken des Beschwörungspentagramms und an den Schutzkreis. Phaelandriel verfiel in einen nichts sagenden, unheimlichen Singsang. Sie summte eine Melodie, immer und immer wieder dieselbe, merkwürdige, unheimliche Melodie. Während sie die Beschwörung vorbereitete summte sie, während sie im Kreis stand und noch einmal die Beschwörungsformel durch ging, während sie sich darauf vorbereitete, die ersten Worte zu sprechen, während sie alles noch mal im Kopf durch ging. Die Planung, ihre Forderungen. Sie würde neue Kraft erhalten, um ihren Plan nach Eroberungen umsetzen zu können. Es war wichtig, dass diese Beschwörung einwandfrei durchgezogen wurde. Sie blickte zu der Tür, die den Keller mit dem Schloss verband. Ein Gedanke und die Tür verschloss sich klickend. Phaelandriel atmete noch einmal tief durch, dann sprach sie die ersten Worte der langen Beschwörungsformel. Es war eine fremde Sprache, von der nur die Begabtesten Beschwörer überhaupt wussten, was es bedeutete.
„Iskah sioueb Gestriajn“, sagte sie und schloss die Augen. Komm zu mir und erscheine. „Ansproon ahrnwoold woiebajd.“ Finde den Weg und erscheine. „jahras wulkoan wirljs.“ tauche aus den Tiefen der Hölle. Sie öffnete die Augen und wartete ab. Es verlief soweit noch alles nach Plan. Jetzt musste der Dämon nur noch erscheinen. Sie hatte ihn nicht bei seinem Namen gerufen. Hätte sie ihm einen Namen gegeben, hätte er Macht besessen, sich ihr zu widersetzen, etwas, das niemals geschehen durfte. Er durfte nicht genug Macht haben, um den Beschwörer in Frage stellen zu können. Sobald das geschehen war, konnte man ihn nur noch zurückschicken und hoffen, dass er sich nicht rächen würde. Phaelandriel lächelte spitz. So etwas passierte nur den geringeren Beschwörern. Sie allerdings war eine Meisterin. Sie war geboren, um Dämonen zu beschwören, sie war geboren, um zu herrschen. Es war nicht wichtig, wer der Dämon war. Natürlich, mit einem Namen war es wahrscheinlicher, dass der Dämon überhaupt erschien, aber er hatte dann Macht über seinen eigenen Namen. Das war zu gefährlich. Sie wollte sich sicher sein.
Eine Aura erschien im Pentagramm. Sie war schwach und durchsichtig, doch Phaelandriel konnte sie spüren. Sie konnte sie fühlen, merkte, wie sie im Pentagramm herum waberte und nach einen Ausgang suchte. Nur würde es hier keinen Ausgang geben. „Zeige dich“, gebot sie ihm jetzt in ihrer Sprache. Es war ein klarer, harter Befehl. Dämonen konnten sich keinen Befehlen widersetzen, wenn sie keinen Namen besaßen. Ein Dämon ohne Namen war Niemand. Wenn man keinen Namen besaß war es so, als wäre man gar nicht existent, als würde man überhaupt niemals auf der Erde gewandelt haben. Deshalb nur hatten Menschen Namen und deshalb nur gab sie diesem Dämon keinen Namen. Denn wenn sie mit ihm fertig war, dann würde er nicht mehr existieren, Name hin oder her. Der Dämon erschien. Es war ein wabernder, weißer Nebel, der immer auf der gleichen Stelle schwebte, immer noch verzweifelt nach dem Weg nach draußen. „Nimm eine menschliche Gestalt an, du Wicht!“, schrie Phaelandriel erbost. Was bildete sich dieses Wesen ein?! Vor ihr erscheinen und dann sich die Frechheit erlauben, ein Nebel zu werden, etwas, dass sie nicht fassen konnte? Der Nebel verdichtete sich zu einer menschlichen Gestalt, aber es war immer noch ein Nebel. „Wähle die Gestalt eines Menschen“, sagte Phaelandriel erneut. Sie blickte wütend zum Pentagramm, das Bannfeld, das sie selbst hergestellt hatte. Dieser Dämon hielt sich wohl für überdurchschnittlich witzig. Das Lachen würde ihm noch vergehen, zumal Lachen sowieso eine menschliche Eigenschaft war, die keinen Dämonen gebührte. „Wer bist du?“, fragte sie ihn mit gebieterischer Stimme, wohl wissend, dass er ihr auf diese Frage keine Antwort geben konnte. Ich bin der, der ich bin, sagte der Dämon mit einer tiefen, männlichen Stimme. Phaelandriel zog die Augenbrauen hoch. Er hatte ihr geantwortet, wie überaus merkwürdig. „Erläutere dich“, befahl sie, nun doch wider Willen interessiert. Ich bin der, von dem ihr wünscht, der ich bin. Ich bin der, der ich sein werde, wenn ihr mir einen Namen gegeben habt, wenn ihr mir eine Gestalt gegeben habt. Ihr seid meine Meisterin, Königin Phaelandriel. Sie lächelte, von den Worten geschmeichelt. Dann blickte sie den Dämon, den Nebelmenschen, an. Sie runzelte die Stirn. Woher kannte er ihren Namen? Er war nicht das, was sie erwartet hatte, aber zweifelsohne interessant und möglicherweise auch jemand, von dem sie mehr Kraft beziehen konnte, als sie eigentlich benötigte. „Du kennst meinen Namen“, sagte sie langsam und ließ sich die Worte während sie sie sagte, noch einmal durch den Kopf gehen. Er kannte ihren Namen. Er kannte ihren Namen. Wieso kannte er ihn? Woher kannte er ihn? Wer war er? WER war er? Wo kam er her? Was wollte er von ihr? Sie war sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob er ihr untergeordnet war, oder ob er nicht einfach ein Spiel mit ihr spielte, ein fieses, kleines Spielchen, das nur zu seinem Zeitvertreib diente. Ich kenne ihn. Es ist ein Name, den man nicht so leicht vergisst. Ihr wart in der Prophezeiung, Königin. Ihr wisst nicht, wer ich bin und ich weiß es nicht mehr, seit ich hier bin, seit ihr mich in Eure Welt gebannt habt. Wenn ich zurückkehre, dann werde ich es wieder wissen, ich werde wissen, wie mächtig ich war und wie leicht ich euch hätte zerquetschen können. Oder ich werde wissen, wie schwach ich war und wie leicht ihr mich hättet zu Eurem Eigen hättet machen können. Aber ich werde wohl nicht zurückkehren. Ich werde wohl hier bleiben, ohne Namen, ein Diener einer mächtigen Königin. Ihr Energiespeicher. Ihr seht, Königin Phaelandriel, ich bin bereit dazu. Ich bin bereit, Euch zu dienen, Euch zu gehorchen und Euch jeden Gehorsam zu versprechen. Der Geist verneigte sich und sein nebliger Körper wurde zu Fleisch, er wechselte die Gestalt zu einem Menschen. Als der Mann hoch blickte, starrte Phaelandriel entsetzt zu ihm. „Du?“, fragte sie überrascht und aufgebracht. „Was tust du hier? DU?“ Der Mann blickte unter den schwarzen Haaren sie auf eisblauen Augen an. Er lächelte. „Ihr kennt diese Gestalt, meine Königin?“, fragte er mit menschlicher Stimme. „Erkennen? ERKENNEN? Das ist hier nicht die Frage!“, kreischte sie überrascht. Der Mann fuhr sich mit den Fingerspitzen über den durchtrainierten Oberkörper, Phaelandriel sah ihm dabei zu. Sein Lächeln war magisch, wirkte überirdisch und passte nicht zu der Gestalt, die sie kannte. „Drorn“, flüsterte sie leise. „Es ist Drorns Gestalt.“ Der Dämon blickte sie erneut an, in seine eisblauen Augen mischte sich nun ein Rotton, den sie bei Dämonen gewohnt war. „Ihr wollt mich als Diener, nicht wahr?“, fragte er und lächelte. „Ihr liebt diesen Körper. Er ist so schön. Vielleicht interessiert Euch auch, wie ich zu der Gestalt komme? Wir können es alles besprechen, wenn ihr mich zu dem Euren gemacht habt.“ Phaelandriel überlegte kurz. Sie könnte diesen Körper immer in ihrer Nähe haben, diesen vollkommenen Menschen. Auch wenn er kein Mensch war und das Original irgendwo in der Welt noch lebte und unterwegs war. Sie nickte. Sie wollte ihn. Hatte sie zuerst vorgehabt, den Dämon zu verschlingen und sich seine Kraft zu Eigen zu machen, so war ihr Plan jetzt ein anderer. Es gab andere Methoden, wie ein Dämon seiner Herrin Kraft geben konnte, dazu musste sie ihm nicht das Leben nehmen. Sie musste ihm nur einen Körper geben. Einen menschlichen Körper. Wer wäre dafür geeignet? Phaelandriel überlegte kurz. Ihre Tochter? Aber Phenelope war ein Mädchen. Sie brauchte einen Mann.
In diesem Moment klopfte es an der Tür. „Mylady Phaelandriel?“, fragte eine Stimme. Phaelandriel lächelte böse. Der Kurier war also zurück, er hatte ihre Botschaft erfolgreich im ganzen Reich verbreitet. Schade nur für ihn, dass er diesen Triumph nicht länger genießen würde können. Aber dennoch sollte er sich glücklich schätzen. Sein Dienst würde ihr selbst, der Königin, von großem Nutzen sein. Damit auch für das ganze Königreich. Mit einem Gedanken entriegelte sich das Schloss. „Komm herein“, rief sie, dann lächelte sie kalt. Zu dem Dämon gewandt sagte sie: „Er sei dein.“ Sie machte das Zeichen, mit dem sie den Dämon aus dem Bannfeld befreite. Der Kurier öffnete die Tür und lächelte Phaelandriel an. „Hier seid ihr also. Ich habe den Auftrag erfolg...“ er stockte überrascht, als etwas in ihn hinein schlüpfte. Phaelandriel lächelte ihm zu, als der Kurier zu Boden sank und dabei das Bewusstsein verlor. Er schloss die Augen, als er auf dem Boden aufprallte. Sie blieb in ihrem Kreis stehen und beobachtete das weitere Geschehen. Noch passierte nichts, aber der Dämon war noch irgendwo hier im Raum, das konnte sie spüren. Sie konnte den Kreis nicht verlassen, bevor der Kurier nicht vom Dämon eingenommen worden war, denn sonst lief sie Gefahr, selbst eine Besessene zu werden. Sie fuhr mit der Hand durch ihr blondes wallendes Haar und wartete. Ihre Schönheit war seitdem der König eines merkwürdigen Todes gestorben war, nur größer geworden. Heute hatte sie erneut Heiratsanträge abweisen müssen. Dabei hatte sie immer nett tun und lächeln müssen, jetzt war es genug. Ihr Lächeln war zu strapaziert, sie würde den Rest des Tages in gleichgültiger Stimmung verweilen. Eine Hand legte sich auf ihre Schulter. Sie fuhr überrascht herum- und blickte in Drorns Augen. „Hallo, hübsche Königin“, sagte der Dämon mit Drorns Stimme. Phaelandriel errötete, das hatte sie schon lange aus diesem Mund hören wollen. Wen störte es, dass er nicht der richtige Drorn war? Sie trat aus dem Kreis und blickte ihren neuen Diener an. „hast du auch einen Namen?“, fragte sie ihn mit einem hochmütigen Blick. Der Mann lächelte sie an, als wäre er ihr komplett verfallen. „Jeder Name, der meiner Königin gefällt, ist der meine.“ Phaelandriel lächelte. „So nenne ich dich Drorn“, sagte sie und entblößte ihre makellosen Zähne. „Nach dem, dessen Aussehen du besitzt.“ Der Dämon im Menschenkörper lachte mit Drorns männlicher, tiefer Stimme. „Was immer Ihr wünscht, schönste Königin.“
13. Träumer
Träumer lief hinter Schatten und Chila her. Er dachte nur noch selten an das Mädchen mit den weißen Haaren, aber sie wollte seinen Kopf nicht ganz verlassen. In Momenten, in denen er an nichts Böses dachte, schlich sie sich in seine Gedanken, sie war mit ihm beim Aufstehen und beim Einschlafen, immer dann, wenn er es nicht erwartete, aber nie dann, wenn er ihre Anwesenheit suchte. Man konnte es getrost einen Überfall nennen, denn so kam es Träumer selbst auch vor. Er lief hinter Schatten her, den ganzen Weg, den er hinter dem seltsamen Leuchtwesen hergelaufen war und weiter, immer weiter. So vergingen Tage, einige Tage. Träumer seufzte. Es war jetzt über ein Monat vergangen. Er wusste nicht mehr, wie weit er von zu Hause entfernt war. Manchmal erinnerte er sich nicht einmal mehr an Thomes Gesicht, oder an das Gesicht des kleinen Kindes, das ihn immer angelächelt hatte. Ab und zu kamen Bilder in seinen Kopf. Bilder von den toten Spinnen oder von dem Mann, den Schatten vor Träumers Augen ermordet hatte. Das Mädchen, das so versessen darauf gewesen war, ihn zu heiraten. Schattens Wahl, die auf Chila fiel. So viele Erinnerungen und Bilder, Dinge, die er nie erlebt hätte, wenn er im seinem Dorf geblieben wäre. So vieles... Er seufzte. „Schatten“, rief er. Schatten drehte sich um, blieb aber nicht stehen, sondern ging rückwärts weiter. „was ist?“, fragte er. Träumer stellte die Frage, die ihm in den Sinn gekommen war, er allerdings nicht aussprechen wollte. „wann sind wir endlich da?“, fragte er. Schatten lachte. „Du beobachtest deine Umgebung überhaupt nicht, oder?“, fragte er grinsend. Träumer sah ihn verwirrt an. „Wieso?“, fragte er. „Weil wir heute Abend da sein werden“, sagte Schatten und deutete an den Horizont. Träumer blickte in die Richtung, in die Schatten zeigte und er sah Berge. Berge, die an den Spitzen mit Schnee bedeckt waren. Er sah zu Schatten und starrte überrascht auf die Berge. „Werden wir dort hindurchgehen?“, fragte er entsetzt. Schatten zuckte mit den Schultern. „Wer weiß?“, sagte er lächelnd. Träumer sah ihn an und verzog das Gesicht. „Schluss mit der Geheimniskrämerei“, sagte er. „Erzähl endlich alles. Und lass nichts aus.“ Schatten winkte ab. „Heute Abend“, sagte er. „Wenn wir rasten.“ Schatten drehte sich wieder um. Träumer fragte: „Kannst du das schwören?“ Er sah, wie Schatten mit dem Kopf nickte. „Ich schwöre.“ Die Worte wehte der Wind zu Träumer heran, allerdings waren sie so leise, dass Schatten auch etwas anderes hätte antworten können. Dennoch fragte Träumer nicht noch einmal nach. Er wusste, dass er keine Antwort bekommen würde, wenn er noch einmal nachfragte. So gingen sie weiter, immer weiter. Träumer hatte durch die ganze Lauferei zu viel Zeit zum Nachdenken. Er wollte jetzt nicht über alles und nichts Nachdenken, aber er hatte nichts anderes zu tun. Er zwang sich, an nichts zu denken, einfach zu laufen, immer nur zu laufen, immer gerade aus, immer den beiden anderen hinterher. Es wurde kälter, je näher sie dem Gebirge kamen. Es wurde dunkler und dunkler. Dunkel und kalt, dachte Träumer resigniert. Das wird ja schön. Er wusste, dass er es jetzt schon nicht mögen würde. Er war einfach nicht für lange Wanderungen gemacht, schon gar nicht, wenn sie erstens anstrengend waren und zweitens extreme Unempfindlichkeit bei niedrigen Temperaturen voraussetzten. Der Mond schlich ans Firmament und löste mit einem leicht melancholischem Lächeln die Sonne ab, die sich ihre Nachtmütze nahm und auf die andere Seite der Erde wechselte, um dort erst einmal ordentlich aus zu schlafen. Schließlich musste sie am nächsten Tag wieder fit sein und ihren gewohnten Platz einnehmen. Träumer, Chila und Schatten waren währenddessen am Fuß des Gebirges angekommen. Schatten hatte unterwegs Holz gesammelt und machte sich nun daran, ein Feuer zu entfachen. Das erste Mal, dass sie ein Feuer machten, bemerkte Träumer überrascht. Wieso jetzt auf einmal und vorher nicht? Minuten später waren ihm viel wärmer geworden, das Feuer erfüllte seine Pflicht und der Gedanke, durch das Gebirge zu wandern, erschien ihm nur noch halb so schlimm wie zuvor. Schatten breitete seinen Mantel auf dem Boden aus und setzte sich darauf. Träumer tat es ihm gleich. Der Erdboden war kühl und der Mantel kaschierte das kaum, doch besser ein Mantel als nichts. Chila schien das nicht so zu sehen. Sie hatte sich zwar auch auf ihren Mantel gesetzt, wirkte aber höchst unglücklich. Offensichtlich war ihr viel zu kalt. Träumer blickte sie mitleidig an, doch Schatten ignorierte sie einfach. „Du wolltest den Rest wissen, kleiner Dichter?“, fragte er, doch es war weniger eine Frage, als mehr eine Aussage- mit einem Fragezeichen dahinter. Er wollte nicht fragen, eigentlich schien er auch keine Antwort haben zu wollen. Dennoch nickte Träumer und sagte: „Ja. Ich wollte den Rest hören.“ Schatten blickte ihn an, lange schwieg er, doch dann setzte er sich auf und nickte. „in Ordnung“, sagte er und nahm das Tuch von seinem Mund ab. Chila schnappte kaum hörbar nach Luft. Sie starrte Schatten an, als wäre er irgendein Übermensch. Träumer grinste. Auch sie schien Schatten für einen verdammt attraktiven Mann zu halten. Sie hatte ihn ja auch noch nie jemanden töten sehen. Er schauderte, als ihm der Gedanke daran wieder hoch kam. Auch wenn Schatten getötet hatte, damit die beiden lebten, schien es Träumer immer noch nicht richtig. Seine Einstellung verbot ihm, dass, was Schatten zu ihrem Schutz getan hatte, als richtig zu empfinden. Er kicherte. Wie paradox. Schatten blickte Chila an, die errötete und sich anders hinsetzte, wohl um ihre weiblichen Reize mehr hervorzuheben. Schatten wandte sich ihr wieder ab und Träumer konnte ihr enttäuschtes Gesicht sehen, das aber sofort, als sie bemerkte, dass Träumer ihr zusah, zu einer gleichgültigen Miene vereiste. Er lächelte. Schatten räusperte sich. „wo war ich denn stehen geblieben?“, fragte er Träumer. Träumer legte nachdenklich die Stirn in Falten. Wo war er stehen geblieben? Da fiel es ihm ein. „Der Dichter“, sagte Träumer leise. „Du wolltest erzählen, was mit ihm geschehen war. Mit ihm... und mit seiner Frau.“ Schatten nickte. „ach ja“, sagte er und lächelte. „Sie waren beide sehr nette Menschen.“ Chila blickte nur verständnislos herüber, aber dennoch beugte sie sich etwas vor, um ebenfalls den Worten Schattens zu lauschen. Träumer war sich nicht sicher, ob der Inhalt sie wirklich interessierte, er bezweifelte das sogar. Vielleicht hörte sie nur zu, weil sie am liebsten dauernd Schattens Stimme gelauscht hätte. Träumer widmete seine Aufmerksamkeit wieder Schatten, der nun anfing, den Rest seiner Lebensgeschichte zu erzählen. „ Der Dichter war einer der nettesten Menschen, die mir je begegnet waren und seine Frau war schöner als alles, was ich jemals gesehen habe. Sie war so schön, dass immer Leute kamen, um sich von ihrer Schönheit zu überzeugen und dann Lieder und Gedichte über sie zu schreiben, oder um ihr Bücher zu widmen. Ich glaube, sie war auch die Muse des Dichters, immer, wenn er nicht weiter wusste, dann baute sie ihn auf, sie las seine Arbeit und lobte und kritisierte ihn, wenn es ihr notwendig erschien. Sie war eine perfekte und liebevolle Ehefrau. Ich wünschte mir oft, dass sie meine eigene wäre, doch niemals wäre ich auf die Idee gekommen, ihr jemals von meinen Gefühlen zu berichten.“ Schatten schwieg eine Weile und starrte gedankenverloren in den Sternenhimmel. Er dachte an sie, da bestand kein Zweifel. Träumer ließ ihn eine Weile so dasitzen und träumen, doch als er keine Anstalten machte, weiter zu erzählen und immer nur da saß und keine Regungen zeigte, räusperte sich Träumer leise und riss Schatten damit aus der Trance. „Der Dichter und sie waren das glücklichste Ehepaar, das jemals auf der Erde gewandelt war“, sagte er. „Bis etwas geschah, dass keiner von den beiden geahnt hatte. Selbst ich hätte es niemals wissen können. Sie wurden dafür bestraft, dass sie mich aufgenommen hatten. Sie wurden dafür bestraft, dass ich diese Frau liebte. Sie wurden dafür bestraft, dass sie glücklich waren, weil es mich glücklich machte, bei ihnen zu sein, wenn sie so glücklich waren.“ Träumer verstand gar nichts. Wieso bestraft? Von wem? „Eines Tages geschah es einfach“, sagte Schatten und seine Miene wurde hart. „SIE kam ins Dorf.“ Träumer sah Schatten an. „SIE?“, fragte er irritiert. „Ja“, nickte Schatten. „Sie. Diejenige, die Schuld an meinem Unglück ist. Sie ist jetzt Königin, wusstest du das? Oh ja. Phaelandriel, dieses verfluchte Miststück!“ er spie das Wort aus, als wäre es das widerwärtigste, dem er je begegnet war. Träumer sah Schatten an. Der Name löste in ihm nichts aus, rein gar nichts. Das bedeutete wohl, dass er diese Person nicht kannte. Überhaupt nicht kannte. Doch Als Schatten sagte, dass sie Königin war, merkte er allmählich, wohin sie gingen und vor allem- warum. Was Schatten vorhatte. Die ganzen Einzelheiten wurden langsam heller. Miststück... „Sie kam an einem Frühlingstag und mit ihr eine Gruppe von Schauspielern. Ich traf sie das erste Mal auf dem Marktplatz, als ich für uns Wasser holte. Sie war eine hübsche junge Frau, aber älter als ich, wohl um die 26 Jahre. Wir unterhielten uns etwas. Ich weiß gar nicht mehr genau, worüber, doch auf einmal meinte sie, dass ich mit ihr gehen sollte. Ich lehnte ab. Sie verlangte, die Gründe zu erfahren. Also erzählte ich ihr alles. Ich erzählte ihr vom Dichter, von seiner schönen Frau, davon, wie glücklich ich mit den beiden war. Und schließlich von dem Kind, das die beiden bekommen würden.“ Schatten starrte in die Flammen. „Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe“, sagte er. „Auf alle Fälle hörte sie mir zu, geduldig und interessiert. Ich hätte ja nicht ahnen können, was dann geschehen würde. Sie verschlang jedes Wort, jedes einzelne Wort. Sie hörte zu, aber nicht, als würde sie hören, sondern so, als wäre jedes Wort, das ich sprach, lebensnotwendig für sie. Als wäre sie süchtig nach meiner Stimme. Sie machte mir Angst. Deswegen habe ich das Gespräch verkürzt.“ Schatten holte Luft. „Sie merkte, dass mir ihre Anwesenheit unangenehm war. Sie wurde richtig böse und meinte, dass ich nie wieder glücklich werden solle. Dass sie mein Glück zerstören wollte. Sie verfluchte die Frau, die ich so abgöttisch liebte. Die Frau des Dichters.“ Schatten brach erneut ab. Träumer saß da und starrte Schatten fassungslos an. Was war das für eine Frau? Schön und kaltherzig, bösartig. So sollten Frauen nicht sein. Dazu waren sie doch nicht geschaffen! Kein Mensch war dazu geschaffen, anderen ein Leid an zu tun. Niemand. „Die Frau wurde krank. Sie gebar zwar ihr Kind, aber starb bei der Geburt. Der Dichter musste eine Hebamme für das kleine Kind suchen, damit es nicht verhungerte. Fünf Jahre später starb es ebenfalls.“ Chila schnappte entsetzt nach Luft. Sie lauschte der Geschichte noch andächtiger als Träumer und Schattens Vergangenheit schien sie wirklich mitzunehmen, auch wenn sie nicht die ganze Geschichte kannte. „Danach verließ er das Land. Einfach so. Er ließ mich allein zurück. Ich ging in die Hauptstadt. Wenige Jahre später sah ich sie erneut. Sie war eine Ehe mit dem König des Landes eingegangen. Kurze zeit später erfuhr ich, dass auf mich ein Kopfgeld ausgesetzt worden ist. Sie hat mich jagen lassen wie ein wildes Tier. Ich habe mir geschworen, sie zu töten. Sollte es das Letzte sein, was ich in meinem Leben tue, dann war es so bestimmt. Dann sollte es so sein.“ Träumer nickte. Ihn war nun einiges Klar. Schatten schnaubte noch einmal leise, dann schüttelte er den Kopf. „Jetzt weißt du alles. Alles, was du wissen musst. Noch irgendwelche Fragen?“ Schatten blickte Träumer an. Träumer schwieg. „Dann ist ja alles klar“, sagte Schatten und legte sich hin. Sekunden später war er eingeschlafen. Träumer blickte Chila an, die immer noch da saß und nachdenklich auf Schatten starrte. „Das hast du nicht gewusst, hm?“, fragte Träumer sie. Es war das erste Mal, dass er sie ansprach. Sie blickte ihn verwirrt an. „Nein“, sagte sie dann. „Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich habe nichts davon gewusst. Du etwa?“ Träumer schüttelte den Kopf. „Ich hatte keine Ahnung“, sagte er. Er hatte wirklich keine Ahnung gehabt, aber jetzt zumindest war alles klar. Zumindest so klar, wie es ihm sein sollte. Er legte sich hin, die Arme hinter dem Kopf verschränkt blickte er zum Sternenhimmel. Sein Hut lag auf seinem Kopf, behinderte seine Sicht allerdings nicht sonderlich. Er dachte an Magnolia, an ihr Lächeln und fragte sich, wie es ihr wohl ging. Einer inneren Eingebung folgend holte er die weiße Flöte hervor und spielte ein Lied. Er wusste, dass sie es hören würde. Er lächelte. Der Baum würde bedrohlich knarren, wütend über den Verlust seines Holzes. Sie würde sich an den Baum lehnen, ihm beruhigend zuflüstern und der Melodie lauschen, die dort, wo sie war, nicht melancholisch, sondern fröhlich klingen. Es würde sie daran erinnern, dass er bald zurückkehren würde. Er blies in die Flöte und die leise Melodie wurde vom Wind getragen, weit über die Ebene. Die Melodie würde ihren Weg zu ihr finden, genauso wie er irgendwann den Weg zurück zu ihr finden würde. Dann würde er mit ihr nach Hause zurückkehren. Er lächelte. Thome würde sich sicher freuen, wenn er ein Mädchen mitbrachte. Sie war schließlich ein Mädchen. Auch wenn sie eine Nymphe war, war sie eindeutig nicht männlich, sondern weiblich. Thome hatte sich nie Sorgen um ihn in dem Sinne gemacht, aber er hatte sich gefragt, warum Träumer nie ernsthaft über die Mädchen im Dorf nachdachte. Dabei hatte Träumer sie immer genau beobachtet. Er hatte sie gesehen und ihnen zugesehen. Zuerst hatte ihre Gestalt sie bezaubert, doch der Zauber war verflogen, als er sah, wie sie mit sich umspringen ließen. Dass sie still und ohne zu Murren das taten, was sie sollten, hatte Träumer verwirrt und sein Interesse zu ihnen erstickt. Doch dieses Mädchen war anders. Irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise war sie besonders. Er schloss die Augen und wusste, dass morgen ein neuer Tag beginnen würde. Er grinste. So viel Intelligenz hatte er sich gar nicht zugetraut.
21. Drorn
Träumer war schon viel zu lange fort. Schatten saß in dem Zelt, das Alan ihm zur Verfügung gestellt hatte und warf der Zeltwand finstere Blicke zu. Er hatte Träumer nicht aufhalten können, sein Blick war zu entschlossen gewesen, aber jetzt wünschte er sich, er hätte es getan. Der Junge war noch nicht soweit! Und vor allem nicht mit so einem seltsamen gefährlichen Magier! Dieser Alan wollte ihn doch umbringen, deshalb hatte er ihn so schnell ziehen lassen. Vielleicht hatte dieser Lian den Auftrag, sofort zurück zukommen, wenn er Träumer irgendwo ganz allein zurückgelassen hatte, wo er auch nicht zurückkommen konnte. Schließlich hatte Schatten den Blick in Alans Augen gesehen. Die Verachtung, die Ungläubigkeit und dann dieser Gesichtsausdruck. 'Was willst du mit diesem nichtsnutzigen Trottel?', hatte sein Blick ihn gefragt. Natürlich brauchten sie ihn, Schatten, um den Menschen die nötige Hoffnung zu geben. Er war so ziemlich das Symbol des Widerstandes gegen eine tyrannische Königin, denn er hatte ihr schon so oft die Stirn geboten, dass es schon niemand mehr zählen konnte. Aber jetzt.... ohne Träumer würde er nicht in den Kampf ziehen. Zumindest nicht, wenn er nicht wusste, dass es ihm gut ging. Er war in der kurzen Zeit zu seiner Familie geworden, zu allem, was ihm blieb. Sollte er ihn jetzt auch noch verlieren - das würde er keinem vergeben. Dem Magier nicht, den Rebellen nicht, Alan nicht.
Etwas pochte gegen die Zeltwand und Schatten fuhr aus seinen Gedanken hoch. „Wer ist da?“, fragte er und stand auf, in Alarmbereitschaft. In den Zelteingang trat eine junge Frau, ein Tablett in den Händen. „Ich bringe euer Abendmahl, werter Herr Drorn“, sagte sie und senkte den Blick. Schatten nickte nachdenklich. „Stell es dahin und lass mich dann allein“, sagte er und deutete auf einen provisorischen Tisch, der in der Mitte des Raumes stand. Sie tat wie geheißen und stellte das Tablett ab. Dann jedoch blieb sie stehen. Schatten warf ihr einen irritierten Blick zu. „Gibt es noch etwas?“, fragte er und seine Augen musterten die schüchterne Frau, die unter seinem Blick rot anlief. „Nun...“, sagte sie und ihre Finger suchten Halt an ihrem Kleid. „Wenn ihr noch einen anderen Wunsch habt.... Mir wurde aufgetragen, euch in jeder Art und Weise behilflich zu sein. Wenn ihr versteht.“
Schatten sah sie überrascht an. Jede Art und Weise? Meinte sie damit... Verachtung flackerte in seinen Augen auf. Dieser Alan! Dachte er ernsthaft, dass er Schatten mit so billigen Tricks zufrieden stellen konnte? Er war nicht einer dieser wollüstigen Männer, die für eine Frau am Abend seine Treue schwören würden. Eine Frau in einer solchen Weise zu benutzen... nein, das konnte er nur, wenn er wirkliche Absichten hatte. „Ich nehme das Angebot zur Kenntnis“, sagte er langsam. „Aber ich lehne ab. So ehrenhaft eure Absichten auch sein mögen und egal wie groß eure Angst vor Alan ist, ich werde nichts dergleichen mit euch tun. Und Gesellschaft brauche ich jetzt auch nicht. Also geht bitte.“ Er versuchte, seine Stimme ruhig zu halten und sah wieder gegen die Zeltwand. Also wirklich. Wie hatte Alan dass Mädchen dazu bekommen, sich ihm bereitwillig hinzugeben? Gewalt? Vielleicht tat sie es auch, damit sie ihm gefiel; das verliebte Herz tat manchmal seltsame Dinge.
Doch das Mädchen ging nicht. Stattdessen setzte sie sich in einigem Abstand zu Schatten auf den Boden. „Warum tragt Ihr das Gesicht immer vermummt?“, fragte sie und musterte den Boden mit einem interessierten Blick. Sie traute sich anscheinend immer noch nicht, ihn anzusehen. „Habt Ihr eine tiefe Narbe im Gesicht? Oder seid ihr irgendwie anders entstellt?“ Als Schatten schnaubte, fuhr sie zusammen. „Verzeiht, das war sehr ungehobelt von mir“, flüsterte sie. „Aber die Frauen haben sich gefragt, wie ihr wohl ausseht. Und nun ja...“, sie blickte ihn leicht lächelnd an. „ich soll die Antwort für eine Freundin herausfinden.“
Schatten erwiderte ihren Blick ausdruckslos. „Ich trage dieses Tuch, weil es sicherer ist.“ Das Mädchen hörte interessiert zu. „Sicherer für wen?“, fragte sie. „Sicherer für die Leute, die mich nicht erkennen, wenn ich bei ihnen etwas einkaufe. Oder ihnen zufällig über den Weg laufe.“ Sein Blick wurde hart. „Ich bin der meistgesuchte Mann im ganzen Land. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie es überleben, wenn sie mich sehen und es nicht melden? Zu allerletzt ist es auch sicherer für mich, weil ich so weniger Ärger habe. Und es sorgt für weniger Blut an meinen Händen.“
Schatten blickte auf seine rechte Hand. „Ich habe schon zu viel Blut gekostet, Kind. Und jetzt lass mich allein.“ Das Mädchen protestierte. „Nur einen Blick, mein Herr! Nur einen...“ Schatten riss sich das Tuch von Gesicht und Nase und sah sie kühl an. „Raus hier“, sagte er leise. Das Mädchen, von einer plötzlichen Röte ergriffen, nickte benommen und kroch ein paar Schritte rückwärts. Dann rappelte sie sich auf und lief Richtung Zeltausgang. Kurz vorher drehte sie sich noch einmal um. „Denkt daran, dass ihr ordentlich essen müsst, Herr Drorn.“
Dann ließ sie die Stoffplane über Schattens Zelt zufallen. Schatten war wieder allein. Er blickte zu dem Tablett und ging einige Schritte darauf zu, um in Augenschein zu nehmen, was sie ihm gebracht hatte.
Es war nicht sonderlich viel, Brot, ein paar Früchte und etwas gebratener Fisch, dazu ein Schlauch, der vermutlich mit Wein gefüllt war. Schatten lächelte. Endlich wieder etwas vernünftiges zu essen.
Er setzte sich vor den Tisch und begann das Mahl. Ohne Träumers Gesellschaft hatte er schnell alle Speisen verzehrt und den Schlauch ebenfalls geleert. Dann verließ er sein Zelt und schlenderte nachdenklich zwischen den Zelten auf und ab, während die Sonne langsam unterging und alles in eine kühle Röte tauchte. Hoffentlich geht es Träumer gut, dachte Schatten besorgt. Hoffentlich kommt er gut bei sich zu Hause an. Und hoffentlich – das machte ihm viel mehr Sorgen – ist das, was er dort findet, nicht das, was ich befürchte.
Schatten ballte die Fäuste. „Träumer“, flüsterte er dem Sonnenuntergang zu. „Komm heil wieder zu mir zurück.“
22. Träumer
Um Träumer herum war es still. Der Zauberer sollte eigentlich schon seit einer Weile bei ihm sein, aber von Lian fehlte jede Spur. Langsam überkam Träumer ein schrecklicher Verdacht: Hatte der Zauberer ihn etwa hier herüber transportiert, wohl wissend, dass er nich wieder zurück konnte, um ihn hier sterben zu lassen? Natürlich, dieser Alan hasste ihn eindeutig, und Lian war sein Untergebener oder so etwas in der Art. War er dann hier verloren? Allein konnte er den Weg zu seinem Dorf nicht finden und ganz sicher nicht zurück zu Schatten gelangen. Verzweiflung brach über ihm zusammen, ließ ihm die Knie wackelig werden und brachte ihn schließlich dazu, auf dem Boden zusammenzusacken.
Er war hier vollkommen allein. Um ihn herum Dunkelheit. Und Schatten war vielleicht meilenweit weg. Er konnte ihm nicht helfen. Sein Dorf war möglicherweise zerstört, Thome war... Nein, daran durfte er nicht denken, bestimmt ging es allen gut. Es musste ihnen einfach gut gehen! Aber wie kam er hier allein heraus? Dieser Zauberer war vermutlich schon über alle Berge... „Was hockst du hier so trostlos herum?“, fragte ihn da eine ihm vertraute Stimme. Seine Augen weiteten sich. „Aber... Du hast mich ja gar nicht im Stich gelassen!“ Lian sah Träumer verwirrt an. „Natürlich nicht“, entgegnete er irritiert. „Warum sollte ich das auch tun?“
Träumer begann als Antwort nur zu lachen. Als er sich beruhigt hatte, stand in seinem Gesicht ein strahlen. „Denk nicht weiter drüber nach, lass uns gehen.“ Lian nickte zustimmend. Über ihm erwachte wieder die Lichtkugel und die beiden setzten ihre Reise fort. „Wir müssten bald das Ende des Tunnels erreicht haben“, bemerkte Lian. „merkst du, wie der Weg langsam ansteigt? Das ist ein sicheres Zeichen.“ Träumer nickte zustimmend. „Du weißt eine ganze Menge über diesen Tunnel“, sagte er. Lian schüttelte den Kopf. „Nein, eigentlich nicht. Ich bin hier auch noch nie gewesen. Allerdings... war ich schon mal in einem anderen. Die Zugänge sind alle gleich gesichert, da nur Zauberer die Gänge betreten konnten. Ich schätze, ihre Arroganz hat sie dazu getrieben.“ Er kicherte. „Das war auch ihr Untergang, weißt du? Die Arroganz eines jeden einzelnen Zauberers, weil jeder von sich dachte, dass er die Krone der Schöpfung ist und natürlich unbesiegbar. Solche Dummköpfe.“
Träumer hörte Lian nachdenklich zu. „Du meintest vorhin, du wolltest mir auf dem Weg die Geschichte erzählen, wieso es nur noch so wenig Zauberer gibt. Ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür?“ Lian erstarrte für einen Augenblick, dann sah er zu Träumer herüber, musterte ihn kurz, seufzte und nickte dann. „Wenn du sie wirklich hören willst, erzähle ich sie dir gern. Aber es ist eine ziemlich dumme Geschichte, und sie trieft nur so von Ignoranz und Arroganz. Wenn du gern eine Geschichte darüber hören willst, wie der Hochmut die Zauberer zu Fall brachte...“ Träumer unterbrach Lian, indem er ein leises Kichern vernehmen ließ. „Es ist schon gut“, sagte er. „Erzähl die Geschichte einfach.“ Und dann blickte er gespannt zu Lian, der ebenfalls ein Lächeln auf dem Gesicht hatte. Doch der Magier schwieg eine Weile und ging stumm voran, während Träumer versuchte, mit ihm Schritt zu halten. Anscheinend war er in seine eigenen Gedanken vertieft und Träumer fand es unhöflich, ihn noch einmal auf die Geschichte anzusprechen, also wartete er ab.
„Es fing an mit Blut“, flüsterte Lian schließlich. „Und es endete mit Blut. Hochmut gehörte schon immer zu den Lastern eines jeden Magiers. Arrogant, weil er mit einer besonderen Gabe gesegnet war, ignorant, weil er die Tugenden und Fähigkeiten eines normalen Menschen nicht anerkennen konnte. Und es wurde schlimmer mit jeder Generation. Magier, die Menschen mit Tieren gleichstellten, die ihre Macht vergrößern wollten, die der Meinung waren, sie hätten ein besseres leben verdient. Einige begannen, ihre Mitmenschen für Experimente zu missbrauchen, andere belegten sie mit Bannsprüchen und Flüchen, um sie so für Sklavendienste in Anspruch nehmen zu können. Und im Volk machte sich der Hass auf Magier breit. Zuerst nur still und unscheinbar, aber die Zauber der Magier wurden immer dreister, sie verzauberten Städte, ließen Ernten verschwinden, stahlen Frauen und Kinder aus ihren Betten. Es muss eine grauenhafte Zeit gewesen sein.“ Lian starrte nachdenklich in die Leere. Dann sah er zur Seite und sein Blick traf Träumers. „Dann war das Maß irgendwann voll. Die Leute begannen sich zu wehren, Zauberer zu jagen, zu foltern, zu töten. Und die Magier machten in ihrer Arroganz Fehler, sie unterschätzen die Leute und unterlagen schließlich. Die wenigen Überlebenden flüchteten. Aber die Magie wurde damit nicht ausgelöscht. Zwei Jahrhunderte lang wurden die Kinder, die mit magischen Fähigkeiten geboren wurden, ertränkt, bevor sie zu so einem Geschöpf heranwachsen konnten, das man damals so mühsam vertrieben hatte. Aber manche hatten Glück und überlebten, sei es durch Mutterliebe oder durch irgendeinen anderen glücklichen Umstand, den sie überhaupt nicht verdient hatten.“ Lian schloss die Augen für einen Moment. „ Ich habe es auch nicht verdient zu leben. Kein Magier hat das. Aber nun bin ich hier, und wenn ich schon einmal am Leben bin, kann ich auch versuchen, mich nützlich zu machen. So, wir müssten diesen Tunnel bald durchschritten haben...“ Lian klopfte vorsichtig an der Tunnelwand. Träumer warf ihm einen Blick zu. „was tust du da?“,. Fragte er, etwas neugierig. „Ich suche den Ausgang, natürlich“; erwiderte Lian und runzelte die Stirn. „Hier irgendwo müsste doch etwas sein, das uns darauf verweist. Aber ich finde es nicht...“ Die Lichtkugel, die immer noch über ihnen schwebte, sirrte leise näher an die Wand, um Lian beim Suchen behilflich zu sein. Mit ernster Miene klopfte Lian die Wand ab, horchte ein paar mal, gab einen unbefriedigten Laut von sich und sah zu Träumer. „Der Ausgang müsste hier irgendwo sein... ich finde ihn aber nicht. Das hatte ich so nicht geplant.“ er seufzte und sah Träumer in die Augen. „Wenn wir sehr großes Pech haben, müssen wir wieder zurückgehen, ohne irgendwelche Neuigkeiten erhalten zu haben, Träumer. Es tut mir leid.“ Träumer stockte der Atem. Was?! Sie waren so weit gekommen, SO WEIT! Und jetzt einfach wieder zurückgehen, ohne zu wissen, ob Thome noch lebte oder nicht? Er wollte ihn sehen, von ihm in die Arme geschlossen werden. Der alte Mann fehlte ihm und auch all die anderen aus seinem Dorf. Und die Hoffnung, sie vielleicht bald wieder zu sehen und die Angst, dass ihnen vielleicht etwas zugestoßen sein könnten, hatte ihn angetrieben, ihn so weit gebracht, wie er jetzt gekommen war. All das sollte umsonst gewesen sein? Träumer knirschte mit den Zähnen. „Das soll doch ein Witz sein, Lian“, sagte er und seine Augen funkelten wütend und entschlossen. „Wir werden weitersuchen, bis wir den Ausgang gefunden haben. Ich werde dir bei der Suche helfen. Und wenn es den Rest meines Lebens dauern sollte. Aber was wir jetzt auf keinen Fall tun werden ist einfach aufzugeben! Ich bin mit Schatten gereist, ich habe eine Menge Dinge gesehen, die ich in meinem Leben NIE sehen wollte und ich habe eines gelernt und zwar, dass es erst vorbei ist, wenn man aufgibt! Schatten lebt danach. Hätte ich sein Schicksal, dann hätte ich längst aufgegeben, aber er blieb hart, er kämpfte für das ,was ihm wichtig war, und wenn es einfach die Gerechtigkeit und die Rache war. Meine Motive sind zwar von einer weniger drastischen Natur, aber ich habe mir geschworen, dass ich die Dinge auch so nehmen will, wie sie kommen und sie meistern will.“ Er schloss die Augen. Genau. Er war nicht mehr der naive junge Mann, der damals ausgezogen war, weil er keine Wahl hatte. Er hatte jetzt einen treuen Freund gefunden und viel erlebt, neuen Mut gesammelt. Fähigkeiten an sich entdeckt, die ihm vorher verborgen waren.Und Thome würde staunen, wenn er ihn sah. Das wollte und konnte er doch nicht verpassen. Also rieb er sich noch einmal die Hände und stellte sich dann neben Lian, um ihm beim Abtasten der Wand zu helfen. Dieser stand etwas verdattert neben ihm und hatte während Träumer gesprochen hatte, sich nicht bewegt noch irgendeinen Muskel gerührt. Jetzt schien er wieder aufzutauen. „Gut“, sagte er mit einer unsicheren Stimme. „Wir schaffen das schon, denke ich.“ Dann fügte er mit einer leiseren Stimme dazu, die Träumer aber sehr wohl hören konnte: „Auch wenn du überhaupt nicht weißt, wonach du überhaupt suchen sollst...“ Träumer legte die Hände an die Wand und schloss die Augen. Er würde selbst herausfinden, wonach er suchen musste. Magie hatte eine Aura, die er spürte, wenn er die Lichtkugel über sich hatte. Ansonsten konnte er in der Nähe nichts spüren, denn die Magie, die die Kugel ausstrahlte, war einfach zu... Er schlug sich mit der Handfläche auf die Stirn. Aber natürlich! „Lian, du musst das Licht löschen! Ansonsten können wir die Magie doch gar nicht wahrnehmen!“ Lian drehte sich überrascht zu Träumer um. „Wahrnehmen? Wie meinst du das? Kannst du etwa...?“ „nicht jetzt“, übertönte Träumer ihn. „Tu es einfach, sonst sitzen wie hier noch Ewigkeiten fest!“ Lian antwortete nicht, stattdessen begann die Kugel zu flimmern. Ihr Licht wurde immer schwächer, bis sie schließlich mit einem leisen Seufzer verlöschte und die beiden in Dunkelheit zurückließ. Träumer konzentrierte sich wieder auf die Wand. Er legte seine Hände auf den kalten Stein und begann leise zu murmeln. Die Worte flossen in ihn durch seine Finger und kamen dann aus seinem Mund, unzusammenhängende Wortfetzen, die zusammengefügt einen sirrenden singenden Wirrwarr ergaben.
Dunkle Geschichten
Wallendes Blut
todkranke Kinder
Angst
Verrat
Mut
ein Gruß
Sternenglanz
leuchtende Wege
Er wiederholte die Wörter immer und immer wieder, während seine Hände fortwährend die Wand absuchten nach einer Spur von Magie, die ihm den Ausgang zeigen sollten. Und schließlich fand er ihn: Den silbernen Faden, der leise mitsummte. „Lian, es ist hier drüben“, rief Träumer halblaut. „Ich denke, ich habe den Ausgang gefunden. Du kannst jetzt wieder Licht machen!“ Niemand antwortete Träumers aufgeregten Worten. Nur die Stille und die Dunkelheit schmiegten sich an ihn, als schienen sie sagen zu wollen: Wenigstens sind wir noch da, hab keine Angst. Träumer sah sich um, doch er konnte nichts sehen. Seine Augen waren nutzloser als seine Hände, doch er konnte diesen Ort auch nicht verlassen, war es doch möglich, dass er nie wieder herfand. Was sollte er tun? Panik machte sich in ihm breit. Lian hatte ihn verlassen, er war auf und davon! Ein leises Seufzen neben ihm ließ Träumer zusammenschrecken. „Du vertraust mir immer noch nicht, was?“, fragte Lians Stimme sehr nah neben ihm. Dann flackerte auch die Kugel über Träumers Kopf auf und der junge Zauberer stand direkt neben ihm. Vor Schreck machte Träumer einen Schritt zur Seite. „Erstaunlich, dass du den Ausgang gefunden hast“, sagte Lian nachdenklich und sein Blick ruhte auf Träumer. „Vielleicht ruht in die mehr, als du glaubst. Aber ich will keine wilden Vermutungen anstellen.“ er seufzte. „Nun ja, wo du den Ausgang jetzt allein gefunden hast, muss ich dich wohl auch weiterhin begleiten, was? Damit hätte Alan auch nicht rechnen können. Naja, mir soll es Recht sein. Ich habe schließlich keinen Befehl bekommen, was diesen Fall angeht.“ Träumer sah Lian verständnislos an. „Alan? Was ist mit...“ dann dämmerte es ihm. Also doch! Seine Zweifel und sein Misstrauen waren angebracht gewesen. Dieser Alan hatte etwas vor gehabt, um ihn loszuwerden! „ Nun, es gibt keinen Grund, es länger zu verschweigen“, sagte Lian und legte den Kopf schief. „Ich sollte dich so weit bringen und dann vorgeben, den Ausgang nicht zu finden. Du solltest am Boden zerstört sein und dann so schnell wie möglich wieder zurück zum Lager der Rebellen und zu diesem Drorn kommen.“ Träumer sah Lian an. „Alan hatte gar nicht vor, mich loszuwerden?“, fragte er halblaut. Lian warf ihm einen überraschten Blick zu. „Nein, natürlich nicht. Warum sollte er auch? Schließlich sieht er in dir nicht mehr als Drorns Geliebten. Oder... sein Haustier, schätze ich. Er wertet dich nicht als einen vollwertigen Menschen, den es zu beseitigen gilt.“ Dann merkte Lian, was er da gesagt hatte und ein Lächeln umspielte seine Lippen. „Das ist natürlich nicht meine Meinung. Die Stunden mit dir haben mich eines besseren belehrt. Du bist eine sehr interessante Persönlichkeit und ich kann mir vorstellen, was es ist, dass Drorn an dir findet. Aber jetzt wollen wir erst einmal diesen Ausgang öffnen.“ Jetzt war es an Träumer, überrascht zu schauen. „Du willst dich Alans Befehl widersetzen?“ Lian nickte. „Ja“, sagte er. „Ich habe meinen eigenen Kopf. Außerdem bin ich neugierig auf die Menschen, die dir so am Herzen liegen.“
Träumers Lippen formten sich zu einem Lächeln. „Du bist ein sehr netter Mensch, Lian“, sagte er. Lian warf Träumer einen kurzen Blick zu, dann wandte er sich der Wand zu. „Nein, eigentlich bin ich das nicht“, sagte er. „Eigentlich bin ich das wirklich nicht.“ Dann begann er mit dem Zauber, der ihnen die Tür öffnen würde.
Seine Hände formten seltsame Muster in die Wand, die sich unter seinen Bewegungen zu winden schien. Die Luft flimmerte und knisterte um Lian herum, seine Haare begannen an den Spitzen zu leuchten und als er vorsichtig und leise die ersten Worte sprach, wurden Träumer die Knie weich. Lians Stimme war so verändert. Dieser Zauber glich dem ersten nicht, die Stimme war so kraftvoll. So fühlt es sich also an, wenn man mit Gebirgen spricht, dachte Träumer und sein Körper zitterte. Es schien einfacher zu sein, den Berg davon zu überzeugen, dass man hineinwollte, als dass man wieder Ausgang verlangte. Langsam bildete sich Schweiß auf Lians Stirn. Er stand anscheinend unter großer Anstrengung, die Träumer hier auch spüren konnte. Dann machte Lian ein abschließendes Handzeichen, seine Stimme verstummte und es war vorbei. Knackend und knarrend schoben sich die Steine auseinander und gaben den Weg nach draußen frei. Lian warf einen Blick zu Träumer. „nach dir“, sagte er und lächelte. Träumer rührte sich nicht, seine Beine zitterten und sein Körper schien sich nicht bewegen zu wollen. Lian sah ihm eine Weile zu, dann öffnete er nochmal den Mund, um zu sprechen. „Geh jetzt endlich! Wir wollen hier keine Wurzeln schlagen, oder?!“ Träumer zuckte zusammen und nickte. Dann zwang er sich vorwärts. Mit jedem Schritt fiel es ihm wieder leichter zu gehen und jeder Schritt brachte ihn dem Tageslicht näher.
14. Magnolia
Magnolia saß am See und nähte Seerosen. Sie erschuf Blumen, die dann Wirklichkeit wurden und zu wachsen begannen. Sie war in der Lage, alles, was wachsen konnte, zum wachsen zu bringen. Sie war eine Nymphe. Doch seit diesem Tag wünschte sie sich, dass sie es nicht war. Dass sie ein einfacher Mensch war. Ein Mensch, der einen anderen Menschen lieben konnte. Sie hörte von fern einer traurigen Melodie und seufzte. Sie kannte dieses Lied. Heute Morgen war es schon einmal erklungen, schön und doch so traurig. Ein Lied, das sie zum Lachen brachte- und zum Weinen. Sie lehnte sich an den Baum, das einzige weitere Lebewesen, mit dem sie sprechen konnte. „Ich wäre gern ein Mensch“, flüsterte sie ihm zu. Der Baum knarrte nur missbilligend. Warum? Fragte er. Was hast du davon, ein Mensch zu sein? Ist es nicht viel schöner, ewig zu leben und dich um die Blumen zu kümmern? Um die Blumen beim wachsen zu betrachten, immer und immer wieder neue erschaffen zu können und das Leben zu genießen, ohne um den bald eintreffenden Tod fürchten zu müssen? Mensch zu sein birgt keinen Vorteil. Die kleine Nymphe seufzte. „Er würde mich lieben, wenn ich ein Mensch wäre.“ Das ist nicht wahr. Sagte der Baum leise. Wenn er dich nicht lieben kann, wenn du eine Nymphe bist, wird er dich auch nicht lieben, wenn du ein Mensch bist. Sie sah den Baum böse an. „was weißt du denn schon?“, fragte sie wütend. „Du bist doch nur ein Baum!“ Der Baum knarrte als Antwort. Sie seufzte. „Es tut mir leid“, sagte sie. „Aber ich denke nicht, dass es so schlimm wäre, ein Mensch zu sein. Vielleicht stirbt man, wenn man alt wird, aber man kann mit denen zusammen sterben, die man liebt. Vielleicht ist das Leben viel zu kurz, um es zu genießen, aber der Luxus, zu wissen, dass das leben einzigartig und wertvoll ist, weil es einem jederzeit genommen werden kann... dieser Luxus fehlt mir! Ich würde so gern einmal wissen, ob der Himmel blauer ist, wenn man Mensch ist. Ob man alles um sich herum intensiver wahrnehmen kann, gerade weil man weiß, dass es nicht von Dauer ist, weil man weiß, dass man es nicht EWIG besitzen wird. Ost es nicht das, was das Leben erst lebenswert macht? Selbst du stirbst einmal, Baum, weil du selbst zwar ein langes, aber kein unsterbliches Leben hast. Aber ich, ich kann nicht sterben! Ich kann es nicht, es sei denn, ich beende es von selbst. Ich bin verdammt dazu, ewig auf dieser Erde zu bleiben und Blumen das Leben zu schenken. BLUMEN!“, sie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Der Baum antwortete nicht. Er wiegte sich im Wind und überließ es ihr, weiter zu reden. Sie lauschte noch eine Weile der Melodie, die zwar schon längst verklungen war, aber dennoch in der Luft zu spüren war. „Er hatte eine Flöte aus deinem Holz“, sagte sie leise. „Woher er die wohl hatte? Ich habe ihn hier noch nie vorher gesehen. Aber dennoch hatte er diese Flöte. Weißt du, woher er sie haben könnte?“ Der Baum wiegte sich hin und her. Ich schenkte einst einem jungen Dichter einen meiner Äste, weil er ein Gedicht für ein Mädchen in meinen Stamm ritzen wollte. Er hat die ersten Zeilen vorsichtig hinein geritzt. Sieh auf der anderen Seite nach. Der Baum schüttelte sich. Magnolia ging um den Baum herum und fand am Stamm einige Worte eingeritzt. „Ich kann sie nicht lesen“, sagte sie leise. „Ich kann keinen einzigen Buchstaben entziffern.“ Der Baum knarrte wieder. Dort stand folgendes: Im Frühling bin ich bei dir, Im Sommer kühlst du mich. Im Herbst bist du bei mir, Im Winter wärme ich dich. Nicht besonders gut gereimt, findest du nicht auch? Magnolia schüttelte den Kopf. „Es ist ein Gedicht, das eine emotionale Tiefe hat“, sagte sie leise und eine weitere Träne rollte über ihre Wange. „Wenn nur jemand so etwas für mich schreiben würde, ich wäre unglaublich glücklich.“ Der Baum knarrte. „Wieso knarrst du?“, fragte Magnolia leise. Lebe nicht in Eventualitäten, Kleines. Vielleicht wird dir nie jemand so etwas schreiben. Vielleicht doch. Vielleicht findest du auch den Weg, zum Mensch zu werden. Magnolias Augen wurden groß. „Es gibt einen Weg, zum Mensch zu werden?“, fragte sie und schluckte. Oh ja... sagte der Baum, Den gibt es in der Tat. Magnolia lächelte. „Ich werde ihn finden“, sagte sie. „Wenn er mich holen kommt, werde ich ein Mensch sein. Bestimmt.“ Sie saß da und nähte weiter an ihren Blumen. Eine Blume wurde schöner als die andere. Sie ließ ihre ganze Liebe in die Blumen fließen. Ihre ganze Liebe für den Menschen, den sie nur ein Mal, ein einziges Mal gesehen hatte. Sie liebte ihn von ganzem Herzen. Er war etwas Besonderes, dessen war sie sich sicher. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte. Das hatte sie in seinen Augen lesen können. Sie wusste, dass er zurückkommen würde. „Ach Baum“, seufzte sie. „Was soll ich denn nur machen?“ Der Baum knarrte nur. Sie nickte. „Du hast Recht. Ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen, nicht wahr? Ich sollte weiter meine Blumen erschaffen, so wie es sich für eine Nymphe gehört. Ich sollte nicht versuchen, ein Mensch zu werden.“ Sie hob den Blick zum Himmel und ihre Augen waren voll von Tränen. „Warum fällt mir dieser Weg nur so schwer? Warum will ich etwas werden, was ich nicht bin? Warum? Nur, weil ich ihn gesehen habe? Warum kann ich nicht zufrieden sein mit dem, was ich habe?“ Sie stand auf und ließ die halbfertige Blume auf den Boden sinken. „Ich gehe schlafen, Baum“, sagte sie und lächelte. Ihr lächeln hinterließ einen wehmütigen Hauch in der Atmosphäre, als sie zu ihrer Hütte ging und die Tür hinter sich schloss. Gute Nacht, sagte der Baum leise. Er wiegte sich sanft im Wind und versank dann ebenfalls in einen Halbschlaf.
15. Träumer
Träumer erwachte nach einem langen und erholsamen Schlaf. Ihm tat nichts weh, wenn man mal von der Lücke, die die Nymphe in sein Herz gerissen hatte, absah. Er fühlte sich so gut wie lange nicht mehr. Vorsichtig setzte er sich auf und merkte, dass die Sonne noch nicht aufgegangen war, es aber dennoch außergewöhnlich hell war. Verwirrt sah er sich um. Schatten und Chila schienen noch zu schlafen, sie bemerkten nichts von dem, was sich hier gerade abspielte. Auf den Grashalmen um sie herum saßen kleinste Wesen mit kleinen Laternen und blickten ihn und die anderen zwei Wanderer aufmerksam an. Von Zeit zu Zeit kicherte eines der Wesen oder eine Lampe ging aus, aber sofort hüpfte ein weiteres dazu und entzündete das Licht wieder. Träumer sah zu und er blickte von einem Wesen zum anderen. Das Wesen, das ihm am nächsten war, blickte ihn mit großen, schwarzen Knopfaugen an und lächelte. Träumer betrachtete verwundert die hellblaue Haut und die kleinen schmetterlingsartigen Flügel. Das Wesen öffnete den Mund und ein seltsames Geräusch erklang, etwa so, wie als wenn man eine Seite zerriss. Träumer starrte das Wesen an. Im nächsten Moment blickte jeder zu Träumer. Er blickte sich verwirrt um. „Träumer?“, fragte Schatten leise. Er war nahe dran, auf zu wachen. Das Wesen kreischte noch einmal, dann, wie auf ein geheimes Kommando, verschwanden sie alle. Schatten setzte sich auf. „Ist etwas passiert?“, fragte er verwirrt. „nein, nichts“, sagte Träumer und sah zu Schatten herüber. Er würde ihm nichts von den Wesen erzählen, es interessierte ihn im Grunde überhaupt nicht, ob sie nun gefährlich waren oder nicht. Was machte es denn für einen Unterschied? Sie hatten ihn nicht getötet, also würden sie es vermutlich auch in näherer Zukunft ebenfalls nicht tun. Bis es soweit war, waren er, Schatten und Chila vermutlich sowieso schon längst über alle Berge. Also was sollte es? Es spielte keine Rolle. Einfach überhaupt keine Rolle. Er nickte Schatten zu, dann stand er auf und steckte sich. Die Sonne kletterte langsam über den Bergen empor und blickte sich um. Träumer lächelte ihr zu, dann musste er eine Weile die Augen schließen, damit die Punkte wieder verschwanden, die er als Folge überall sah. Er hob seinen Umhang auf, klopfte ihn sorgsam ab und band ihn sich dann wieder um. Nachdenklich sah er Schatten dabei zu, wie er ebenfalls seinen Mantel abklopfte und ihn sich wieder umband. Dann machte Schatten Anstalten, Chila zu wecken. Träumer drehte sich von den beiden weg und betrachtete die Berge vor ihm. Ein eisiger Wind wehte ihm entgegen und ließ ihn frösteln. Was war das nur für ein Gefühl, das er tief in sich wahrnahm? Langsam breitete es sich in ihm aus und flüsterte ihm leise und unruhig Dinge ins Ohr, die ihn erschaudern ließen. Es waren Dinge über Menschen, die in diesem Gebirge gestorben waren, die in Felsspalten gerutscht und verhungert waren, die von wilden Gebirgswölfen gerissen wurden wie Getier. Die auf eine sehr qualvolle Art und Weise ums Leben kamen. Er schloss die Augen, um die Bilder aus seinem Kopf zu verbannen, doch sie wollten nicht verschwinden. Sie wurden nur noch intensiver, je dunkler es war. Wenn er die Augen schloss, war er allein in seinem Kopf, ein Zustand, den er lieber nicht erstreben sollte. Denn wenn er allein war, sah er alles deutlicher, bunter, grausamer. Er öffnete die Augen wieder, atmete ein paar Mal tief ein und aus, dann blickte er zu Schatten, der Chila dabei half, ihre Sachen zusammen zu packen. Schatten war ein ungewöhnlicher Mensch. Er beobachtete die beiden dabei, wie er versuchte, Chila den Mantel ordentlich anzustecken. Sie lachte ihn süß an und er blieb erstaunlich nett und freundlich, obwohl er ihr klar mitteilte, dass er kein Interesse hatte. Wie konnte man gleichzeitig abweisend, aber dann doch so einladend sein? Träumer konnte es nicht verstehen. Er besaß diese Gabe nicht. Er war nicht der Mensch, der gern unter anderen Menschen war. Einerseits war es wohl das. Andererseits schien es wirklich eine Gabe zu sein, mit anderen Menschen gut klar zu kommen. Als die beiden alles zusammengepackt und das Feuer so gut es ging verborgen hatten, schlossen sie zu Träumer auf. Schatten warf einen Blick zu Träumer, der ihn anlächelte. Eigentlich war es ein glücklicher Zufall, dass sie sich begegnet waren, auch wenn er es damals nicht so betrachtet hatte. Es würde wohl auch Zeiten geben, in denen er selbst davon überzeugt sein würde. Doch alles in allem war es ein glücklicher Zufall. Vielleicht wäre Träumer gestorben, wenn Schatten sich nicht seiner angenommen hätte. Vielleicht hätten die Spinnen ihn getötet und zum Frühstück verspeist. Vielleicht wäre er aber auch nie bei den Spinnen angekommen. Er wusste es nicht. Aber er würde es auch nie wissen. Schatten blickte ihm interessiert zu. „Was starrst du so?“, fragte er und lachte freundlich. „Ich starre nicht“, entgegnete Träumer nur, doch er lächelte ebenfalls. „Nein, kein bisschen“, sagte Schatten und betrachtete ihn weiter, jetzt allerdings belustigt. „Vielleicht solltest du noch einmal zurück in die Schule gehen. Bei der Lektion „Lügen“ hast du total versagt.“ Träumer blickte zu Schatten. Sein Blick wurde ernst. „Ich glaube nicht, dass das eine Lektion ist, die ich unbedingt noch erlernen müsste.“ Schatten lächelte nur geheimnisvoll. „Es ist eine Lektion, die man besser beherrscht; schon allein, um sich vor Schlimmen zu schützen.“ Träumer schüttelte den Kopf. „Ich habe dich. Wirst du mich nicht vor Bösem beschützen?“ Schatten nickte. „Ja. Mit meinem Leben werde ich dich schützen. Mit meinem Leben, kleiner Dichter. Aber was, wenn ich nicht mehr da sein sollte? Was, wenn ich nicht da bin, wenn du in Not bist?“ Träumer sah ihn an. „Das sollte nie geschehen. Aber du würdest mich nie im Stich lassen. Das weiß ich.“ Schatten nickte. „Zumindest nicht absichtlich. Aber was, wenn wir getrennt würden? Oder... wenn ich sterben würde?“ Träumer starrte ihn an. „Das...“, sagte er und schluckte. „Ich komme auch so klar“, sagte er, doch seine Stimme klang zittrig. Was, wenn Schatten sterben würde? Wieso dachte er ans Sterben? „Der Tod ist überall“, sagte Schatten düster. „ Du magst ihn nicht sehen und noch vor ihm fliehen können, ich bin mir aber nicht einmal sicher, ob du ihn nicht sogar siehst. Du siehst ja so einiges, das man lieber nicht sehen sollte. Vielleicht hat er dich gerade nicht im Visier. Aber er ist da. Er ist immer da. Das solltest du nicht vergessen. Er ist immer in der Nähe und in einem Moment, in dem du einmal nicht auf dich acht gibt, nimm er sich deine Seele. Er hat Zeit. Er hat all die Zeit, die dir fehlt. Die Zeit, die dir fehlt, um die Ewigkeit zu erreichen. Die Unsterblichkeit...“ Schatten setzte kurz aus, um einmal auszuatmen und dann erneut Luft zu holen. „Aber das ist auch gut so“, sagte er und sah Träumer lächelnd an, der Schatten mit einem erschreckten Gesichtsausdruck anstarrte. „Schließlich ist ein Leben in Ewigkeit auch unglaublich langweilig und eintönig, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und selbst, wenn man in den ersten Jahrhunderten die ganze Welt bereist: Es folgen noch viele weitere Jahrhunderte, die man verbringen muss, bis man schließlich mit dieser Welt sein Ende findet. Ist das erstrebenswert? Ich glaube nicht. Da habe ich lieber mein kurzes Leben, das jederzeit vorbei sein kann und genieße es, soweit ich kann. Ich nutze es.“ Chila stellte sich neben Schatten und blickte zu ihm auf. „Wollen wir los?“, fragte sie und lächelte Schatten an. Schatten blickte zu Träumer. „Ich bin schon eine ganze Weile bereit“, sagte Träumer grinsend. Chilas Lächeln traf nun auch ihn. „Wir sollten am besten jetzt los“, sagte sie und schob ihre braunen Locken zurück. Träumer nickte und sah zu Schatten. Schatten seufzte. „Auf geht es“, sagte er und nickte erschlagen. Oder besser: überstimmt. Chila sah ihn mit ihren schönen, braunen Augen an. „Wohin wird es gehen?“, fragte sie. Ihre Stimme war weicher geworden. Allmählich schienen sie eine echte Gruppe zu werden, nicht nur einfach zwei Leute und eine Führerin, sondern Freunde, die zusammenhielten. Oder wenigstens Kumpanen. Schatten flüsterte Chila etwas ins Ohr, sie überlegte kurz und nickte dann. „Alles klar“, sagte sie. „Wir müssen dann dort entlang. Folgt mir.“ Sie ging voraus, Schatten folgte ihr, Träumer war der letzte, wie sie es gewohnt waren.
Die ersten Schritte waren noch leicht, doch dann wuchs der Anstieg und jeder Schritt wurde immer anstrengender. Er ging und ging, der Schweiß bildete kleine Perlen an seiner Stirn, die aber nicht herab fließen wollten. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, obwohl er eigentlich fror. Die Temperatur sank konstant, es wurde immer kälter, je höher sie kamen, auch die Luft wurde immer dünner. Ihm wurde ab und zu schwindelig und es fiel ihm schwer zu atmen, doch ansonsten war der Anstieg nicht sonderlich gefährlich. Es gab kaum noch Pflanzen, die das Vorankommen erschwert hätten, nur diese immer währende Kälte machte ihm zu schaffen. Sie wanderten und wanderten. Schon wieder wusste er nicht, wohin sie gingen, wieder machte es ihm eigentlich nichts aus. Seine Erwartungen waren wohl einfach zu niedrig. Er erwartete von Schatten nicht mehr, dass er ihn in alles einweihte. Vielleicht auch, weil er wusste, dass er selbst mit den Informationen sowieso nichts anfangen konnte, vielleicht, weil er wusste, dass Schatten alles unter Kontrolle hatte. Solange alles gut war, brauchte er doch nichts befürchten. Schatten wusste, was er tat. Sie waren eine Gruppe, die Schattens Plan ausführte, nicht Träumers. Träumer zuckte überrascht zusammen, als ihm klar wurde, dass er eigentlich unwichtig war. Er war den beiden nur eine Last, er kannte weder den Weg, noch konnte er irgendetwas besonders gut. Er konnte im Grunde nichts besonders gut. Er nannte sich zwar Dichter und das, was er reimte Poesie, doch eigentlich war es das wohl gar nicht. Er war nicht gut genug, um das Recht zu haben, sich so zu nennen. Er war nicht gut genug, dass er der Gruppe angehörte. Warum gingen die beiden vor ihm über diese Tatsache so einfach hinweg? Warum sahen sie nicht, dass er nichts konnte, dass er zu nichts nütze war? Er konnte nichts, er wusste nichts. Er tat nichts, außer allen nur ein Klotz am Bein zu sein. Jetzt gerade zum Beispiel versank er in Selbstmitleid, anstatt zu laufen und zu versuchen, mit dem anderen Schritt zu halten. Er schüttelte wütend den Kopf. So zu denken war weder nützlich, noch vernünftig. Er war so. Gut. Er musste es eben akzeptieren. Jeder tat das. Schatten akzeptierte, dass er nichts konnte. Chila akzeptierte das. Nur er selbst konnte es nicht akzeptieren. Er musste aber. Er musste, wenn er wollte, dass sich etwas änderte. Nur so war das möglich. Er musste. Schlicht und einfach. Er musste. Träumer lief wieder schneller. Als er so in Gedanken war, hatten die beiden anderen einen großen Vorsprung gewonnen. Er atmete aus und aus seinem Mund kam eine weiße Wolke. Überrascht betrachtete er seinen Atem. So kalt war es bei ihm nie gewesen. In seinem Dorf gab es so etwas wie den Winter nicht. Sie hatten immer Frühling. Diese Kälte war nicht normal. Seine Haut brannte dort, wo die Luft seine Wange berührte und er zurrte den Mantel enger um sich. Schatten schien es überhaupt nichts auszumachen und Chila wirkte so, als würde sie die Kälte begrüßen. Ihr Tempo war so schnell, dass Träumer immer weiter zurück fiel, doch selbst Schatten hatte ein wenig Mühe, ihr zu folgen. Bald hatten sie die erste hohe Stelle erreicht. Eine Weile würde es wieder bergab gehen. Chila war oben stehen geblieben und wartete auf die beiden Männer. Ihr langes, lockiges Haar wallte im Wind und selbst Träumer empfand sie in diesem Moment für sehr hübsch - und vor allem begehrenswert. Er, der nicht verstand, warum man eine Frau lieben konnte, bekam nun eine Ahnung davon. Die Idee begeisterte ihn zwar nicht, weckte aber eine Art Interesse. Für einen kurzen Moment dachte er daran, wie Chila wohl ohne Kleidung aussah. Dann schob sich ein Bild der Nymphe dazwischen und er dachte wieder an sie. Verglichen mit seiner Magnolia war Chila nichts, nicht erwähnenswert. Er konnte sagen, neben Magnolia wirkte Chila wie – ein Lebewesen. Zu mehr reichte es allerdings nicht. Doch Magnolia war eine Nymphe. Kein menschliches Wesen. Eine Unsterbliche mit einem menschlichen Körper zwar, aber das war nicht dasselbe. Er selbst war sterblich. Er wollte nicht altern und sterben - während sie es nicht tat. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie nach seinem Tod vielleicht Jahrhunderte in Trauer verbringen würde oder dass sie vielleicht einen neuen Mann nahm, der dann mit ihr die Dinge tat, die er sich von ihr erträumte. Allein die Vorstellung ließ ihn erschaudern. Das war nicht in Ordnung. Er musste sich deshalb etwas einfallen lassen. Mit diesen Gedanken erreichte er Chila und warf das erste Mal einen Blick auf das, was hinter dem Berg lag, den sie gerade erklommen hatten.
Träumer öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber ihm fehlten die Worte, ein Zustand, der nicht sonderlich oft vorkam. „Unglaublich“, stammelte er schließlich. Chila drehte sich zu ihm um und lächelte zufrieden. „Noch nie so etwas gesehen, was?“, fragte sie neckisch. Irgendetwas an ihr erinnerte ihn an Thome und er musste lächeln. „In der Tat“, sagte er. „noch nie.“ Chila zuckte mit den Schultern. „Tja“, sagte sie. „Es gibt immer ein erstes Mal. Hoffen wir, dass es nicht bei einem mal bleibt. Der Anblick ist zu gut, als dass man ihn nur einmal genießen sollte.“ Träumer nickte. „Ich verstehe“, sagte er. Er war sich nicht sicher, ob er verstand, aber er hoffte es mal. Schatten nickte. „Ein berauschender Anblick“, sagte er. Meinte er damit die Zacken der Berge, die noch folgten und wie Messerspitzen in den Himmel zu schneiden schienen? Meinte der den Schnee, der an den Hängen klebte und die toten Bäume verschönerte? Oder meinte er vielleicht die Stadt, die sich hinten am Horizont abzeichnete? Träumer war sich nicht sicher. Vielleicht meinte er auch den Gesamteindruck, doch jeder dieser einzelnen Aspekte verdiente das „berauschend“ schon. Es war nicht nur wunderschön, sondern überirdisch schön. Das weiß war so rein, diese Farbe hatte er bis jetzt nur einmal gesehen, nämlich beim weißen Baum. Magnolias Haar hatte ebenfalls eine Farbe, die der des Schnees perfekt glich. Sie war auch wunderschön. Etwas, das ihr in so einer merkwürdigen Weise ähnelte, konnte nur genauso schön und einzigartig sein. Diese Nymphe besaß sein Herz noch. Sie hatte es zärtlich aus seiner Verankerung befreit und es ausgetauscht gegen eine Pumpe, die zwar sein Blut bei Gefahr wallen lassen konnte, aber bei anderen Frauen ihn kein Interesse mehr wecken ließ. Er grinste. Als hätte er vorher Interesse gezeigt. Es war im Grunde kein Verlust. Dennoch tat das nichts zur Sache.
Schatten blickte nach unten. Dann grinste er seine zwei Mitstreiter an. „Wer wagt den Abstieg mit mir?“, fragte er. Chila und Träumer sahen sich an und beide schüttelten gleichzeitig den Kopf. „Ich nicht“, sagte Träumer. „Oh nein“, sagte Chila. Sie verschränkten beide die Arme und Träumer drehte sich nach links weg, Chila sich nach rechts weg. „Der Weg könnte gefährlich werden“, sagte Schatten und seine Stimme wurde geheimnisvoll. „Es werden uns vielleicht Monster über den Weg laufen, die uns das Leben kosten könnten. Wir könnten Schätze finden, die von grausamen Räubern bewacht werden und uns nicht glauben werden, dass wir nicht vorhatten, ihre Schätze zu stehlen. Wir werden vielleicht den hübschesten Lebewesen des Universums begegnen, die der Meinung sind, dadurch, dass sie uns fressen, an Intelligenz zu gewinnen. Es wäre möglich, dass wir den letzten Weg nicht mehr lebend verlassen werden.“ Träumer drehte sich wieder zu Schatten um, genauso wie Chila es auch tat. „Als wenn wir dir den Spaß allein gönnen würden“, sagte Chila und grinste breit. „Eben“, unterstützte Träumer sie. „Und widersprich niemals dieser Frau.“ er grinste. Schatten nickte. „Niemals“, sagte er und hob Zeige- und Mittelfinger. „Niemals würde ich so etwas tun.“ Träumer nickte. „Also los“, sagte er und ging vorsichtig abwärts. Träumer und Chila folgten ihm. Bald hatten sie die normale Reihenfolge aber wieder eingenommen. Es schien, als konnten sie so wirklich am besten wandern. So liefen sie immer weiter auf ihrem Weg, während sich die Sonne wieder dem Untergehen zuwandte.
16. Phenelope
Ein Eichhörnchen stahl eine Nuss aus Phenelopes Teller. Sie sah dem kleinen Tier zu, wie es sich einfach auf den Tisch setzte und anfing, die Nuss zu knacken. Sie streckte vorsichtig die Hand aus und berührte das Tier. Es schreckte minimal zurück, dann ließ es sich von ihr streicheln. Sie lächelte. „Du bist aber niedlich“, sagte sie und ihre zierliche Hand strich sanft über den Kopf des kleinen Nagetiers. Das Eichhörnchen genoss die Streicheleinheit, dann aber schien es etwas zu wittern. Die kleinen Schnurrhaare bebten und schließlich lief es davon. Enttäuscht blickte Phenelope ihm nach, doch sie wusste, was der Grund war. Marktl, ihr kleiner Kater tapste mit seinen großen Pfoten auf den Tisch und miaute kläglich. Sie lächelte und strich ihm über den Kopf. „Du Süßer, Kleiner“, sagte sie liebevoll und küsste ihn auf die Stirn. „was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ich habe dir doch gesagt, dass du das Eichhörnchen nicht so erschrecken sollst. Es hat nämlich Angst vor dir, du Dummkopf. Ein Eichhörnchen ist nämlich keine Maus. Ich weiß, dass du lieber Eichhörnchen als Ratte essen würdest, aber die Eichhörnchen sind meine Freunde und Mutter erlaubt mir nicht, dich länger zu halten, wenn du die Rattenplage nicht im Zaum hältst.“ Der Kater blickte sie mit großen Augen an. „Ja, ich weiß auch, dass das als einzelner Kater nicht zu schaffen ist“, sagte sie seufzend. „Aber du musst es zumindest versuchen, einverstanden? Ich weiß, dass du dazu in der Lage bist, Süßer. Du schaffst das schon.“ Sie schob den kleinen Kater vom Tisch, als sie Schritte vernahm. „Hier seid Ihr also, Prinzessin“, sagte Drorn, der neue Diener ihrer Mutter. Sie blickte ihn kühl an. „Hier bin ich also. Was will er von mir?“ Sie mochte Drorn nicht, er sah so düster aus. Außerdem war seine Aura viel zu dunkel für ihren Geschmack. Er passte nicht zu ihnen - weder zu Mutter, noch zu sonst jemanden im Schloss. „Eure Mutter verlangte zu wissen, was ihr macht“. Sagte Dorn und lächelte sie höflich an. Elender Schleimer, dachte sie wütend. Er konnte sie nicht leiden, dass spürte sie ganz deutlich. Dennoch tat er immer so, als wäre sie etwas Besonderes, obwohl er selbst nicht glaubte, wovon er sprach. Sie hasste ihn. Abgrundtief hasste sie ihn. Doch nur für seinen Charakter, nicht jedoch für sein Aussehen. Denn er sah gut aus. Eigentlich viel zu gut für jemanden, der so ein Ekel war, so ein... Sie stoppte ihre Gedanken. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass er wusste, was sie dachte. Eine eklige Vorstellung. Sie dachte sich schnell die schlimmste Todesart für ihn aus, die sie kannte: Ein möglichst schmerzhaftes Gift, das in seinen Wein gemischt wurde. Ihr Vater wurde auf dieselbe Art und Weise getötet, wie er sterben sollte. Sonst fiel ihr aber auch keine Art ein, jemanden gewaltsam zu Tode kommen zu lassen. Und schmerzhaft musste es sein, sonst konnte er nicht für all das büßen, was er ihr bereits in den wenigen Tagen, da er hier war, angetan hatte. Seit er hier war, hatte sie keine Ruhe mehr. Dauernd war er in ihrer Nähe, schien sie zu verfolgen, zu bespitzeln. „Sage er meiner Mutter, ich sei im Garten und wünsche KEINERLEI Störung“, sagte sie kalt und drehte sich zu ihm weg. Hoffentlich ging er schnell wieder, damit sie sich möglichst bald wichtigeren Dingen widmen konnte. Drorn verbeugte sich, doch er ging nicht. „haben Mylady wirklich alles, was sie benötigen?“, fragte er. Phenelope drehte sich zu ihm um, das Gesicht weiß vor kalter Wut. „Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt?“, fragte sie mit leicht bebender Stimme. „Habe ich nicht soeben klar gesagt, was ich meine? Ich möchte keinerlei Störung mehr. Das bedeutet, dass ich möchte, dass er mich nicht mehr stört, was zufällig auch mit einschließt, dass er jetzt geht. Und nein, das ist nett von ihm, aber ich habe bereits alles, was ich benötige. Braucht er noch eine Extraeinladung oder findet er die Tür von selbst?!“ Drorn verneigte sich still und verließ den Garten wieder, ein leises Lächeln auf den Lippen. Phenelope wartete, bis er verschwunden war, dann hob sie das kleine Kätzchen wieder auf ihren Schoß. „So ein dummer, dummer Mensch“, sagte sie leise zu dem Kätzchen und drückte ihm leicht einen Finger auf sie Nase. „Ist er nicht dumm? Was will er eigentlich dauernd von mir? Schließlich ist er nicht mein Diener, sondern der meiner Mutter, das bedeutet, dass er sich um meine Mutter zu kümmern hat. Nicht um mich. Nicht wahr Marktl?“ Das Kätzchen miaute erneut kläglich. „Ja, ich weiß“, seufzte sie. „Du hast Hunger. Du hast immer Hunger, mein Süßer.“ Sie stand auf, das Kätzchen auf dem Arm. „Schauen wir mal, was wir für dich auftreiben können, mein Süßer. Warum nur verfolgt mich dieser Diener dauernd? Warum muss er so unerträglich sein?“ Sie seufzte. „Und warum muss er nur so furchtbar gut aussehend sein? Warum nur, mein Süßer?“ Mit dem Kätzchen auf dem Arm verließ sie den Garten und steuerte die Küche an.
17. Träumer
Sie waren nun schon etwa zwei Monate unterwegs: Träumer, der Dichter, Schatten, der Kopfgeldjäger, und Chila, die weder das eine noch das andere war, sondern als Führer diente. Sie wanderten durch das Gebirge, Schritt für Schritt vorwärts, immer weiter und weiter. Es war kalt, viel zu kalt, als dass Träumer es hätte ertragen können. Viel zu kalt. Er schnürte seinen Mantel enger um sich. Die Kälte zerrte an seinen Nerven. Es war verdammt noch mal viel zu kalt. Warum konnten diese Temperaturen nicht zur Abwechslung einmal steigen anstatt zu sinken? Er schnaubte leise und sein weißer Atem stieg in die Luft. Leise rieselten kleine Flocken auf den Boden. Verblüfft sah er nach oben. „Was ist das?“, fragte er überrascht. „Das nennt sich Schnee“, erwiderte Schatten. Er blickte kurz zu Träumer, dann schnürte er das Tuch wieder fester. Träumer lächelte ihm zu. „Aha“, er blickte auf die kleinen Flocken, die sich auf seinem Handrücken ablagerten, nach Sekunden aber wieder verschwanden und zu winzigen Wassertropfen wurden. „Schnee“, sagte er nachdenklich. Interessant. Das war also der Name dafür. Er passte eigentlich recht gut, wenn er es sich genau überlegte. Sie liefen weiter und je weiter sie kamen, desto niedriger wurde die Temperatur. Die Kälte wurde immer unerträglicher, je länger er sich in ihr aufhielt. Seine Hände schienen schon längst nicht mehr zum Körper dazuzugehören, dennoch schmerzten sie von der Kälte. Träumer blickte zu Schatten, der nun selbst Vorkehrungen gegen die Kälte traf und seinen Mantel enger schnürte. Dann blickte er zu Chila. Der Frau schien die Kälte überhaupt nichts auszumachen. Dabei sollen doch die Frauen die kälteempfindlicheren sein“, murmelte Träumer verstimmt. Ihm war kalt und er hatte keine Lust mehr, hier in dieser Kälte herumzulaufen. Ihm kam sein zu Hause in den Sinn. Dort hatte es so etwas wie Winter nie gegeben. Dort war es nie so kalt gewesen. Unwillkürlich überkam ihn wieder das Heimweh. Er schüttelte den Kopf. Was half es, über Dinge nachzudenken, die nie so kommen würden? Er würde in absehbarer Zeit nicht nach Hause zurückkehren können, das stand fest. Er seufzte. Wieso kam ihm immer in den Unpassendsten Momenten sein Heim in den Sinn? Er dachte an Thome, an das Leben bei ihm in der Schmiede. Dann blickte er auf die Berge die noch vor ihm lagen, blickte zurück auf die Berge, die er bereits hinter sich gelassen hatte. Wie sollte er jemals wieder zurückkommen? „Gibt es noch einen anderen Weg zurück, als über die Berge?“, fragte Träumer Schatten. „Ja“, sagte Schatten. „Den gibt es allerdings.“ Träumer blickte ihm in die Augen. „Und welcher ist das?“, fragte er. „Der Weg über das Meer“, sagte Schatten und in seinen Augen spiegelte sich ein Lächeln. „Es ist ein angenehmerer Weg, aber wenn das Meer launisch ist, kommen wir nicht herüber. Ich konnte das nicht riskieren. Außerdem war ich viel zu weit vom Meer entfernt. Allein wäre ich nicht durchs Gebirge gegangen, aber ihr zwei seid ja da, deswegen ist es wahrscheinlicher, dass wir es überleben.“ Chila sah ihn an und lächelte. „Wir haben es auch bald geschafft“, sagte sie. „Hinter den nächsten Bergen endet das Gebirge.“ Träumer sah zu den Bergen, doch es sah nicht danach aus, als würde hier irgendetwas irgendwann enden. Dennoch glaubte er Chilas Worten, wahrscheinlich auch deswegen, weil er gerne wollte, dass sie wahr waren. Sie gingen weiter. Es passierte eigentlich nicht sonderlich viel, der Schnee fiel weiterhin und bedeckte die Berge mit Schnee. Zusätzlich machte er es für die drei Wanderer gefährlicher. Auf dem frischen Schnee konnten sie leicht ausrutschen. Träumer setzte behutsam einen Fuß vor den anderen und gab sich Mühe, nicht weg zu rutschen. Er hielt sich an den Rücken von seinem Vordermann. Schatten ging exakt in Chilas Spuren. So kamen sie mühsam, aber doch einigermaßen sicher und schnell vorwärts. Der Schnee wurde immer dichter. Die Flocken fielen und man konnte fast nichts mehr sehen. Chila blieb stehen, sodass Schatten in sie und Träumer in Schatten lief. „Wir können nicht mehr weitergehen“, sagte sie. „Wir müssen eine Höhle finden, in der wir bleiben können. Zumindest über Nacht.“ Schatten nickte nur missmutig, doch Träumer lächelte erfreut. Er würde endlich etwas schlafen können. In einer Höhle gab es auch keinen Wind, also würde er auch nicht so stark frieren. Vielleicht hatte dieser Tag doch noch etwas Gutes an sich.
Sie liefen herum und versuchten, eine Höhle zu finden, doch bei dem dichten Schneegestöber war das nahezu unmöglich. Als Chila dann doch rief, sie hätte etwas Passendes entdeckt, war es schon Stunden später. Die Höhle war kühl und trocken. Sie schützte vor Wind. Träumer ließ sich erschöpft sofort auf den Boden sinken und schloss die Augen. Schatten stellte sich neben Chila und blickte sie an. „Sieht nahezu stabil aus“, meinte er. „Hier können wir wohl die Nacht über bleiben.“ Chila nickte. „Es war nicht einfach, sie zu finden“, gestand sie. „Ich bin selbst mehr durch Zufall darauf gestoßen.“ Schatten nickte nachdenklich. „mhh“, sagte er. Träumer öffnete die Augen wieder. „Ihr zwei“, sagte er leise. „Werdet ihr die ganze Zeit da stehen und reden?“ Schatten lachte und wuschelte Träumer durch die blonden Haare. „Keine Panik“, sagte er. „Du kommst schon noch zu deinem Schlaf.“ Träumer nickte. „Das ist mir klar. Nur, ich dachte, vielleicht wollt ihr euch nicht lieber setzen? Der Boden ist gar nicht so kalt, wie es scheint.“ Schatten lächelte erneut. „Wenn du das sagst, dann wird das wohl etwas heißen“, sagte er und nickte zustimmend. Er setzte sich neben Träumer auf die Seite, die dem Höhleneingang zugewandt war. „Wollen wir nicht lieber erst nachsehen, was sich noch hier in der Höhle befindet?“, fragte Chila leise. „Und den Bären aus seinem Winterschlaf wecken, dem sie gehört?“, fragte Schatten und zog die Augenbrauen hoch. „Nein, danke. Sicher nicht.“ Chila wiegte den Kopf hin und her, als dächte sie über das nach, was er gerade gesagt hatte. Sie schien es plausibel zu finden, zumindest erwiderte sie nichts darauf. Träumer schloss wieder die Augen. Ein Bär machte ihm nichts aus. Er nahm seinen Hut ab und legte ihn neben sich auf den Erdboden, dann wickelte er seinen Umhang etwas fester um sich und schlief schließlich ein. Man hörte kurz darauf nur noch ein leises Atmen aus der Höhle, während draußen der Schneesturm tobte.
18.Nastian
Auf einem hohen Turm im Norden des Landes wurde zur selben Zeit erhitzt diskutiert. „Das ist unmöglich“, rief ein Professor mit weißem Bart. „Völlig unmöglich, überhaupt nicht realisierbar, eine Utopie, jawohl! So etwas kann es nicht geben und wird es auch niemals! Ich bin der oberste, ich weiß, wie die Welt funktioniert, jawohl! Und so ganz sicher nicht!“ Eine empörte Stimme machte dazwischen immer abfällige Geräusche, es war ein kleiner Mann mit blondem Haar. „Aber unter Umständen“, sagte ein jüngerer Herr. „Unter Umständen wäre es doch möglich? Es wäre möglich! Ich kann beweisen, dass es möglich wäre!“ Wieder ein Tumult. „Unerhört!“ – „Unmöglich!“ - „nicht zu fassen!“ Diese und mehrere ähnliche Sätze flogen durch den Raum, geradewegs auf den jungen Mann zu, der als letztes das Wort erhoben hatte. Ein alter Mann winkte ab und die Stimmen verstummten sofort. „Wie willst du es beweisen?“, fragte er mit leiser Stimme, aber dennoch nicht uninteressiert. „Wie willst du so eine Theorie beweisen?“ Er stoppte kurz nachdenklich, dann sagte er. „Wo wir gerade dabei sind: Was hast du überhaupt herausgefunden, das so haarsträubend ist?“, fragte er. Gemurmel wurde wieder laut, der alte Mann unterband dies mit einem Wink seiner Hand. „Antworte“, sagte er. Der junge Mann erhob sich. „Großer Ältester“, sagte er. „Ich habe die letzten Nächte mit dem Blick in den Himmel verbracht und habe dort eine sehr wichtige Information gefunden. Es geht um den Fortbestand dieses Landes.“ Erneutes Gemurmel wurde lauter. Der Älteste runzelte die Stirn. „was hat das wohl zu bedeuten?“, fragte er. „Aber fahre ruhig fort. Du wirst ja wohl noch nicht fertig gewesen sein.“ Der junge Mann nickte. „Wie gesagt, ich sah in die Sterne...“ Eine wütende Stimme warf ein: „Nun komm endlich zum Punkt, Nastian!“ Der junge Mann fuhr kurz zusammen, dann fing er sich wieder. „Ich habe die Zukunft unseres Landes gesehen“, sagte er. „Es wird untergehen.“ Wieder wurde Tumult laut. „So eine Pfuscherei!“- „er ist so jung; kann man sich da überhaupt sicher sein?!“ - „ Er ist viel zu unbegabt, das kann nicht stimmen!“ Der junge Mann, den sie Nastian nannten, schwieg und ließ die Anschuldigungen über sich ergehen. Das Letzte Wort war noch nicht gesprochen. Noch hatte der Älteste nicht gesagt, was er davon hielt. „Du bist also der Meinung, dass wir untergehen werden, Nastian?“, fragte der alte Mann und blickte ihn mit wässrigen Augen an. „Ich bin mir ziemlich sicher, Herr“, sagte Nastian und räumte damit einen kleinen Zweifel ein. „So, so“, sagte der alte Mann. Er schwieg eine Weile, dann blickte er Nastian an. Eine Weile beobachtete der alte Mann ihn, Nastian wurde nervös. „Das hast du also gesehen“, sagte er schließlich. „Wo ist da das Problem?“ Nastian blickte überrascht auf. „Aber Herr, wir werden alle sterben, wenn das so weiter geht! Wir werden alle der Willkür unserer neuen Königin zum Opfer fallen! Das haben die Sterne so bestimmt!“ Der alte Mann sah Nastian lange an. „Ich bin alt, Nastian. Ich bin alt. Ich weiß selbst um die Gefahr, auch ich habe sie gesehen.“ der Rest des Saals verstummte. Der Älteste war der gleichen Meinung wie der unreife Jüngling, sie lagen im Unrecht. „Ich habe sie gesehen. Ich habe die Königin gesehen und ich denke, ich weiß mehr über sie als jeder von euch hier, ich verstehe die Situation besser als kein anderer. Auch weiß ich mehr, als die Königin weiß, dass ich weiß, sonst wäre ich schon lange nicht mehr hier. Das wäre zumindest sicher.“ Er lächelte zufrieden. „Ich weiß um die Gefahr Nastian. Es ist löblich, dass du sie erkannt hast, aber du hast nicht alles gesehen. Du weißt nicht, wie es ausgehen könnte. Du bist noch zu jung, um die Anzeichen zu deuten. Dennoch - ein guter Verdienst, ein guter Verdienst...“ der Kopf des Ältesten sank langsam auf den Tisch. Kurz bevor er auf dem Tisch aufschlug, hob der Älteste erneut den Kopf. „Wo waren wir stehen geblieben?“, fragte er müde. „Ach ja. Nastian. Was war noch einmal dein Betragen, dass alle in solche Aufruhr versetzt hat?“ Nastian blickte den Ältesten an und er verneigte sich still. „Es ist von keinerlei Belang, Herr“, sagte er und verbeugte sich ein weiteres Mal. „Dann... warum stört ihr meinen Schlaf? Ein alter Mann sollte mehr schlafen und nicht so viel reden. Ein alter Mann in meinem Alter sollte schon tot sein, aber das ist eine andere Sache.“ Nastian schüttelte den Kopf. „Sagt so etwas nicht, Herr“, sagte er und verneigte sich ein weiteres Mal.
„Wenn es denn die Wahrheit ist“, sagte der alte Mann. Nastian schüttelte den Kopf. „dann erkläre ich den Fall Nastians für abgeschlossen“, sagte der alte Mann. „Höre ich Einspruch?“ einstimmiges Kopfschütteln war die Antwort. „gut“, sagte der alte Mann. „Dann beenden wir diese Sitzung.“ Nastian half dem Ältesten, aufzustehen und reichte ihm dann seinen Gehstock. Er war eingeteilt, dem Ältesten zur Hand zu gehen, wenn er nicht konnte. So zum Beispiel beim Aufstehen. Der Mann nahm dankbar denn Stab entgegen und humpelte aus dem Saal. „Der Alte wird senil“, sagte einer der jüngeren zu seinem Freund. „Ich möchte wissen, wie lange er es noch macht. Warum kratzt er nicht einfach ab, der Alte? Wäre doch langsam mal soweit!“ Nastian warf ihm einen bösen Blick zu, doch die zwei lachten nur und verschwanden aus dem Saal. Nach wenigen Sekunden war der Raum wie leer gefegt. Einzig die Zettel auf dem Tisch erinnerten daran, dass eben hier noch wild diskutiert worden war. Jetzt herrschte Leere. Jetzt herrschte Stille.
19. Träumer
Träumer wachte auf. Er öffnete die Augen und blinzelte den Schlaf davon. Vorsichtig und langsam stand er auf und ging zum Eingang der Höhle, um zu sehen, ob der Sturm vorüber gezogen war. Man musste nichts von Schneestürmen wissen, um zu erahnen, dass er jetzt wohl vorbei war. Denn keine einzige Schneeflocke fiel draußen. Er sah sich um, der Schnee lag Zentimeter hoch. Er ging wieder zurück zu den anderen. Schatten lag da, mit geschlossenen Augen, und schlief. Chila schien ebenfalls noch zu schlafen. Er seufzte. Er würde sie nicht wecken, sie sollten den Schlaf bekommen, den sie brauchten. Aber es störte ihn, dass er bereits wach war. Er selbst hätte eine weitere Mütze Schlaf ebenfalls gut gebrauchen können. Aber nicht nur eine Mütze. Er wusste, dass er selbst am Ende derjenige sein würde, der nicht mehr gehen konnte. Er würde wieder der erste sein, der vor Erschöpfung einschlief. Und jetzt lag auch noch eine zentimeterdicke Schneeschicht auf ihrem Weg und verhindere das schnelle Vorankommen. Er blickte zu Chila. Sie hatte die Augen geschlossen und ihre braunen Locken umrahmten ihr eigentlich wirklich schönes Gesicht. Sie hat etwas, dachte er. Sie hat dieses Etwas, dass manche Frauen ausstrahlen. Dieses Etwas, das ich vorher noch nie an einer Frau bemerkt habe, jetzt aber schon zum zweiten Mal finde. Magnolia hat es auch, dieses Etwas. Ich frage mich, was es sein mag. Er sah ein zweites Mal zu Schatten. Schatten besaß dieses Etwas überhaupt nicht. Er mochte zwar attraktiv sein, intelligent und verantwortungsbewusst, entscheiden können und viele andere positive Dinge. Aber er hatte das Etwas nicht. Nur Frauen hatten es. Schatten war schließlich keine Frau. Träumer musste bei diesem Gedanken unwillkürlich grinsen. Er dachte darüber nach, wie Schatten wohl mit einer weiblichen Figur aussehen würde. Eindeutig nicht so, wie Träumer sich eine hübsche Frau vorstellte. Er war dafür eindeutig zu... männlich. Er hatte breite Schultern und mittlerweile einen Dreitagebart. Träumer fuhr sein eigenes Kinn nach. Nichts. Er war zwar schon 19 Jahre alt, aber dennoch kein Bartwuchs, zumindest kein richtig vernünftiger. Er spürte zwar feine Härchen, aber man konnte das beim besten willen nicht Bart nennen. Träumer seufzte. Warum war er selbst nur so überhaupt nicht männlich? Wieso war sein Kreuz nicht so breit wie das von Schatten? Wieso konnte er nicht so entschlossen sein, wieso nicht so willensstark? Wieso nur war er, wie er war? Wieso schrieb er? Wieso konnte er sonst nichts? Er schüttelte den Kopf. Solche Fragen würden ihn nicht weiterbringen. Sie würden ihn nur noch mehr verunsichern, nur noch mehr, als er sowieso schon war. Ja, er war verunsichert. Es verunsicherte ihn, dass er weniger konnte als Chila, dass sie so dominant war. Ohne Schatten, der sich gegen sie durchsetzten konnte, vermochte er nichts. Das verwirrte ihn, machte ihn hilflos und unglücklich, gleichzeitig aber auch irgendwie gereizt und aggressiv. Ein Gähnen war zu hören. „Träumer?“, hörte er Schattens Stimme. „Ich bin hier“, sagte Träumer und setzte sich wieder auf den Boden. „Ah... Gut“, Schatten lachte. „Du bist nicht erfroren.“ Träumer sah ihn entsetzt an. „Erfroren?“, fragte er. Schatten nickte. „Du bist diese Temperaturen nicht gewöhnt, deswegen wusste ich nicht, ob du die Nacht gut überstehen würdest. Aber du bist härter, als du aussiehst. Das muss man dir lassen.“ Schatten lächelte. Träumer begegnete seinem Blick irritiert. Er sah also schwächer aus, als er eigentlich war? Also sah er schwach aus? Er versuchte, diesen Gedanken aus seinem Kopf zu verbannen, redete sich ein, dass Schatten das nicht so gemeint hatte. Dennoch blieb der Zweifel in einer Ecke seines Kopfes erhalten, immer bereit, sich auf den unvorbereiteten Träumer zu stürzen. Schatten gähnte erneut. Er sah zu Chila herüber und fragte Träumer: „War sie schon wach?“ Träumer schüttelte den Kopf. „Nein, war sie nicht“, sagte er. Schatten runzelte die Stirn. „Seltsam“, sagte er. „normalerweise schläft sie nicht so viel. Vielleicht...“ er stutzte, dann stand er auf und lief in großen Schritten zu Chila zu. Er drehte sie herum – und blickte in ihr blasses Gesicht. Schatten zischte wütend. „Sie ist krank“, sagte er. „Könnte eine Vergiftung sein. Was sollen wir denn jetzt machen? Verdammt, wir können sie hier doch nicht einfach verrecken lassen!“ Träumer stand wie erstarrt da. „Eine Vergiftung?“, fragte er entsetzt. „Wir können das nicht kurieren! Wir haben keine Heilmittel dabei! Und einen Heiler haben wir erst recht nicht! Wir können...“ er stockte. Sie konnten gar nichts tun. Wütend biss er die Zähne zusammen. Er konnte nicht immer sagen, dass sie nichts tun konnten. Sicherlich konnten sie IRGENDETWAS tun. Er musste nur herausfinden, was das war. Er MUSSTE herausfinden, was Chila retten könnte. Was sie retten würde. Schatten maß nachdenklich ihren Puls. Er schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte er schließlich. „nichts zu machen. Sie ist schon so gut wie tot.“ Träumer sah ihn an. „Nein“, sagte er. „Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein! Das ist unmöglich!“ Er zog Chilas Körper hoch- und hätte sie fast wieder fallen gelassen. Eine Schlange kringelte sich unter der Frau und zischelte böse. Träumer drückte Chilas Körper an sich, um sie möglichst weit weg von der Schlange zu halten. „Schatten“, rief er. „Schatten, hier ist eine Schlange!“ Schatten hatte sie längst registriert und zog sofort sein Schwert. Mit einem sauberen Schnitt war die Schlange in der Mitte durch geteilt worden. Sie zuckte noch einige Sekunden, dann lag sie still. Träumer presste Chilas halbtoten Leib noch immer an sich. „Oh Gott“, flüsterte er. „Oh Gott, nein...“ Schatten ging zu Träumer und nahm ihm den Körper ab. Er legte Chila behutsam gegen die Felsenhöhle. „Schatten!“, sagte er. „Schatten!“ in seinen Augen bildeten sich Tränen. Er fing an zu weinen. Schatten legte ihm die Hand auf die Schulter. „Ist ja gut“, sagte er. „Schatten! Sie ist tot! TOT! Und daran sind wir schuld! Weil wir die Höhle vorher nicht durchsucht haben. Wir hätten die Schlange viel früher bemerken können! Jetzt musste sie sterben... und wir sind Schuld.“ er weinte bitterlich. Die Tränen rannen ihn von den Wangen und tropften auf den Erdboden. Den kalten Erdboden. “Oh Gott...“ er schniefte. „Sie ist tot... Gestern noch... Schatten, sie hat gelacht! Wie kann sie sterben? Wo sie mich doch gestern noch angelächelt hat? Oh Schatten!“ Er drückte sich gegen Schattens Brust, allein konnte er nicht mehr stehen. Schatten hielt ihn stumm, obwohl ihm die Situation etwas unangenehm schien. „Sie ist einfach tot?“, flüsterte Träumer. „Ja!“, sagte Schatten. „Das ist nicht fair“, weinte Träumer. „Das ist überhaupt nicht fair!“ Schatten nickte. „Ist es nicht.“ er fuhr Träumer tröstend über den Rücken. „Ist es wirklich nicht.“ Träumer blickte auf Chila. „Wie konnte sie nur einfach sterben?“, fragte er. „Wie konnte sie mir das nur einfach antun? Wie konnte sie dir das antun? Wie konnte sie? Wir kommen ohne sie doch gar nicht weiter! Ich gehe ohne sie nicht weiter. Schatten, sie ist noch nicht tot, oder? Wir könnten versuchen, sie zu retten! Wir könnten doch versuchen, sie zu entgiften! Wir haben das Gift! Damit kann man doch ein Gegenmittel finden!“ Träumer blickte Schatten verzweifelt an und er wusste schon, dass Schatten den Kopf schütteln würde. „Wir wissen nicht, wie lange sie schon so da liegt. Wahrscheinlich ist sie schon nicht mehr zu retten.“ Träumer schüttelte den Kopf. „Wie kannst du so etwas sagen?“, fragte er und seine Augen waren wieder von Tränen erfüllt. „Wie kannst du so etwas nur sagen? Wie kannst du so etwas nur denken?! Schatten, es sollte nicht so enden! Wir müssen doch alle zusammen gehen! Wir sind doch eine Gruppe! Chila! Chila wach auf! Wir wollen weiter!“ Er lief zu ihr und schüttelte sie während er immer wieder ihren Namen rief. „Träumer!“, brüllte Schatten auf einmal. Träumer zuckte zusammen und sah Schatten an. Der Wahnsinn war in seinen Blick getreten. „Es ist zu spät. Wir können hier nichts mehr tun.“ Träumer fing an, bitterlich zu weinen. Er sank auf dem Boden zusammen und schluchzte nur noch. Kein Widerspruch mehr, kein Wort. Chila hatte den Kampf gegen den Tod ausgefochten und den Kürzeren gezogen. „Sie wird uns nie wieder führen, nicht wahr?“, fragte Träumer leise. Schatten nickte stumm. Träumer wandte Chila den Blick zu und küsste sie auf die Stirn. „Das von mir“, sagte er leise. „Danke, dass du uns den Weg begleitet hast.“ Schatten ging ebenfalls zu ihr und küsste sie auf die Stirn. „Das von mir“, sagte er. „Danke, dass du dich bereit erklärt hast, uns zu ertragen.“
Träumer blickte weg. Sie war tot. Endgültig. Wie war das nur geschehen? Hätte er besser aufgepasst, hätte er nur besser aufgepasst! Er hatte ihr den Tod gebracht. Wenn nicht direkt, dann wenigstens indirekt, indem er nichts getan hatte. Er hatte sie sterben lassen, obwohl er nach einem Heilmittel hätte suchen müssen. Als Träumer und Schatten die Grotte verließen, lag der Schnee sehr hoch. Sie sanken immer wieder ein, doch sie konnten das Ziel schon am Horizont sehen. Das Ende des Gebirges. Das Ende von allem. IN ihm spürte er diese Leere. Eine Leere, die zugleich nichts und alles war, die zugleich Trauer und Freude war, doch im Moment war die Freude verpufft oder wenigstens so klein, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Irgendetwas war fort. Es war nicht nur Chila, es war ein Stück Welt, ein Stück Hoffnung. Träumer konnte die Tränen nicht zurückhalten. Sie liefen über seine Wangen und es schien, als brannte jede Träne ein Loch in seine Haut, bis er sich vollständig aufgelöst hätte. Die Schmerzen wurden immer stärker, mit jeder Träne wurden sie schlimmer und schlimmer. Die Kälte nahm zu, das Wasser schien auf seiner Haut zu gefrieren. Träumer hörte dennoch nicht auf zu weinen. Er weinte weiter und der Schmerz war nichts, überhaupt nichts, gegen die Gefühle, die in ihm schrien. Er wollte nicht glauben. Wollte sich nicht eingestehen, dass er nichts dafür konnte, dass er machtlos gewesen war. Das war er lange genug gewesen. Machtlos und hilflos. Er musste das ändern, musste endlich eigene Entscheidungen treffen, damit er irgendwann endlich wieder aufrichtig lachen konnte. Falls er überhaupt noch lachen konnte. Er versuchte es, zog durch einige Anstrengungen die Mundwinkel nach oben. Doch das war kein Lachen. Das war nicht einmal ein Lächeln. Nur eine Fratze, die es nicht wert war, überhaupt einen Namen zu bekommen. Er ließ die Mundwinkel wieder nach unten sinken. Wie durch Magie flossen seine Tränen weiter und weiter. Unermüdlich. Wenn das so weiterging, dann musste er irgendwann unweigerlich austrocknen. Der Gedanke erschreckte ihn nicht sonderlich. Er war in eine gefährliche Gleichgültigkeit verfallen. Alles war gleich. Alles war egal. Der Tod war nichts, dass ihm jetzt Angst machte. Dem Tod sollte generell nicht angstvoll begegnet werden. Warum trauerte er dann? War es nicht besser, wenn sie tot war? Es war doch nicht so schlimm, wenn sie nicht mehr bei ihnen war. Oder? Sein Herz wusste, dass er lieber selbst sterben würde, wenn das dafür sorgen würde, dass Chila wieder lebte. Er wusste nicht, warum er so intensive Trauer verspürte. Aber sie war da, allgegenwärtig, sie machte mit ihm jeden Schritt, den er tat, jeden Atemzug, den er machte. Sie war da, beobachtete, wartete. Und weinte. Weinte, bis alles egal war. Weinte, bis zum letzten Tag. Vielleicht der letzte Tag seines Lebens, vielleicht würde er aber noch weinen, wenn der jüngste Tag gekommen war. Er wusste es nicht. Es war auch überhaupt nicht von Bedeutung. Von keinerlei Bedeutung. Unwichtig. Er schüttelte den Kopf und die Tränen fielen in den Schnee. Dort färbten sie den Schnee leicht rot. Mit gemäßigter Überraschung sah Träumer auf den rötlichen Schnee. Schatten drehte sich zu ihm um. „Du blutest im Gesicht“, sagte er. Träumer blickte Schatten an. „Wie meinst du das?“, fragte er. „So wie ich es gesagt habe“, sagte Schatten nur und deutete auf Träumers Wangen. „Du blutest. Deine Tränen sind gefroren und haben deine Haut aufgerissen. Das sieht schmerzhaft aus.“ Träumer zuckte mit den Schultern. „Ich spüre nichts davon“, sagte er leise und ließ die roten Tränen weiter auf den Boden tropfen. Solange, bis er nicht mehr weinen konnte. Wann immer das sein mochte. Es schmerzte. Natürlich schmerzte es, es schmerzte wie verrückt. Aber das war es wert. Auch wenn Träumer nicht wusste, was genau es wert war. Trotz dem unglücklichen Zwischenfall hatten sie beim Abend den Rand des Gebirges erreicht. Dahinter fing eine weitere Ebene an, doch sie schien trister und dunkler zu sein als die, von der sie gekommen waren. Vielleicht schien es Träumer auch nur so, weil er lange Zeit nur weiß gesehen hatte, aber er war sich nicht sicher. Vielleicht würde er nie wieder etwas in einer fröhlichen Farbe sehen. Vielleicht. Schatten sah ihn nur einmal an, dann ging er voraus, bis er einen Platz gefunden hatte, an dem sie rasten würden. Träumer ließ sich auf den Boden fallen, er war ausgelaugt und hundemüde. Der Tod war nun etwas allgegenwärtiges, etwas, dass er selbst dauernd erleben musste. Es machte ihm Angst, darüber nachzudenken, ob er vielleicht der Nächste sein würde. Oder ob Schatten der Nächste sein würde. Denn alles war möglich und jetzt waren sie so nah am Ziel, das spürte Träumer, auch wenn er nicht wusste, was ihr Ziel war. „Schatten“, sagte er leise. „Hm?“, sagte Schatten und blickte zu ihm herüber. „Was ist unser Ziel? Wo müssen wir hin?“ Schatten schloss die Augen. „Ich dachte, da wärst du langsam von allein drauf gekommen.“ Träumer sah ihn an, dann schüttelte er den Kopf. „Ich bin wohl nicht so schlau, wie du denkst“, sagte er leise. Schatten lächelte matt. „Unsinn“, sagte er. „Du bist bestimmt schlauer, als ich denke. Aber wenn du von allein nicht darauf kommst: Wir gehen zu Phaelandriel.“ Träumer sah ihn irritiert an. „Zu Wem?“, fragte er. „Zu Phaelandriel“, sagte Schatten noch einmal, dann schloss er die Augen. „Du weißt schon.“ Träumer sah ihn an. „Nein“, sagte er verwirrt. Schatten seufzte. „Die neue Königin.“ Träumer starrte ihn an. „Welche neue Königin?“, fragte er. Schatten öffnete seine Augen und zog die Augenbrauen hoch, als er Träumer ansah. „Welche neue Königin wohl?“, fragte er und verdrehte die Augen. „UNSERE neue Königin?“, fragte Träumer entsetzt. „die, die jetzt gerade den Thron inne hat?“ Schatten nickte. „Eben die“, bestätigte er. Träumer gab ein undefinierbares Geräusch von sich. Er legte sich ins Gras und stöhnte leise auf. Das konnte nur schief gehen. Ihn beschlich die leise Ahnung, dass sie niemals gewinnen konnten. Nicht gegen eine Königin. Denn Träumer wusste, dass Schatten nicht zur Königin wollte, um mit ihr Tee zu trinken. Er wollte sie töten. Er schauderte. Da war er wieder. Der Tod. Erneut in seinen Gedanken. Träumer sah zu Schatten und schüttelte den Kopf. „Das ist Wahnsinn, Schatten!“ Schatten lachte. „Nein“, sagte er. „Nein, das ist es nicht.“ Träumer starrte ihn an. „Wir haben doch keine Chance!“, rief er. Schatten nickte. „Zu zweit nicht, das stimmt schon. Aber ich habe auch nicht behauptet, dass wir zu zweit gehen werden, oder? Ich kenne einige Leute, die bereit wären, sich uns anzuschließen. Sie haben ebenfalls mit der Königin ein Problem, aus welchen Gründen auch immer.“ Träumer überlegte kurz. „Zum Beispiel, weil sie eine Frau ist?“ Schatten lachte. „Vermutlich auch das. Aber das spielt keine Rolle. Sie sind bereit mit uns in den Krieg zu ziehen, aus welchen Beweggründen auch immer.“ Träumer schüttelte den Kopf. „Ich finde schon, dass das eine Rolle spielt“, sagte er und sah Schatten ungläubig an. „Man sollte solche Menschen doch nicht auch noch unterstützen!“ Schatten seufzte „Du hast recht“, sagte er. „Wahrscheinlich sollte man das wirklich nicht. Aber es spielt keine Rolle für mich. Es ist mir vollkommen egal, wie ich zu meinem Ziel komme. Ich lebe letzten Endes nur noch für meine Rache. Ich lebte nur für den Tag, an dem sie endlich stirbt. Weil sie mir meine Lebensfreude genommen hat und weil sie das Leben eines Menschen zerstört hat, der mir sehr nahe stand. Weil sie die Frau umgebracht hat, die ich über alles geliebt habe. Weil sie Spaß daran hat, mit den Leben von anderen Menschen zu spielen. Weil sie eine bösartige Hexe ist. Weil sie ihre Macht ausnutzt. Weil ich sie von ganzem Herzen hasse.“ er sah zu Träumer und seufzte. „Weil sie eine Magierin ist, der die Macht zu Kopf gestiegen ist.“ Träumer verschluckte sich. Er hustete ein paar Mal, dann konnte er sich wieder beruhigen. „Sie ist was?“, fragte er entsetzt. „Sie ist eine... eine... eine Magierin? Wieso? Wie ist das passiert? Warum hast du mir das nie erzählt?“ Schatten lächelte traurig. „Es spielt doch keine Rolle“, sagte er. „Es spielt im Grunde wirklich keine Rolle. Nicht einmal ansatzweise. Es sagt überhaupt nichts über einen Menschen aus, was er ist. Selbst als Prinzessin kann man nett und freundlich sein und sich um Arme kümmern. Als Heiler kann man auch verdorben sein und alle Patienten töten. Das Einzige, das ich je gelernt habe, und damit meine ich nicht das Zeug, was man beigebracht bekommt, sondern das, was man von allein über Menschen erfährt, dann ist es, dass er völlig egal ist, wer du bist oder in welchem Stand du geboren wurdest. Es ist vollkommen egal, denn du kannst immer den falschen Weg einschlagen und zu etwas werden, dass du am Anfang verachtest hast. Du kannst immer dazu werden, was du nie sein wolltest. Ich habe mir nie gewünscht, Menschen zu töten. Jetzt ist es mein Beruf. Sie hat mich dazu getrieben, Weil sie immer wieder Menschen auf mich gehetzt hat. Durch sie habe ich keine anderen Arbeiten bekommen, immer waren die in Lebensgefahr, die sich mit mir abgaben. Nur weil sie mich attraktiv fand. Träumer, Schönheit ist kein Segen. Schönheit ist ein Fluch. Wenn du hässlich bist, achten die Menschen auf deine inneren Werte. Wenn du aber schön bist, wirst du auf dein Aussehen herabgestuft. Das schlimmste ist, dass du sogar selbst anfängst, Schönheit für das Maß aller Dinge zu halten- bis dir ein Unfall widerfährt und du völlig entstellt wirst.“ Er deutete auf die Narbe in seinem Gesicht. Träumer musterte sie eine Weile und meinte dann: „Aber deine Narbe hat dich nicht entstellt. Du siehst doch immer noch gut aus. Zumindest, soweit ich das beurteilen kann.“ Schatten lachte. „Das wollte ich damit nicht provozieren“, sagte er und lächelte. Dann wurde sein Gesicht zu Stein. „Jetzt sind wir zwei wieder auf uns gestellt, was?“, fragte er. Träumers lachen erstarb daraufhin sofort. „Ja“, hauchte er tonlos und in seinen Augen stiegen die Tränen wieder hoch. „ja, das sind wir.“ Schatten setzte sich neben Träumer auf den Boden und legte den Arm um ihn. „Weine nicht, kleiner Dichter. Tränen sind zu kostbar, als dass man sie dem kalten Erdboden schenken sollte.“ Träumer blickte ihn an. Schatten lächelte ihn an. „Schreib doch etwas, wenn du der Meinung bist, dass du deine Gefühle irgendwo abladen musst“, Träumer nickte. „Ja, vielleicht hast du recht“, räumte er ein. Schatten lächelte. „Wo ist im Übrigen dein Hut?“, fragte Schatten. Träumer blickte ihn an. „Was?“, fragte er. „Dein Hut“, sagte Schatten. „Er ist weg.“ Träumer fasste zu seinem Kopf. Schatten hatte Recht. Der Hut war verschwunden. Er zuckte mit den Schultern. „Ich muss ihn wohl verloren haben“, sagte er. „Macht mir nichts aus. Es ist ja nicht so, als würde ich sonderlich an ihm hängen. Früher oder später musste ich ihn verlieren. Das war ja bis jetzt immer so“, eine Träne lief ihm über die Wange. Schatten wischte sie vorsichtig mit seiner Hand weg. „Träumer“, sagte er leise. „Du darfst nicht so an dem irdischen hängen. Das macht dich nur unnötig unglücklich.“ Träumer schüttelte den Kopf. „Woran sollte ich dann hängen?“, fragte er. „Es gibt doch sonst nichts, woran ich mich halten könnte. Es gibt doch sonst nichts! Schatten, woran sollte ich mich halten?“ Doch Schatten schüttelte nur erneut den Kopf. Er erwiderte nichts darauf. Träumer schwieg ebenfalls. Er schwieg, weil es nichts mehr zu sagen gab. Er schwieg auch wegen Chila, die jetzt nichts mehr sagen konnte. Sie würde nie wieder etwas sagen können. Er senkte den Blick. „schlaf jetzt, kleiner Dichter“, sagte Schatten. „Wenn du jetzt schläfst, dann können wir morgen früh weiter. Dann ist alles schneller vorbei.“ Träumer nickte. Er schloss die Augen, aber irgendwie glaubte er nicht, dass er heute noch Schlaf finden würde. Wieder dachte er an Chila. Ob er auch nie wieder aufwachen würde, wenn er jetzt einschlief? Solche Gedanken würden ihn nicht trösten, befand er. Und dann, endlich, schlief er ein und träumte von Dingen, die nicht so grausam waren wie die Wirklichkeit, in der er sich befand.
20.
Träumer erwachte, doch er fühlte sich nicht ausgeruhter, im Gegenteil, er fühlte sich noch schlechter, als er es gestern getan hatte. Die Sonne schien in sein Gesicht, er selbst war ungeschützt, jetzt, da ihm sein Hut fehlte. Er seufzte, setzte sich auf. Schatten war bereits wach. „Iss etwas, Träumer“, sagte er. „Wir werden bald wieder aufbrechen.“ Träumer nickte. Er holte etwas Essbares aus seinem Rucksack. Das Meiste, was sich darin befand war entweder zu hart, um es noch zu essen oder es begann zu schimmeln. Er fand einen schrumpeligen, aber noch genießbaren Apfel und biss hinein. Der Geschmack war nicht sonderlich aufregend, er schmeckte noch schlimmer als ein gewöhnlicher Apfel. Träumer hatte noch nie Äpfel gemocht, aber dieser war der schlimmste, den er jemals gegessen hatte. Er aß auf und warf den Stiel weg. Dann schmiss er auch die ganzen schimmeligen Essensreste weg. Schatten sah ihm dabei zu. „jetzt musst du ja richtig Platz in deinem Rucksack haben“, bemerkte er. Träumer zuckte mit den Schultern. „Mag sein“, sagte er. „mir gefiel es aber besser, als er noch schwerer war. Da wusste ich zumindest, dass ich mir um die Verpflegung keine Gedanken machen musste.“ Schatten lachte leise, doch es klang nicht fröhlich. Im Grunde klang er in letzter zeit nie fröhlich. Träumer dachte darüber nach, ob Schattens Lachen vielleicht niemals fröhlich gewesen war, er es aber nicht mitbekommen hatte. Möglich war es zumindest, nach allem, was Schatten durchgemacht hatte. In seiner Umgebung starben alle um ihn herum, Träumer wusste nicht, wie er das aushielt. Nur er selbst war noch nicht gestorben. Aber zweimal war es zumindest kurz davor gewesen. Träumer dachte an den Sumpf zurück und schüttelte den Kopf, um den Gedanken zu vertreiben. Er blickte auf den Inhalt seines Rucksacks. Da lagen seine Pergamente, sein Federkiel, seine Flöte, sein Tintenfass. Sonst nichts. Er seufzte. Er hatte im Grunde nichts Wertvolles bei sich, das war zwar einerseits glücklich, weil ihn so niemand ausrauben würde, aber andererseits auch traurig. Er stand auf. „Wohin gehen wir, Schatten?“, fragte er. Schatten sah ihn an und stand dann ebenfalls auf. „Wir gehen heute zum ersten Endpunkt unserer Reise“, sagte er. „Zum Stützpunkt.“ Träumer sah ihn verständnislos an. „Was ist das?“, fragte er. „Der Platz, an dem sich die Leute befinden, von denen ich dir bereits erzählt habe“, sagte Schatten. „Die, die mit uns gegen die Königin kämpfen werden. Die Rebellen, wie sie sich selbst nennen.“ Bei dem Wort „kämpfen“ zog sich Träumers Magen krampfhaft zusammen. „Aha“, sagte er und setzte sich seinen Rucksack auf. Jetzt war nicht die Zeit um zu schwächeln. Er hatte diesen Weg gewählt und deshalb würde er ihn jetzt bis zum Ende beschreiten. Schatten ging voraus. Wie immer. Träumer folgte ihm, doch diesmal blieb er nicht hinter ihm. Während dieses Monatlichen Trips hatte er an Kondition gewonnen. Jetzt war er in der Lage, mit Schatten Schritt zu halten. Er ging neben ihm. Er war jetzt nicht mehr derjenige, der ihm immer hinterher lief. Jetzt konnte er mit ihm mithalten. Vielleicht nicht in allem, höchstwahrscheinlich nicht in allem. Aber zumindest beim Laufen. Zumindest jetzt in diesem Moment konnte er sich so fühlen, als wäre er Schatten ebenbürtig. Schatten war nur ein Mensch. Träumer war auch nur ein Mensch. Sie waren aus demselben Stoff gemacht, sie würden jetzt zusammen bleiben und wenn nötig, auch zusammen sterben. Wie Poetisch. Er lief immer neben Schatten, so als wäre er sein Schatten. Über dieses Wortspiel musste er lächeln, doch das Lächeln verschwand so schnell wie es gekommen war, es wurde ihm mit einem geschickten Zug vom Gesicht gewischt, als er auf den Wald blickte, den er in der Nähe erkennen konnte. Er roch einen bekannten Geruch. Es war der Geruch von Blut. Schatten bemerkte es ebenfalls. „Hier stimmt etwas nicht“, sagte er beunruhigt. Schatten begann zu rennen, Träumer ebenfalls, auch wenn er nicht wusste, was es zu bedeuten hatte. Doch er konnte es sich beinahe denken: Das Lager der Rebellen, dieser so genannte Stützpunkt - es schien entdeckt worden zu sein. Und der Blutgeruch wollte diese These auch noch unterstützen. Schatten rannte, er rannte immer schneller, immer weiter, wie ein Wahnsinniger, immer geradeaus. Träumer rannte hinterher, er konnte den Abstand, der zwischen ihnen lag, nicht verringern, doch immerhin wurde er nicht größer. Sie kamen dem Wald immer näher und der Geruch von Blut verstärkte sich. Träumer wurde fast übel, eine solche Konzentration hatte er noch nie erlebt. Schatten allerdings schien nicht so eine Übelkeit zu verspüren, er war allerdings extrem angespannt. Je weiter sie in den Wald hinein liefen, desto verzweifelter wurde er. Er verschnellerte sein Tempo. Jetzt kam Träumer endgültig nicht mehr hinterher. Keuchend blieb er stehen und schnappte nach Luft. Der Geruch hing überall: in den Bäumen, er lag auf den Blättern und hing wie Tautropfen auf dem Gras. Träumer hielt sich die Nase zu und versuchte verkrampft, durch den Mund zu atmen, weil er sich sonst übergeben hätte. Zugegeben, der Apfel, den er vorhin gegessen hatte, war die ganze Mühe vielleicht gar nicht wert. Aber hier ging es nicht um den Wert, sondern eigentlich um das Prinzip. Schließlich war er ein Mann und ihn durfte so etwas nicht zum Erbrechen bringen. Er würde noch viel mehr Blut riechen müssen, viel, viel mehr. Jetzt konnte er sich davon nicht in die Knie zwingen lassen. Er schloss die Augen und riss sich zusammen. Er öffnete die Augen wieder. Schatten war verschwunden. Träumer blickte sich entsetzt um. Er war ganz allein. In Panik blickte er nach links und nach rechts, doch er konnte Schatten nirgendwo entdecken. Das einzige, was er sah, war eine Leiche. Ihm stockte der Atem. Er ging mit vorsichtigen Schritten auf den toten Körper zu, der sich seinem Blick fast ganz entzog, weil er hinter einem umgefallenen Baum lag. Träumer ging um den Baum herum und hätte beinahe laut aufgeschrien. Die Füße des Menschen waren das einzige, was noch klar zu erkennen war. Der Kopf bestand nur noch aus einer breiigen Masse, die wohl aus Haut, Muskel und Blut bestand, aber Träumer war sich dabei nicht ganz sicher. Er wich einen Schritt zurück und starrte auf die Leiche, von der er nicht einmal mehr bestimmen konnte, ob es eine Frau oder ein Mann gewesen war. Er wich noch weiter zurück, bis er gegen einen Baum prallte. Als er sich umdrehte, wünschte er sich, dass er es nicht getan hätte. Denn vor ihm lag, in einiger Entfernung, ein Berg von Leichen. Die Übelkeit übermannte ihn. Sie zwang ihn in die Knie, er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Sein Magen grummelte, als sich sein Inhalt auf den Waldboden wieder fand. Träumer
stützte sich mir den Armen auf dem Boden ab, er wagte es nicht, nach oben zu blicken. Er wagte es nicht, noch einen Blick auf die toten Körper zu riskieren. Er wagte es nicht. Es machte ihm Angst. Es machte ihn Angst, die toten Körper zu sehen, weil er dann wieder an Chila denken musste. Er schloss die Augen und zwang sich, aufzustehen. Mit wackeligen Knien stand er und drehte sich um. Mit geschlossenen Augen war das schwieriger, als er gedacht hatte. Er hatte es sich nämlich leichter vorgestellt. Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Er öffnete die Augen und wollte sich an Schatten lehnen, doch der Mann, dem er in die Augen sah, war nicht Schatten. Entsetzt starrte er ihn an. „Wer bist du?“, fragte er entsetzt. Der Mann blickte ihn finster an. „Das sollte ich dich fragen“, knurrte er. Träumer wollte zurückweichen, aber hinter ihm war der Baum. Ihm fiel ein, dass er sich ändern wollte. Dass er wollte, dass er nicht mehr der Jammerlappen war, der er jetzt war. Er blickte dem Mann direkt in die Augen und zwang sich, den Blick aufrecht zu erhalten. „Wer will wissen, wer ich bin?“, fragte er mit leicht zitternder Stimme. Der Mann blickte ihn noch finsterer an, dann zog er langsam seine Waffe. Träumer griff zu seinem Dolch, mit einigem Widerwillen. Er wollte nicht töten. „Er gehört zu mir!“, erklang eine laute Stimme. Träumer lächelte. Das war Schattens Stimme. Der Mann drehte sich nach der Stimme um und als er Schatten erblickte, erbleichte er. „Das habe ich nicht gewusst“, sagte er. „Er hat so bei den Leichen der königlichen Soldaten herumgestanden, ich hielt ihn für einen Soldaten, der uns entwischt war.“ Schatten lachte laut und kalt. „Träumer würde niemals töten“, sagte er. „Aber es spricht nicht für dich, dass du deine Verbündeten nicht erkennen kannst!“ Der Mann zuckte zusammen. „Ihr habt recht“, sagte er leise und verneigte sich. „vergebt mir, Freund des Drorn, dass ich euch für einen Feind gehalten habe. Vergebt mir meinen Frevel.“ Träumer blickte ihn erheitert an und nickte. „Es sei dir vergeben“, sagte er. Dann blickte er zu Schatten. Schatten machte eine Fingerbewegung, die ihm sagte, dass er zu ihm kommen sollte. Träumer lief auf ihn zu. Schatten legte ihm schützend den Arm über die Schulter. „Der hätte dich eiskalt umgebracht“, sagte er und seine Stimme verriet Verachtung. „Gut, dass ich dich rechtzeitig gefunden habe, nicht wahr?“ Träumer konnte nur nicken, seine Stimme versagte gerade. Er hatte ihn töten wollen? TÖTEN? „Was ist hier passiert?“, fragte Träumer mit leiser, fast erstickter Stimme. „Offensichtlich gab es hier einen Verräter in den eigenen Reihen, so wie ich das mitbekommen habe“, sagte Schatten und zog Träumer von dem Leichenberg in eine andere Richtung davon. „Die Soldaten der Königin haben diesen Platz entdeckt und wollten alle Rebellen vernichten. Allerdings haben sie - wie man sieht - erbitterten Widerstand geleistet und dabei die meisten Soldaten töten können. Sie sind sich nicht sicher, ob es nicht einige geschafft haben, sich zu verkleiden und unter die Rebellen zu mischen. Momentan wird eine Säuberung vollzogen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er dich für fähig gehalten hätte, Menschen zu töten. Du hast dich übergeben, als du die Leichen gesehen hast!“ Schattens Stimme wirkte leicht erheitert. Träumer errötete. „Wie lange hast du schon da gestanden und mich beobachtet?“, fragte er leise. „Nicht sehr lange“, sagte Schatten. „Ich bin größtenteils diesem Kerl gefolgt.“
„Diesem Kerl?“, fragte Träumer. Schatten wies mit dem Kopf zu dem Mann, der die beiden bis eben noch interessiert gemustert hatte und nun sich daran machte, davon zugehen. „Den da. Ich habe ihn gesehen, als ich mich beim Anführer der Truppe erkundigt habe, was vorgefallen war. Er hat mich so seltsam gemustert und als er dann den Befehl erhielt nach verdächtigen Leuten Ausschau zu halten, habe ich mich an ihn dran gehängt. Ich hatte so eine Ahnung, dass er letzten Endes mich zu dir führen würde- du warst schließlich auf einmal verschwunden, so wie du das ab und zu einfach tust. Und mein Gespür hat mich nicht im Stich gelassen.“ er lächelte. Träumer nickte. „mhh“, sagte er leise und blickte zu Boden. „Komm mit“, sagte er. „Ich möchte dich jemanden vorstellen.“ mit diesen Worten ging er los und setzte wieder einmal voraus, dass Träumer ihm folgte. Träumer lächelte und tat genau das, was Schatten von ihm erwartete- er folgte ihm. Schatten führte ihn durch den Wald. Ein gutes Stück tiefer im Wald befand sich ein Lager, zu dem er Träumer brachte. Sie begegneten einigen Menschen, die ihre Waffen schärften oder reinigten, die ihre Wunden oder die Wunden von anderen behandelten. Überall war ein geschäftiges Treiben, wie Träumer es lange nicht mehr erlebt hatte. Seit sie bei den Räubern im Wald gewesen waren, war einige Zeit vergangen und seit sie in der Stadt gewesen waren, noch mehr. Und... seit er zu Hause gewesen war, war eine Zeitspanne vergangen, die er nicht einmal genau definieren konnte. Es war zu viel Zeit. Er dachte an Thome und stellte fest, dass er sich nicht mehr zu einhundert Prozent an ihn erinnern konnte. Sein Gesicht war zwar noch in seinen Gedanken, aber verschwommen, wie durch einen Nebel verzerrt. Er machte ein trauriges Gesicht. Schatten sah ihn an und fragte: „Alles in Ordnung?“ Träumer nickte, doch es war nicht alles in Ordnung. Er wollte zurück nach Hause, zurück zu Thome, zurück zu der Harmonie. Er vermisste es, er vermisste das alles so sehr, dass er immerzu weinen könnte. Doch er musste stark sein. Stark, weil Schatten es von ihm erwartete, weil Thome bestimmt nicht wollte, dass er wegen ihm weinte. Weil Träumer wollte, dass es ihnen dort gut ging. Sie sollten nicht mit den Gedanken gequält werden, dass es ihm vielleicht schlecht ging. Sie waren doch seine einzige Familie. Die einzige, die er jemals hatte. Und Schatten war vielleicht sein einziger Freund. Wenn er das eine aufgeben musste, um das andere zu erlangen, dann sollte es wohl so sein. Er seufzte. Was würde wohl noch alles geschehen? Schatten führte ihn durch einige Zelte und Holzhütten zu einem Zelt, dass etwas größer als die übrigen war. Er schlug den Eingang auf und sagte zu Träumer: „Tritt ein. Er erwartet dich bereits.“ Träumer wagte nicht zu fragen, wer „ER eigentlich war, er ging ohne etwas zu erwidern ins Zelt. Schatten trat nach ihm ein und schloss den Eingang wieder hinter sich. Das Zelt war kleiner, als es von Außen den Anschein gehabt hatte, was vor allem an der Innenausstattung lag, die dem Raum einiges an Größe nahm. Sie waren deswegen ein wenig ungeschickt angeordnet, fand Träumer. So hätten die großen Schränke, die hinter einem großen Holzstuhl standen, nun wirklich nicht in dieses Zelt gemusst. Sie passten nicht zum Stoff, dazu waren sie zu groß und zu dunkel, selbst die feinen, geschnitzten Verzierungen wirkten eher unheimlich als schön. Kurz um schufen sie eine Unheimliche Atmosphäre. Träumer machte wieder einen Schritt rückwärts. Er hatte das Bedürfnis, das Zelt sofort wieder zu verlassen. Schatten stand hinter ihm und drückte ihn wieder sanft nach vorn. Träumer blickte sich nicht zu Schatten um, aber der Gedanke, dass er hinter ihm stand, gab ihm mut und Kraft. Er blickte sich um und bemerkte, dass sich eine weitere Person sich in diesem Zelt befand. Ein dunkelhäutiger breitschultriger Mann trat aus dem Schatten. Seine Augen waren eisblau und stachen aus dem Dunkel hervor. Träumer musste wider seinen Willen schlucken. Er hatte Angst vor diesem Mann. „Du bist also Träumer?“, fragte der Mann mit einer unerwartet rauchigen und friedlichen Stimme. „Träumer nickte wie automatisch. Er war zu einer Antwort, bei der er reden musste, nicht fähig. Der Mann musterte ihn eine Weile und trat dann ganz aus dem Schatten, den die großen Schränke warfen. Er setzte sich auf den Stuhl, der in der Mitte des Zeltes stand und aus dunklem Holz gefertigt war. „Tritt näher“, verlangte er. Träumer rührte sich nicht, erst, als Schatten ihn ein Stück nach von schubste, machte er die letzten Schritte von allein. Der Mann blickte ihn nachdenklich an. „Dreh dich“, forderte er Träumer auf. Träumer folgte dieser Aufforderung nur mit Widerwillen, doch schließlich gehorchte er. Er war nie gut darin gewesen, sich direkten Befehlen zu widersetzen, weder bei Thome, noch bei Schatten oder sonst wem. Der Mann murmelte zustimmend irgendetwas, das Träumer nicht verstand, vielleicht war es sogar eine andere Sprache, aber da war er sich nicht ganz sicher. Dann erhob er sich und gab Träumer die Hand. „Ich bin der Anführer dieser Truppe“, sagte er und mit einem Lächeln entblößte er weiße Zähne. „Von welcher Truppe?“, fragte Träumer unvorsichtig. „Von den Rebellen natürlich!“, sagte der Mann und seine Augenbrauen zogen sich wütend zusammen. Träumer nickte nur, die Situation erschien ihm viel zu gefährlich, als dass er irgendetwas anderes behauptet hätte. Er drehte sich zu schatten um, dessen Miene unergründlich war. Träumer wandte sich wieder dem Mann zu. „Ihr kennt meinen Namen“, sagte er fest und sein Herz pochte dabei schmerzhaft bis zum Hals. „Aber ich kenne den Euren nicht. Ich schlage vor, dass Ihr ihn mir verratet, bevor wir noch weitere Worte wechseln.“ Der Mann blickte Träumer an, doch Träumer hielt dem Blick stand. „Wie unhöflich von mir“, sagte der Mann, doch Träumer konnte nicht sagen, ob er es tatsächlich so meinte, oder ob er nur einen sarkastischen Scherz machte. „Ich war der Annahme, mein Name wäre schon bekannt.“ Träumer hielt sich davon ab, ein „Tja, ist aber nicht so“ zurückzugeben. Er antwortete darauf einfach gar nicht und versuchte, den Blickkontakt aufrecht zu erhalten, auch wenn ihm das sehr schwer fiel. „Ich bin Alan. Freut mich sehr, dich kennen zu lernen.“ Alan reichte Träumer erneut die Hand 8nd Träumer ergriff sie und schüttelte sie. Dabei hielt er den Blick immer auf Alan gerichtet. „Du willst also hier bei uns mitmachen?“, fragte Alan. Träumer schüttelte entschieden den Kopf. „Nein“, sagte er. Alan hob die Augenbrauen hoch. „Nicht?“ Alan blickte zu Schatten, doch der machte nur ein undefinierbares Geräusch und blickte bewusst in eine andere Richtung. Alan sah Träumer gerade heraus an. „warum bist du dann hier?“ Träumer blickte in Alans Augen. Es schmerzte ihn innerlich, denn er merkte, wie wütend es Alan machte, dass er so tat, als wären sie gleich gestellt, obwohl er ein Anführer war - und Träumer ein Nichts. „Ich bin hier, um Schatten zu helfen“, sagte Träumer ernst. Er wich keinem Blick aus. Jetzt galt es, sich zu beweisen. Alan blickte Träumer lachend an. „Und was, wenn es bedeuten würde, in meiner Armee einzutreten, um Schatten zu helfen?“, fragte er. Träumer lächelte, wollte etwas antworten, doch dann schwieg er erst, als dächte er über die Antwort nach. Schließlich antwortete er lächelnd: „Selbst dann würde ich nicht eintreten. Denn ich würde nichts machen, wodurch ich den Tod von anderen Menschen verantworten würde. Ich bin nicht so.“ Alans Lächeln verblasste. „So wie wer?“, fragte er und seine Stimme bekam einen bedrohlichen Unterton. „So wie wer?“ Träumer schluckte. „So wie ihr“, sagte er. „Meinetwegen auch so wie Schatten. Ich bin kein Mörder.“ Alans Augen blitzten wütend, Träumer hatte das Gefühl, als könnte er sich jeden Moment auf ihn stürzen. Doch stattdessen blickte Alan zu Schatten und dieser ließ sich von Träumers Worten sehr wenig bis überhaupt nicht beeindrucken. Der dunkelhäutige Mann fand sein Lächeln schnell wieder. Dieses kalte, bedrohliche Lächeln, das Träumer das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen und lächelte ebenfalls. Sein Lächeln war anders. Falsch, hölzern. Er bezweifelte, dass Alan hochgezogene Mundwinkel und ein echtes Lächeln unterscheiden konnte. Die wenigsten Menschen konnten das. Vielleicht hatte er Glück. Vielleicht. Vielleicht hatte er aber auch Pech und er würde in den nächsten Minuten umgebracht werden. Obgleich das eigentlich unwahrscheinlich war. Sie wollten Schatten nicht als Verbündeten verlieren, sonst hätte der Mann vorhin sich nicht so tief verneigt und nicht so verängstigt geschaut. Obwohl, wenn er es sich recht überlegte, es ja nichts Neues war, dass Männer vor Schatten Angst hatten. Er selbst hatte ebenfalls zuerst Angst gehabt. Träumer lächelte innerlich. Er selbst war wohl der schlechteste Maßstab, den er hätte wählen können, um diesen Vergleich zu machen. Unwichtig. Alans stechender Blick riss ihn wieder aus den Gedanken. „Was hast du dann für einen Nutzen für uns?“, fragte er. Träumer lachte leise. „was gibt es da zu lachen?“, fragte Alan wütend. Dieser Mann war sehr leicht zu reizen und zu erzürnen, das stand fest. „Ich werde für euch nicht von Nutzen sein“, sagte Träumer. Alan starrte ihn irritiert an. „Wieso denkst du dann, dass du hier bist?“, fragte er. Träumer begegnete dem Blick mit den eisblauen Augen mit seinen eigenen, grünen. „Ich bin hier, weil Schatten möchte, dass ich bei ihm bin. Ich bin hier, um mit Schatten das zu Ende zu bringen, was er beenden möchte. Ich bin hier, weil die Königin diesen Krieg beenden soll, damit ich wieder nach Hause kann. Dorthin, wo ich vorher gewohnt habe. Woraus mich der Krieg vertrieben hat.“ Alan blickte ihn an. „Wenn es dein zu Hause noch gibt, vorausgesetzt“, sagte er. Träumer blickte ihn irritiert an. Auch Schatten schien überrascht aufgrund dieses Themawechsels. „was?“, fragte Träumer. „Ich meine das ernst“, sagte Alan. „wer weiß denn, ob dein zu Hause noch steht? Die Ebene der Dörfer ohne Namen zum Beispiel ist vor zwei Wochen von der königlichen Armee „gereinigt“ worden, weil nicht genug Rekruten aus dieser Gegend gekommen sind. Ein Exempel an Staatsverrätern.“ Träumer starrte Alan an. „Was?“, fragte er ein zweites Mal. „Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr…“ Er schüttelte den Kopf. Schatten schnappte nach Luft. „Träumer“, sagte er. „Doch nicht etwa…“ Träumer ballte die Hände zu Fäusten. „Ich muss sofort dorthin!“, brüllte er. „Ich muss sofort nach Hause! Das ist nicht wahr! Ich muss gehen und mich davon überzeugen, dass er gelogen hat! In meinem Dorf geht es allen gut! Es geht ihnen gut…“ er drehte sich zu Schatten um und wollte das Zelt verlassen. Schatten streckte seinen Arm aus und zog Träumers Kopf an seine Brust. „Zieh keine voreiligen Schlüsse“, sagte er. „Vielleicht hat er sich nur versprochen.“ Träumer blickte zu Schatten hoch, Tränen blitzten in seinen Augen auf. „Er hat gesagt, dass die Ebene der Dörfer ohne Namen dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Ich wohne dort! Mein Dort hat keinen Namen, genauso wie alle anderen Dörfer dort in der Gegend keinen Namen haben! Ich muss es wissen Schatten! Ich muss wissen, ob es stimmt! Ob alle tot sind! Ob Thome…“ er schüttelte den Kopf und senkte ihn, damit Alan ihn nicht weinen sah. Alan schien es dennoch zu bemerken, denn er sagte: „Ich kann ihm jemanden mitgeben, der mit ihm geht.“ Schatten funkelte Alan an. „Er wird nicht gehen“, sagte er leise und bestimmend. „Oh, doch, Schatten“, sagte Träumer. „Ich werde gehen! Ich werde gehen, wenigstens um… wenigstens… wenigstens, um meinen Ziehvater zu begraben. Er hat eine ehrenwerte Beerdigung verdient. Er hat mich doch all die Jahre… er hat sich doch all die Jahre um mich…“, Träumer konnte weiter nichts mehr sagen. Er schluchzte leise auf und seine Beine gaben unter ihm nach. „Geh nicht“, bat Schatten ihn. „Lass mich gehen“, sagte Träumer und weinte. „Lass mich gehen. Ich werde danach sofort zurückkommen, aber lass mich gehen!“ Schatten schüttelte den Kopf. „Es würde Monate dauern, Träumer! So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben noch höchstens zwei Wochen.“ Alan meldete sich zu Wort. „Das wäre möglich“, sagte er. Schatten und Träumer blickten ihn an, beide überrascht. „Wie bitte?“, fragte Schatten. Alan nickte. „Ich kann ihm jemanden zur Seite stellen. Außerdem gibt es eine Abkürzung, die man nehmen kann - und damit meine ich nicht den Weg über das Meer, sondern einen durch das Gebirge. Und zwar DURCH und nicht über das Gebirge.“ Träumer hörte interessiert zu. „Es gibt einen Tunnel“, sagte Alan. „Einen Tunnel, der hier in der Nähe beginnt und irgendwo bei Irgon wieder endet. Kaum jemand weiß von dem Tunnel; es ist ein alter Weg der Magier; wir haben auch nur durch Zufall davon erfahren. Ich würde ihm auch jemanden zur Seite stellen, der kompetent genug ist. Er ist unser Neuzugang, aber man kann ihm blind vertrauen.“ Bei den Worten „Neuzugang“ und „blind vertrauen“ schnaubte Schatten zwar auf, aber dennoch schien er nicht uninteressiert. „Wer ist es?“, fragte er. Alan lächelte geheimnisvoll. „Tritt ein“, sagte er leise. Von hinten öffnete sich das Zelt einen Spalt und ein junger Mann schlüpfte herein. Er war einen Kopf kleiner als Träumer und etwa zwei Köpfe kleiner als Schatten, hatte dunkelbraune Haare und Augen in derselben Farbe. Träumer musterte ihn irritiert. „Das“, sagte Alan und lächelte stolz. „Das hier ist Lian. Er ist unser einziger Magier.“ Träumer sah überrascht hoch und auch Schatten zog die Luft ein. Es entstand eine kurze Stille, doch dann durchbrach Lian sie. „Hallo“, sagte er und seine braunen Augen funkelten, als er lächelte. „Schön, sie kennen zu lernen. Ich habe schon viel von Euch gehört Drorn.“ Er nickte zustimmend und verbeugte sich vor Schatten. Dann sah er zu Träumer und das Lächeln stahl sich erneut auf sein Gesicht. „Und Ihr“, sagte er. „Ich hörte, Ihr seid Dichter? Ich liebe das geschriebene Wort! Am liebsten würde ich in einem Turm voller Bücher leben. Aber ich habe nie genug Geld, um mir diesen Traum zu verwirklichen.“ Er seufzte. „Doch solltet ihr ein Buch herausbringen, so werde ich es ganz sicher kaufen. Egal, wie meine finanzielle Lage sein sollte.“ Lian wartete auf eine Antwort und als außer geschmeicheltem Schweigen nichts kam, blickte er zu Alan. „Ihr habt mich gerufen, Meister Alan?“, fragte er. Alan nickte. „Ich habe eine Bitte“, sagte er. „Fahrt nur fort“, sagte Lian und lächelte. „Ich möchte, dass du diesen jungen Mann dort“, er deutete zu Träumer. „zu der Ebene bringst, wo die Dörfer keine Namen haben.“ Lian blickte Alan verwirrt an. „Aber die Königin hat dort doch alles dem Erdboden gleichgemacht“, sagte er verständnislos. „Warum will er dort hin?“ Alan blickte zu Träumer und meinte dann nur: „Er wohnt dort.“ Lian verstand. „Oh“, sagte er. Dann musterte er Träumer besorgt. „Das wird keine schöne Nachricht für euch gewesen zu sein. So etwas gleich bei der Ankunft zu erfahren… mein Beileid.“ Er wandte sich zu Alan. „Wann werden wir denn aufbrechen?“, fragte er. Alan überlegte nicht lange. „Ab besten sofort“, entschied er. „nimm ihn mit dir.“ Lian nickte. „kommt. Lass uns alles Notwendige vorbereiten. Wie ist eigentlich euer Name?“, mit diesen Worten schob der junge Magier Träumer aus dem Zelt. Er redete und redete. Träumer lächelte. Eine solch lebensfrohe Person war ihm in den letzten Tagen nicht mehr unter die Augen gekommen. Selbst in den Zeiten des Friedens war er selbst niemals so gewesen. Er war immer schon nachdenklich und leise gewesen, hatte viel über Dinge nachgedacht. Auch über endgültige Dinge, wie den Tod. Doch Lian schien davon noch nie gehört zu haben und wenn doch, dann hatte er es einfach eiskalt ignoriert. Träumer hörte dem bunten Redeschall nicht wirklich zu, aber nur, weil er sich so viele Informationen auf einmal gar nicht einprägen konnte. „Wie es denn jetzt euer Name?“, fragte Lian gerade im fröhlichen Plauderton. „Träumer“, sagte Träumer. Lian blickte ihn an. „Wirklich?“, fragte er. „Ich dachte, das sei nur ein Kosename für euch, so wie ihr Drorn einen Schatten nennt. Ist das also wirklich euer richtiger Name? Und ihr seid glücklich damit?“ Lian sah Träumer fassungslos an. Träumer überlegte kurz...„Nun ja…“, sagte er. „Eigentlich schon. Ich habe noch nie darüber groß nachgedacht.“ Lian nickte nachdenklich, dann sagte er: „Das ist nicht in Ordnung. Ihr solltet einen richtigen Namen haben. Ich meine, einen Namen, den man auch als solchen erkennt. Selbst Drorn, den ihr Schatten nennt, hat einen wirklichen Namen. Namen sind sehr wichtig.“ Träumer blickte Lian an. „Warum?“, fragte er. „Warum sind sie das?“ Lian lachte. „Warum, fragt Ihr?“, sagte er und ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. „Das kann ich beantworten. Weil es in der Natur des Menschen liegt, Namen zu geben. Es ist menschlich. Und will ein Mensch nicht immer möglichst menschlich sein?“ Träumer runzelte die Stirn, das ergab im Grunde keinen Sinn. Doch er stellte es nicht in Frage, sondern schwieg. Er schwieg und überließ Lian das Reden. Dieser redete auch ununterbrochen. „Ein Name ist das, was den Menschen auszeichnet. Sein Hang, alles und jedem Namen zu geben, was er sieht, macht ihn besonders. Ah, dort drüben ist mein Zelt. Wieso folgt ihr mir nicht einfach?“ Er plauderte fröhlich weiter, während er Träumer zu einem kleinen Zelt lotste, das ein wenig außerhalb des Lagers stand. „Ich bin ein wenig gefährlich, wenn ich schlafe“, erklärte Lian grinsend. „Deswegen liegt mein Zelt etwas weiter abseits. Auch wenn Alan mich am Liebsten viel näher bei sich gehabt hätte. Ein Magier ist eben ein seltenes Gut. Es gibt nicht mehr viele von uns.“ Träumer sah in Lians freundliches Gesicht. „Wie kommt das?“, fragte er. Lians Lächeln verschwand für einen kurzen Moment, dann kehrte es unsicher zurück. „Es ist eine traurige Geschichte“, sagte er. „Und sie ist ziemlich lang. Ich denke, ich kann sie dir erzählen, wenn wir auf dem Weg sind.“ Träumer nickte. Sie betraten Lians Zelt.
Das Zelt hatte nur wenige Möbel. Ein kleiner Stuhl, auf dem Kleidungsstücke lagen, eine dünne Matte, die auf dem Boden ausgerollt war, ein kleiner Schrank, der magisch zu glitzern schien. Lian nahm einen Rucksack, der neben der Matte stand und packte wahllos ein paar der Kleidungsstücke hinein. Träumer sah ihm dabei zu. Dann fuhr Lians Blick über die Gegenstände, die auf dem Boden herumlagen und er nahm sich einen Stock. Dann lief er zur Kommode und öffnete eine der Schubladen. Er nahm allerlei okkult aussehendes Zeug heraus, steckte es ebenfalls in den Rucksack und kehrte dann zu Träumer zurück. „Habt ihr alles?“, fragte er und lächelte. Träumer starrte wortlos auf Lians Rucksack. Er sah kaum gefüllt aus, hatte aber doch vor Sekunden alles Mögliche in sich aufgenommen. Lian bemerkte Träumers irritierten blick und lächelte schelmisch. „Ich habe meinen Rucksack mit einem Zauber belegt“, sagte er. „Damit ist er nicht so schwer- und sieht auch nicht so aus.“ Träumer zog die Augenbrauen hoch, er hatte Mühe, das zu glauben, wobei er es doch mit eigenen Augen gesehen hatte. „Ah… ja“, sagte er und versuchte ein Lächeln. „Seid Ihr denn jetzt soweit?“, fragte Lian. „Oder… kann ich auch „du“ zu Euch sagen?“ Träumer zuckte mit den Schultern. „Wie du willst“, sagte er. Lian lächelte. „großartig“, sagte er. „großartig.“ Er verließ sein Zelt wieder und bedeutete Träumer, ihm zu folgen. Träumer folgte Lian wieder durch das Lager. Lian bog einige Male ab, dann blieb er vor einer Holzhütte stehen, aus der es sanft nach Lebensmitteln roch. „Unsere Vorratskammer“, erklärte Lian. „Da wir den Tunnel benutzen werden, können wir ja schlecht auf Beutezug gehen oder auf dem Weg irgendwo etwas Passendes einkaufen. Deswegen müssen wir es von hier mitnehmen. Warte kurz auf mich.“ Mit diesen Worten verschwand Lian hinter der Tür. Man hörte nichts mehr. Nach einigen Minuten krachte es und ein leises Stöhnen gefolgt von einem Fluchen war zu hören. Dann kam Lian wieder aus der Hütte zurück. Sein Rucksack schien etwas voller zu sein und er hielt sich mit einer Hand den Schädel. „Wollen wir dann los?“, fragte er Träumer. Träumer nickte nach einigem Bedenken. „Ja“, sagte er. „Ich will endlich sehen, ob es stimmt.“ Das wollte er wirklich. Die Ungewissheit, die an ihm nagte, war unerträglich. Träumer blickte noch einmal in die Richtung, in der er das zelt vermutete, in dem sich Schatten zurzeit befand, dann folgte er Lian, der wieder ein Stück vorausgegangen war und ihm jetzt freundlich zuwinkte. Die beiden verließen das Lager in östlicher Richtung. Sie liefen erst durch den Wald, der nach wenigen Stunden wieder in eine Ebene mündete. Von hier aus konnte man das Gebirge sehen. „Wir müssen unter dem Gebirge durch“, sagte Lian. „Ich kenne den Weg. Es ist ein alter Magiertunnel, der unter dem Gebirge hindurchführt und uns direkt zu der Ebene bringt, in die du willst. Du wusstest es vielleicht nicht, aber früher war die Ebene ohne Namen die Heimat aller Magier. Durch den großen Krieg vor vielen hundert Jahren aber wurden sie daraus vertrieben und normale Menschen haben sich dort niedergelassen. Normalerweise vertragen sich Magier nicht gut mit normalen Menschen. Es heißt, Magier sind zu hochmütig dazu.“ Lian lachte. „Vielleicht stimmt das sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die meisten Magier haben tatsächlich nicht viel mit normalen Sterblichen zu tun. Schließlich leben wir länger als ihr Menschen es tut. Im Grunde sind wir auch mächtiger als ihr. Das hat viele Magier dazu bewogen zu denken, sie wären besser als normale Menschen. Ein trauriger Fehler. Dann selbst Magier sind nicht unsterblich.“ Lian seufzte leise. Sie gingen weiter, immer weiter und erreichten schließlich das Gebirge. Lian legte die Hand an den kühlen Stein, der an dieser Stelle steil nach oben verlief. Er schloss die Augen und summte leise einen tiefen Ton. Er ging Schritt für Schritt vorwärts und hielt dabei immer den Ton, immer summte er. Plötzlich blieb er stehen und öffnete die Augen. „Hier ist es“, sagte er leise. Seine Stimme bebte vor Konzentration, als er plötzlich die Melodie änderte. Die Luft knisterte leise, als die Magie durch sie hindurch auf den Stein zufloss. Eine kleine blaue Flamme deutete sich an Lians Finger ab, er zog einen Kreis mit seinem Finger auf dem Stein. Der Stein knarrte und knisterte, dann schwang er zurück und gab den Blick auf einen Schwarzen Tunnel frei. Lian lächelte. „Gut“, sagte er. „Tritt ein. Wir sind da.“ Träumer ging ein paar Schritte vor und zögerte dann. „Wieso gehst du nicht zuerst?“, fragte er misstrauisch. „Ich kann nicht zuerst gehen“, sagte Lian leise. „Das Tor verschließt sich sofort, wenn der Magier hindurchgegangen ist, der das Siegel geöffnet hat. Das verhindert, dass Feinde hier eindringen können, ohne das ein Magier es will.“ Träumer nickte, doch er schien nicht ganz überzeugt. Es wäre ebenfalls möglich, dass das alles hier nur ein abgekartetes Spiel war, mit dem sie ihn von Schatten trennen wollten. Doch er hatte keine andere Wahl, er musste Lian vertrauen. Es gab keine Alternative, wenn er sein Dorf sehen wollte. Es gab keinen anderen Weg. Also trat er hindurch in die schwarze Leere. Sekunden danach hörte er, wie der Eingang sich verschloss. Sekunden später war es stockfinster. Träumer drehte sich um, doch er hörte nichts. Kein Atem, kein Wort. Nichts. Er verfluchte sich dafür, dass er so dumm gewesen war und Lian geglaubt hatte. Er war so nett gewesen, er konnte es gar nicht ernst gemeint haben. Er hatte ihn belogen. Diese Erkenntnis traf Träumer ziemlich hart. Sekunden später leuchtete eine blaue Lichtkugel neben ihm auf und Lian tauchte neben ihm auf. „Da bist du ja“, sagte er. Träumer sah ihn erleichtert an. „Ich dachte schon, du hättest mich hier allein gelassen“, sagte er leise. Lian blickte ihn ungläubig an. „Dann würdest du hier ja verhungern“, sagte er und schüttelte den Kopf. „Nein, so etwas würde ich nicht tun. Hungertod ist das schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Der Tod durch verhungern, sterben, weil man nichts zu essen hat… Gruseliger kann es nicht sein.“ Er schüttelte sich, als wollte er seine Aussage damit bestätigen. Träumer lächelte. „du siehst aber gar nicht so verfressen aus“, sagte er. „Das täuscht. Magie verbraucht eine Menge Energie, die ich nur wieder bekommen kann, wenn ich genug esse“, er grinste. Dann schloss er die Augen und konzentrierte sich. Er vergrößerte die Lichtkugel, sodass sie den Gang einige Meter weit beleuchtete. „Lass uns jetzt losgehen“, sagte Lian und deutete nach vorn. „Wir haben einen Weg von etwa zwei Tagen in Finsternis vor uns, dann noch etwa einen Tag im freien, bis wir zu dem Dorf ankommen, von dem ich mir vorstellen kann, dass du dort herkommst.“ Als er Träumers ungläubigen Blick sah, lächelte er. „Glaube mir, ich weiß, wo du herkommst. Ich war selbst einmal dort und viele der Dorfbewohner ähneln dir in ihrer Art.“ Träumer wiegte nachdenklich den Kopf hin und her. War das möglich? Er hatte nie so genau darüber nachgedacht. „Du magst recht haben“, sagte er langsam und gähnte. Die Dunkelheit um ihn herum machte ihn schläfrig. „Ich mag nicht nur Recht haben“, sagte Lian und lachte. „Ich habe Recht. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und jetzt lass uns gehen, bevor du noch einschläfst. Wir haben nämlich nicht sonderlich viel Zeit.“ Träumer nickte stumm und gähnte erneut. Dann folgte er Lian, der sich in Bewegung versetzt hatte. Sie gingen ein gutes Stück durch den halbdunklen Gang, den Lian mit seiner Leuchtkugel beleuchtete, dann begann der junge Zauberer urplötzlich, zu singen. Er sang ein leises Lied in einer Sprache, die Träumer völlig fremd war und er sang sie zusätzlich noch in einer merkwürdigen Tonlage, sodass das Lied mal hoch, mal tief, mal traurig und mal fröhlich klang.
Lian ging durch die Finsternis, er sah sich nicht um und ging immer weiter in die Dunkelheit hinein. Träumer überfielen Plötzlich Selbstzweifel. Vielleicht war es nicht der richtige Weg. Vielleicht war mit seinem Dorf nichts passiert und er würde umsonst dort hingehen. Vielleicht würde Thome in Zorn geraten und ihn anschreien und hochkant hinauswerfen. Alles war möglich. Er schloss kurz die Augen. Die Dunkelheit wurde immer stärker, sie waberte vor seinem inneren Auge hin und her. Er öffnete seine Augen wieder und es wurde heller. Er schloss die Augen wieder. Finsternis. Er öffnete sie: Ein bläuliches Licht. „Was ist das eigentlich für ein Licht, das du da beschworen hast?“, fragte Träumer. „Magisches Licht“, sagte Lian. Träumer stöhnte leise auf. Das erklärte überhaupt nichts. „Es ist ein Licht, das eigentlich nicht existiert“, sagte Lian. „Es leuchtet nicht direkt, sondern... es nimmt ihnen die Dunkelheit, verstehst du? Ist ein bisschen schwierig zu erklären.“ Träumer nickte, obwohl es ihm nicht klar war. Doch das spielte keine Rolle. Er spürte, dass Lian es nicht besser erklären konnte. Und selbst wenn Lian es anders erklärt hatte, so wettete er darauf, dass er es dennoch nicht verstanden hätte. Träumer lächelte spitz. Er dachte an Thome und die Bewohner seines Dorfes und das Lächeln gefror im Gesicht. Es gab jetzt noch keinen Grund, um in irgendeiner Weise glücklich oder erleichtert zu sein. Nicht, wenn er sich nicht sicher sein konnte, dass sie überlebt hatten. „Wie lange müssen wir noch wandern?“, fragte Träumer. Lian blickte ihn an und sein Blick verriet Verwirrung. „Einen Tag, denke ich“, sagte er und musterte ihn nachdenklich. Träumer nickte. „Und wie lange sind wir schon unterwegs?“ Lian überlegte kurz. „Wohl eineinhalb Tage, vielleicht etwas weniger. Ich kann die Zeit hier so schwer schätzen.... Wir werden diesen Tunnel bald hinter uns haben. Keine Angst.“ Er lächelte. Träumer schüttelte den Kopf. „Ich habe keine Angst“, sagte er. „Wieso sollte ich auch?“ Lian zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht. Eigentlich gibt es hier nichts, das einem Angst machen könnte... Nur diese eine Sache...“ Träumer wurde hellhörig. „Was für eine Sache“, verlangte er zu erfahren. Lian druckste herum. „Na ja...“, sagte er. „Es gibt hier eine Stelle die etwas gefährlich ist. Früher einmal floss ein Fluss durch diesen Teil des Tunnels. Die Magier haben dort Fähren angebracht, um ihn gefahrlos zu passieren. Na ja... Früher einmal war das so. Jetzt fließt dort kein Wasser mehr, deshalb befindet sich anstatt des Flusses dort ein Spalt im Weg. Es gibt zwar eine Brücke, aber die ist nicht sonderlich sicher...“ Träumer starrte Lian fassungslos an. „Wieso hast du mir das nicht eher erzählt?“, fragte er. Lian zuckte Schuldbewusst. „Du wolltest unbedingt deine Freunde sehen. Ich habe selbst nicht daran gedacht, es tut mir Leid. Und außerdem wollte ich schon immer einmal zum Land hinter dem Gebirge, aber ich habe Angst vor dem Meer, weswegen ich nicht den Seeweg nehmen kann. Ich wollte schon immer, aber auch nicht allein und als du meintest, du wolltest auch auf die andere Seite, da dachte ich, ich könnte mit dir zusammen hingehen. Wenn du es gewusst hättest, wenn du gewusst hättest, das es diese Stelle auf dem Weg geben wird, dann wärst du vielleicht nicht mehr mitgekommen. Ich wollte dieses Risiko nicht eingehen. Es tut mir Leid, das war ein Fehler. Wir können wieder umkehren, wenn du das möchtest...“ Lian senkte die Schultern und blickte den Boden an. Träumer lachte und schüttelte dann den Kopf. „Ich bin schon so weit gekommen...“, sagte er. „ Da werde ich jetzt nicht aufgeben. Jetzt ganz sicher nicht.“ Lian hob den Kopf und strahlte. „Ich wusste, dass du das sagen würdest!“, sagte er und das Lächeln erschien wieder auf seinen Gesichtszügen. Träumer nickte. „Das habe ich vermutet“, sagte er und ein leichtes Lächeln huschte über sein Gesicht. „Lass uns weitergehen, damit wir schnell aus dieser Düsternis herauskommen können.“ Lian nickte zustimmend. „Mir nach“, rief er und seine Stimme strahlte eine gewisse Vorfreude aus. „Auf zu den grünen Hügeln!“ Träumer überlegte, was Lian damit wohl meinte. Dann entschloss er sich, ihn zu fragen. „Was meinst du damit?“ Lian sah ihn an. „Ach, weißt du...“, begann er. „Ich habe im Traum einmal eine Vision von der anderen Seite gesehen, und seit dem erscheint mir unser Gras so... fad, so farblos.“ Träumer blickte ihn überrascht an. „Das habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal das Gras hier gesehen habe. Nicht so grün wie in der Heimat. Hier ist es nicht so farbenfroh wie dort,woher ich komme. Aber ich dachte, das läge daran, dass ich kürzlich eine Freundin verloren habe...“ Träumer fuhr sich durch das blonde Haar. Lian blickte ihn überrascht an. „Oh“, sagte er betroffen. „Mein Beileid, das wusste ich nicht.“ Träumer nickte und ein wehmütiger Blick machte sich auf seinem Gesicht breit. „Ich weiß. Du konntest es überhaupt nicht wissen. Aber es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn du davon gewusst hättest. Wir standen uns nicht sonderlich nahe, sie war unsere Führerin. Eine Schlange hat sie getötet.“ Träumer seufzte. „Wir kannten uns kaum“, sagte er. „Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihr verbringen können. Mehr Zeit, um mit ihr zu reden, mehr Zeit, um sie vielleicht besser kennen zu lernen. Aber das war mir nicht vergönnt.“ Er dachte an Chila, an ihr braunes Lockengespinst, an ihr Lächeln. Er wurde wehmütig und die Tränen wollten wieder hochsteigen, doch er schluckte einmal und verdrängte sie wütend. Jetzt war nicht der Augenblick, um zu weinen, sondern der, sich zusammenzureißen und zu wandern. Mittlerweile konnte er eines nämlich ziemlich gut: Wandern. Wandern und dabei nicht nachdenken, dabei einfach nur vorwärtsgehen. Er hatte Chila eigentlich nicht leiden können, aber sie war nützlich gewesen und ihr Tod war vollkommen unverdient. Allerdings trug auch niemand Schuld an ihrem Tod. Dieser Gedanke fuhr in Träumer und ließ ihn erleichtert aufatmen. Er war im Grunde nicht Schuld. Schatten war nicht Schuld. Selbst Chila war nicht die Schuldige an ihrem Tod gewesen. Sie hatten nichts tun können, um ihr zu helfen.Träumer wollte fast wieder lächeln, aber dann durchzuckte ihn es erneut. Das klang wie eine Ausrede. Als habe er Angst, jemand würde ihn für ihren Tod verantwortlich machen wollen. Als könnte er es nicht ertragen, dass durch seine Nachlässigkeit eine Person ums Leben gekommen war. Es machte jetzt keinen Unterschied mehr. Wahrscheinlich würde Chila niemand mehr finden, über die Berge kamen nur selten Menschen, die meisten wählten den Weg über das Meer, um in die Hauptstadt zu gelangen. Er schüttelte den Kopf. Er musste diese Gedanken aus seinem Kopf vertreiben, sonst würden die Schuldgefühle ihn für immer verfolgen. Träumer seufzte ein weiteres mal und bewirkte damit, dass Lian sich zu ihm umdrehte, um zu sehen, ob alles in Ordnung war. Träumer lächelte ihm zu. Lian lächelte zurück und drehte sich wieder um. Die zwei wanderten weiter, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, Stunde für Stunde. Die Zeit verrann und doch hatte Träumer das Gefühl, dass sie nicht vorankamen. Er versuchte sich einzureden, dass das alles nur von der Dunkelheit kam, aber so war es nicht. Es lag nicht nur daran, dass er nicht sehen konnte, wie viel Weg schon hinter ihnen lag oder wie viel Weg sie noch beschreiten würden müssen. Es lag daran, dass er Lian nicht genug vertrauen konnte. Der Junge war zwar fröhlich und sicherlich sehr nett, aber Träumer kannte ihn gerade einmal drei Tage. Schatten war weit weg, und Träumer folgte Lian in ein Gebiet, in dem er sich nicht selbst auskannte.
„Du traust mir nicht“, sagte Lian plötzlich. Dass der junge Magier die Wahrheit so einfach aussprach, überraschte Träumer etwas. Er nickte unwillkürlich. „Ja“, sagte er. „Du hast Recht. Ich traue dir nicht.“ Lian ging weiter. „Um ehrlich zu sein, das war mir von Anfang an klar.“ Träumer starrte überrascht in Lians Rücken. „Aber es stört mich nicht sonderlich“, ertönte Lians fröhliche Stimme. „Es ist normal, Fremden nicht viel Vertrauen zu schenken und ich bin eine besondere Art von Fremder. Ich bin ein Magier, einer der wenigen, die es noch gibt.Stell dir vor, letztens wollten mich doch tatsächlich ein paar Leute umbringen, weil irgendjemand ihnen erzählt hat, dass Magier mit den Teufeln im Bunde stehen würden.“ Träumer warf ihm einen verständnislosen Blick zu. „Den Teufeln?“, fragte er. „Wer sind die Teufel?“ Lian drehte sich zu ihm um. „Das weißt du nicht?“, fragte er überrascht. Träumer schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte er. „Dort, wo ich herkomme, gibt es so etwas wohl nicht.“ Lians Gesicht legte sich kurz in Falten, dann erhellte sich seine Miene. „Ach ja, stimmt, du bist ja von der anderen Seite. Ich wusste nicht, dass ihr dort die Teufel nicht kennt.“ Träumer kam sich mit einem Mal dumm vor. „Ist das denn so elementar zu wissen, wer die Teufel sind?“, fragte er. Lian schüttelte den Kopf. „Nein, eigentlich nicht. Aber um deine Neugier zu befriedigen, kann ich dir ja trotzdem verraten, was es damit auf sich hat.“ Lian lächelte wieder. Träumer hob aufmerksam den Kopf. „Erzähl“, sagte er gespannt. Lian nickte. „Dann geh am Besten neben mir, so können wir uns besser unterhalten.“ Träumer beschleunigte seinen Schritt, damit er neben Lian gehen konnte. Nach einer Weile begann Lian zu sprechen. „ Es gibt eine alte Sage über die Entstehung unserer Welt“, sagte er. „Damals war unsere Erde von unsterblichem Eis bedeckt und keine Leben herrschte, abgesehen von einer Gruppe Dämonen und einem Wesen, das die Geschichtsschreibung den Herren des Lichtes nennt. Über ihn ist eigentlich nichts bekannt, er spielt im weiteren Verlauf auch nur einmal eine wichtige Rolle. Wichtig sind eigentlich die Dämonen. Sie waren sich einig, dass sie die Herrscher über die Eiswelt sein sollten, aber nicht darüber, wie sie überhaupt verfahren wollten. Denn drei der vier Dämonen waren des ewigen Eises müde und wollten Veränderung spüren. Doch der letzte der vier wollte das Eis behalten. So spalteten sie im Streit die Welt auf in vier Teile und die drei Dämonen erschufen zuerst das warme Land. Der vierte rettete Landstriche des Eises und verteilte dort die Tiere, wilde Polarfüchse, Bären und andere wilde Tiere. Der dritte der Dämonen schuf das wilde Gewässer, die anderen beiden teilten das warme Land unter sich auf und damit sie sich nicht über die Grenze streitig wurden, schufen sie das Gebirge, eben das, was unser Königreich trennt. Sie schufen die wilden Tiere und das Gewürm und alles, was nicht gut oder gar niederträchtig handeln konnte. Schließlich schufen sie Unterdämonen, die nach ihrem Ebenbild geformt waren und jeder mit einem Bruchteil der Macht gesegnet, die die vier Urdämonen hatten.“ Träumer hatte bis hierhin zugehört, doch er fragte sich, inwiefern das etwas mit diesen „Teufeln“ zu tun haben sollte. Doch bevor er fragen konnte, hatte Lian schon weitergesprochen. „Diese Dämonen begannen, die ursprüngliche Welt auf den Kopf zu stellen; Sie errichteten Altäre zu Ehren der Urdämonen, gaben ihnen Namen wie die Unverbesserlichen, die Unsterblichen oder auch die Teufel. Doch eines Tages entschloss sich der Herr des Lichts, der bisher nur untätig dem Treiben mehr oder weniger Beachtung geschenkt hatte, einzugreifen. Er vernichtete die niederen Dämonen und lieferte sich dann einen Kampf gegen die vier Urdämonen, den er letztendlich siegreich beendete. Die vier Urdämonen konnten von ihm jedoch nicht so einfach getötet werden, da sie aus dem selben Stoffe waren wie der Herr des Lichts selbst. So verbannte er sie in eine Zwischendimension und verbot ihnen, diese Erde jemals wieder zu betreten. So weit die Theorie.“ Lian blickte zu Träumer und seine Augen leuchteten. „Es kursiert das Gerücht, dass die vier Urdämonen wieder auf der Welt sind, eingepfercht in Menschenkörper, beschworen von den letzten Magiern, die es noch gibt. Das ist auch der Grund, warum ich gejagt wurde. Die Menschen fürchten sich vor diesen Gerüchten, sie fürchten, dass sich ein Fünkchen Wahrheit in ihnen befinden könnte.“ Träumer begegnete Lians Blick mit nachdenklicher Miene. „Und?“, fragte er. „Sind die Gerüchte wahr?“ Lian zuckte mit den Schultern. „Ich weiß es nicht“, räumte er freimütig ein. „Und wahrscheinlich wird es niemand wissen. Aber wenn diese Dämonen wirklich wieder auf unserer Welt wandeln, dann wird es gefährlich für jeden Magier in dieser Welt. Denn die Dämonen schätzen keine Menschen, die sie wieder verbannen können, so wie es der Herr des Lichts damals getan haben soll.“ Träumer nickte. „Du lebst ziemlich gefährlich“, bemerkte er. Lian lachte. „Man kann sich nicht aussuchen, wer man ist“, sagte er. „Und irgendwie ist das doch auch gut so. Ganz ehrlich, ich fühle mich wunderbar in meiner Haut. Niemals käme ich auf die Idee, dass ich lieber jemand anderes wäre. Mein Leben ist so schon sehr spannend. Und was ist mit dir? Hast du manchmal das Gefühl, dass du im falschen Körper sitzt?“ Träumer nickte. „Immer“, sagte er. „Immer.“ Lian sah ihn fragend an. „Wieso das denn?“, fragte er. „ Kein Selbstbewusstsein?“ Träumer gluckste. „Wenn man das so einfach ausdrücken könnte! Nein, es ist dieses unscheinbare Gefühl, dass dir immer in die Brust schleicht, wenn du jemanden siehst, der wirklich etwas kann! Jemand, der nicht einfach nur angibt, der wirklich etwas ist und so tut als wäre er so wie du. Wobei du selbst immer weißt, wie viele Stufen du unter dieser Person stehst. Alles an dieser Person gibt dir das Gefühl schlecht zu sein, unvollständig und völlig hilflos. Du siehst zu ihr auf und bewunderst sie und weißt, dass du niemals so werden könntest. Du weißt auch, dass dieser Gedanke allein dich schon daran hindert, so zu werden wie diese Person. Von dir selbst hältst du überhaupt nichts mehr und von Tag zu Tag schmerzt es dich mehr, dass du nichts kannst.“ Lian war stehen geblieben. Er blickte stirnrunzelnd zu Träumer und musterte ihn von Kopf bis Fuß. „Bist du dir sicher, dass du dich beschreibst?“, fragte er mit einem seltsamen Tonfall. Träumer nickte. „Ich denke schon.“ Lian hob überrascht eine Augenbraue. „Wirklich?“, fragte er. „Ich hätte dich nicht so eingeschätzt. Du bist eine ziemlich imposante Erscheinung, wenn du mich fragst.“ Träumer stutzte. „Bitte?“, fragte er und schob seine Haar hinter das Ohr für den Fall, dass er sich verhört hatte. „Ich meine es bitter ernst“, sagte Lian und seine Augen fixierten Träumers. Das tiefe Braun erinnerte Träumer plötzlich an die Augen eines Rehs. „Wie hättest du mich denn beschrieben?“, fragte Träumer. Lian öffnete den Mund, doch zuerst sagte er nichts. Dann schloss er den Mund wieder und legte den Kopf schief. „Du bist etwas Besonderes“, sagte er. „Anders. Das hat man dir schon angesehen, als du in unser Lager gekommen bist. Der Schwarzhaarige war ja schon eine seltsame Erscheinung, aber du warst anders. Diese dunkel gebrannte Haut, als würdest du immer in der Sonne liegen. Dazu das helle Haar, das sich gegen diese dunkle Bräune mit strahlender Helligkeit gewehrt hat. Der abgekämpfte Ausdruck im Gesicht, der sowohl Angst, als auch entschlossene Verbissenheit ausstrahlte. Du warst ein Rätsel. Und als du dann den Schwarzhaarigen angelächelt hast, war ich vollkommen verwirrt. Dein Lachen war so rein, als hättest du noch nie einen einzigen Menschen sterben sehen. Vollkommen befreit, unschuldig, glücklich. So ein Lachen hätte ich auch gern einmal gehabt.“ Träumer blickte ihn irritiert an. „Aber du hast doch die ganze Zeit gute Laune“, sagte er. „Warum solltest du auf mein Lachen neidisch sein?“ Lian schüttelte den Kopf. „Das stimmt doch nicht“, sagte er. „Mein Lächeln ist niemals so gewesen. Ich kann nicht lachen, als wäre das Leben ein Spaziergang. Mein Leben war schon immer schwer gewesen, Aber ich sah sofort, dass du schon einiges hinter dir haben musst. Und dennoch dieses Lachen? Wieso konnte ich mich nie NIE richtig freuen? Ich bin nie glücklich, ich habe nur gelernt, so zu scheinen, weil es einem Sympathien bringt.“ er lächelte. „Ziemlich Falsch, aber ich kann nichts daran ändern. Es liegt mir im Blut.“ Träumer sah ihn an. „Warum beschwerst du dich?“, fragte er. „Mein Lachen mag vielleicht frei sein, vielleicht auch „unschuldig“ und was du sonst noch so für Worte dafür gefunden hast. Aber was ist daran beneidenswert? Ich würde sofort mit dir tauschen. Sofort. Aber ich kann nicht. Und das ist vielleicht unglücklich, vielleicht ist es auch ein glücklicher Umstand. Wer weiß das schon?“ Lian nickte. „Du hast Recht“, sagte er. „Vielleicht sollten wir einfach weitergehen, sonst kommen wir nämlich nicht voran. Du wolltest schließlich innerhalb von drei Tagen da sein, nicht wahr?“ Träumer nickte. Lian lächelte. „Eben. Das allein wird schon knapp, wenn wir uns beeilen. Also los jetzt!“ Träumer nickte zustimmend und die beiden setzten sich in Bewegung. Kurze Zeit später waren sie wieder in monotones Laufen verfallen. Träumer folgte Lian, und Lian bewegte sich unermüdlich auf den Ausgang zu. Es mochten Stunden vergangen sein, Träumer hätte es nicht sagen können. Zu lange waren sie jetzt schon in der Dunkelheit unterwegs gewesen.
Dann, wann konnte Träumer nicht mit Gewissheit ermitteln,hielt Lian plötzlich an. Träumer hatte nicht damit gerechnet, deswegen wäre er fast in den Magier hineingelaufen. Glücklicherweise konnte er sich rechtzeitig stoppen – hätte er es nicht gekonnt, so wäre der junge Magier kopfüber in einen hunderte Meter tiefen Spalt gefallen. Lian drehte sich zu Träumer um. „Wir sind jetzt fast da“, sagte er. Träumer blickte den Abgrund hinunter. „Wenn du das wirklich meinst“, sagte er und bezweifelte Lians Aussage stark.
Der Abgrund war so tief, dass man seinen Boden nicht sehen konnte. Lian lächelte aufmunternd und sagte dann zu Träumer. „Wir kommen da schon herüber. Das dürfte nicht allzu schwierig werden.“ Träumer sah Lian überrascht und ungläubig an. „Nicht allzu schwierig?!“, schrie er. „Das ist ein ABGRUND! Wenn wir da hineinfallen, dann kommen wir morgen noch nicht auf dem Boden auf!“ Lian grinste. „Na, dann fall am besten nicht rein. Wir haben nämlich nicht genug Zeit dafür. Morgen müssen wir nämlich wieder auf dem Rückweg sein.“ Träumer sah Lian verständnislos an. „Wieso?“, fragte er. Lian grinste. „Weil Morgen Abend die drei Tage vorbei sind. Und jetzt sei still, ich muss mich konzentrieren.“ Träumer ließ Lian gewähren. Der Magier schloss die Augen und schien sich zu sammeln. Dann erschuf er eine Platte aus Licht, die sich unter Träumers Füße schob und ihn in die Luft gehen ließ. Träumer, vor Angst unfähig, irgendetwas zu sagen, wurde langsam auf den Abgrund zu getragen. Er wagte es nicht, sich zu bewegen, aus Angst, die Platte könnte aus dem Gleichgewicht geraten und ihn in die Tiefe stürzen. So stand er verkrampft und steif da, während die magische Plattform über den Spalt flog und nach ihn – nach einigen qualvollen Minuten – wieder auf festem Boden absetzte. Dann flog sie über den Spalt zurück, um Lian zu holen – und ließ Träumer in einem Meer von Dunkelheit allein zurück.
Über den Autor
Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht gefallen euch ja auch die eine oder andere meiner Geschichten :)
Leser-Statistik
97
Kommentare
Kommentar schreiben
| EagleWriter |
| EagleWriter Ich weiß schon warum ich spinnen nicht mag, na ja habs jetzt bis Seite 65 geschafft . Mal sehen wies weitergeht, habe ja noch ein paar Seiten vor mir lg E:W |
| EagleWriter Soweit ichs bisher gelesen habe doch ganz spannend, werde dranbleiben lg E:W |