Krimis & Thriller
Die Amerikanerin - Teil III
Kategorie Krimis & Thriller
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
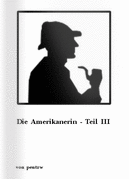
Die Amerikanerin - Teil III
Ein Tag aus ihrem Leben
Morgens
Zum Glück war sie noch so fit, dass sie sich körperlich in bester Verfassung wähnte. Ihre Schönheit war ihr noch immer anzusehen, wenn sie sich wie jetzt im Spiegel betrachtete. Die steinerne Schönheit einer Marmorstatue. Allerdings ihr Konterfei, empfand sie, gleichfalls wie aus Marmor versteinert, hatte dadurch das Gesicht einer steinernen Tonsur gekriegt. Es wirkte so angespannt, als hätte sie eine Schönheitsoperation hinter sich, weil sich kaum eine verräterische Falte zeigte. Auch ihr Körper - sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihren prallen Busen im Spiegel taxieren zu können - war objektiv noch recht anziehend, wenngleich ohne Leben, was nur sie wusste. Diese Tatsache entrang ihr ein Seufzer, sie wandte sich vom Spiegel ab und schaltete das Licht in ihrem kleinen Kabuff ab, um in der Düsternis des Zimmers ihren Gedanken über ihr Leben nachzuhängen.
Zwar war sie von ihrem Mann wegen einer Jüngeren verlassen worden, aber es war ihr ein Klacks gewesen, locker weggesteckt und kein bisschen aus der Bahn geworfen hatte es sie. Sie war ehrlich, und das war sie sowohl zu sich selbst, soweit man das kann(!) als auch ihrer Umwelt gegenüber, der sie freimütig verkündete, dass sie es Leid sei, so einen alten Bock ständig in ihrem Bett abwehren zu müssen (so sprach sie freilich nur zu sich selbst), also, dass sie sich froh dünkte, da durch zu sein. (Sie durfte gar nicht an diese immerwährenden Umstände denken, wo sie sich diverse Öle und sonstige Gleitmittel in die Vagina rieb, um geschmeidig zu sein. Von wegen, Sex im Alter sei eine Sache der Attitüde, bei ihr war eindeutig der Ofen aus.) Dies zu begründen brauchte sie nicht, denn ihre Zuhörer waren in einem Alter, in dem sie das nur zu gut verstanden. Andere, glücklicher- und rücksichtsvollerweise, waren anständig genug, nicht nachzubohren, Sexualität hatte immer noch einen gewissen Status an Bigotterie inne.
Vor sich sagte sie sich: ich habe alle Perioden eines erfüllten Lebens mitgemacht: in jungen Jahren von einem heiß begehrten Soldaten umworben, erobert und geschwängert und in fortgeschrittenem Alter von einem hochangesehenen Intellektuellen umgarnt, ausgehalten und herumgetragen worden, so dass ich stets Erfüllung in meinem Leben gefunden habe. Auch als ihr sich letzter Mann von ihr verabschiedet und abgewandt hatte, hatte sie immer noch ihren Jungen, mit dem sie nach Deutschland umzog, dann wieder nach Amerika zurück undsoweiter, je nach Bedarf und erforderlicher Umstände. So sah sie es als ebenso schicksalhaft an, dass sie im Alter von ihrem Ehemann verstoßen worden war, was sollte sie diesem ja noch bieten können, sie, die die Menopause hinter sich hatte und wirklich kein sexuelles Bedürfnis mehr in sich verspürte und sich mehr regte, ganz im Gegensatz zu diesem Partner und „Mann“, dessen Energiefluss stetig gleichmäßig strömte, nicht zu versiegen drohte und bei ihr natürlicherweise sein Ventil suchte.
„In jungen Jahren“, grübelte sie, „sind die Mädchen den Jungen voraus, im Alter, ausgleichende Gerechtigkeit, ist es der Mann, der der Frau dann voraus ist“, seufzte sie melancholisch.
Mag er sich an einer jüngeren Latinofrau befriedigen, so gönnte sie es ihm – sie empfand keinen Neid und keine Eifersucht. Im Kapitalismus oder in ihrer Welt vielleicht, so wie sie sie erlebt hatte und wohinein sie geboren wurde, gesellschaftlich-privilegiert, körperlich-attraktiv und geistig-intellektuell ungemein rege, gehörte es dazu, dass man seine gesellschaftliche Status entsprechend seinem Verwendungszweck zugewiesen bekam.
Wie stand sie heute da?
Wie hätte es auch anders sein können: sie war stark, sehr stark, das, was man als starke Frau bezeichnete. Beweis ihrer Stärke: in ihrer letzten Beziehung mit dem jüdischen Diplomaten war sie stets die Aktivere gewesen. Sie war es doch, die ihm nach Amerika hinterhergereist war, als er wieder zurück in die Staaten von seinem Auftraggeber beordert und sie allein in der Nachkriegszeit in einem zerbombten hoffungslos dastehenden Deutschland zurückgelassen worden war und das, bedenke man, obwohl ihr ihre zwei Bälger, ihre Töchter, am Hals hingen!; sie war es, die den Herrn Staatsdiener stets aus seiner Lethargie herausreißen musste, damit er etwas auf die Beine stellte, als er dann von seinem Arbeitgeber, dem amerikanischen Staat, suspendiert worden war (notabene: wegen ihr; wegen ihr! Lächerlich, als sei sie ein Nazibraut gewesen, völlig abstrus!) und sich nach anderer Arbeit umsehen musste - wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben, hatte er doch bestimmt von seiner Familie die Order erteilt gekriegt, in den Staatsdienst einzutreten und schwerlich aus freien Stücken dazu getrieben worden war.)
(Übrigens, an ihre zwei Töchter dachte sie kaum. Sie war dem neuen Schwarm über den Ozean nachgereist, um sich dort mit ihm zu vermählen, aber mit der Hoffnung und festen Absicht, ihre zwei Töchter aus erster Ehe nachreisen zu lassen. Die Umstände jedoch wollten es, dass ihre Herkunftsfamilie ihr die eigenen Kinder entfremdete, sie als die verlorene Mutter mit zurückgelassenen Kindern am Pranger stand, die Kinder zur Adaption in eine reiche kinderlose Familie übergeben wurden, dort eine gute bürgerliche Erziehung genossen und in jungen Jahren sehr gute Partien mit zwei Ärzten machten. Nunmehr lebten sie glücklich verheiratet in München und wollten nichts mehr von ihrer Mutter wissen. Aber auch sie nichts mehr von ihnen.)
Nein, verletzt sich zu zeigen, war nicht ihr Stil, verstieß gegen das Selbstverständnis ihrer beiden Rollen, die sie zueinander pflegten. Genauso wenig ihrem Sohn gegenüber natürlich. Auch wegen ihrer Vertreibung aus dem Paradies, sicherem Pensionat ihres Staatsbeamten, hegte sie keinen Groll. Es ging immer weiter, sie kämpfte sich immer über Mauern, die sich vor ihr auftaten, auch dieser nunmehr. Wenngleich sie jetzt schon sehr auf dem absteigenden Ast saß, nachdem sie ihre Eigentums-Wohnung hier in Nürnberg hatte aufgeben müssen, weil es ihr zu viel geworden war, einen eigenen Hausstand aufrechtzuerhalten und nunmehr in ein Altenheim, wenn auch das beste der Stadt hatte einziehen müssen, eine Stiftung für verarmte Söhne und Töchter dieser Stadt, aber von der Lage her lag es absolut zentral, nämlich gleich neben dem Marktplatz und an der Pegnitz, von der zwar nachts schon recht unheimliche Nebelschwaden aufstiegen, aber wie heißt es schließlich: nothing is perfect.
Dann der Verlust ihres Sohnes! Hm, eigentlich auch eine wahrhaftige Erleichterung, nur noch für sich selbst sorgen zu brauchen, jetzt noch der Wegfall der Mutterrolle, wenngleich diese Aufgabe zu verlieren, ihr wohl am schlimmsten fiel. Sie seufzte. An ihren Sohn zu denken, bedeutete noch immer, Rot zu sehen.
Was aber die Pflichten, Aufgaben und Bürden anbelangte, kam ihr doch am schlimmsten die Zeit mit dem Ehemann an. Diesem durfte man keine laue Suppe vorsetzen, wie dies beim Sohn erlaubt war. - Ein Bild tauchte auf, der für diese Zeit wichtigste Eindruck, der ihr geblieben war. Wie sie so oft am Fenster stand, hinter dem Store, um durch einen Spalt immer wieder auf den Vorplatz des Car Ports zu lugen und zu warten, ob er schon mit seinem übergroßen, benzinverschlingenden Cadillac eingefahren sei. Ja, dieses sehnsüchtige Warten mit dem Essen abends, bis Er nach Hause kam, war sie leidgeworden. All die Umstände, wenn er sich verspätet hatte und sie genötigt war, den Braten in der Kasserolle warm zu halten – einfach ätzend. „Umständlich“ hätte bei weitem nicht den Nagel auf den Kopf getroffen, „fussy“ dachte sie in Wirklichkeit. Alles fassy das, genauso sein ständiges sexuelles Bedrängen des, obwohl gleichaltrig, dennoch weitaus sexuell aktiveren Mannes. -„Ach, bin ich was von so froh, da durch zu sein!?“, dachte sie, eine sehr moderne Redewendung, die aus dem Englischen kommt und die sie bereitwillig in ihre Repertoire übernommen hatte und die ihr half, sich von dem Gedanken abzulenken, nicht der aktivere Part gewesen zu sein.
Sie fasste sich an die Stirn und dachte, dies hast du gerade vorhin bereits so gedacht. Du drehst Dich im Kreis mit Deinen Gedanken heute. Oft passiert das, öfter als es Dir lieb sein kann…
Dann kam wieder der Gedanke an ihrem Sohn, einer, den sie auch schon hatte heute.
Dennoch spürte sie jetzt wieder den Schmerz, dass ihr Sohn nicht die geringsten Medikamenten-, Unterhalts- oder sonstige Lebenskosten übernommen hatte. Obwohl sie bislang gut zurande gekommen ist, allein zu leben, alles in allem.
Nur keinen Groll hegen, es als selbstverständlich sehen, selbst für sich zu sorgen – wie sie es von den anderen Mitmenschen auch erwartete, dies zu tun.
Sie schaute sich in ihrem Zimmer des Spitals um, in dem sie nunmehr lebte. Wenige Habseligkeiten, Erinnerungsstücke konnte sie hier unterbringen, das meiste musste sie verscherbeln oder verschenken. Aber trotz Wehmut darob dachte sie auch etwas stolz daran, wie ein amerikanischer Song doch hieß: Freiheit heißt, nichts zu verlieren. Das erfüllte sie wiederum mit Stolz. Was die Oberhand gewann, der Schmerz des Verlustes, dessen, was ihr Leben ausmachte, begonnen mit den zwei Mädchen, ihrem Ursprungsland, ihrem Mann, ihrer Wahlheimat, dann ihrem Sohn, schließlich ihren sämtlichen allmählich sich angesammelten Souvenirs, und auf der anderen Seite das Erhabenheitsgefühl des freien Menschen, wusste sie nicht mehr zu sagen. Sie schwankte in letzter Zeit ja sehr, manchmal glaubte sie, schon so weit zu sein, als Messi eingestuft werden zu müssen, obwohl das keiner ihr gegenüber hatte sagen getraut: sie sei dement und, mein Gott, einen Alzheimer hie und da, wer hatte den nicht?
Sie befand sich im Herzen ihrer Geburtsstadt, in einem Haus, das eines der Symbole dieser Stadt überhaupt darstellte. Worüber sollte sie sich noch beklagen? Freilich, der innerstädtische Fluss floss an ihr vorbei, wenn sie aus dem Fenster schaute und verbreitete mit seinem träg-fließendem Wasser doch eine ziemlich feucht-kühle Dampfwolke, die allüberall um ihr herumstand, ob in ihrem Zimmer, im Essraum oder im Garten. Einige Heimbewohner sagten unumwunden, dass es besonders im Winter unangenehm-kühl sei. Zudem lockte die Nässe natürlich auch Ratten an, von denen man manchmal einige den Wasserdamm hinaufklettern sah.
Sie schauderte vor Schrecken , denn ihr negatives Lieblingstier war die Ratte. Vor der fürchtete sie sich wie vor nichts mehr. Was aber die andere Sache anbelangte, dieser dichte Nebel, den der Fluss hin und wieder produzierte, und vor dem sich der ein oder anderen Heiminsasse fürchtete, als enthielte er Gespenster und Geister, musste sie nur lachen. Abergläubisch war sie mit Sicherheit nicht! Aber Ratten, Ratten, sehr unangenehm! Bei der Vorstellung, eines dieser Virusinfizierten, kecken, dreisten Viecher machten sich in ihrem Zimmer zu schaffen und sie stand ihm im Angesicht zu Angesicht gegenüber, wusste sie nicht, was sie da tun würde: schreien wie ein dummes Weibchen? sich nach ihrem Revolver (sie keinen hatte) umschauen, nach einem starken Mann flüchten (war keiner in der Nähe), ja, wahrscheinlich nach dem Bereitschaftsdienst klingeln halt.
Bei dieser Vorstellung übrigens, Ratte, Auge im Auge, sah sie ein funkelndes rotes Äuglein vor sich. Als ob Ratten nur roten Augen besäßen, war bestimmt ein Vorurteil, so eine fixe Idee, der sie aufsaß und doch nicht entkommen konnte. Ratten, iihh!
Sie stand am Fenster und schaute in den braunen Fluss hinunter, durch dem man niemals bis zum Grund gelangte. Er durchströmte langsam die schöne alte Museumsbrücke, in deren Mauer am äußersten linken und rechten Brückenpfeiler schaurige Plastiken reliefartig angefertigt worden waren, die auch nicht gerade das Sinnbild der Romantik wiederspiegelten: gierige echsenförmige Köpfe, aus denen Wasserstrahlen drangen – eine mittelalterliche, eben kein renaissance- oder klassizistisch-angehauchte jüngere Stadt eben – „Schicksal nimm deinen Lauf“, fiel ihr das Sprichwort ein.
Aber was sie zudem störte, waren diese vielen religiösen Zeichen, die überall hier in dieser Stadt zu sehen waren: Kreuze, Heiligenplastiken und dergleichen. Zum einen war sie in eine evangelische Familie hineingeboren worden und zum anderen hatte sie es niemals mit der Religion gehabt, war nahezu Atheistin gewesen, hatte zumindest seltenst in ihrem Leben eine Kirche von innen gesehen. Hier jedoch traf man Schritt auf Schritt auf solch religiösen Insignien. Überall diese pathetischen Ausflüsse von Schmerz und Tod, sehr unappetitlich im Grunde genommen, wenn man es realistisch betrachten konnte wie Säkularisierte wie sie. Am schlimmsten empfand sie aber den großen Schmerzensmann am Kreuz, nackt, qualvoll-verstellt oder vor Qualen sich verrenkend, nenne es, wie du willst, aber das war kein schöner Anblick. Solche Dinge waren in Amerika kaum zu sehen, aber in Europa halt, das katholische zudem, um’s genau zu sagen.
Sie seufzte wieder, wahrscheinlich ein Gefühl des Heimatverlustes?
Zum Teufel, warum aber war sie hierhergekommen? Ja, sie hatte in Amerika dauernd an Europa denken müssen und nun, wo sie in Europa saß, dachte sie wehmutsvoll an Amerika! Es scheint fast so, also ob der Mensch niemals zufrieden sein kann mit seinem Schicksalsort...
Nachmittags
Da saß sie wieder mit Frau Schönleben, die ihr überraschend einen Strauß Blumen mitgebracht hatte. Wollte sie mit ihrem Besuch erfreuen? Aber warum redete sie nicht? In der Tat saß sie schon eine Viertel Stunde da und brachte kein Wort heraus. Stattdessen blinzelte sie unaufhörlich mit ihren Wimpern und starrte gerade vor sich hin, wobei sie nicht leblos und untätig war. Man merkte deutlich, dass ihr Gehirn auf Hochtouren lief und arbeitete. Bis sie endlich einen Satz herausbrachte: „Schöner Tag heute, nicht wahr?“, waren allerdings wieder gute zehn Minuten verstrichen.
Sie stimmte natürlich zu, weil sie schon einmal froh war, das ihre Gesprächspartnerin wieder etwas herausgebracht hatte. Wenn sie selbst erzählte, reagierte diese sofort und spontan, meist lachend, obwohl es nicht unbedingt witzig war, was sie erzählte. Das war wohl so eine Schicklichkeits-Marotte von ihr: lache stets, auch wenn der andere den größten Blödsinn sagt, so hat er das Gefühl, er wäre geistreich und witzig.
„Ich habe heute nacht nicht schlafen können wegen des Nebels draußen. Ich kann Ihnen sagen: der drang auch in mein Zimmer herein. Da kann man wirklich an Geister glauben, wenn so eine dicke Nebelschwade zum Fenster hereinschwebt, durch den Raum und dann mitten darin zum Stillstand kommt, verharrt und so aussieht, als schaue sie sich um, wohin es sich nun wenden könne. Ja, als glotze sie mich permanent an.“
Frau Schönleben lachte.
„Haben Sie wohl richtig Angst vor ihr?“ verdruckstes Lachen hinter vorgehaltener Mund.
`Mei, ist das vielleicht schaurig-schön, was?´, dachte sie bitter. `Na, Hauptsache, Dich erfreut‘s.`
Denn ihr war bei dieser ganzen Sache alles andere als lustig zumute. Aber was soll’s, man gewöhnte sich auch daran.
So grübelte sie vor sich hin, bis ihr bewusst wurde, ach je, ich habe ja schon wieder zwei Minuten geschwiegen. Wie zu erwarten gewesen, war von Frau Schönleben auch nichts gekommen.
Frau Schönleben, ehemalige Topmanagerin einer großen Firma - welch tiefer Absturz jetzt.
Sie fragte sich schon, ob sie nicht etwas übertreibe mit ihren Klagen und Horrorschilderungen, nur um Frau Schönleben aus der Reserve zu locken. Je krasser ihre Schilderungen, desto eindeutiger deren Reaktionen. Denn eins war klar, wenn sie einmal redete, dann sprudelte es nur so aus Frau Schönleben heraus und das durften nur Horrorszenarien sein, meist solche, wo der andere, in diesem Fall sie, darunter zu leiden hatte.
Und so setzte sie ihre Schilderung fort, nur um ihre Gesprächspartnerin zu erfreuen.
„Und so ein Nebelgeist kann einem vielleicht ersticken, haha.“
Alles nicht besonders geistreich, aber lachen darüber konnte man ja, einzig, weil es ihr Vis-a-vis amüsierte. Diese selbst hätte niemals ihr gegenüber wiederum eine Szene geschildert, wo ihr übel mitgespielt wurde. Das rührte bestimmt noch aus ihrer Zeit her, als sie Chefin war, wo oberstes Gebot darstellte: stell dich immer ins rechte, gute Licht und niemals dein Licht unter dem Scheffel.
Aber auch bei ihr ein tiefer Fall, die gesellschaftliche Karriereleiter heruntergestürzt, wie man so sagt. Wenngleich ihrerseits, wie gesagt, man recht besehen nicht von einem Absturz reden konnte. Sie hatte ihr Leben gelebt.
Abends
Es roch hier nach Urin. Es war dumpf und feucht, dämmrig. Sie saß gerne hier auf der Bank, die so alt war, dass sich der hier ausbreitende Efeu am Boden sich selbst schon um die Bankbeine kringelte. Nur dass doch hin und wieder einer hier saß, verhinderte, dass dieser Schmarotzer nicht schon das Holz völlig zugedeckt hatte.
Von dieser alten Bank aus, die hier an der Spitze der Halbinsel stand, fühlte sie sich abgetrennt von aller Welt. Man erblickte von unten her die Dammwände des Flusses, sah hinauf zur alten, sandsteinernen Brücke, von der her es lärmte von den hin- und hertreibenden Touristenströmen und den Einzelhändlermarktbuden, die die Brücke bestanden und Quelle des Lärms marktbeflissener Ausrufe der Kaufmänner waren, der sich zwischen Häusern und über der Fluß-Wasseroberfläche als Echo hollywoodfilm-reifer Töne brach. Wenn in der Ferne die Kirchentürme von der Sonne gelb leuchteten, hatte dieser Anblick sogar etwas Jenseitiges. Am Unwirklichsten war die Aura, wenn die Sonne sich durch die Häuser brach und über dem ganzen Szenario ein Sonnenglast wie einen Schleier legte, der dick wie Honig zu kleben schien. Des Morgens, wo sie allerdings selten hier verweilte, war die Luft klar und lilafarben.
Die Dammwände waren schwarz von der Feuchte. Um die Spitze der Halbinsel waren morsche Holzpflöcke eingelassen, als wäre es eine Mole. Aber nur ein Boot, das des Hausmeisters, lag da an.
Sie konnte sich noch gut daran erinnern, dass hier, wo sie auf der Bank saß, einst ein stämmiger Birkenbaum stand, den die Stadtverwaltung längst abgesägt hatte, wohl, wie es die Begründung bei solchen Dingen hieß, die herunterfallenden Blütenstempel zu viel Umstände der Pflege und Wartung benötigten. Die Blüten verursachten Gries, der überall, selbst auf der Bank, herumlag und den wegzukehren wiederkehrende Arbeit verursachte, die auf Dauer betriebswirtschaftlich als zu teuer und aufwändig taxiert wurde. Da tat es ein pflegeleichter Baum auch. Nur hatte man nicht mehr das interessante Muster eines Birkenbaumes. Und die Vielfältigkeit- und Verzweigung der Verästelung. Und und…
Wenn man alt wurde und sah, wie man mit einer alten Stadt verfuhr, übertrug sich die krebsartig mutierende und zunehmende Trostlosigkeit und Einsilbigkeit des Stadtbildes aufs Gemüt des Menschen. In letzter Zeit verursachte diese abgeholzte Einfältigkeit Anfälle von Verzweiflung, so dass sie sich am liebsten auch abgesägt hätte, wenn man das so sagen mag, bildlich gesehen, am liebsten ins Wasser gesprungen und sich somit ertränkt hätte…