Krimis & Thriller
Realitätsverlust (1. Kapitel)
Kategorie Krimis & Thriller
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
www.sarah-thieme.de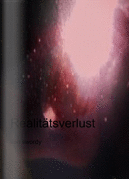
Realitätsverlust (1. Kapitel)
Spätsommer 2000
Auf dem Weg in unsere Realität blendet mich die gleißende Sonne. Die verdörrten Äste über mir wirken wie leblose knöcherne Arme. Meine mittelgroße, schwarze Tasche, die ich betont lässig geschultert habe, schneidet mir brennend ins Fleisch und vor meinem inneren Auge stelle ich mir vor, wie sich bereits rot-blaue Pünktchen bilden, die wenig später schon zu einem blauen Fleck heranwachsen. Schweren Schrittes bahne ich mir durch das mittlerweile hochgewachsene und vertrocknete Gras den Weg. Ich bewege mich derart schwerfällig, dass ich mich weit älter fühle, als ich es jemals werden wollte. Die Kulisse erinnert fast an das Paradies. Ab und an zwitschert ein Vogel, weiße Schäfchenwolken über mir ziehen dicht aneinandergedrängt in die Richtung, die ich eingeschlagen habe. Mein Weg ist kurz und bevor ich die Türklinke herunterdrücke, drehe ich mich noch einmal um und lasse mich erneut von der Sonne blenden. Ich liebe den Geruch des Sommers und der Wärme auf meiner Haut. Auch wenn dieses Gefühl gleich vergehen wird, wie so vieles im Leben. Als ich endlich eintrete blinzle ich unwillkürlich bis meine Augen sich an die Dunkelheit hier drinnen gewöhnt haben. Die Fenster sind mit schweren dunklen Vorhängen zugezogen und lassen nicht den kleinsten Lichtstrahl eindringen. Hier oben gibt es keinen Hinweis auf das, was wir vorhaben. Voller Vorfreude schleiche ich durch den Raum. Ich beherrsche mich, nicht einfach loszurennen. Auch meine schwere Tasche erinnert mich daran, vorsichtiger zu sein. Hier und da bleibt sie an den Gerätschaften hängen, die in diesem Raum wie in einem Museum aufgebaut sind. Ich vermeide viel Lärm. Ich liebe den Überraschungseffekt und außerdem muss ich mich konzentrieren. Seit meinem Eintritt zähle ich die Schritte im Kopf und taste mit meinen Füßen nach dem schweren Teppich. Wenn ich ihn erreicht habe, bin ich schon fast da. Bald schon spüre ich ihn, beuge mich nach unten, bedacht darauf nicht zur Seite zu kippen, die Tasche wird immer schwerer, ziehe ihn zur Seite und öffne die schwere Luke. Nur wenige Sekunden später schnellt mein Kopf zurück. Meine Nase kräuselt sich, zwingt mich den Atem anzuhalten und beißt gleichzeitig bis in die Stirn hinauf. Obwohl ich schon seit ein paar Tagen hierherkomme, widert mich der ekelhaft süßliche Geruch, der mir ins Gesicht peitscht, an. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Vielleicht liegt es aber auch an genau diesen Tagen, die diesen Geruch intensiver werden lassen. Jetzt halte ich die Tasche behutsam vor meiner Brust und schleppe sie die wenigen Stufen hinunter. Schweiß perlt mir von der Stirn bis zur Oberlippe. Der Geruch hindert mich aber daran, ihn mir mit der Zunge abzulecken. Unten angekommen krame ich in meiner Hosentasche und schmiere eine dicke Schicht des endlich gefundenen japanischen Heilpflanzenöls unter die Nase. Immerhin hält es für einige Sekunden, bevor mein Geruchssinn sich auch daran gewöhnt hat. Hier unten riecht es noch stärker nach bitterer Süße. Der typische Verwesungsgeruch setzt ein und sucht sich seinen Weg durch jede erdenkliche Öffnung. Die modrige, muffige Luft des Kellers vermischt sich außerdem mit dem Gestank von Erbrochenem. Ich spüre die kühlen Mauern links und rechts von mir und setze meinen Weg fort. Ich muss nicht weit laufen, bis ich den hellen Lichtschein sehe. Jetzt komme ich zu einem weiteren Raum. Er ist groß ausgebaut und sollte wohl zur Lagerung von allerhand Dingen dienen, die Menschen liebgewonnen haben und einfach nicht entsorgen können. Inmitten dieses Raumes steht ein silberfarbenes hohes Möbelstück, das mich an einen überdimensionalen Tapeziertisch erinnert. Darüber befindet sich auch die Lichtquelle. Sie flackert grell und taucht uns in eine unwirkliche schwarz-weiß Szene. Zumindest bilde ich mir dieses ein, weil ich das Gefühl, das mir alte Filme vermitteln, so sehr liebe. Ein Wimmern aus der hintersten Ecke lässt mich aus meiner netten Vorstellung aufhorchen. Dort sitzt er. Wimmernd, jammernd, von seinem eigenen Erbrochenen vollgesudelt. Die Knie hat er ganz dicht an sein Kinn gezogen, die Arme fest um seine Beine gewickelt. Als suche er nach etwas, das ihn beruhigt, wippt er auf und ab. Sein hysterisches Geheul bekommt er trotzdem nicht in den Griff. Seine Schwäche widert mich an und ich unterdrücke den Drang danach zu spucken. Bevor ich es mir doch anders überlege, reißt ein metallisches Geräusch mich abermals aus meinen Gedanken. Mein Partner in dieser Sache, lehnt lässig am Tisch und klopft mit einem Skalpell auf seine Oberfläche. Wie ein Kind, das sich auf Weihnachten freut, grinst er übers ganze Gesicht. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Stück Fleisch. Mehr ist es nicht. Der Torso ist fast vollkommen zerstört und lässt kaum noch erkennen, dass es sich um einen Menschen gehandelt hat. Der abgetrennte Kopf daneben lässt nicht einmal erahnen, um was für einen wunderschönen Menschen. Er grinst mich weiter an und möchte wissen, was ich in meiner Tasche habe. Dramatisch schließe ich meine Augen und blicke ihn kurz darauf freudestrahlend an. Er gluckst und tätschelt den Torso an den Stellen, an denen vor einigen Tagen noch Arme und Beine den Körper schmückten. Das verkrustete Blut klebt schwarz an dessen Rändern und wirkt unecht, fast wie angemalt. Wir müssen uns beeilen. Die Haut, die sich nach einer gewissen Zeit vom Körper löst, wölbt sich schon verdächtig. Wir wollen doch ein schönes Ergebnis haben. Der Kerl, den ich kurze Zeit nicht wahrgenommen habe, bäumt sich plötzlich auf und beschimpft uns kreischend. Eigentlich ist mir nach Lachen aber ich zwinge mich entnervt in seine Richtung zu blicken. Zum Glück verstummt er sofort und verfällt erneut in seine wimmernde Position. Im künstlichen Licht inspiziere ich noch einmal den abgetrennten Kopf. Das Haar liegt gekämmt, immer noch fest an der Kopfhaut, ausgebreitet wie ein Fächer auf dem Tisch. Als wäre es seine eigene Trophäe hat der Typ am Torso das Gesicht gereinigt. Der Kopf sieht unwirklich aus und doch ist er echt. Die Lippen haben geküsst, wurden geküsst. Die Augen haben gesehen, die Nase hat ihren Dienst erfüllt. Ein völlig gesundes Gesicht. Eine wunderschöne Person, es war so eine wunderschöne Person.
"Ich bin gleich wieder da", sage ich dem Kerl und laufe mitsamt der Tasche zur Kühltruhe. Grunzend vor Freude bewegt er sich kein Stück sondern wartet geduldig auf mich. Der Schweiß in seinem Gesicht glänzt und seine Augenlider zucken. Ich vermeide es so gut es geht ihn anzusehen. Seine offene Freude ist mir zuwider. Beim Öffnen der Kühltruhe, legt sich ein feiner Nebel Kälte über mein Gesicht. Sie ist sehr angenehm nach dem langen Weg in der Hitze oben und dennoch passt sie ebenso gut zu diesem Szenario. Die Truhe ist so voll, dass sie fast überquillt. Das Eis in ihr hat sich mit dem Blut vermischt und erinnert mich an eine Mischung aus Erd- und Heidelbeere. Aber auch hier kleben schon an manchen Stellen schwarze Blutreste. Fast lautlos öffne ich die Tasche und lege meinen Inhalt zufrieden ab. Ich schleiche weiter zum Kühlschrank und greife nach einer Flasche Wasser, die direkt neben dem Gefäß mit Formaldehyd steht. Der ganze Kühlschrank stinkt danach. Wieder ziehe ich mein Heilpflanzenöl hervor und schmiere es mir in doppelter Menge unter die Nase. Wir hätten den Formaldehyd sofort in die Halsschlagader spritzen sollen, es hätte uns einiges an Aufschub gewährt. In Anbetracht der einzelnen Teile, war dies leider nicht mehr möglich. Eigentlich haben wir den Kopf direkt in einem großen Glaseimer und der Lösung gelagert. Kurz denke ich an ein Labor, aber davon sind wir weit entfernt. Der Kerl, dessen Haare über Nacht so weiß wie Schnee geworden sind, holt den Kopf immer wieder heraus. Ich habe es aufgegeben ihn zurechtzuweisen. Ich nehme einen großen Schluck aus der kühlen Flasche, stelle sie zurück und schließe schnaubend die Kühlschranktür. Schleichend trete ich zum Tisch zurück. Unaufhörlich tätschelt der Kerl die Wangen des toten Schädels und blickt entzückt zu mir auf.
"Wir können bald anfangen."
Ein erneutes Glucksen ist seine Antwort. Seine Augen kleben wieder an diesem wunderschönen Gesicht. Ich stelle mich ans andere Ende des Tisches und warte noch kurz ab. Eine Fliege ploppt immer wieder gegen das Licht. Langsam kriechen die Viecher aus jeder noch so kleinen Ritze, dabei achte ich wirklich darauf, dass wir so vorsichtig wie möglich vorgehen. Wie zu mir selbst sprechend, fasse ich nun zusammen, was geschehen wird. Der Typ in der Ecke wimmert wieder lauter, dann übergibt er sich.
"Keine Angst, du darfst gleich mitspielen", entfährt es mir. Ich mag es nicht unterbrochen zu werden. Erneut schüttelt sich alles in mir und ich drehe mich zu unserem Projekt. In Gedanken bleibe ich weiterhin bei dem mittlerweile Galle kotzenden Typen. Ein hochgewachsener junger Mann. Damen würden ihn gewiss als attraktiv einstufen. Ich bin erschüttert, dass meine Mutter so viele Jahre…Ich kann nicht weiterdenken, weil mir ein noch viel schlimmerer Gedanke kommt. Jetzt ist es mir zum Brechen aber ich schlucke den säuerlichen Geschmack hinunter. Die Fliege setzt sich auf die silberne Pritsche vor uns. Mit einem Ruck habe ich sie erwischt und zerquetsche sie sofort zwischen meinen Fingern. Sie hinterlässt einen kleinen Blutfleck und klebt an meiner Hand. So viel Blut für so wenig Tier.
Ich unterdrücke ein aufkeimendes Lachen. Ich habe tatsächlich überlegt, mir die Hände zu waschen. Das ganze Blut, das bereits an ihnen klebt, lässt sich dadurch nicht reinwaschen. Hätte ich einen Pullover an, würde ich mir jetzt die Ärmel hochrempeln, stattdessen nicke ich dem Kerl mir gegenüber zu. Augenblicklich hört er auf mit den Haaren des Kopfes vor ihm zu spielen und streckt seinen Rücken gerade durch.
"Fangen wir an."
Gemeinsam schreiten wir in die Ecke. Der Typ wimmert wieder lauter, spuckt, heult und wippt hin und her. Ohne Gewalt geht es also nicht. Er tritt um sich, beschimpft uns, dabei wäre es an uns, ihm zu erzählen, was für ein bestialischer Hund er ist. Alles ist seine Schuld. Hätte er nicht begonnen, müssten wir es nicht zu Ende bringen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wie sie. Ich wäre wie die schwächeren Menschen. Ich wünschte mir, ich könnte mir meine eigene heile Welt erschaffen. Meine persönliche Realität und mich in ihr verkriechen, aber ich nehme meine Aufgabe ernst. Ich schüttle abfällig meinen Kopf. Mit all meiner Wut trete ich gegen seine Lippe, die sofort platzt. Ich weiß nicht, was mit ihm geschieht. Er verstummt sofort und fährt sich mit seinem Unterarm über die Lippe. Als er sein eigenes Blut sieht, beginnt er lauthals zu lachen. Endlich lässt er sich auf die Beine ziehen. Voller Blut und Erbrochenem besudelt zerren wir ihn nun zum Tisch. Seine Haare hängen in fettigen Strähnen in seine Stirn. Die Fingernägel abgekaut, der Rest völlig verdreckt.
Ich stehe ihm gegenüber und unterbinde das Verlangen ihn erneut zu treten. Ich beobachte genau was er tut und kann einfach nicht fassen dass dieser Wurm mein Vater ist.