Krimis & Thriller
Morvanja (Leseprobe)
Kategorie Krimis & Thriller
http://www.mystorys.de
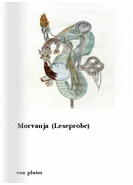
Morvanja (Leseprobe)
Beschreibung
Reiche Eltern, eine Riesenvilla, jede Menge angesehene Bekannte, Geld im Überfluss? Eigentlich könnte man meinen, dass Benjihim Lachamayers, Sohn der berühmten Politiker, nichts fehlen würde... Wenn da nicht die Tatsache wäre, dass er ein Junge ist.
Prolog
Der Schmerz rast innerhalb von Sekunden durch meinen Körper und die Welt verschwimmt um mich herum. Ich öffne den Mund, doch ich höre keinen Schrei. Alles was ich wahrnehme, ist ein schier unerträgliches Rauschen, dass mit jedem Augenblick lauter zu werden scheint. Es ist, als würde die Welt stehen bleiben, ich höre meine Herzschläge nicht mehr, kann nicht mehr atmen und die Gedanken, welche ich noch vor ein paar Sekunden in meinem Kopf hatte, sie sind einfach wie weggeblasen. Als wäre mein gesamtes Leben ausgelöscht.
Und dann kommt die Erkenntnis, ich weiß jetzt, was sie damals meinte, ich scheine auf einmal alles zu begreifen – doch ist es zu spät. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es nun einmal getan habe, und ich habe Fehler gemacht, große Fehler, viele Fehler. Den schlimmsten habe ich heute begangen, vor nicht mal einer halben Minute wohl. Dieser eine Fehler, der es mir nicht mehr ermöglichen wird, alle anderen Fehler gutzumachen, oder mich wenigstens dafür zu entschuldigen. Irgendwo weit weg spüre ich, wie salziges Wasser über mein Gesicht rinnt, ich weine wohl. Doch auch weinen wird mir nichts mehr bringen. Ich lag falsch und jetzt ist es zu spät, es ist aus.
Mit letzter Kraft versuche ich mich noch an das Hier und Jetzt zu klammern, ich will nicht gehen. Ich will nicht loslassen. Jetzt, wo ich nicht mehr kann, bemerke ich, dass ich hier bleiben will. Es war schön hier. Ja, nicht wundervoll und es war in einer gewissen Weise auch grauenhaft, aber doch war es weit nicht so schlimm, wie ich immer gedacht habe. So klammere ich mich an alles was ich habe, ich versuche mich an jede einzelne Erinnerung zu klammern, damit ich ja noch nicht gehen muss.
Joleen...
1. Kapitel
Als ich erwachte, blendete mich ein grelles Licht. Alles war weiß und nur langsam gewöhnten sich meine Augen an die Helligkeit und es wurde wieder dunkler um mich herum. Zuerst wunderte ich mich noch, warum ich so gut wie nichts sah und das was ich sehen konnte auch nur verschwommen wahrnahm, doch dann bemerkte ich den stechenden Schmerz und mir wurde langsam klar, dass meine Augen geschwollen sein mussten. Um sicher zu gehen, dass ich mich nicht irrte, wollte ich diese mit meinen Fingern betasten, doch so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte mich nicht bewegen.
Es dauerte eine Weile, bis mein kleines und erbärmliches Gehirn diese Nachricht verarbeitete und als ich schließlich die Bedeutung hinter dieser Neuigkeit wirklich realisierte und begriff, stieg Panik in mir auf. Blitzartig zuckten meine Augen auf der Suche nach einem Ausgang in dem kleinen Raum herum – selbst wenn sie dabei höllisch wehtaten und ich sowieso nicht viel erkennen konnte.
Erst jetzt, wo ich mich genauer umsah, fiel mir auf, dass ich nicht in meinem Zimmer lag, dazu war es hier viel zu dunkel. Konnte es sein, dass ich im Keller war, dort brachten sie mich doch immer hin, wenn ich unartig gewesen war. In diesen unheimlichen, finsteren und düsteren Keller, der für Außenstehende anscheinend aus Sicherheitsgründen abgeschlossen war und den man nicht betreten durfte, solange man ihn noch nicht renoviert hatte, was natürlich eine Lüge war, da er schon längst fertig war und als, eigens für mich eingerichteter, sogenannter Erziehungsraum gebraucht wurde. Ich bin im Gegensatz zu meiner kleinen Schwester, sie war damals fünf Jahre alt, sehr oft dort unten gewesen und hatte panische Angst vor diesem Raum und den Sachen die dort unten immer geschahen, wo ich von der Außenwelt abgeschnitten war und niemand mir helfen konnte. Also, war ich nun in diesem finsterem Keller oder nicht?
Hysterisch zuckten meine Augen nochmals durchs Zimmer, mein Vater liebte mich doch genug um mich nicht dort unten einzusperren, oder? Doch so sehr ich mich auch anstrengte, bekannt kam mir hier in diesem Raum nichts vor.
Fieberhaft wanderten meine Augen wieder und wieder im Raum herum. Irgendwie musste ich doch herausfinden können, wo ich mich befand. Verschwommen nahm ich neben dem Bett, auf dem ich lag noch drei andere einfache Eisenbetten war. Sie sahen nicht recht gemütlich aus, doch sonderbarer weise waren sie es. Neben jedem dieser Betten stand ein kleines Kästchen mit ungefähr drei Schubladen und, soweit ich erkennen konnte, einem offenem Fach. Auf meinen Kästchen stand etwas, doch ich konnte nicht erkennen was es ist, die anderen waren aber, so gut ich dies beurteilen konnte, vollkommen leer.
Außer dieser insgesamt vier Betten und vier Nachtkästchen, stand noch ein kleiner Tisch mit vier Stühlen in der Mitte des Raumes. Sonst gab es noch zwei Fenster, welche weiße Vorhänge bedeckten und mir so den Blick nach draußen verwehrten, und zwei Türen, wobei eine an der Wand gegenüber von mir, neben dem letzten der beiden Betten dort, war und sich die zweite genau gegenüber der Fenster, also an der Wand rechts von mir, befand.
Die ganze Einrichtung – mit Ausnahme der Bettgestelle – war weiß – nicht so ein schönes und reines Weiß, wie das der Kleider meiner Mutter, sondern ein eher gelbliches Weiß. Die Bettbezüge und Vorhänge waren ebenfalls weiß, doch sie hatten dünne bläuliche Streifen. Dieses Weiß war etwas reinlicher, als das der Möbel. Die Wände und Türen waren wohl gerade frisch gestrichen worden, denn sie hatten – ebenfalls weiß – nicht diesen gelblichen Stich, wie alles andere in diesem Raum.
Mein Bett war das einzig belegte in diesem Raum, also musste ich alleine hier sein. Als mir klar wurde, was dies bedeutete, wich meine anfängliche Erleichterung, nicht im Keller unseres Hauses eingesperrt zu sein, wieder der altvertrauten Panik. Langsam und stoßweise atmete ich aus und versuchte mich zu beruhigen, doch es war vergeblich. Nach wenigen Augenblicken bekam ich beinahe keine Luft mehr und gerade als ich glaubte, dass ich vor Atemnot – die Dummerweise aus meiner bescheuerten, aber doch berechtigten Angst entstanden war – ersticken werde, hörte ich Stimmen, ganz leise Stimmen. Sie schienen von hinter der Tür, die weiter von mir entfernt, also die dem Fenster gegenüber, war, zu kommen und – was mich nicht gerade beruhigte – sie kamen definitiv näher.
„Es tut mir wirklich leid Madame Sie enttäuschen zu müssen, doch es ist uns leider Gottes nicht gestattet, Sie zu ihrem Sohn zu lassen. Sein derzeitiger Gesundheitszustand macht dies unmöglich“, die Stimme klang bedauernd, doch irgendetwas war komisch an ihr, ich konnte nur nicht sagen was, fast so als würde die Frau nicht ganz die Wahrheit sagen.
Erstaunt blickte ich zur Tür und dem mir dahinter Verborgenem. Wer war diese Madame, dass man ihr ausgerechnet vor meiner Tür – Moment mal! Ich war doch nicht etwa... Das ist unmöglich, oder?! Konnte ich mich wirklich in einem Krankenhaus befinden?! – sagte, dass sie nicht zu ihrem Sohn konnte, woran auch immer das liegen mochte. Ob es ihm wohl schlechter wie mir ging? Oder besser?
Nur zu gerne wollte ich wissen, wer diese Dame vor meiner Zimmertür war. Dieses Verlangen war so groß, dass es sogar beinahe meine Angst über die Tatsache, dass ich mich in einem Krankenhaus befand, verdrängte. Bereits einen Moment später wurde mir mein Wunsch erfüllt, worüber ich nicht erfreut war.
„Was soll das heißen?! Ich darf nicht zu meinem Sohn, wie reden sie eigentlich mit mir?! Wissen sie überhaupt, wer ich bin?!! Was erlauben sie sich?! Er ist hinter dieser Tür, habe ich Recht? Gehen sie zur Seite!“
Mir blieb nicht mal die Zeit mich wirklich zu erschrecken, denn schon Sekunden später ging die Tür auf und die wütende Frau, meine Mutter, kam herein gestürmt und machte einen Laut, der einem falschen Schluchzer sehr nahe kam.
Ich weiß nicht wie ich das Kunststück vollbrachte, doch irgendwie gelang es mir – was mich selbst wohl am meisten überraschte – meiner Mutter und der verdutzten Ärztin, Krankenschwester, oder was auch immer, die wohl noch immer wie erstarrt in der Tür stand, weiszumachen, ich sei nach wie vor ohnmächtig.
Wieder ertönte einer dieser schrillen falschen Schluchzer und eine kalte Hand berührte meine Schulter, etwas zu fest. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht laut aufzuschreien vor Schmerz, dass ich zusammenzuckte, konnte ich trotz meiner Mühe jedoch nicht verhindern. Wenige Sekunden später fing meine Mutter bitterlich zu heulen an, wobei sie mich nur noch fester an mein Bett nagelte und ich die Befürchtung hatte, dass ich wirklich bald mein Bewusstsein verlieren würde, denn die Schmerzen waren beinahe unerträglich. Dass ihr Heulen nicht echt war, fiel mir nicht schwer zu erkennen, aber dass sie mir vor einer Ärztin, oder was auch immer diese Frau ist, einfach so wehtun konnte, war – und ist mir immer noch – mir einfach unbegreiflich.
Meine Mutter ist eine äußerst hochnäsige Frau, die aber nach außen hin sehr höflich wirkt. Sie und ihre Freundinnen, welche ebenfalls alle den selben unguten Charakter meiner Mutter haben, lieben es ärmere Menschen als sie selbst zu verhöhnen und sich über die tragischen Unglücke mancher Familien in dieser Stadt lustig zu machen. Mama ist – soweit ich dass damals mit meinen sechs Jahren an miserablen Leben beurteilen konnte und heute bin ich noch immer der Meinung – immer perfekt gestylt und hat einen dieser schlanken und wunderbar geformten Topmodellkörper. Sie ist etwa 1,70 Meter groß und hat elendslange Beine, die sie immer in die passenden Stöckelschuhe steckt.
Corienne Lachamayers, wie meine „liebe“ Frau Mama mit vollem Namen heißt, wobei sie immer alle Corinne oder Madame Lachamayers nennen, hat langes braunes Haar, welches ihr wie Seide über die Schultern fällt. Ihre Augen sind dunkelgrün und werden von langen, schwarzen Wimpern, mit denen sie liebend gerne klimpert, eingerahmt. Außerdem hat sie ein warmherziges und offenes Lachen, welches von Güte und Geborgenheit zeugt und ihre Stimme klingt wie die eines Engels, hell und wie Glockengesang. Diese Stimme bringt beinahe jeden Mann zum Schmelzen und sie hat meist einfaches Spiel sie um den Finger zu wickeln. Wenn man meine Mutter so betrachtet, sieht sie eigentlich freundlich und äußerst fürsorglich aus, doch wie sagt man so gerne, der äußere Schein kann auch trügen, denn meine Mutter ist alles andere als nett. Sie hat nicht die geringste Liebe zu ihren Kindern, nun ja, zumindest nicht zu mir, ihrem eigenen Sohn, den sie wie ein Stück Dreck behandelt. Natürlich macht sie dies nur dann, wenn keiner in der Nähe ist, der ihr in dieser Hinsicht gefährlich werden könnte, doch dass sind nicht allzu viele die ich kenne.
Sicherlich fragen sich viele von euch, wer ich überhaupt bin, dass mich meine Eltern, die Menschen die mich erzeugt haben und meine Mutter, die mich neun erstaunliche Monate, in denen sie nett zu mir war, in ihrem Körper getragen hat, so sehr hassen.
Ihr fragt euch auch sicher, wer ich bin, dass ich hier so großkotzig daher rede, oder?
Ich bin Benjihim Lachamayers – ja ich weiß, dass das ein komischer Name ist – und bin 17 Jahre alt. Damals, also als ich im Krankenhaus lag, war ich aber erst sechs Jahre. Meine Eltern sind zwei der bekanntesten Politiker hier in Melody. Offiziell bin ich der erstgeborene Sohn, doch ich weiß es besser.
Was mit meinen großen Bruder passiert ist? Nun ja, wie soll ich sagen, er ist tot.
Ich habe schwarze Haare, die meisten ziemlich zersaust sind, da ich nicht oft die Zeit habe sie mir zu kämmen und ehrlich gesagt auch zu faul dazu bin, bin ziemlich blass (heute nicht mehr ganz so wie damals, aber ich trage ja doch immer eine Weste und eine Kapuze, wie soll da dann Sonne zu meiner Haut gelangen). Mit sechs kam ich einfach so gut wie nie an die frische Luft, denn davon gab es in unserem Keller nun wirklich nicht genügend. Ich habe hellblaue Augen, ganz anders als der Rest meiner Familie. Eigentlich bin ich sogar froh darüber, dass ich weder meiner Mutter noch meinem Vater ähnlich sehe. Nun ja, ich würde mich selbst eigentlich als Krüppel bezeichnen, denn mein Körper ist über und über mit kleinen (und heute auch einigen sehr großen) Narben bedeckt.
Damals wusste ich schon, dass meine Eltern mich hassten, doch hätte mich mit fünf jemand gefragt, ich hätte ihm gesagt, dass mich meine Eltern lieben, denn ich dachte, es sei normal, seine Kinder so zu behandeln, immerhin hatten sie ja auch immer gesagt, dass sie das nur aus Liebe zu mir machten. Doch als ich dann für kurze Zeit bei meiner Tante gewesen bin, änderte sich das alles.
Sie hatte eines Nachts herausgefunden, was in unserem Haus geschah (und wohl auch noch immer geschehen würde) und hat mir dann erklärt, dass dies strengstens verboten sei, immer wieder hatte sie versucht, mich von meinen Eltern wegzubringen. Das alles liegt jetzt aber schon weit zurück, denn sie ist tot, genauso wie mein großer Bruder, den ich nie kennengelernt habe. Geändert an der Situation in meiner Familie hat sich trotzdem nichts, außer, dass ich jetzt weiß, dass sie mich hassen.
Ich hatte Angst, dass mich meine Mutter mit nach Hause nehmen wollte, da ich dann sicher bald meine Tante und meinen Onkel wieder gesehen hätte. Doch die Angst, welche sich schon in meine Glieder gefressen hatte, blieb diesmal ohne Grund, denn nach wenigen Minuten stürzte eine weitere Person ins Zimmer.
Die Frau hatte eine weiche und gutmütige Stimme, doch das heißt ja noch lange nicht – wie man am Beispiel meiner Mutter sehen kann – dass sie auch wirklich so nett war, wie es schien.
„Madame, Sie müssen jetzt wirklich gehen und zwar sofort. Sehen Sie denn nicht, dass ihr Sohn Ruhe braucht!?“, sie sagte es in einem höflichen Ton, aber bestimmt. Außerdem merkte man dieser Stimme an, dass es der dazugehörigen Person egal war, wer meine Mutter sein mag und auch aus welchem Hause sie stammt, schien der Frau nicht von Bedeutung zu sein. Noch immer mit diesem markerschütternden und falschen Schluchzern stand Mama schließlich auf und verließ, nachdem sie meine Hand – ein klein wenig fester als nötig – gedrückt hatte, begleitet von der Dame, welche vorhin mit ihr vor meiner Zimmertür gesprochen hatte, den Raum.
„Wenn du etwas brauchst, egal was es ist, dann sag es uns bitte, okay?“, die zweite Frau, welche tatsächlich eine Ärztin sein dürfte, war im Zimmer geblieben, beugte sich nun zu mir herunter und legte ihre Hand auf meine Schulter, so wie es Mama vorhin gemacht hatte, mit dem Unterschied, dass diese Frau meine Schulter kaum berührte um mir nur ja nicht wehzutun.
Damit versuchte sie mich sicherlich dazu zu bewegen, preiszugeben, dass ich nicht mehr ohnmächtig war, doch ihre Schmeicheleien nützten nichts, ich würde darauf sicherlich nicht hereinfallen, denn dies tat meine Mutter auch immer, also kannte ich den Trick bereits. Da hatte sie sich schon etwas mehr anstrengen müssen.
Nach einer Weile gab sie jedoch auf und ging seufzend zur Tür zurück, wo sie stehen noch einmal stehen blieb. Es vergingen etliche Minuten in denen sie einfach nur dastand und ich ihre Blicke auf mir spürte.
Auf einmal bemerkte ich, dass ich Gänsehaut hatte und stark zitterte, mir war bis jetzt noch gar nicht aufgefallen, wie kalt es hier war. Auch der Ärztin, die noch immer schweigend im Türrahmen stand, schien dies aufgefallen zu sein, denn sie kam nun doch wieder zu mir ans Bett, gab mir eine zweite Decke – es wurde sofort wärmer – und holte einen Gegenstand aus meinem Nachtkästchen, der – wie ich durch meine zusammengekniffenen und stark angeschwollenen Augen erkennen konnte – starke Ähnlichkeit mit einer Wärmeflasche hatte – vielleicht war es auch eine.
„Was haben sie nur mit dir gemacht Junge?“, mit diesen Worten gab sie mir einen sanften Kuss auf die Stirn, wie ich ihn nur von meiner Tante kannte, was mir beinahe die Tränen in die Augen trieb, und ging.
Ich bekam es nicht mehr mit, wie die Frau wieder ins Zimmer zurück kam, doch als ich das nächste Mal erwachte, lag eine Wärmeflasche unter den beiden Decken, mit denen ich zugedeckt war.
Ängstlich starrte ich die Frau an, es war dieselbe, die mir die Wärmeflasche gebracht hatte. Ich war heute zu ihr ins Büro gerufen worden, wo man anscheinend mit mir reden wollte. Da ich noch nicht gehen konnte, war ich mit einem Rollstuhl hierher verfrachtet worden, was meine Lage noch verschlimmerte, denn solange ich in diesem dummen Gefährt festsaß, konnte ich nichts tun.
Meine Augen zuckten ängstlich herum, doch ich nahm meine Umgebung nur verschwommen war, was – wie ich mir einzureden versuchte – hoffentlich nur an meinen geschwollenen Augen lag, woran ich selbst aber nicht mal wirklich glaubte.
Die Frau hatte sich auf einen Stuhl niedergelassen, der hinter einem großen Schreibtisch stand, was das einzige Möbelstück war, das sich im Moment zwischen uns befand. Auf diesem Schreibtisch, stand, wobei ich ihn nur als undeutlichen weißen Schemen erkennen konnte, ein Computer und vor diesem lag ein Zettel, wozu auch immer der da war.
Rechts neben mir befand sich eine Couch, welche Farbe sie genau hatte, konnte ich nicht sagen, ehrlich gesagt interessierte es mich auch nicht, aber durch den grauen Schleier, der alles bedeckte, sah sie grünlich aus. Daneben standen zwei gemütliche Sessel, ebenfalls in der undefinierbaren Farbe des Sofas, und ein kleiner Tisch auf dem eine Vase mit Blumen stand.
Die Wände waren bunt gestrichen (und sie sind es immer gewesen, solange ich in diesen Raum gegangen bin), Rot-, Orange-, und Gelbtöne. Auch in diesem Raum waren Fenster, aber sie waren wesentlich größer als die in meinem Zimmer und außerdem waren die gelb-roten Vorhänge, welche in schönen Wellen hingen, zur Seite geschoben worden und man konnte so den Stadtplatz, der ganz in der Nähe war, erkennen.
An den Wänden hingen mehrere Bilder und ein Teppich schmückte den Boden, was mir aber am meisten ins Auge stach, war ein, der neben dieser nach außen hin so gemütlichen Atmosphäre total fehl am Platz wirkte, großer silberner Aktenschrank, welcher sich über die gesamte Wand hinter der Ärztin erstreckte. An einer Stelle der Wand sah dieser Schrank jedoch nicht zu massiv aus, aber das bildete ich mir in meiner Panik sicher nur ein, wie ich mir damals dachte.
Was mir außerdem noch sofort aufgefallen war: es gab hier nur einen Ausgang, und der befand sich hinter mir, unglücklicher Weise genau dort, wo sich die andere Frau, welche mich hereingebracht hatte, niedergelassen hatte. Also bestand tatsächlich keine Möglichkeit von hier zu verschwinden.
Die Frau hinter dem Schreibtisch sagte etwas und stand dann auf, als sie auf mich zukam und die Hand ausstreckte, machte ich mich so klein wie es irgendwie ging und riss die Augen noch weiter auf, sie machte jedoch keine Anstalten sich wieder abzuwenden. Stattdessen streckte sie die Hand noch weiter aus, langsam kam sie näher, immer näher. Sie war noch zwei Schritte von mir entfernt, ich versuchte meine Füße in den Rollstuhl zu ziehen... ein Schritt, und ich kippte fast um, die Welt wurde schon ganz schwarz um mich herum... etwa zehn Zentimeter... Erschrocken nahm sie die Hand wieder zurück, das Wimmern, welches ich in meiner Panik nicht zurückhalten hatte können, hatte sie so erschreckt, dass sie sich wieder zurückgezogen hatte. Dennoch blieb sie weiterhin vor mir stehen, würde sie ihre Hand ausstrecken, berührte sie mich. Diese Erkenntnis veranlasste mich dazu, mich noch weiter in den Stuhl zu drücken.
So wie die Ärztin vor mir stand, sah sie viel jünger aus, als ich am Anfang dachte. Sie hatte lange rotblonde Haare, die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Trotzdem hingen ihr ein paar zu kurze Locken ins Gesicht, welches eigentlich recht freundlich wirkte, wenn man genauer hinsah. Sie hatte kleine braune Augen, um welche sich kleine Lachfalten sammelten, ihre Nase war klein und schmal, aber der Mund war groß und voll. Ein paar vereinzelte Sommersprossen zierten ihre rosigen Wangen. Obwohl ich – und diese Meinung hat sich nie wirklich geändert – sie nicht besonders schön (oder heute attraktiv) fand, hatte sie etwas an sich, irgendwie sah sie sogar immer niedlich aus.
Auf ihrer himmelblauen Bluse, steckte ein Schild, auf dem stand, dass sie die Frau Oberärztin Menosa Brunkon ist. Als sie bemerkte, dass mein Blick an dem Schild hängen geblieben war, stahl sich ein Lächeln in ihr Gesicht, das seit einer geschlagenen Minute zu einer Maske erstarrt war, zurück.
„Möchtest du etwas zu essen?“ Menosa ging zu ihrem Schreibtisch zurück und setzte sich wieder hin.
Dann nahm sie einen Stift und fing an auf dem leeren Bogen Papier, der vor dem Computer lag zu schreiben. Für einige Minuten war nur das Kratzen des Stiftes auf Papier zu hören, dann legte sie ihn zur Seite, nahm das Blatt in die Hand und ging, sehr behutsam und langsam, zu dem Aktenschrank hinter ihr, öffnete eine Tür und holte etwas, das wie ein Folder aussah heraus. Sorgfältig verstaute sie den Zettel darin und gab dann beides wieder in den Schrank zurück.
Als sie mit ihrer Prozedur fertig war, ging Menosa, eben so langsam und vorsichtig wie zuvor, zu ihrem Schreibtisch zurück und blieb stehen um sich eine Tasse Kaffee einzuschenken. Auch der Krankenschwester hinter mir reichte sie eine. „Hier Mendra. Wenn du fertig bist, kannst du mir das dann bitte zu Kyriandril bringen?“
Die junge Frau nahm die Kaffeetasse und den Zettel, den ihr Menosa hin hielt entgegen und ließ sich dann auf einen der Polstersessel nieder. Langsam schlürfte sie an ihrem Kaffee.
Jetzt da Mendra, wie sie hieß, in meinem Blickfeld war, konnte ich sie mir genauer ansehen.
Ihre Augen waren wachsam und von einem tiefen Grün, so wie ich es noch nie gesehen hatte, und auch nie wieder sah. Es war ein kräftiges und dunkles Grün, das Grün einer Tanne, nicht so ausgewaschen, wie die meisten grünen Augen es sind. Tiefe Schatten lagen unter diesen beeindruckenden Augen, beinahe so, als hätte sie schon lange nicht mehr geschlafen. Ihre Augen waren ziemlich schmal, aber sonst waren Mendras Gesichtszüge weich und mädchenhaft.
Sie hatte blonde Haare, welche sie zu einem Knoten hochgesteckt hatte, was ihr wohl ihre Arbeit erleichterte. Sie hatte einen zierlichen und zerbrechlichen Körper und war außerordentlich klein, sie wirkte ziemlich verlassen in dem Gewand, welches hier alle Krankenschwestern trugen.
So wie Mendra sich in den Stuhl drückte, könnte man meinen, dass sie sich unwohl in ihrer Haut fühlte – so wie ich – doch was konnte ich schon sagen, ich war ja schließlich niemand, der die Gedanken der anderen lesen konnte.
Kaum hatte sie ihre Tasse geleert, sprang sie auf und verließ den Raum, nachdem sie ein geflüstertes Wiedersehen von sich gegeben hatte. Nun waren nur noch Mensoa und ich im Raum.
„Du solltest wieder in dein Zimmer, immerhin brauchst du Ruhe. Komm ich bringe dich hin“, mit diesen Worten, kam Mensoa langsam auf mich zu, diesmal ignorierte sie mein hämmerndes Herz und den Versuch mich so klein wie möglich zu machen.
Ich hörte ein seltsames und lautes Klicken, dass mich zusammenzucken ließ und dann wurde ich durch die Tür in den Gang geschoben. Während der kurzen Fahrt zu meinem Zimmer, schwirrten mir die schlimmsten Gedanken, was diese anscheinend so nette und außerordentlich fürsorgliche Frau mit mir machen könnte, durch den Kopf.
Ich zitterte am ganzen Körper und versuchte krampfhaft, meine Atmung unter Kontrolle zu halten, aber es brachte alles nichts, als wir durch meine Zimmertür fuhren, fing ich wieder zu wimmern an und Tränen strömten mir übers Gesicht. Ich hörte Menosa seufzen und dann spürte ich eine warme Hand, die sich auf meine Schulter gelegt hatte.
Vor Schreck und Angst fing ich noch lauter zu wimmern an und versuchte zurückzuweichen, doch die Hand blieb liegen, dann hob sie mich behutsam hoch und legte mich in mein Bett. Ich hatte die ganze Zeit über geheult und machte jetzt noch einen letzten Versuch mich von ihr zu befreien.
„Keine Angst, Kleiner, hier passiert dir nichts.“
Ich wurde zugedeckt, dann bekam ich noch einen Kuss auf die Stirn – beinahe vergaß ich wie man atmet – dann ging Menosa und ließ mich alleine mit meinem Elend.
An diesem Tag weinte ich mich in einen unruhigen Schlaf, aus dem ich immer wieder schweißgebadet erwachte.