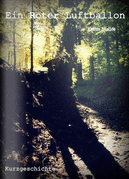In Shibuya sind die Menschen normalerweise sehr pingelig, wenn es um die Pünktlichkeit der Züge geht. Doch da an den Universitäten und Oberschulen von Tokio gerade die Zeit der Prüfungen ist, drückt man ab und an ein Auge zu. Zu dieser Zeit ist die Selbstmordrate am höchsten und die Züge kommen oft zu spät. Japan hat den selben Weg eingeschlagen wie der Rest der Welt. Wir haben ein striktes Schusswaffenverbot für Privatpersonen und teilweise lehnen sogar unsere Polizisten es ab, ihre Dienstwaffen zu tragen. Doch wir ruhen uns darauf aus und die Gewalt bleibt. In der restlichen Welt werden Überfälle und Amokläufe mit Schusswaffen verübt. Hier greift man dafür zu Küchenmessern und Teppich-Cuttern. In Japan kann jede Straftat verjähren, sogar Mord. Andererseits richten wir immer noch hin. Mit kurzen Stricken, die das Genick nicht brechen, sondern den Verurteilten, der erst an diesem Tag erfahren hat, dass er heute sterben wird und dessen Anwalt und Familie erst nach der Urteils-Vollstreckung von der Exekution erfahren werden, qualvoll ersticken lassen. Fortschritt existiert in dieser Welt nur noch auf technischer Ebene, was dazu führt, dass Eltern kein Verständnis dafür haben, wenn ihr Kind schlechte Noten nach Hause bringt aber umso mehr dafür, dass der Zug Verspätung hat, weil es sich davor warf. Dieses Land muss es endlich schaffen sich von seiner Vorstellung zu lösen, dass Selbstmord etwas ehrenhaftes ist, sonst bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke. Doch genau aus diesem Grund verspüre ich immer wieder den Wunsch, gerade diesen Ausweg zu wählen. Gerade jetzt denke ich: „Naoko, was willst du auf dieser Welt? Sie ist so hässlich und farblos. Alles ist grau.“ Beim Anblick der Bahnsteigkante wird mir schwindelig. Ich muss an die Stelle aus „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ denken, wo beschrieben wird wie Teresa auf dem Aussichtsturm steht und ihr schwindelig ist. Milan Kundera schreibt: „Schwindel ist nicht die Angst vor der Höhe, sondern der Wunsch sich fallen zu lassen.“ Tatsächlich verspüre ich diesen Wunsch. Meine Füße fangen an zu kribbeln, haben den Drang auf die Gleise zuzulaufen. Es wäre so einfach. Der nächste Zug fährt sicher gleich durch. Laufe vor bis zur Kante. Ein Schritt, dann ist alles vorbei. Es wäre aber auch so einfach zu leben, wenn ich in dieser Welt nur eine andere Farbe, außer grau, finden könnte. Irgendein Hoffnungsschimmer. Der Mann vor mir dreht sich um und ich lese das Wort „stirb“. Ich schließe die Augen für einen Moment. Als ich sie öffne wird mir klar, dass ich zwar „shine“ gelesen habe, dass es aber nicht das Japanische Wort „shine“ ist. Es ist auch in lateinischen Buchstaben und nicht in Kanji geschrieben. Der Mann trägt ein Rolling-Stones-T-Shirt mit dem Aufdruck „Shine A Light“. Mich überkommt ein kalter Schauer bei dem Gedanken, dass ein Englisches Wort, dass etwas schönes bezeichnen soll, genauso geschrieben wird wie die Imperativ-Form des Japanischen Verbs „sterben“. Die Anweisung zu glänzen, zu strahlen, zu leuchten und gleichzeitig auch ein Todesbefehl. Ich beschließe, dass es besser ist auf andere Gedanken zu kommen und mir fällt die Kneipe gegenüber meines Büros ein. Ich werde wohl noch in Shibuya bleiben. Ästhetisch kann Tokio sicher nicht mit New York oder Paris mithalten, doch diese Weltmetropole ist viel sauberer und es gibt weniger Müll, wodurch sie aber noch unmenschlicher wird als ihre beiden Schwestern und auch hier benutzt man Alkohol um zu verdrängen. In der Kneipe trinke ich warmen Sake und rufe Toma an, weil ich mich allein fühle. Ich will mit ihm schlafen, doch aus anderen Gründen als sonst. Ich vermisse meinen Freund nicht wegen irgendeiner seiner Eigenschaften. Ich will nur dieses verfluchte Wort aus meinem Kopf bekommen. Shine. Die Englische Bedeutung ist verschwunden. Sogar die lateinischen Lettern. Vor meinem inneren Auge sehe ich nur noch einen, in Kanji geschriebenen, Befehl zur Selbstauslöschung. Ich will diesen Gedanken loswerden. Vielleicht ist alles besser wenn ich Toma spüre. Vielleicht denke ich dann wieder: „Das hier ist schön. Ich habe etwas im Leben das schön ist.“ Aber wahrscheinlich hilft Ficken nicht, denn das mit dem Sex ist wie mit dem Alkohol und den Drogen. Man ist kurzzeitig betäubt, aber dann wird alles schlimmer. Toma geht immer noch nicht ran und ich bin kurz davor aufzulegen. Doch dann wird mir klar, dass ich, wenn ich heute noch einmal zum Bahnhof gehe, diesen einen Schritt gehen werde. Wenn der Zug mich erfasst, werden sich meine Füße vom Boden lösen und in meiner letzten Sekunde wird es sich anfühlen wie Fliegen. Es wird zu ende sein bevor ich den Schmerz spüre. So male ich es mir zumindest aus. Doch dann denke ich daran wie ich als kleines Mädchen, ohne eine Ahnung von Leben und Tod, das Zirpen einer Zikade mit meinem Handrücken für immer verstummen ließ. Als ich meine Hand wegzog, war ein Großteil der Zikade nur noch Matsch, aber irgendwie hatte ich es nicht geschafft ihren Kopf zu zerquetschen und sie lebte noch, bewegte ihn, zappelte auch mit dem einen Bein, das nicht an meinem Handrücken klebte. Wird es wirklich schmerzlos sein? Endlich nimmt Toma, den Anruf entgegen. „Wer ist da?“ „Ich bin es, Naoko. Deine Freundin.“ „Achso. Was kann ich für dich tun?“ Ich zögere kurz, überlege ob ich ihm sagen soll, dass ich mit dem Gedanken spiele vor einen Zug zu springen und es auch tun werde, wenn er mich in den nächsten zehn Minuten nicht abholt, doch ich überlege es mir anders und sage: „Ich bin gerade mit der Arbeit fertig und hab mir überlegt heute Nacht in Shibuya zu bleiben, weil du mir fehlst.“ Dabei versuche ich, die Worte „weil du mir fehlst“ so klingen zu lassen, dass er das darin versteckte „Lass uns ficken!“ nicht überhören kann. Dazu wird er nicht „Nein“ sagen, denn er muss ständig zu irgendwelchen Konferenzen fahren, oft sogar ins Ausland. Unser letztes Mal ist bestimmt einen Monat her. „Tut mir leid. Ich bin momentan geschäftlich in Osaka. Ich komme erst morgen wieder.“ „Davon hast du gar nichts gesagt.“ Ein kurzer Moment der Stille, dann: „Ich habs vergessen.“ Wie um etwas wieder gut zu machen, sagt er nach weiterem zögern: „Ich bin heute an einem Haus, das Ando entworfen hat, vorbei gefahren und musste an dich denken. Weil du von seiner Architektur doch so schwärmst.“ Ich hasse Tadao Andos Gebäude. Zu viel Zement. Zu viel grau. Trotzdem sage ich nichts. „Ich melde mich, wenn ich morgen in Tokio ankomme. Ich muss auflegen. Da ist noch einen wichtiger Anruf auf der anderen Leitung. Ich liebe dich Naoko.“ „Ich dich auch.“ will ich antworten, doch Toma hat bereits aufgelegt ohne dieses Gefühl von Leere mitzunehmen, das ich spüre. Betrügt er mich? Vielleicht mit einem Mädchen, das Ando wirklich mag? Normalerweise hätte er es mir doch gesagt, wenn er nach Osaka fährt. Wieder spüre ich Schwindel, den Wunsch zu fallen. Ich will aufstehen um zum Bahnhof zu gehen, doch werde von einem Mann angehalten, der an meinen Tisch kommt. Er ist vielleicht 50 und schaut mich mit nicht unfreundlichen Maulwurfsaugen, durch zwei dicke Brillengläser an. „Entschuldigung. Ich habe zufällig ihr Telefonat mitangehört. Wenn ich es richtig verstanden habe, heißen sie Naoko oder?“ „Ist das wichtig?“ „Ja, denn ich suche eine Naoko.“ „Und sehe ich aus wie die?“ frage ich scherzhaft aber ohne eine Spur von Lachen auf den Lippen. „Das weiß ich nicht.“ sagt der Mann, was mich sehr verwirrt. „Wer sind sie überhaupt?“ frage ich. Jetzt etwas unfreundlicher. „Ich arbeite für die Forstaufsicht, des Aokigahara.“ Bei diesem Namen werde ich hellhörig. „Dieser Selbstmordwald? Da haben sie ja einen angenehmen Job.“ Ich kann mir diesen sarkastischen Kommentar nicht verkneifen. Trotzdem beschließe ich mich zu setzen und ihm zuzuhören als er anfängt seine Geschichte zu erzählen.
Der Aokigahara liegt am Fuße des Fujis, des höchsten Berg Japans. Der Wald liegt westlich vom Saiko und südöstlich vom Shoji-See. Er hat eine Fläche von etwa 35 km² und liegt zwischen den Gemeinden Fujikawaguchiko und Narusawa in der Präfektur Yamanashi. Aokigahara klingt wesentlich schöner als der Name unter dem dieser Wald traurige Berühmtheit erlangte. Suicide Forest. Dieser Wald ist eine Art Pilgerstätte für Selbstmörder. Sie kommen alle her um zu sterben. Meistens hängen sie sich an einem Ast auf. In seltenen Fällen nehmen sie Tabletten oder schneiden sich die Pulsadern durch. Als Forstarbeiter ist es mittlerweile zu meiner Hauptaufgabe geworden, Leichen zu suchen oder den zukünftigen, die ich noch lebendig im Wald treffe, ihre Pläne auszureden, es zumindest zu versuchen, denn ich bin damit nur selten erfolgreich. Diese Menschen behaupten meistens, sie seien Wanderer. Doch niemand kommt hier her um zu wandern. Sie alle kommen um zu sterben. Manchmal treffe ich ein paar unentschlossene, man erkennt sie daran, dass sie Zelte mitgebracht haben, doch letzten Endes kommen sie alle um zu sterben. Das musste ich auf unangenehme Art und Weise lernen. Meine erste Woche, im Aokigahara werde ich nie vergessen. Das war die Woche in der ich Akai traf. Eigentlich hieß er nicht so. Ich weiß gar nicht wie er wirklich hieß, aber als ich ihn auf Suizid-Patrouille traf, trug er einen roten Pullover und deswegen nenne ich ihn Akai. Das Japanische Wort für diese Farbe ist ein sehr schönes. Es reimt sich nicht auf das Wort „tot“ oder „dead“, so wie es das Deutsche „rot“ oder das Englische „red“ tun. Auch wenn ich seitdem viele Gesichter von Selbstmördern wieder vergessen habe, so ist mir seines doch immer in Erinnerung geblieben. Vielleicht weil ich niemals herausgefunden habe, wer er wirklich war. Auch wenn meine Erinnerungen seit dem immer mehr verschwimmen, habe ich diesen Tag immer noch ganz deutlich vor meinen Augen.
Akai trägt einen Pullover aus roter Baumwolle. Er ist kein Japaner, vielleicht ein Deutscher. Schwer zu sagen, denn so wie es den Europäern schwer fällt uns Asiaten zu unterscheiden, genau so schwer können wir sie auseinander halten. Als ich ihm auf Englisch sage, dass er zurück auf den Weg muss antwortet er überraschenderweise in fließendem Japanisch. „Oh tut mir Leid. Ich suche nur einen guten Platz für mich.“ Ich starre ihn entsetzt an. Dann wird ihm klar, wie sich seine Worte für mich anhören müssen. Er grinst. „Ich bin keiner von DENEN. Ich studiere Psychologie in Tokio und schreibe gerade an meiner Abschlussarbeit über Suizid und das Bild vom Freitod in der Japanischen Gesellschaft. Wo in Japan ist man denn dichter an diesem Thema? Ich hatte vor hier mein Zelt aufzustellen.“ Der Junge sieht nicht aus wie ein potenzieller Selbstmörder. Doch heute werde ich noch lernen, dass das innerer eines Menschen unberechenbar ist. Im Moment denke ich aber nur daran, wie schlimm es ist hier allein herumzulaufen. Also sage ich ihm: „Das Zelten ist hier leider verboten. Ich muss sie bitten, im Gasthof zu übernachten. Wenn sie wollen, können sie mich aber morgen auf meinem Kontrollgang begleiten. Heute lohnt sich das wohl nicht mehr für sie, denn ich habe nur noch harmlose Dinge zu tun. Nichts mit Selbstmördern, sondern nur meine eigentliche Forstarbeit. In einer Stunde kann ich sie hier abholen. So lange können sie sich meinetwegen noch umschauen, danach fahre ich sie zum Gasthof.“ Akai lächelt, er nimmt mein Angebot an und ich verabschiede mich. Später fällt mir ein, dass ich vergessen habe ihn nach seinem Namen zu fragen und ich beschließe es sofort zu tun, wenn ich ihn abhole. Doch es ist zu spät. Schon von weitem sehe ich etwas rotes zwischen den Ästen hin und her schwingen. Ich ahne schreckliches und renne los. Das rote Bündel, das an einem dicken Ast baumelt ist tatsächlich der junge Mann. Er hat sich mit einer Angelschnur aufgehängt, die man nur schwer gegen die Abendsonne sehen kann. Er schwebt dort oben wie ein roter Luftballon. Ich hasse mich für meine Dummheit. Ich könnte weinen und bin so verdammt wütend auf mich selbst. Wieso zur Hölle habe ich nicht nachgedacht? Mit einiger Anstrengung schaffe ich es, die Angelschnur zu durchtrennen. Nur verschwommen realisiere ich den tiefen Schnitt, den ich mir dabei an meiner Handfläche zuziehe. Genau wie das Messer in meine Hand, hat das Seil in das Fleisch des Jungen geschnitten. Natürlich ist es schon zu spät. Kein Puls. Alle meine Wiederbelebungsversuche scheitern. Wahrscheinlich hing er schon eine halbe Stunde da oben. Verzweifelt beiße ich mir in die verletze Hand. Du dummes Arschloch! Wieso warst du so nachlässig? Ich schmecke Blut. Über Funk rufe ich Hilfe. Dann setze ich mich auf den Waldboden und versenke meinen Kopf in meinen Händen mit dem Wunsch zu weinen. Irgendwas zu tun. Doch ich spüre nur Wut und meinen Hass auf mich selbst. Ich stehe wieder auf und mache mich auf die Suche nach irgendetwas, das mir einen Hinweis auf die Identität des Toten gibt. Doch seine Taschen sind leer. Er hat nichts bei sich. Nur ein Zugticket, das er offenbar in Tokio gelöst hat. Wollte er nicht, dass irgendjemand herausfindet wie er heißt? Hat er in seiner Verwirrung, seine ganzen Papiere zuhause vergessen? In seinem Rucksack befindet sich kein Zelt. Er wollte hier nicht übernachten. Er hat von Anfang an gewusst, dass er sterben will. Seine Geschichte diente nur dazu mich wegzulocken und ich Idiot bin darauf hereingefallen. In seinem Rucksack hat er nur einen Hammer und ein paar Nägel. Hammer und Nägel? Ich schaue mich noch einmal genauer um und tatsächlich, an einem Baum entdecke ich, zwischen ein paar Blättern versteckt, seinen Abschiedsbrief. Dieser ist mit einem Nagel dort befestigt. Auf dem weißen Papier steht nur ein Satz: „Naoko, denke immer an mich!“
„Tut mir leid.“ sage ich. „Ich bin sicher nicht die Naoko, die sie suchen. Ich war damals noch ein ganz kleines Mädchen. Bis ich fünfzehn war, hat meine Familie in Kobe gewohnt. Damals kannte ich keine Studenten aus Tokio. Erst recht keinen, auf den ihre Beschreibung passt.“ „Das habe ich mir gedacht.“ sagt er und ich kann die Enttäuschung in seinen Augen sehen. „Wissen sie, es wird ja gesagt: Jeder stirbt für sich allein. Aber das stimmt nicht. Immer wenn ich durch diesen verdammten Wald laufe, finde ich frische Blumen und andere Dinge, an den Stellen wo sich Menschen das Leben genommen haben. Das Leid der Angehörigen macht mich traurig, aber es ist auch das, was mir am meisten Kraft gibt. Niemand auf dieser Welt ist allein. Niemand stirbt allein. Es gibt immer Menschen die einen lieben. Deswegen erzähle ich Akais Geschichte jeder Naoko die ich treffe, in der Hoffnung die richtige zu finden. Ihm zu beweisen, dass auch er nicht allein war.“ Er verabschiedet sich freundlich, steht auf und geht, macht sich auf die Suche nach der nächsten Naoko, um ihr Akais Geschichte zu erzählen. Das wird er so lange machen, bis er Akais Naoko gefunden hat oder vorher stirbt. Ich hoffe, dass er sie findet. Als ich die Kneipe verlasse weiß ich nicht so recht, was ich tun soll. Der Wunsch mich fallen zu lassen ist immer noch da. Schwächer aber er ist da. Ich stehe an einer Ampel. Komplett in Gedanken versunken starre ich auf den grauen Asphalt. Plötzlich nehme ich für einen Moment eine andere Farbe wahr. Der Wind weht einen roten Luftballon an mir vorbei. Weht ihn über die graue Straße, vorbei an einer grauen Hauswand in Shibuya. Niemand auf dieser Welt ist allein und es gibt immer jemanden der einen liebt, auch wenn man es selbst vielleicht nicht ahnt. Ich denke an Toma und seine letzten drei Worte am Telefon. Ja, vielleicht hat der alte Mann recht und selbst wenn er die richtige Naoko nicht findet, wird eine Naoko den Jungen im roten Pullover nie vergessen. So wie es sein Wunsch war. Sie wird Akai nie vergessen, obwohl sie ihn nie getroffen hat. Sie beschließt zum Bahnhof zu gehen. Nicht um ihrem Schwindelgefühl nachzugeben, sondern um in einen Zug zu steigen der Shibuya verlässt.