Kurzgeschichte
Das Mädchen und der Fuchs
Kategorie Kurzgeschichte
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Es tut mir leid, dass ich \\\"Restrisiko\\\" löschen musste, aber es ist jetzt in einer Kurzgeschichtensammlung namens \"Das Unfassbare\" vom ipm-verlag veröffentlicht worden. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Unter www.bookrix.de/-schneeflocke kann "Restrisiko" nach wir vor noch lesen. LG Flocke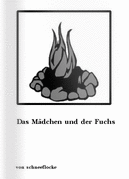
Das Mädchen und der Fuchs
Es war einmal ein Mädchen namens Marie. Marie lebte ganz alleine in einer Holzhütte im Wald. Ihre Eltern waren im letzten Winter gestorben, und seither hatte sie niemanden mehr. Ab und zu brachten ein paar der Frauen aus dem nahen Dorf ein paar Holzscheite vorbei, und der ein oder andere Bauer versorgte sie mit Kartoffeln und Gemüse, aber ansonsten war Marie ganz auf sich gestellt.
Sie vermisste ihre Eltern. Sie wünschte sich jemanden, mit dem sie sprechen konnte. Es war so schrecklich still, abends in der Hütte. Es gab niemandem, dem sie erzählen konnte, was sie den Tag über getan hatte, niemanden, der sich Sorgen machte, wenn sie zu lange im Wald blieb, niemanden, der sie vermissen würde, wenn sie sich verirrte. Und es gab niemanden, dem sie von den kleinen Gestalten erzählen konnte, die in den Bäumen lebten. Gnome hatte ihre Mutter sie genannt. Sie hatte ihr eingeschärft, niemandem aus dem Dorf von den kleinen Männchen zu erzählen, die zwischen den Wurzeln der hohen Tannen wohnten. „Sie würden es nicht verstehen, Kleines“, hatte Mutter gemeint. „Sie sehen nicht. Sie haben verlernt, zu sehen, was sie nicht sehen wollen. Weil es einfacher ist, in einer Welt zu leben, die man sich erklären kann. Sie würden es nicht verstehen. Sie würden dich davonjagen, oder schlimmer noch, dich als Hexe bezichtigen. Erzähl niemandem davon.“
Und so war es immer ihr Geheimnis geblieben. Nicht, dass sie viel Gelegenheit gehabt hätte, mit den Menschen aus dem Dorf zu sprechen. Sie hielten sich die meiste Zeit von der kleinen Blockhütte im Wald fern. So als wüssten sie, dass der Wald mehr Geheimnisse barg als ihnen lieb war.
Als Marie an diesem Tag durch den Wald ging, um ein wenig Feuerholz zu sammeln, spürte sie, dass irgendetwas anders war. Die Gnome ließen sich nicht blicken, sie erspähte nicht eine einzige, dunkelrote Zipfelmütze im Dickicht unter den Wurzeln. Es war ungewöhnlich still. Sogar die wenigen Vögel, die über den Winter geblieben waren, waren verstummt. Vielleicht lag es an der dicken Schneedecke, die den Waldboden bedeckte. Vielleicht schluckte der Schnee die Geräusche. Doch Marie fühlte tief in ihrem Inneren, dass das nicht alles war. Der ganze Wald schien den Atem anzuhalten.
Und dann sah sie ihn. Den Jungen im Schnee. Den Jungen, der gleichzeitig ein Fuchs war.
Sie blinzelte, rieb sich heftig über die Augen, doch das Bild, das sich ihren ungläubigen Augen bot, blieb dasselbe. Ein Fuchs, der sich seines Felles entledigte. Ein Fuchs, der sich in einen Jungen verwandelte. Eine Gestalt, die zu flackern schien, ehe sie endgültig die Form eines Jungen annahm.
Einen Moment erstarrte sie erschrocken, die Hand vor den Mund gepresst. Einen Moment dachte sie, er sei tot, so reglos lag er dort im Schnee, so bleich war seine Haut.
Doch dann zuckte seine rechte Hand und ballte sich langsam zur Faust. Etwas, das wie ein leises Wimmern klang, drang aus seinem geöffneten Mund und hinterließ eine kleine weiße Atemwolke.
Er sah so klein aus, wie er dort im Schnee lag. So klein und verloren und so jung. Er hatte sich zusammengerollt, als suche er Schutz. Als versuche er, die wenige Wärme, die noch in ihm war, zu halten. Hastig schälte sich Marie aus ihrem dicken Wintermantel und legte ihn um die Schultern des Jungen. Am liebsten hätte sie ihn aufgehoben und nach Hause getragen und ihn vor das offene Feuer in der Küche gelegt. Aber sie war nicht stark genug, und auch wenn er so zerbrechlich aussah, wusste sie doch, dass er zu schwer für sie sein würde.
Es war nicht richtig, dass er so völlig nackt und hilflos dort lag. Es war nicht richtig, dass er fror. Und als sie noch versuchte, ihn mit dem Kleidungsstück zuzudecken, da öffnete er die Augen.
Jeder andere wäre wahrscheinlich vor ihnen zurückgezuckt. Vor diesen Augen, die gleichzeitig jung und uralt waren. Sie wollten nicht so recht zu seinem Körper passen, diese Augen. Die Farbe allein war so ungewöhnlich. Eine seltsame Mischung aus gold und hellbraun, und die Pupillen – die Pupillen waren ganz leicht oval. Wie die einer Katze. Oder die eine Fuchses...
Und dann schlossen sich die Augen wieder. Der Junge bebte vor Kälte. Sein Lippen waren blau. Marie wusste, dass ihm die Zeit davonlief.
Sie konnte nicht länger mit ansehen, wie er so zitterte. Wie er so zitterte und bebte und sich selbst umschlungen hielt. Kurz entschlossen beugte sie sich zu ihm hinunter.
„Kannst du aufstehen?“, murmelte sie ihm leise zu, um ihn nicht zu erschrecken. Der Junge antwortete nicht. Das Zittern wurde ein wenig schwächer. Marie konnte sich erinnern, wie sie einmal mit ihrem Vater durch den kalten Winterwald gegangen war. Sie waren in dicke Felle gehüllt gewesen, und trotzdem war es bitterkalt gewesen. Sie war so müde gewesen, dass ihr immer wieder die Augen zugefallen waren. Damals hatte Vater ihr eingeschärft, dass man nicht einschlafen durfte, wenn es so kalt war. Dass der Körper irgendwann Kälte nicht mehr von Wärme unterscheiden konnte, und dass man im Schnee erfror, ohne es zu bemerken. Er hatte ihr auch erklärt, dass man irgendwann aufhörte zu zittern. Weil es zuviel Kraft kostete. Und darum wusste sie, dass jetzt Eile geboten war. Sie würde diesem seltsamen, fremden Jungen nicht hier erfrieren lassen.
Kurz entschlossen fasste sie ihn unter den Achseln und begann, ihn vorsichtig durch den Schnee in Richtung ihrer Hütte zu ziehen. Der Junge wimmerte leise, und der Laut fuhr durch sie hindurch und berührte irgendetwas in ihrem Inneren, das lange geschlafen hatte. Es tat ihr leid, und sie wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, ihm das hier zu ersparen. Wenigstens hatte er ihren Mantel, der seine bloße Haut ein wenig vor der kalten Schneedecke schützte.
Ihren viel zu weiten Mantel, der einmal ihrem Vater gehört hatte. In einem anderen Leben war das gewesen.
Der Junge rührte sich nicht, als sie ihn auf die Felle vor dem Kamin legte und ein Feuer entzündete. Sie hätte ihn für tot gehalten, hätte sie nicht gesehen, wie sich sein Brustkorb ganz leicht hob und senkte. Marie suchte eine der dicken Winterdecken aus der Truhe unter dem Fenster heraus und deckte ihn damit zu, und dann legte sie seinen Kopf vorsichtig auf eines der mit Stroh gefüllten Kissen. Er fing wieder an zu zittern, aber sie nahm das als gutes Zeichen. Er hatte noch die Kraft, sich selbst zu wärmen.
Lange saß sie so neben ihm und bewachte seinen Schlaf. Lange saß sie dort neben ihm vor dem Kamin und beobachtete den blonden Schopf auf dem dunklen Stoff des Kissens, die bleichen Wangen, die Lippen, die von der Kälte aufgesprungen und rissig waren. Wie lange hatte er wohl dort im Schnee gelegen? Wie lange war es her, dass er zuletzt ein Mensch gewesen war?
Sie fragte sich, ob er sich wohl wieder verwandeln würde, und was sie tun würde, wenn er wieder zum Fuchs wurde. Ob sie überhaupt etwas tun konnte. Füchse waren scheue Tiere.
Und dann, nach einer langen Weile, regte er sich. Es war kein langsames Erwachen. Er blinzelte nicht, er reckte sich nicht. Von einem Moment auf den nächsten sprangen seine Augen auf. Sie erschrak beinahe über den klaren, wachen Blick, der sie traf. Reflexartig sprang er auf. Sein Haltung war wachsam, jeder Muskel seines Körpers angespannt. Misstrauisch erfassten seine Augen den kärglich eingerichteten Innenraum der Hütte, ehe sie zu ihr zurückkehrten.
„Was ist geschehen?“
Seine Stimme wollte nicht so recht zu ihm passen. Sie klang so tief und so ernst und erwachsen. Als hätte er schon zu viel gesehen, um noch an das Gute in der Welt zu glauben.
„Ich habe dich im Wald gefunden. Du lagst im Schnee und hast dich nicht gerührt. Ich hatte Angst, dass du dort draußen erfrierst, wenn es erst Nacht wird. Deswegen habe ich dich mitgenommen“, erklärte Marie und versuchte, nicht in diese seltsamen, goldenen Augen zu sehen. Sie verwirrten sie und machten ihr ein klein wenig Angst. Sie waren so anders. Sie sahen zu viel.
Der Junge schwieg lange. Er hüllte sich in die Decke wie in einen Mantel. Es schien ihn nicht zu stören, dass er keine Kleider trug. Es war, als sei er es gewohnt, ohne Kleider zu sein. Er sah sie an, und sie sah in die Flammen, die im Kamin vor sich hin knisterten. Es war eine beinahe friedliche Stille. Es war irgendwie schöner, gemeinsam zu schweigen.
„Wessen Behausung ist das hier?“, fragte er irgendwann. Er hatte sich auf eines der Felle neben sie gesetzt. So als habe er entschieden, ihr zu vertrauen.
„Die meine.“
„Du wohnst allein?“
„Ja.“
Diesmal war das Schweigen ungläubig und erfüllt von vielen Gedanken. Sie wusste, dass es seltsam erscheinen musste, dass sie hier ganz alleine war. Dass es niemanden mehr gab, der für sie sorgte. Es war ungewöhnlich, dass sie überlebt hatte. Vielleicht hatte sie das auch nicht. Manchmal war sie sich nicht sicher, ob sie nicht vielleicht doch nur ein Geist war. Der Geist eines Mädchens, das vergessen hatte, dass es gestorben war. Doch als sie ihn aus dem Schnee gezogen hatte, als sie seine kühle Haut auf der ihren gespürt hatte, da war sie sich das erste Mal seit langer Zeit wieder sicher gewesen, dass sie lebte. Er hatte sich so wirklich angefühlt.
Das Knistern des Feuers füllte die Stille. Irgendwann drehte sie sich doch zu ihm um. Um sich zu vergewissern, dass sie ihn nicht nur geträumt hatte. Dass er wirklich da war.
Sie hatte sich geirrt. Er saß nicht neben ihr am Feuer. Er lag dort, auf dem dunklen Fell, in sich zusammengerollt, und sein Haar war nicht mehr hell, sondern rot wir das eines Fuchses. Und seine Augen – seine Augen waren die eines Fuchses. Wie hatte sie jemals Menschenaugen in seinem Gesicht sehen können? Diese Augen hatten nichts mit denen eines Menschen gemein. Es gefiel ihr, irgendwie. Sie waren unschuldig, diese Augen. Ohne Berechnung. Sie lebten. Das war mehr, als sie von ihren eigenen Augen behaupten konnte.
„Wer bist du?“, fragte Marie.
Der Junge, der mehr war als nur ein Junge, setzte sich überrascht auf. Sein Haar war wieder blond. Hatten ihr die flackernden Flammen einen Streich gespielt? Sie glaubte nicht daran.
„Hast du keine Angst vor mir?“
„Warum sollte ich Angst vor dir haben?“ Sie hatte schon lange keine Angst mehr. Wovor sollte sie sich fürchten? Es gab niemanden mehr, den sie verlieren konnte.
„Ich bin anders als die anderen. Ich bin kein normaler Junge. Ich verwandle mich in einen Fuchs.“
„Ich bin auch anders als die anderen. Ich bin alleine hier. Ich sehe Dinge, die sonst keiner sieht. Und ich mag Füchse.“
Da lächelte der Junge. Seine Augen veränderten sich, als er so lächelte. Sie wurden ein wenig heller, menschenähnlicher.
„Warum warst du ein Fuchs? Vorhin?“
„Warum bist du ein Mädchen? Ich weiß es nicht. Aber es ist einfacher, ein Fuchs zu sein.“
Und in diesem Moment sah sie es. Sie sah die Dunkelheit hinter dem hellen Gelb seiner Augen, sie sah sie, weil eine ähnliche Dunkelheit in ihr wohnte. Sicher war es einfacher, ein Tier zu sein. Ein Tier, das nichts von Vergangenheit und Zukunft wusste. Tiere konnten im Jetzt leben. Sie beneidete ihn, diesen seltsamen Jungen, der neben ihr auf den Fellen saß und wieder ins Feuer sah.
„Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich getan habe, damit du jetzt ein Mensch bist.“
„Nein, jetzt stört es mich nicht. Hier ist es anders. Hier...bei dir...“
Seine Stimme war jetzt leise. Leise und fast ein wenig unsicher. Als sei er es nicht gewohnt, unter Menschen zu sein. Zu sprechen. Zu denken. Sie fragte sich, wie lange er wohl ein Fuchs gewesen war. Ob er überhaupt noch wusste, wer er davor gewesen war.
„Du bist das“, sagte sie ebenso leise. Sie war es auch nicht gewohnt, ihre eigene Stimme zu hören. Sie war es nicht gewohnt, am Feuer zu sitzen und nicht alleine zu sein. „Du bist das, der alles anders macht. Seit du hier bist, ist die Stille weniger schwer. Sie fühlt sich irgendwie leichter an. Alles ist irgendwie...leichter.“
Wahrscheinlich hielt er sie jetzt für verrückt. Wahrscheinlich ergaben ihre Worte keinerlei Sinn für ihn. Sie erwartete diesen Blick, den Blick, an den sie schon so gewöhnt war, dass er kaum mehr schmerzte. Sie erwartete, dass er sie ansah, als sei sie etwas Widernatürliches. Eine Laune der Natur, die es eigentlich nicht geben durfte. Ein Gespenst. Ein Geist. Eine Fee aus der Märchenwelt, die sich verirrt hatte. Eine Absonderlichkeit, die man in ihrer Hütte im Wald vergessen hatte. Die man vergessen wollte.
Doch er sah sie anders an. Er sah sie an, als würde er sie sehen. Als wollte er sie sehen.
„Du hast keine Angst“, stellte er irgendwann überrascht fest. „Du siehst mich, nicht das Ungeheuer.“ Das Gold seiner Augen war warm im Flammenschein. Er hatte auch keine Angst vor ihr. Das machte ihn so besonders.
„Du bist nicht mehr Ungeheuer, als ich eines bin. Und du hast mir immer noch nicht verraten, wie du heißt.“
„Luka.“
„Ich bin Marie. Schön, dich kennenzulernen.“
„Gleichfalls.“
Und da lächelte er. Es war ein zögerndes Lächeln, das seinen Mund nur streifte. Aber sie las es in seinen Augen. Und ihr wurde warm, als sie es sah. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wollte sie ebenfalls lächeln. Ihre Lippen hatten verlernt, zu lächeln. Aber sie hoffte, dass sie es wieder lernen konnten. Irgendwann. Wenn er blieb.
Sie verstanden sich gut, der Junge, der manchmal ein Fuchs war, und das Mädchen, das Dinge sah, die sonst niemand sah. Sie erzählte ihm von den Gnomen, die unter den Wurzeln der Bäume lebten, und er erzählte ihr davon, wie es war, ein Fuchs zu sein, durch den Wald zu streifen, frei zu sein und nur das Jetzt zu kennen, kein Vorher und kein Später. Nur das Jetzt und die Waldluft um ihn herum und der Gesang der Vögel über ihm und der weiche, moosige Boden unter seinen Pfoten.
Wenn er kein Fuchs war, half er ihr, Feuerholz zu hacken oder Beeren zu sammeln, und manchmal fing er ein wenig Wild, einen Hasen oder einen Fasan oder ein Eichhörnchen, das in einer seiner Fallen gelandet war.
Doch er war und blieb seltsam stumm. Manchmal saßen sie bis spät in die Nacht hinein vor dem Feuer und starrten in die Flammen, ohne dass ein Wort zwischen ihnen fiel. Marie spürte, dass es das war, was er brauchte. Die Stille. Er war sie gewohnt. Vielleicht hatte dort, wo er herkam, niemand mit ihm gesprochen. Oft fragte sie sich, wo er wohl herkam. Wie es kam, dass er so leicht in das Leben mit ihr hineingefunden hatte. Wie es kam, dass er nichts und niemanden zu vermissen schien. Fast kam es ihr vor, als sei er in dem Moment, in dem sie ihn gefunden hatte, in dieses Leben hier hineingeboren worden. Als hätte er niemals etwas anderes gekannt. Als habe er keine Vergangenheit. Aber er musste eine haben. Jeder hatte eine Vergangenheit. Und eines Tages, als die Nacht besonders dunkel war und sie die Stille nicht länger ertragen konnte, eines Tages fragte sie ihn dann doch.
„Woher kommst du, Luka? Gibt es niemanden, der dich vermisst?“
Von einem Moment zum nächsten wurde es kälter. Eine Kälte, die aus seinem Inneren kam. Sein Gesicht, zuvor ruhig und entspannt, schien einzufrieren. Doch das Schlimmste waren seine Augen. Sie waren auf einmal so hart. So hart und kalt und fremd.
„Nein“, antwortete er steif. „Nein, da ist niemand mehr. Ich weiß nicht, ob da jemals jemand war. Wenn, dann ist es lange her. Sehr lange.“
Sie spürte, dass da mehr war. Sehr viel mehr. Schmerzhaftes. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, ihn darauf anzusprechen. Vielleicht war es zu früh gewesen.
Und so erzählte sie ihm statt dessen von ihrer Vergangenheit. Wie sie hier in dieser Hütte mit ihren Eltern gelebt hatte. Wie ihre Mutter ein zweites Kind bekommen hatte. Wie die Hebamme aus dem Dorf gekommen war und besorgt die Stirn gerunzelt hatte, dass das Kind sich so lange Zeit ließ. Wie die Schreie ihrer Mutter bis in den Wald hinein geklungen waren. Wie sie sich die Ohren zugehalten und sich unter dem Tisch versteckt hatte. Wie bleich das Gesicht ihres Vaters gewesen war. Wie er neben ihrer Mutter gesessen und ihre Hand gehalten hatte, obwohl ihn die alte Frau hatte wegschicken wollen, weil das Frauenarbeit sei, wie sie sagte.
Wie die Schreie ihrer Mutter immer schwächer und immer leiser geworden waren, bis sie keine Kraft mehr gehabt hatte. Bis sie nur noch leise gewimmert hatte.
Das Kind war tot geboren worden. Es war ein kleiner Junge gewesen, so klein, dass sich Marie nicht vorstellen konnte, wie er hätte leben können. Sie hatten ihn unter der großen Tanne hinter dem Haus begraben, in den Armen seiner Mutter.
Marie weinte, als sie davon erzählte. Sie weinte, weil es immer noch wehtat. Luka räusperte sich unsicher. Nie zuvor hatte sie diesen Ausdruck in seinen Augen gesehen. Er wirkte irgendwie sehr unsicher.
„Marie“, murmelte er. „Es tut mir so leid. Sag mir...sag mir, was ich tun soll. Wie ich dir helfen kann.“
„Kannst du mich...würdest du mich in den Arm nehmen?“
Er sah sie mit großen Augen an. Da war noch mehr Unsicherheit in seinen Augen, aber keine Ablehnung. Dann öffnete er zögernd seine Arme.
Es war so lange her, seit sie das letzte Mal gehalten worden war. Damals, unter der Tanne, hatte Vater sie umarmt. Doch das war lange her. Und irgendwie war es anders, von Luka gehalten zu werden.
„Mache ich das richtig?“, fragte er irgendwann leise. Sein Atem war warm in ihrem Haar. Eine Hand strich vorsichtig über ihren Rücken. So vorsichtig, als habe er Angst, sie zu zerbrechen. Als habe er Angst, irgendetwas falsch zu machen. Und in dem Moment begriff Marie, dass ihm das vollkommen fremd war. Vielleicht war er nie in den Arm genommen worden. Vielleicht war er nie zuvor einem anderen Menschen so nahe gewesen.
Sie kuschelte sich noch ein wenig enger an ihn. Vergrub ihr Gesicht im warmen Stoff seines Hemdes und versuchte, genau hier zu sein, im Jetzt. Nie zuvor hatte sie sich so geborgen gefühlt.
„Ja. Du machst das genau richtig.“
Er fragte nicht nach ihrem Vater. Er fragte nicht, wie lange es her war, wie lange sie schon alleine gewesen war, bevor er gekommen war. Er fragte nicht, warum sie hier draußen im Wald gelebt hatten, so fern von anderen Menschen. Er hielt sie einfach nur, und das war genug.
„Ich war wie du“, murmelte er irgendwann in ihr Haar hinein. „Ich war allein. Es gibt einen Grund, weswegen ich ein Fuchs geworden bin. Es war einfacher. Es war...besser. Ich konnte vergessen, wenn ich ein Fuchs war. Ich wollte vergessen.“
Sie wollte noch mehr fragen. So viel mehr. Die Worte brannten ihr auf der Zunge, und es war sehr schwer, sie nicht auszusprechen. Aber sie wusste auch, dass es besser war, manche Dinge nicht auszusprechen. Weil es zu sehr weh tat. Und so fragte sie nicht, und er sagte nichts weiter, und sie dachte sich, dass er darüber reden würde, wenn er dazu bereit war. Wenn er jemals dazu bereit war.
Es dauerte lange, aber Marie war geübt in Geduld.
Und eines Tages, als sie nach einem langen Marsch durch den Wald vor dem prasselnden Feuer in der Küche saßen, in ein Nest aus dicken Wolldecken eingehüllt, da erzählte er das erste Mal von seiner Vergangenheit. Von dem Davor.
Davor.
Davor war Luka ein normaler Junge gewesen. Sein Vater hatte im Bergwerk gearbeitet. An seine Mutter konnte er sich nicht mehr erinnern. Sie war gestorben, als er noch klein gewesen war. So klein, dass es nicht weh tat, daran zu denken. Es gab andere Dinge, die weh taten. Die neue Frau, die eingezogen war, und die Art, wie sie Luka nicht zu sehen schien. Das hatte weh getan. Die Schläge mit dem Lederriemen, die sie ihm verpasste, wenn sie unzufrieden damit war, wie er die Bettlaken zum Trocknen aufgehangen hatte, oder weil nicht genug Salz im Essen war (obwohl nie genug Salz im Haus war). Die hatten auch wehgetan.
Marie hörte nur zu. Sie hörte zu und dachte, dass er sehr allein gewesen war. Dass er vielleicht einsamer gewesen war als sie, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Denn irgendwie war es schlimmer, einsam zu sein, wenn man mit anderen Menschen zusammen lebte. Wenn man sah, was sein könnte, aber nie sein würde.
„Irgendwann hatte ich einfach genug“, flüsterte er mit einer Stimme, die so leblos war, dass es sich anhörte, als würde er vom Grund eines Grabes sprechen. Maries Arme überzogen sich mit Gänsehaut.
„Ich wollte nur noch...fort. Es war mir egal, wo dieses Fort war. Es war mir egal, was mit mir geschah, so lange ich dieses Haus, diese Menschen nie wieder sehen musste. Und so schlich ich mich in der Nacht davon. Ich ging in Richtung Wald, weil ich dachte, dass man mich dort nicht finden würde. Obgleich ich wusste, dass niemand nach mir suchen würde. Wer sollte mich vermissen? Wen würde es kümmern, wenn ich fort war?
Es war kalt, dort im Wald. Ich weiß noch, dass ein wenig Schnee fiel, und ich sah den Flocken zu, wie sie durch die Luft tanzten. Es sah so leicht aus, wie sie fielen. So schwerelos. So schön. Ich ging so lange in den Wald hinein, bis ich zu müde war, um weiterzugehen. Und dann...und dann habe ich mich einfach in den Schnee gelegt und darauf gewartet, zu sterben. Ich weiß noch, dass ich in den dunklen Himmel gesehen habe, und den Schneeflocken dabei zugesehen habe, wie sie langsam herunterschwebten. Wie sie sich auf meine Kleider legten. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Und als ich aufwachte, war ich nicht mehr ich, sondern der Fuchs.“
Sie sah es vor sich. Sie sah es vor sich, während er ihr davon erzählte. Und dann sah sie ihn an, wie er neben ihr saß und ins Feuer starrte und dieses Geschichte erzählte, mit einer Stimme, die wie das Innere eines Grabes klang. Wie er all das erzählen konnte, ohne dass sich etwas in seinem Gesicht rührte. Es tat weh, dass er all das erzählen konnte, ohne zu weinen. Vielleicht war das der Grund, warum ihre Augen auf einmal seltsam feucht waren.
Erst viel später verstand sie, dass es einfacher war, um einen anderen zu weinen, als um sich selbst.
Der Frühling wurde zum Sommer, der Sommer zum Herbst. Die Welt um die Holzhütte wandelte sich und blieb doch die gleiche. Die Blätter sprossen aus dem Waldboden, färbten sich bunt und fielen kurz vor dem ersten Frost. Der Winter kam schleichend, jede Nacht war ein wenig kälter. Trotzdem war Marie überrascht, als sie eines Morgens aus dem Fenster sah und die Welt im endlosen Weiß versank.
Es war Winter geworden. Es war Winter geworden, und Luka war immer noch da.
Natürlich hatte sie gewusst, dass es kalt werden würde. Sie hatten vorgesorgt, hatten Vorräte angelegt, Holz gesammelt, das Haus auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Und doch war sie überrascht, wie schnell die Zeit verstrichen war. Die Nächte waren nicht mehr so endlos wie früher. Sie saß nicht mehr allein vor den Flammen, gefangen im endlosen Kreis ihrer Gedanken. Wenn sie schwiegen, taten sie es zu zweit, und in letzter Zeit hatten sie immer weniger geschwiegen und immer mehr miteinander gesprochen. Sie hatte Luka von ihrem Vater erzählt, wie er eines Tages in den Wald gegangen und nicht mehr zurückgekommen war. Wie sie seinen Spuren gefolgt war, die sich im Wasser des Sees verloren hatten. Sie war nicht mehr am See gewesen seit jenem Tag. Sie glaubte, seine Augen darin zu sehen, die vom tiefen Grund aus zu ihr aufblickten, sie lockten, sie zu ihm riefen.
Auch an diesem Abend hatte Luka sie gehalten. Er wurde immer besser darin.
Luka lebte mehr im Jetzt. Vielleicht, weil er nicht immer ein Mensch war. Luka erzählte, was er im Wald gesehen hatte. Welche Tiere er entdeckt hatte. Welchen Spuren er gefolgt war. Wie das Lied der Vögel von der Weite des Himmels und der Welt hinter dem Wald erzählt hatte. Er sprach selten vom Davor. Vielleicht war er noch nicht soweit. Vielleicht war es nicht nötig.
Lächelnd schnürte Marie die dünnen Holzbohlen unter ihre Schuhe, die ihr helfen würden, durch den Schnee zu gehen. Irgendwie spürte sie, dass er heute zu ihr zurückkommen würde. Er mochte die Kälte nicht, selbst als Fuchs nicht. Er würde instinktiv die Wärme des Feuers suchen. Sie wollte ein wenig durch die Winterwelt gehen, nach den Fallen sehen, die Luka gestellt hatte, und die letzten Beeren von den Brombeersträuchern pflücken.
Sie war noch nicht lange unterwegs, als ihr auffiel, wie still es war. Selbst die Vögel waren verstummt. Etwas war anders. Etwas war im Wald.
Und dann sah sie ihn. Den toten Fuchs, der vor ihm im Schnee lag. Er lag dort, wo ein Jahr zuvor Luka gelegen hatte. War das wirklich erst ein Jahr her? Er gehörte inzwischen so sehr zu ihrem Leben hier, gehörte so sehr zu der Blockhütte im Wald wie sie selbst, und sie konnte sich nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu leben. Der Fuchs lag genau dort, wo Luka gelegen hatte, aber sein Atem bildete keine Wölkchen mehr, und er regte sich nicht, und seine Augen blieben geschlossen. Er war als Fuchs gestorben, und Marie hätte nicht sagen können, ob er wirklich nur ein Fuchs gewesen war, oder ob er sich nicht manchmal auch in einen Menschen verwandelt hatte...
„Nein!“, flüsterte Marie. Das Weiß um sie herum schwankte, oder war sie das?
„Oh, nein, bitte nicht!“
Und dann waren da zwei Arme, die sie auffingen, und warmer Atem an ihrem Ohr. Sie kannte diese Arme.
„Luka...“
„Ich weiß, Marie. Ich weiß.“
Lange standen sie so im Schnee vor dem kalten Körper des fremden Fuchses, der Luka hätte sein können. Lange standen sie so da, dich aneinandergedrängt, und versicherten einander, dass sie einander nicht verloren hatten. Das erste Mal war sich Marie nicht sicher, ob er sich nicht auch an ihr festhielt.
„Hast du ihn...gekannt?“, fragte sie ihn leise, als sie wieder vor dem Feuer saßen.
„Nein. Ich kenne niemanden, wenn ich ein Fuchs bin. Ich kann keine Erinnerungen mit mir nehmen, wenn ich...mich verwandle. Aber...“
Aber es hätte sein können. Es hätte der Fuchs sein können, der ihn zu dem gemacht hatte, der er war. Es hätte Luka sein können. Luka, der dort tot vor ihr im Schnee lag.
Es war das erste Mal, dass Marie ihn weinen sah. Lautlose, zögernde Tränen, die irgendwie schlimmer waren, als wenn er lauthals geschluchzt hätte. Es tat weh, ihn weinen zu sehen. Auch wenn sie wusste, dass es richtig war, dass er weinte. Dass es gut war. Dass es bedeutete, dass er fühlte. Dass er zuließ, zu fühlen. Dass er den Schmerz zuließ. Sie rückte ein wenig näher an ihn heran und legte ihm die Hand auf die Schulter. Irgendwie spürte sie, dass sie ihn jetzt berühren musste. Dass er spüren musste, dass er nicht alleine war, und nicht länger einsam. Dass sie da war. Dass er nicht egal war. Dass es jemanden gab, der ihn suchen würde, wenn er sich verirrte. Dass es jemanden gab, der um ihn weinen würde, der ihn vermissen würde, wenn er eines Tages nicht mehr aus dem Wald zurückkam. Und auf einmal lag sein Kopf auf ihrem Bauch, und sie fuhr ihm durch das helle, halblange Haar. Wie weich es war. Wie warm.
Wie lebendig.
Sie war so froh, dass er nicht gestorben war. Dass er irgendwie den Weg zu ihr gefunden hatte. Dass er nicht mehr der kleine, traurige Junge sein musste, der so alleine war, dass es wehtat, daran zu denken.
Das Leben war nicht perfekt. Immer wieder verwandelte sich Luka in den Fuchs, und Marie fürchtete jedes Mal, er würde nicht zu ihr zurückkehren. Der Wald war voller Gefahren, und Füchse waren nicht die größten und auch nicht die gefährlichsten Raubtiere, die durch das Unterholz schlichen. Er konnte einem Bären begegnen. Er konnte einem Jäger vor die Flinte laufen. Es war möglich, dass er sich weit von hier entfernt verwandelte. Es war möglich, dass er vergaß, dass es irgendwo am Rande des Waldes Marie gab, die auf ihn wartete.
Aber er vergaß nicht. Und er kam jedes Mal wieder zu ihr zurück. Er konnte nicht anders. Sie war ein Teil von ihm geworden, und er ein Teil von ihr.
Und keiner von beiden war mehr alleine.
Über den Autor
Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
Unter www.bookrix.de/-schneeflocke kann "Restrisiko" nach wir vor noch lesen.
LG Flocke
Leser-Statistik
40
Kommentare
Kommentar schreiben
| Luzifer Die - Geschichte ist wirklich märchenhaft geschrieben und vermittelt tiefe Gefühle. Bei Lukas Vergangenheit fehlt mir aber etwas die Gleichgültigkeit des Vaters. Du schreibst nur, dass er in einem Bergwerk gearbeitet hatte. Die Beziehung zu Luka, so ich sie denn nicht überlesen habe, wird aber nicht erwähnt. Wieso er wegen der Stiefmutter wegwollte, ist eindeutig, aber der Vater hätte sich ja auch nach der Arbeit auch Zeit für Luka nehmen können. Die Möglichkeit besteht jedenfalls. Schön fand ich auch, dass nicht gesagt wird, was die Verwandlung bewirkt hat. Und der tote Fuchs zum Schluss der Geschichte war sowieso genau passend. Bei diesem Text hat mich aber eine Sache besonders gestört. Es kann sein, dass es nur mir so geht, aber du verwendest an verschiedenen Stellen die gleichen Satzanfänge, die mit der Zeit mehr nerven, als der Stimmung dienlich sind. Vor allem deswegen, als manche davon auch umgangen werden können. Seite 8, zweiter Absatz ist ein gutes Beispiel, wo das zweite "Lange saß sie dort neben ihm vor dem Kamin und" nur ein Komma ersetzt werden kann ohne im Geringsten den Sinn zu verändern. Zum Schluss wird es besonders schlimm, wo "dass" schon fast über mehrere Seiten geht. Es stimmt, dass diese Form an einigen Stellen passt und die Atmosphäre vertieft, aber es gibt genau so viele Stellen, wo längere Sätze mehr bewirken, als die "Aufzählungen". Viele Grüße Luzifer |
| ZMistress Einfach schön - Nicht nur, dass ich mich total gefreut habe, mal wieder etwas von dir zu lesen (ich habe gerade vor ein paar Tagen wieder an dich gedacht und hoffe immer noch, dass es eines Tages mit "Mondstrahlen" weiter geht), diese Geschichte ist auch so bewegend, dass sie wirklich eine Menge Kommentare verdient. Ich fand die beiden Figuren so schön ausgearbeitet! Ich konnte richtig mitfühlen und habe mehr als einmal feuchte Augen bekommen. Auch die ganze märchenhafte Stimmung war einfach nur toll. Vielen Dank, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. |