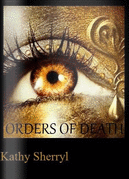PROLOG
PROLOG
Chicago, 20 Dezember
dreizehn Jahre zuvor
„Mommy?“
Umhüllt von der Dunkelheit der Nacht rannte sie die leere Straße entlang. Sie wusste nicht, wo sie war oder wohin sie gehen sollte. Als sie das Ende erreichte, haderte sie, ob sie nach links oder rechts weiterlaufen sollte. Sie blieb stehen und sah sich um.
„Mommy!“, rief sie laut. Vielleicht würde ihre Mutter sie hören, wenn sie sie nur laut genug rief? Dann würde sie zu ihr geeilt kommen und in die Arme nehmen. Mommy würde sicher mit ihr schimpfen, dachte sie, weil sie einfach von ihrer Seite gewichen war. Und dann hatte sie sich irgendwie verlaufen. Bestimmt machte Mommy sich schon Sorgen und suchte nach ihr. „Mommy!“, schrie sie wieder, so laut sie konnte. „Mommy, hier bin ich!“
Sie sollte hier stehenbleiben und einfach weiter rufen. Irgendwann würde Mommy sie hören und kommen.
Sie rief weiter nach ihrer Mutter, minutenlang, bis ihr die Stimme zu versagen drohte. Ihr war kalt. Warum kam Mommy nicht endlich, um sie nach Hause zu bringen? Tränen stiegen ihr in die Augen und kullerten über ihre Wangen, der feuchte Pfad, den sie auf ihrer Haut hinterließen brannte wie Feuer im eisigen Nachtwind. Mit der Rückseite ihrer kleinen Faust wischte sie sie wütend weg und schlang frierend die Ärmchen um den Oberkörper. Es half wenig, ihr war immer noch kalt. Und weit und breit war keine Menschenseele zu sehen.
„Mommy!“
Ihr Rufen blieb ungehört. Langsam machte sich die Angst in ihr breit.
Was, wenn Mommy etwas passiert war? Wenn sie verletzt war und blutete? Dann musste sie sie finden und ihr helfen.
Sie machte einen Schritt vor, in dieselbe Richtung aus der sie gekommen war, hielt jedoch inne. Was, wenn nicht? Wenn Mommy sie suchte und einfach nicht finden konnte? Was, wenn sie schon in der Nähe war?
Mommy hatte ihr einmal gesagt, wenn sie sich mal verlaufen sollte und den Weg zurück nicht mehr finden sollte, solle sie sich nicht von der Stelle rühren und so laut schreien, wie sie konnte. Dann würde Mommy kommen, egal was passierte. Das hatte sie versprochen.
Warum kam sie dann nicht? Sonst war Mommy doch immer da, wenn sie sie brauchte. Aber jetzt war sie nicht hier.
„Mommy!“, schrie sie abermals, diesmal wurde ihr Rufen von einem Wimmern begleitet. Der Druck in ihrem Hals wurde größer, bis sie sich schließlich nicht mehr zusammenreißen konnte und in heftigen Schluchzern zu weinen anfing. „Mommy“, flüsterte sie, ihre Stimme von Tränen erstickt. „Ich will zu meiner Mommy.“
Doch niemand hörte sie.
Zeit verging, ob Minuten oder Stunden, wusste sie nicht. Es kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Noch immer war der Himmel dunkel, die Nacht war noch nicht gewichen und der Tag schien meilenweit entfernt.
Da hörte sie plötzlich Schritte sich nähern. Sie unterdrückte den nächsten Weinkrampf und versuchte, wie ein Mäuschen zu lauschen.
Ja! Jemand kam auf sie zu!
Sie riss das Köpfchen hoch, doch noch war niemand zu sehen. Ohne eine weitere Sekunde warten zu wollen, lief sie los.
Mommy hatte sie endlich gefunden!
„Mommy“, rief sie im Laufen. Sie rannte um die Ecke, bereit sich in die empfänglichen Arme ihrer Mutter zu werfen. Doch sobald sie in die nächste Straße eingebogen war, wurde sie langsamer, bis sie schließlich ganz stillstand.
Das war nicht ihre Mommy.
Aber wer dann? Hatte sie jemand weinen gehört und war gekommen, um sie zu ihrer Mommy zu bringen?
Sie sah auf. Vor ihr stand ein Mann. Ein fremder Mann, der so groß war, wie ein Riese. Er trug einen langen schwarzen Mantel, dessen Saum vom Wind gegen seine langen Beine geweht wurde. Der Hut auf seinem Kopf warf dunkle Schatten, die sein Gesicht verbargen, wodurch er bedrohlich auf sie wirkte. Eine riesige, finstere Gestalt.
Der Schattenmann.
Mommy hatte ihr von diesen Leuten erzählt, aber noch nie war sie welchen begegnet. Mommy sagte, manche von ihnen seien Freunde, andere wären jedoch böse.
Sie wusste nicht, ob sie demjenigen vertrauen konnte, der nun vor ihr stand. Sie wusste nur, dass er ihr Angst bereitete.
Aber was, wenn er sie zu Mommy bringen konnte? Vielleicht war er ja deshalb gekommen?
Als sie zu ihm aufblickte, hoffte sie es mit all ihrem Sein, dass es so war.
„B-bist…“, begann sie vorsichtig, unsicher, wer er wirklich war und was er hier wollte. „Bist du gekommen, um mich zu Mommy zu bringen?“
Er schwieg, starrte sie nur an. Auch, wenn sie seine Augen nicht erkennen konnte, wusste sie es. Sie konnte seinen Blick spüren.
Und sie mochte es überhaupt nicht.
„Wer bist du?“, fragte sie weiter, als der Mann nicht reagierte. Das Schweigen bereitete ihr noch mehr Angst. Es gab ihr ein Gefühl der Sicherheit, wenn sie sprach, ihre eigene, vertraute Stimme hörte. Die Stille zwischen ihr und dem Fremden jedoch ließ sie fast in Panik geraten, denn dann fühlte sie sich ihm so schutzlos ausgeliefert. Dann schien es ihr, als würde sie mit ihm in einer anderen Welt, fernab von jedem Leben und all den Menschen, sein, wo niemand ihr zu Hilfe kommen konnte.
Der Mann blieb weiterhin stumm, stand aufrecht da ohne zu schwanken, ja, nicht mal zu atmen schien er, so reglos wie er war. Wie eine Statue. Aber die Hitze, die von ihm ausging, war mehr als nur lebendig. Wie auch alles andere an ihm, schüchterte sie sie ein.
Sie versuchte unmerklich einen Schritt zurückzuweichen, versuchte, Abstand zu ihm zu bekommen. Während sie dort stand, ihm gegenüber, wurde sie im Gefühl immer sicherer, dass dieser Fremde nicht zu den Guten gehörte.
Er war böse.
„Kennst du meine Mommy?“, fragte sie, einfach nur um ihn abzulenken, damit er nicht bemerkte, wie sie langsam vor ihm zurückwich.
Als sie in den schwarzen Schatten seines Gesichts sah, erkannte sie jedoch im nächsten Moment, dass es unmöglich war, ihn zu täuschen.
Er grinste, ein weißes Aufblitzen seiner Zähne im Dunkeln.
Es war ein Grinsen voller Boshaftigkeit.
Mommy, wo bist du?, dachte sie verzweifelt. Sie wollte wieder in Tränen ausbrechen und gleichzeitig wollte sie vor diesem bösen Mann keine Schwäche zeigen.
Und er war böse, das war ihr jetzt vollkommen bewusst.
„Armes, kleines Mädchen. Hast du dich verlaufen?“
Seine Stimme so plötzlich zu hören, erschreckte sie. Sie war rau, heiser … und unheimlich. Eine Stimme, wie ein Reibeisen. Ein kalter Schauer rann ihr über den Rücken.
„Soll ich dich zu deiner Mommy bringen, kleines Mädchen?“
Ihr wurde kalt. Beinahe hätte sie laut geschrien, aber der Schrei blieb ihr irgendwo im Hals stecken, wo er von einer lähmenden Angst erstickt wurde. Der Mann trat einen Schritt auf sie zu. „Komm“, sagte er grausam lächelnd. „Ich werde dich zu ihr bringen.“
Nun sah sie seine Augen. Sie waren unnatürlich leuchtende, rote Punkte in der Finsternis.
Sie stand da, wie zu Eis erstarrt und blickte in diese Augen. Sie konnte sich nicht rühren. Dann trat der Mann einen weiteren Schritt näher und alles in ihr Schrie auf. In ihrem Kopf gälte die Furcht, doch am lautesten schrie eine warme, ihr ach so vertraute Stimme voller Sorge und Liebe. Eine Stimme, der sie überall hin folgen würde.
„Lauf!“, schrie ihre Mutter. „Lauf weg!“
Seltsam. Die Stimme ihrer Mutter war in ihrem Kopf! Wie war das möglich?
Aber sie hielt sich nicht mit Fragen auf, sondern tat, was Mommy sagte. Sie drehte sich um.
Und rannte.
Sie rannte so schnell sie konnte, schneller noch als zuvor, schneller, als sie in ihrem ganzen bisherigen, so kurzen Leben je gerannt war.
Es tat weh. Das Atmen tat weh, ihr Herz tat weh. Aber sie rannte weiter, hörte nicht auf. Nicht einmal nach ihrer Mutter sah sie sich um, während sie lief, auch wenn sie sich es so sehr wünschte. Der Gedanke, dass sie Mommy mit diesem Mann allein lassen könnte, ließ sie beinahe stehenbleiben und umkehren. Aber sie tat, was Mommy gesagt hatte. Sie rannte. Immer weiter.
Bis der Weg zu Ende war.
Eine Mauer brachte ihre Flucht abrupt zum Ende, keuchend blieb sie stehen. Sie konnte kaum noch atmen, die kalte Luft schnitt wie Messer in ihre Lungen. Sie drehte sich um, um in eine andere Richtung zu laufen.
Aber auch da ging es nicht weiter.
Der Fremde versperrte ihr den letzten Ausweg, der ihr geblieben war. Gefangen zwischen ihm und der Ziegelsteinmauer hinter ihr, presste sie sich mit dem Rücken eng gegen die Wand.
Was sollte sie jetzt nur tun?
„Na, kleines Mädchen?“
Wo war nur Mommy?
„Hier geht es wohl nicht mehr weiter.“
Bitte,… Mommy…
„Du willst zu deiner Mommy, nicht wahr?“
Galle stieg in ihr auf, der Geschmack war ätzend auf ihrer Zunge. Angst packte sie und hielt sie in festem Griff.
„Was hast du mit meiner Mommy gemacht?“ Sie wollte die Antwort nicht hören. Sie wollte es nicht wissen… Mommy durfte nichts zugestoßen sein!
Bitte. Lieber Gott, bitte!
„Ich werde dich zu ihr bringen, wenn du das willst.“ Es war ein freundliches Angebot, mit einem grausamen Lächeln ausgesprochen.
„Wo ist sie“, schluchzte sie, nicht länger fähig die Tränen zurückzuhalten. Sie wischte sich über die Wangen, ohne den Blick von ihm zu wenden, doch aus den Augenwinkeln bemerkte sie die dunklen, rostfarbenen Flecken auf ihren Fingern, auf ihrer Jacke, ihrer nackten Haut.
Blut.
Auf ihr. Überall auf ihr.
Der fremde lachte, als er ein seltsam aussehendes, großes Messer hervorholte, die Klinge blitzte im Dunkeln auf. Sie sah dieselben schwarzen Flecken auf dem Stahl. „Keine Angst. Ihr werdet bald wieder zusammen sein.“ Mit zwei letzten Schritten war er bei ihr, drückte sie gegen die Wand, die Klinge an ihrer Kehle.
Sie wich zurück, aber sie wusste, es gab kein Entkommen.
Ihre Mutter war nicht entkommen.
Und sie würde es auch nicht.
„Sag, kleines Mädchen“, flüsterte er ihr ins Ohr. „Hast du Angst vor dem Tod?“