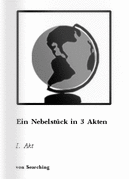Der Wald umschloss ihn, er wusste nicht, wie er herein geraten war, im vergangenen lag nur die Dunkelheit. Er sa├č dort auf Moos, zwischen Kletterpflanzen und alten B├Ąumen, w├Ąhrend das Laub im Mondschein weinte. Die Nacht war so still, sie lag im Sterben, und die Wolken wurden ihr Leichentuch. Kein Wind wagte sich zu regen, kein Tier zu schreien, es war nur still, Totenruhe und er war die Totenwacht. Ein Nachtfalter stieg empor im Schatten des Lichts, stieg empor, dem Himmel entgegen, doch am Schluss setzte er sich auf des W├Ąchters Hand, m├╝de des Fl├╝gelschlags. Der W├Ąchter blickte ihn an, der m├╝de Schmetterling blickt zur├╝ck. Das Himmelszelt lichtete sich, die Schwere stieg hinab, der Himmel ein klares grau, unten der Nebel verblasster Tage. Der Schmetterling hob seine Fl├╝gel, stieg abermals empor, schaut dem Manne in die Augen und sprach ganz leise mit der Melodie des Windes: „F├╝rchte dich nicht, Menschenkind, bist weder heimgesucht vom Wahnsinn noch von D├Ąmonenschar, nur das Licht, dass durch den Schleier der Schatten zu dir spricht. H├Âre seine Worte, auch wenn sie nicht aus meinem Munde stammen.“ Der Wind zog an, der Schmetterling zerging zu Staub, Asche einer verlorenen Flamme, aufgel├Âst im sanften Gesang der W├Ąlder. Der Mann, er sa├č dort, wusste sich nicht zu regen, nicht wissend was zu tun, im Gedanken zwischen Traum und Omen, Illusion und Lichtgestalt. Er sa├č nur dort, unf├Ąhig sich zu r├╝hren, also blieb er dort. Im Ge├Ąst begann es zu krachen, ├äste brachen, Bl├Ątter fielen, die B├Ąume schrieen ihre Qual hinaus. Am Ende trat ein schwarzer Rabe heraus, das Gefieder so schwarz, dass das des Mondes Licht darin verschwand.┬á