Romane & Erzählungen
Rättigen
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Schreibender.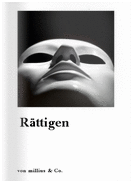
Rättigen
Beschreibung
Ein Dorf, der Teufel und der Tag, an dem das Sterben ein Ende nahm.
Als der Melchior Schmidli im Sterben liegt, stirbt die Sonne für diesen Tag auch gerade, und er findet das irgendwie ganz wunderbar, er würde ihr jetzt zuwinken, der Sonne, wenn er die Kraft noch hätte. Helfen kann ihm auch keiner dabei, denn der Bauer, der Egger Albert, ist zusammen mit seiner Frau im Stall, der halbwüchsige Sohn Tobias ist auch dabei. Dem Schmidli sein Sterben hat gegen Mittag angefangen, aus heiterhellem Himmel, und auch wenn es nun schon einige Stunden dauert, so ist es doch von Anfang an ein Sterben gewesen, so klar wie der Duft von nassem Heu. Und deshalb, hat der Egger Albert gesagt, deshalb habe es auch keinen Sinn, den Arzt zu holen, für was auch, gestorben werde mit oder ohne Arzt, aber ohne sei es billiger. Und dann, so um vier am Nachmittag, der Melchior hat es gesehen, wie er einmal kurz die Kraft gefunden hat, zur alten Uhr an der Wand zu schauen, da ist dann plötzlich der Tobias ins Haus gerannt gekommen, ganz aufgeregt, und hat gerufen, dass die Martha kalbt. Sie alle, der Albert und der Tobias und die Frau vom Albert, die Elsa, sind in den Stall gerannt, weil die Marta eine Problemkuh ist, wie der Peier gesagt hat, der Viehdoktor, also mussten alle helfen, das Kälblein zur Welt zu bringen. Der Melchior hat das verstanden, er hat nie gezählt, wie viele Kälblein er in all den Jahren auf dem Hof vom Egger, zuerst noch vom Senior, hat kommen sehen, aber soviel weiss er, der Knecht, dass die Geburt wichtiger ist als das Sterben, weil da etwas Neues kommt, neues Leben.
Er hat einmal darüber diskutiert mit dem Ivan, dem Zigeuner, der beim Egger immer ausgeholfen hat, wenn die Erdbeerli dran waren, und der Ivan hat zuerst nur zugehört, ein bisschen nachgedacht und schliesslich den Kopf geschüttelt und gesagt, dass er das nicht verstehe. Bei einem Tschutti-Match, er hat das ganz anders ausgesprochen mit seinem Kauderwelsch, aber der Melchior hat ihn verstanden, bei einem Tschutti-Match jedenfalls, da sei doch der Schlusspfiff wichtiger als der Anpfiff, weil man doch da erst wisse, wie alles ausgegangen sei, und das interessiere doch und sonst nichts.
Der Melchior hat darüber nachgedacht, irgendwie ist ihm nichts Gescheites eingefallen, was er hätte erwidern können, aber der Ivan konnte lange reden, es war doch einfach klar, dass die Geburt wichtiger ist als das Sterben, und überhaupt, das Leben ist ja wohl kein Tschutti-Match, was weiss schon so ein dahergelaufener Zigeuner, der einmal im Jahr für die Erdbeeren kommt und dann wieder verschwindet, Gott weiss wohin, und der dann ein Jahr später plötzlich wieder vor der Tür steht, mit noch weniger Zähnen im Maul und denselben Hosen wie vor einem Jahr und wieder Bitti-Betti macht um einen Platz im Schopf und eine warme Suppe und das auch bekommt und sich dafür den Rücken bucklig erntet mit den Erdbeeren, die einfach nicht aufzuhören scheinen, jedes Jahr. Aber irgendwann ist dann doch immer Schluss, und der Ivan verschwindet wieder, meistens lässt er noch etwas Kleines mitgehen, und der Bauer fluecht und tuet und schwört, dass er diesen verdammten Sauzigüüner totschlägt, wenn der es wagt, zurück zu kommen, aber im Jahr darauf macht der Egger Albert wieder die Runde unter den Hausfrauen im Dorf und fragt, wer für ihn zu den Erdbeeren kommt, und alle winken ab, weil man einen krummen Rücken bekommt von dieser Arbeit, und dann wird er ein bisschen grummeln in der Stube, der Bauer, und eines Tages steht wieder der Ivan vor der Tür, der Bauer siracht zuerst ein wenig und tuet und macht, aber irgendwann sitzt der Ivan wieder auf der Eckbank, als wäre nichts gewesen und schaufelt die heisse Gemüsesuppe in den weit geöffneten Mund.
Den Löffel kann er fast zwischen den letzten verbliebenen Zähnen durchschieben, aber wieso sollte er das auch tun, fragt sich der Melchior und möchte den Kopf schütteln über diesen komischen Gedanken, der da in seinem Kopf herumturnt, aber er lässt es lieber und dreht sich stattdessen ein bisschen Richtung Fenster.
Dort ist jetzt die Sonne schon fast gar nicht mehr zu sehen, wenigstens nicht vom Kanapee aus, auf dem der Melchior liegt, er wäre ja gerne in seiner eigenen kleinen Kammer gestorben, aber der Bauer Egger und der Tobias haben ihn zusammen in die Stube getragen, eigentlich mehr gezogen, der Melchior hat noch versucht, selbst zu gehen, weil er seinen Lebtag lang auf seinen eigenen Beinen gegangen ist, aber diesmal wollten sie nicht so recht, und das hat ihn schampar möge, weil er doch gerade an diesem Tag nicht hatte schwach sein wollen, weil es doch ein besonderer Tag ist für ihn. Jedenfalls haben sie ihn hier aufs Kanapee geschleppt, auf diesen schmalen Sidian, bequem ists wirklich nicht, aber der Melchior hat den Egger Albert schon begriffen, als der gemeint hat, es sei besser so, denn wenn er in seinem eigenen Zimmer vor sich hin sterbe, der Melchior, dann sei es gut möglich, dass man ihn da drin vergesse, weil er doch seit einem guten Jahr kaum mehr helfen könne auf dem Hof, und zum Essen komme er auch nicht immer, jedenfalls sei es gut möglich, dass sich niemand besinne, wenigstens für zwei oder drei Tage, dass es den Knecht Melchior ja auch noch gebe,
und dann, er rede nicht gerne darüber, hat der Egger gesagt und ein bisschen zur Seite geschaut, dann sei das nicht so gut, denn diesen Geruch, den bringe man schon nach ein paar Tagen nicht mehr aus den Vorhängen und der Matratze, und er, der Melchior, wolle ja wohl nicht ausgerechnet einen schlechten Geruch als Erinnerung hier lassen.
Ein bisschen Erinnerung, das hat sich der Melchior gedacht, als der Bauer so geredet hat, ein bisschen Erinnerung hätte ihnen allen wohl gut getan im Haus, wenn sie ihn schon im Zimmer vergessen würden, kaum ist er kalt. Aber er hat natürlich Recht, der Egger Albert, es ist nur vernünftig so, auch wenn das Kanapee wirklich schaurig schmal ist, und der Knecht hätte dem Bauern auch sonst nicht widersprochen. So hat es der Melchior Schmidli gelernt, und so will er es halten bis zum letzten Tag. Sogar bis zur letzten Minute, und der Knecht hat jetzt das Gefühl, das könnte allmählich wirklich der Fall sein, aber sicher ist er sich nicht, er hat schon zwei, drei Mal am Nachmittag geglaubt, das sei es nun gewesen und hat noch einmal einen tiefen Atemzug gemacht und die Augen weit geöffnet, weil er so viel wie möglich hat mitnehmen wollen von dieser Welt, aber dann ist ihm plötzlich eingefallen, dass es ja gar nicht so der Segen gewesen ist für ihn hier unten, und er hat darüber nachgedacht, ob er das überhaupt mitnehmen wolle, mit seinen Augen, mit den Händen kann er ja sowieso nichts mitnehmen, und er hätte auch nichts gehabt, und wie er so nachgedacht hat, ist das Sterben für diesen Moment plötzlich an ihm vorbei gewesen, einfach weg, himmeltruurig ist es ihm natürlich immer noch gegangen, aber so, dass er gewusst hat, dass es noch eine Stunde oder zwei gehen würde.
Und so ist es dann auch gewesen, noch eine Stunde ist gegangen und noch eine, aber jetzt könnte es das wirklich gewesen sein, und es beginnt auch dunkel zu werden draussen. Das Chälbli ist sicher längst auf der Welt, und der Egger Albert wird stolz im Stall herumlaufen und sich die Hände reiben, beim Tobias ist er lang nicht so nervös gewesen, der Bauer, wie wenn ein Kalb bevorsteht, daran erinnert sich der Knecht, aber lange denkt er nicht darüber nach, denn er hat das gar nie anders erlebt, auch nicht beim Egger Albert senior, und der hat elf Kinder gehabt, und bei keinem davon hat der alte Bauer ein gesteigertes Interesse gezeigt, wenn es auf die Welt kam. Das wäre beim Albert junior auch nicht anders gewesen, aber der hat ja nur den Tobias, eine Schande ists, dass so eine flotte Familie nur eines hat, aber die Elsa hat eben nur eines zur Welt gebracht, an ihr muss es wohl liegen, soviel der Melchior weiss, der Egger hat einmal so etwas gesagt, als er am letzten Abend der Erdbeerernte ein bisschen mehr getrunken hat als sonst, aber er ist dann nie fröhlich, der Bauer, bitter ist er, und böse ist er, bitterböse sozusagen, und der Melchior, der jetzt schon ein bisschen wegdämmert, studiert daran herum, ob es dieses Wort wirklich gibt oder ob er es grad erfunden hat, es passt so gut, dass es fast nicht wirklich sein kann: Bitterböse. Genau das ist der Bauer, wenn er gesoffen hat, und das hat er an jenem Abend, das ist jetzt wohl schon an die zehn Jahre her, der Tobias ist noch klein gewesen und jeden Abend hat der Lattenrost im Zimmer des Puurs und der Püürin geächzt und geknarrt, dass es der Knecht bis zu seinem Verschlag herunter gehört hat. Aber der Tobias ist trotzdem allein geblieben, und da hat der Egger Albert eben ein bisschen zu sehr gefeiert, dass wenigstens die Erdbeeren gut gekommen sind in jenem Jahr, und irgendwann hat er dem Melchior ganz verschwörerisch erklärt, an ihm könne es nicht liegen, er merke immer ganz genau, wie sehr er komme, das sei also schon fast eine Fontäne, literweise, hat der Bauer schliesslich geschwärmt und zwischendurch einen satten Görps gelassen, literweise schenke er der Frau seinen Samen, grad wie es in der Bibel heisse vom Abraham und seinem Samen, aber beim Abraham habe es doch sicher auch ein paar Mal eingeschlagen, gut, einen Sohn hätte er fast gmetzget, das war diese Geschichte mit der Prüfung Gottes, aber das tue eigentlich nichts zur Sache, hat der Bauer gesagt und vor sich hin gelacht, es ist ein freudloses Lachen gewesen. Aber bei der Elsa, hat der Bauer gesagt, als er fertig gelacht hat, da passiere einfach nichts seit dem Tobias, also liege es ja wohl an ihr, er mache es ja wohl nicht anders als der Abraham, solle
ihm keiner erzählen, er wüsste nicht, wie man seine Frau recht besteige, da müssten ihm die aus dem Alten Testament also wirklich nichts vormachen, jedenfalls bringe dieElsa nichts mehr zustande, und die Zeiten seien ja vorbei, wo die Frauen mit 35 an Tuberkulose sterben oder an Lungenentzündung oder auch einfach so und man sich dann eine neue habe nehmen können, mit der man vielleicht mehr Glück habe.
Bitterböse ist er da gewesen, erinnert sich der Melchior, wie er so auf dem Kanapee liegt und stirbt und versucht, nicht vom Polster zu rutschen, weil sie ihn dann hochheben müssen, und die Eggers haben alle einen kaputten Rücken von den Erdbeeren, diese Mühsal will er ihnen ersparen, der Melchior, auch wenn sie ihm genau genommen keine Mühsal erspart haben, aber daran will er jetzt nicht denken, der Knecht, nicht jetzt, wo er doch grad stirbt, und das tut man ja nur einmal, und er
versucht, sich an etwas Schönes zu erinnern, aber wie es halt so ist im Leben, wenn man sich etwas so sehr wünscht, stirbt der Melchior Schmidli, bevor ihm noch etwas Schönes eingefallen ist.
Aber jetzt hat er sich daran gewöhnt, und deshalb begreift er nicht, dass er heute im Nachtdienst diesen trockenen Apfel kauen muss. Heute abend, das hat er schon vor einer Woche gemerkt, wäre die Bertschinger an der Reihe gewesen, die hat zwar ganz gesund ausgesehen in den letzten Tagen und hat auch mehr gegessen als sonst, aber der Jost hat gewusst, dass das nur ein letztes Aufbäumen ist, und er hat auch gewusst, dass es am Mittwoch so weit sein wird. Am Anfang hat er sich jeweils einen Spass daraus gemacht, in der Küche auszurichten, dass sie im Fall ein Abendessen weniger machen
könnten, weil däsäb oder diesäb heute nichts mehr essen werde oder dann höchstens Hostien auf einer Wolke oben, und nachdem sich dem Baumberger sein Ruf herumgesprochen hat, sind die in der Küche darauf eingestiegen, und es ist nur ein einziges Mal passiert, dass sie dann in aller Eile noch ein Essen hinpfuschen mussten, weil die Frau Peter immer noch putzmunter am grossen Esstisch im Saal unten
gesessen ist und ungeduldig mit dem Messer in der Luft herumgezittert hat, obwohl der Jost doch ganz sicher gewesen ist, dass es die Frau Peter an dem Tag butze würde. Nach drei Bissen ist sie dann aber wirklich Kopf voran in die Suppe gesunken, die Frau Peter, und der Hausmeister hat dann noch gewitzelt, dass die Küche da wohl nachgeholfen habe, damit der Jost seine Wette nicht verliere. Aber der Jost hat nie gewettet, schon gar nicht um Geld, das wäre ihm unmoralisch vorgekommen, er hat
einfach Recht behalten wollen, und das hat er auch in diesem Fall.
Jedenfalls hat er seitdem nie mehr in der Küche ausgerichtet, wer heute an der Reihe ist, nicht, weil er sich hätte irren können, sondern weil gerade in der Nachtschicht so ein Menü zuviel nicht das Schlechteste ist, denn irgendeiner muss es ja dann essen, wenn der Pensionär oder die Pensionärin einfach vor der Essenszeit stirbt. So schaut oft genug ein Znacht für den Jost heraus, wenn wieder ein Bett frei wird. Für heute hat er fest damit gerechnet, und jetzt sitzt die Frau Bertschinger immer noch im Saal unten und jasst, sie jasst grauenhaft schlecht, legt einfach irgend etwas ab und kennt nicht
einmal mehr die Regeln, aber ihre Jasspartnerin, die Frieda Grau, ist 98 und taub und blind und hält die Karten nur in der Hand, weil sie ihr die Bertschinger in die Hand drückt, und sie legt auch nie eine Karte ab, die Frieda, die gute Seele, die Bertschinger spielt ganz alleine vor sich hin und am Schluss nimmt sie der Frieda die Karten zur Hand heraus und wirft alles auf einen Stapel und ruft «Gwunne!» und mischt und legt der blinden, tauben Frau wieder ein Bündel Karten in die Hand. Die Frieda lächelt
manchmal, weil sie meint, es gebe zum Dessert Guetzli, und dann knabbert sie mit ihrem zahnlosen Maul ein wenig an den Karten herum, während die Bertschinger einen Stich um den anderen macht, weil sonst gar niemand Karten legt und dann plötzlich wieder ruft: «Gwunne!»
Jetzt ruft sie gerade und rupft der Frieda die Karten zum Maul heraus, um die nächste Partie zu mischen, und der Jost Baumberger hörts in der Küche und schüttelt den Kopf und grunzt unzufrieden und beisst in seinen Apfel. Er weiss, dass auch er sich einmal irren kann, aber das ist schon lange nicht mehr passiert, und wenn es damit endet, dass so ein furztrockener Apfel sein Abendessen ist, dann, findet der Baumberger, wird es wirklich ungemütlich.
Bevor es aber soweit ist, wird gebetet, und sie haben allen Grund dazu, dem Herrgott zu danken, die Bürgis, und deshalb hat die Paula auch diesen feinen Znacht auf den Tisch gezaubert, weil es doch so ein Freudentag ist. Irgendwie können sie es alle noch nicht so recht begreifen, aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Was zählt, ist der Fredi junior, das älteste der Kinder, dem sie vielleicht ein bisschen Rollschinken zur Seite tun, bis er wieder zuhause ist, ein paar Tage wird es schon gehen, aber was ist schon dieses kurze Warten verglichen mit dem, was die Familie eigentlich befürchtet hat, verglichen mit dem, was geschehen wäre, hätte nicht der Herrgott seine Hand schützend über den Buben gehalten, und deshalb fängt der Fredi Bürgi senior sicherheitshalber noch ein anderes Gebet an, und die drei Kinder rollen mit den Augen und pütschet sich unter dem Tisch an und schauen zum Weissbrot und beten auch, sie beten heimlich und leise, dass das Gebet des Vaters nicht so lang ist wie das vorherige, bis dann ist das Brot nämlich hart, und hartes Weissbrot ist vielleicht besser als hartes Schwarzbrot, aber sicher nicht besser als frisches Schwarzbrot und ganz und gar sicher nicht besser als frisches Weissbrot, das ist klar.
Aber irgendwann ist es doch soweit, auch wenn die Mutter nach dem Vater eigentlich auch noch ein Gebet aufsagen will, eines aus ihrer Kindheit, aber es fällt ihr gerade nicht ein, und deshalb geht sie jetzt allen Ernstes runter in den Keller und durchsucht ihre alten Schulsachen, die sie alle behalten hat, und die drei Mädchen seufzen auf und schauen das Weissbrot an und sehen richtig, wie es langsam trocken und hart wird, zuschauen kann man regelrecht dabei, aber glücklicherweise greift der Vater endlich selber zum Brot, als ihm das Warten zu dumm wird, die Paula kann ja ihr Kindergebet auch vor dem Schlafengehen vorsagen.
Der Fredi junior darf jetzt noch nichts essen, aber, der Vater sagts noch einmal beschwörend, sie werden ihm ja ein Stück Rollschinkli aufbewahren, wenn etwas übrig bleiben sollte jedenfalls, aber so, wie der Fredi senior danach zuschlägt, ist das noch nicht sicher. Aber die Hauptsache ist, er wird wieder gesund, der Bub, und das wird er, haben die Ärzte gesagt und selber gestaunt. Wenn einer mit zwölf Jahren vom Blitz getroffen wird, dann ist es das in der Regel gewesen, und sie haben das auch beim Fredi junior gedacht, als ihn der Hund vom Haugental-Bauern auf dem Feld gefunden und so lange gebellt hat, bis dä Puur sich auf die Socken gemacht und den Buben entdeckt hat. Schlecht hat er ausgesehen, der kleine Bürgi, verschmörzelet und angesengt bis in die Haarspitzen, und der Haugental-Bauer hat noch kurz darüber nachgedacht, ob er sein Geld an die Ambulanz oder an den Pfarrer vertelefonieren soll. Schliesslich hat er den Krankenwagen gerufen, die Sanitäter sind gekommen und haben den Jungen aufgelesen und ihn ins Spital in der Stadt gebracht und die Eltern
dort hingerufen, damit sie ihr Kind verabschieden können, verwunderlich genug, dass das noch möglich gewesen ist, so zwäg, wie der Bub war, mehr tot als lebendig, und weil man nicht mehr für ihn tun konnte als die Schmerzen lindern und man das überall auf der Welt kann und kein teures Spital dazu braucht, haben sie ihn in das Pflegezimmer vom Dorfarzt Alder in Rättigen bringen lassen, dann, hat man gedacht, stirbt er wenigstens dort, wo er gelebt hat, wenn auch nicht gerade lang, und zum
Friedhof ists von hier aus erst noch näher, aber dann hat der Fredi junior am nächsten Tag noch gelebt und am übernächsten und auch am Tag danach, schlecht ist es ihm gegangen, er hat sich nur so durchgesiecht, aber gelebt hat er halt. Und heute abend hat der Alder den Bürgis telefoniert und gesagt, dass ihr Fredi seinen Lebtag lang ein bisschen angesengt bleiben wird, aber leben wird er wohl, so wie es aussieht, denn heute am späten Nachmittag ist er aufgewacht, viel besser ausgesehen hat er zwar nicht, aber einen recht lebendigen Eindruck gemacht, und so sehr er es ihnen gönnt, der Dokter Alder, verstehen tut er es nicht.
Darüber denken sie jetzt nach, der Fredi senior und die Paula, die ihr Kindergebetsbuch gefunden und an den Tisch gebracht hat und daraus vorliest, während um sie herum laut geschmatzt wird, über dieses Wunder denken sie nach, und das Rollschinkli schmilzt bedrohlich vor sich hin, aber eigentlich tut es ja auch eine schöne Bratwurst für den kleinen Fredi, wenn er heimkommt, wahrscheinlich hat er ja auch gar noch nicht so sehr Hunger, sagt sich der Vater, als er das letzte Stückli auf seinem Teller und von da aus in seinem Mund verschwinden lässt.
Am anderen Ende des Dorfes beim kleinen Bahnhof gibt es auch einen Festschmaus. Nicht für Dorothea Zuber, die ist mit wenig zufrieden, und für mehr reicht die Witwenrente auch nicht. Aber Munz, der Kater, der eigentlich jetzt schon viel zu fett ist und den Bauch dem Boden entlang schleift, wenn er mühsam über die Gleise watschelt, der bekommt heute eine Extraportion Fisch, nein, nicht einfach Fisch, ein Stück Lachs ist es, die Dorothea Zuber würde sich nie getrauen, das jemandem zu
erzählen, aber gegeben hat sie den Lachs dem Kater eben doch, weil der das nach all dem Schrecken einfach verdient hat. Er hat ja immer mehr Glück als Verstand gehabt, der Munz, wenn er sich da faul auf den Gleisen in der Sonne wälzt und sich erst träge erhebt, wenn der Zug schon bedrohlich pfeift, aber irgendwie hat es eben immer gereicht, nur heute nicht, dass heisst doch, gereicht hat es offenbar, er sitzt ja hier in der Stube und frisst den Lachs, als hätte er seit Tagen nichts mehr bekommen, so
gesehen hat es natürlich gereicht, aber andererseits hat es eben auch wieder nicht gereicht, denn die Dorothee Zuber ist zwar nicht mehr die jüngste und die flinkste, aber ihre Augen sind noch gut beieinander, soviel ist sicher, und sie hat ja zugesehen, wie der Munz wieder auf dem Gleis gelegen ist und sich die Sonne auf den fetten Bauch hat scheinen lassen, als plötzlich der Zug gekommen ist und das Fraueli hat noch gedacht, komm jetzt, Munz, jetzt musst du langsam auf alle viere, und das hat der Kater auch getan, aber in was für einem Schneckentempo. Sie schaudert jetzt noch, die Frau Zuber, als sie daran denkt, wie sie plötzlich die Loki und ihren Munz gleichzeitig gesehen hat, an ein- und derselben Stelle auf dem Gleis, die Räder oder Kufen oder wie auch immer das heisst bei den Zügen, jedenfalls war die Loki auf ihrem Kater, sie hat ihn richtig überrollt, und den Munz hat es verspickt wie Hagelkörner auf einer Motorhaube, und die Dorothea Zuber hat sich die Hand vor den Mund gehalten und dann vor lauter Schrecken doch ganz vergessen zu schreien, und die ersten Tränen
waren schon unterwegs, als sich der Kater, der auf dem Kies neben dem Gleis zu liegen gekommen ist, als sich der Munz also plötzlich träge auf die Beine stellt und sich ein bisschen schüttelt und reckt und streckt und dann langsam auf das kleine Häuschen zugewatschelt kommt.
Der Zug hat ihn überfahren, kein Zweifel. Aber jetzt sitzt er da, der Munz, kein Fiserli Lachs hat er übrig gelassen und schaut jetzt doch immer noch hungrig und vorwurfsvoll auf das Fraueli, und das studiert, was es dem Kater denn noch geben könnte, einen halben Cervelat vielleicht, es sollte noch einer im Kühlschrank sein. Verdient hat er es ja, der fette Kater, und wieso soll er auch schlanker werden, wenn er doch einfach auf dem Gleis liegen und einen Zug über sich rollen lassen kann und sich
dann einfach ein bisschen reckt und streckt und dann plötzlich wieder vor dem Napf steht.
vor acht Uhr zusammengesoffen, und jetzt kriegt er das heulende Elend. Speziell ist er gewesen, der Jost Baumberger, bis zu diesem Abend ist er irgendwie speziell gewesen, hat etwas gekonnt, was keiner sonst kann, und wer lässt sich das schon nicht gerne nachsagen. Dass das jetzt vorbei sein soll, das kann und will er einfach nicht glauben. Und wie er den letzten Schluck Williams kippt und auf den Gang horcht, ob da nicht doch noch Arbeit wartet und schliesslich hört, dass es nur die quicklebendige Frau Bertschinger ist, die im Schlaf «Gwunne!» ruft, wie er da so sitzt, ein bisschen belämmert vom Alkohol und vom fehlenden Schlaf, weiss der Jost, dass es nicht an ihm liegen kann. Er hat diese Gabe, und es gibt gopfverdeckel keinen guten Grund, wieso sie ihm abhanden gekommen sein sollte.
Es muss etwas anderes sein. Der Baumberger, obwohl er nicht mehr so klar zu den Augen heraus sieht, ist sich plötzlich ganz sicher. Nein, es liegt nicht an ihm. Die Bertschinger ist schuld. Sie stirbt ganz einfach nicht, wie es sich gehört. Und überhaupt ists schon ewig her, dass er ein Abendessen abstauben konnte. Huere Siech, denkt sich der Pfleger, steht auf und torkelt quer durch die Küche zum letzten Schrank, in dem er noch nicht nach Trinkbarem gesucht hat. Huere Siech.
Dass der Zug überhaupt noch Halt macht in Rättigen, das muss irgend einer dieser Minderheitsförderungsaktionen zu verdanken sein, die sie alle paar Jahre machen bei der Regierung, damit man sich nicht ganz vergessen vorkommt in einem solchen Nest. Einsteigen tut kaum jemand, und aussteigen schon gar nicht. Darum würde heute Abend manch einer staunen, dass da wirklich eine der Türen aufgeht und ein Mann herauskommt, einer mit einem Franzosenchäppli und einer schwarzen Ledertasche. Aber weil eben wirklich keiner am Bahnhof ist und höchstens mal die Frau Zuber zum Fenster heraus schaut, wenn sie nicht gerade ihrem Kater ein Lachsfilet zurecht schneidet, darum staunt jetzt auch niemand, und der Mann nimmt den Weg ins Dorf unter die Füsse. Er geht langsam, aber bestimmt, wie wenn er schon einmal hier gewesen wäre, aber das ist unwahrscheinlich, denn wer einmal hier gewesen und dann gegangen ist, der kommt nicht wieder, und wer nie hier gewesen ist, der kommt gar nicht erst.
Der hier aber scheint in eine dritte Kategorie zu gehören, jetzt pfeift er sogar leise vor sich hin, wie er da Richtung Dorfplatz spaziert, die Ledertasche schwingt ein bisschen vor und zurück, aber das Chäppli sitzt wie angeklebt.
Kurz vor der Kirche bleibt der Mann plötzlich stehen, schaut sich ein bisschen um, aber nicht so wie einer, der den Weg sucht, eher wie einer, der noch eine Minute oder zwei zu früh dran ist und ein wenig Zeit totschlagen will. Schliesslich aber setzt er sich in Bewegung und klingt an der Tür vom Pfarrhaus, die Klingel ist ein bisschen versteckt, weil das Efeu darüber gewuchert ist, aber der Mann hat keine Mühe, er drückt durch das Kraut hindurch, ohne auch nur hinzusehen. Nach einigen Momenten
geht die Tür auf, der Pfarrer Gnädinger steht dort, schaut, zuerst neugierig, dann zögernd.
Ich bins, sagt der Mann, und jetzt sieht man, dass das Chäppli doch nicht angeklebt ist, denn jetzt lüpft er es ein wenig zum Gruss, und dazu lächelt er. Ob er reinkommen dürfe, einen Moment nur. Das ist natürlich eine Lüge, aber sie ist so offensichtlich, dass es doch wieder keine ist. Der Pfarrer Gnädinger schaut den Mann stumm an, in seinen Augen flackert etwas zwischen Überraschung, Angst und Erkennen, er geht ein bisschen zur Seite, der Mann an ihm vorbei und schnurstracks in die Küche, wo der alte kantige Tisch steht, an dem sich so schön sitzen und reden lässt, und der Pfarrer hinter ihm her, und wie er in der Küche ankommt, sitzt der Mann schon, hat sein Chäppli abgelegt, die Ledertasche lehnt an der Wand.
Häsch en Kafi, sagt der Mann und lächelt und faltet die Hände. Der Gnädinger setzt sich an die andere Seite des Tisches, er hat nicht einmal gehört, was der andere gefragt hat, aber er ist nicht erstaunt, als der jetzt plötzlich eine dampfende Tasse voll Kaffee vor sich hat, dampfend und heiss und so schwarz, wie er die Farbe Schwarz noch nie gesehen hat, der Pfarrer, und innerhalb von ein paar Sekunden riecht die ganze Küche nach Kaffee, so satt und schwer und voll, dass es dem Gnädinger fast ein bisschen übel wird. Jetzt trinkt er aus der Tasse, der Mann, schaut sich in der Küche um und lächelt und trinkt und schaut wieder, bis es den Pfarrer Gnädinger verchlöpft.
Was? fragt er. Was willsch?
Der andere schaut ihn an, etwas verwundert.
Reden. Ein bisschen reden. - Er nimmt noch einen Schluck und stellt die Tasse dann ganz bestimmt und schnell und hart auf den Tisch zurück. Und fuulenze. Sagts und lächelt und schaut den Kaffee an, aber diesmal lässt er die Tasse stehen, sie dampft immer noch, und jetzt ist gar keine Luft mehr in der Küche, überall hängt der schwere Kaffeeduft, und dem Pfarrer Gnädinger ists so, als wäre sie schwarz geworden, die Küche, tiefschwarz. Er werde nicht hinhören, sagt er jetzt bestimmt, der Pfarrer, nein, das werde er nicht, er solle gar nicht erst anfangen, es sei sinnlos, ganz sinnlos, und
überhaupt, wieso er zu ihm komme, es gebe doch so viele andere auf der Welt, wieso zu ihm, einem Dorfpfarrer, da gebe es doch solche mit mehr Einfluss, die müssten einen wie ihn doch interessieren, und nicht er, der Gnädinger.
Der Mann nimmt einen tiefen Schluck Kaffee, schluckt ihn laut und schmunzelt ergnügt, und wie er die Tasse wieder hinstellt, sieht der Pfarrer, dass sie immer noch voll ist, oder vielleicht auch wieder voll ist, aber jetzt ist der Kaffee da drin so schwarz, dass er schon fast dunkelrot ist, dunkelrot und dickflüssig, fast wie ein Brei, und dem Gnädinger wirds immer schlechter.
Ja, sagt der Mann jetzt, das stimmt wohl, Einflussreichere gibt es zuhauf, bessere Pfaffen als der Gnädinger einer sei. Aber er habe jetzt eben gerade Lust gehabt, hierher zu kommen, so aus einer Laune heraus, und überhaupt: Ob er, der Gnädinger, denn glaube, wenn er mit seinem Gott rede, dann hätten die anderen Milliarden Menschen erst einmal zu warten, bis sie beide miteinander fertig seien. Das wäre ja dann ein Heidenstress – jetzt lacht der Mann ab seinem Wortspiel und sagts gleich noch einmal: en Heidestress! – wenn der liebe Gott einen nach dem anderen dran nehmen müsste mit seinen guten Sprüchen, neinei, der rede gleichzeitig mit allen seinen Schäfchen, und grad so halte er es auch, sagt der Mann und rührt vergnügt mit dem Finger im dampfenden Kafi herum, er sei hier, bei ihm, beim Gnädinger, das sei schon so, das sehe er ja, aber er sei gleichzeitig auch noch bei ein paar anderen Leuten, er müsse sich nicht ganz so wichtig nehmen, der Pfaff, nur, dass das klar sei.
Der Gnädinger faltet die Hände, aber nicht einmal ein Stossgebet will ihm einfallen, ausgerechnet jetzt, wo der Leibhaftige in seiner Küche sitzt und Kaffee trinkt und plaudert und keine Anstalten macht, sich wieder zu erheben.
Nei, sagt der andere vergnügt und rührt mit dem Finger verträumt im süttig heissen Kaffee.
Was? Der Gnädinger hat den Faden verloren, aber sein Gegenüber lächelt nur nachsichtig, fast schon lieb und gar nicht mehr teuflisch. Er wisse schon, was er gerade gedacht habe, sagt der Mann. Und er habe schon recht damit. Er finde es gemütlich hier, werde nicht pressieren mit seinem Kaffee, ganz und gar nicht, und vielleicht, ja, sehr wahrscheinlich sogar, werde er noch ein ganzes Zeitchen darüber hinaus hier bleiben.
Wie lange? Der Gnädinger fragts tonlos, gepresst.
Sein Gegenüber lächelt immer noch, sein Mund bewegt sich keinen Millimeter, aber das Gesicht um diesen Mund herum beginnt zu vibrieren wie eine Knetmasse, die einer in den Mixer geworfen hat, die Augen rutschen vom Kinn hoch zur Stirn und zu den Ohren, und plötzlich dreht sich das ganze Gesicht rund um den lächelnden Mund, und während dem Gnädinger allmählich schlecht wird und er aufstehen will, weil es ihn würgt, schleudert es dieses Gesicht, die Nase und die Augen und die Ohren und die
Wangen und die Stirn und überhaupt alles herum, als wärs eine Achterbahn, und der Gnädinger hört durch seinen Schwindel und sein Würgen hindurch die Stimme nur bruchstückhaft, aber irgend jemand, vielleicht ist es ja sein lieber Gott, der für eine Sekunde in diesen Raum zurückgefunden hat, setzt die Bruchstücke im Kopf des Pfarrers wieder zusammen, so dass stossweise zusammenkommt, was der Teufel gesagt hat.
Für immer, Pfaff. Für immer. Ich bleibe hier. Gnueg tue. Gnueg gschaffet. Jetzt wird ausgeruht. Das Haus ist gross genug. Ich bleibe. Für immer.
Dem Gnädinger wirds schwarz vor Augen, wie er auf den Plättli des Küchenbodens zusammensinkt, und das letzte, was er zu sehen glaubt, bevor es Nacht wird um ihn, ist ein riesiger Trog voll Weihwasser, glänzend und sauber und rein und seligmachend, und plötzlich verdunkelt sich das Weihwasser, richtige Fetzen Dreck schwimmen drin, alles wird braun und gruusig und es stinkt zum Gottserbarmen, und der ganze Trog ist plötzlich voller Gülle, und der Gnädinger will ein letztes Mal hineingreifen, bevor alles
Weihwasser zur Gülle wird, aber seine Hand kommt zu spät und greift in den warmen Kuhmist.
Der andere am Tisch lacht, dass die Kaffeetasse hüpft, aber dann hilft er dem Gnädinger auf die Beine, und der staunt, dass seine Hand ganz sauber geblieben ist, dass er wieder atmen kann, dass die Kaffeetasse auf dem Tisch jetzt doch leer ist. Für einen Moment glaubt er, das alles nur geträumt zu haben, er glaubt, der Mann hier in seiner Küche sei vielleicht doch nur ein armes, verirrtes Schaf seiner Gemeinde, auf der Suche nach Zuspruch und Trost, und wenn er, der Pfarrer, ihm das gegeben hat,
dann werde er gehen, durch die Tür, durch die er gekommen ist. Er glaubt es einige Sekunden lang, und es sind Sekunden, die gut tun, bis der andere wieder spricht.
Er brauche nicht viel Luxus, er werde die kleine Dachkammer nehmen, wenn er nur eine Matratze haben dürfe. Er wolle jetzt erst einmal schlafen, nur schlafen, eine Woche oder auch zwei. Er, der Pfarrer, solle sich nicht um ihn kümmern und ganz so tun, als wenn er hier zuhause wäre. Und der Teufel giggelet über seinen eigenen kleinen Witz und geht aus der Küche auf die Treppe zu.
Jeden Dienstag um fünf Uhr abends kommt der Gemeinderat Rättigen im kleinen Säli des «Ochsen» zu seiner Sitzung zusammen. Früher, als hier oben die Wirtschaft noch blühte und der Zug nicht nur hielt, damit er gehalten hat, sondern auch Leute ein- und ausstiegen, musste der Gemeinderat noch zwei Mal pro Woche sitzen. Jetzt gibts kaum mehr genug Geschäfte, um diese eine Sitzung in der Woche zu rechtfertigen. Aber wenn der Gemeindeschreiber Haslinger diesen leisen Einwand gelegentlich
aufzubringen wagt, schleudert ihm der Gemeindepräsident Bannwart ein wuchtiges «Gwählt isch gwählt» entgegen, dass es von den Wänden zurückschallt. Das Volk habe die fünf Gemeinderatsmitglieder in Amt und Würde gesetzt, auf dass verwaltet und regiert werde. Und er, der Bannwart, werde verwalten und regieren, bis man ihn zum «Ochsen» hinaus tragen müsse, ganz egal, ob es noch etwas zu tun gebe oder nicht.
Aber heute, und der Bannwart scheint um mehrere Kopflängen zu wachsen, gibt es ja etwas zu tun. Auf der Traktandenliste steht eine Anhörung. Der Jost Baumberger, Pfleger im Altenheim, hat den Haslinger gestern angerufen und gebeten, man solle ihn vor dem Gemeinderat sprechen lassen. Wahnsinnig geheimnisvoll habe er getan, erzählt der Haslinger jetzt den Gemeinderäten, während der Baumberger in der Gaststube sitzt und auf seinen Auftritt wartet.
Jo guet, sagt der Bannwart und reibt sich die Nase, wie immer, wenn er nachdenkt. Der Baumberger werde schon seine Gründe haben, wenn er beim Gemeinderat vorsprechen wolle, so einen schwerwiegenden Schritt unternehme keiner einfach so. Aber Ordnung müsse sein, und das Gemeindereglement, der Haslinger habe das die ganze Nacht hindurch sorgsam studiert und ihm, den Bannwart, Bericht erstattet, kenne da ein genaues Prozedere. Der Gemeinderat müsse zuerst abstimmen, ob man den Baumberger überhaupt vorlassen solle. Und deshalb solle jetzt jeder de Arm lupfe, der dafür sei.
Der Bättig, der Senn und der Reimann haben die Hände schon in der Luft, bevor der Gemeindepräsident ausgeredet hat. Die drei Gemeinderäte platzen fast vor Neugier darüber, was der Baumberger zu erzählen hat. Der Gemeindepräsident selber stimmt auch dafür, nur der Wiesmann lässt seinen Arm unten. Eigentlich butzt es ihn auch fast vor Gwunder, aber der Wiesmann stimmt aus Prinzip bei jedem Geschäft anders als seine Kollegen im Rat. Bei den letzten Wahlen war er für die Radikale Opposition Rättigen ins Rennen gegangen, einen Verein, den drei besoffene Guggenmusikanten am Schmutzige Donnschtig gegründet hatten. Wiesmann war einer von ihnen gewesen, und er hatte den Scherz auch noch mitgemacht, als er wieder nüchtern war, weil die Gefahr, er könnte gewählt werden, verschwindend klein war. Dann aber hat sich am Wahltag dem Haslinger sein Sohn beim Stimmenzählen grausam vertue, und der Wiesmann wurde als gewählt ausgerufen. Zwar hatte der Haslinger den Fehler bald darauf gefunden, aber weil sein Sohn noch minderjährig und gar kein gewählter Stimmenzähler war, hat er schön den Mund gehalten, und jetzt sitzt der Wiesmann seit drei Jahren im Rat, sagt kein Wort, versteht kein Wort und stimmt immer gegen die anderen im Rat, weil das im Suff damals so abgemacht gewesen ist.
Aber der Haslinger kann den Rat beruhigen. Im Reglement stehe nichts davon, dass der Entscheid einstimmig sein müsse. Also wird der Baumberger geholt und sitzt wenig später nervös und verschwitzt vor den gespannten Gemeinderäten.
Also, beginnt der Bannwart und rollt dramatisch mit den Augen, der Gemeinderat habe in offener Abstimmung mit vier Stimmen zu einer Gegenstimme beschlossen, dass man ihn, den Baumberger, anhören wolle. Er möge also sagen, was es zu sagen gebe, möglichst schnell, es habe noch einen ganzen Haufen anderer Traktanden, und danach werde der Gemeinderat über das Anliegen befinden.
Der Baumberger nickt, zögert aber noch einen Moment lang. Alles habe damit angefangen, sagt er schliesslich und rutscht unruhig auf seinem Stuhl herum, dass die Bertschinger einfach nicht gestorben sei.
Wer die Bertschinger sei, will der Reimann wissen, und der Bättig und der Senn nicken heftig. Der Baumberger erklärt es ihnen, sagt auch, dass er immer wisse, wenn bei einem Pflegefall das Stündlein schlage und dass es nicht mit rechten Dingen zu- und hergehen könne, wenn die Bertschinger immer noch lebe.
Der Bannwart grummelt unwillig. Er, der Baumberger, werde doch wohl nicht ernsthaft hier vorsprechen, weil eine alte Frau ausserplanmässig noch am Leben sei. Wenn er das vorhabe, so sei das eine Anmassung gegenüber gewählten Amtspersonen, und er, der Gemeindepräsident, werde so etwas in den heiligen Hallen des «Ochsen» nicht dulden.
Der Baumberger hätte jetzt gerne zum Fläschli Schnaps gegriffen, das er in der Jackentasche versenkt hat, aber er besinnt sich eines Besseren, greift in die andere Tasche und holt ein paar zerfledderte Papiere heraus, die er vor den Gemeinderäten auf dem Tisch ausbreitet. Ob sie wüssten, was das sei, fragt der Baumberger.
Scho no sicher, sagt der Haslinger und schüttelt unwillig den Kopf. Er werde ja wohl das Gmeindsblättli kennen, er sei ja der verantwortliche Redaktor. Das hier sei die neueste Ausgabe, die erst gestern in alle Haushaltungen verschickt wurde. Das hätte er nicht mitzunehmen brauchen, lacht der Haslinger, davon habe er noch ein paar Dutzend im Büro.
Der Baumberger nestelt zwischen den Papieren herum, bis er die letzte Seite des Gmeindsblättli gefunden hat. Da steht, wann der Pfarrer Gnädinger seine Sonntagspredigt und den abendlichen Rosenkranz hält, wer in der Gemeinde heiratet und ob wieder ein kleiner Wurm zur Welt gekommen ist. Da, sagt der Baumberger und deutet auf die Zivilstandsnachrichten. Da seht ihrs.
Der Bannwart, der Senn, der Reimann, der Bättig, der Wiesmann und der Haslinger, sie alle beugen sich vor und starren auf das Blatt, und aus dieser Distanz ist dem Baumberger seine Fahne sehr deutlich zu riechen. Alle schauen sie und versuchen, von irgendwoher frische Luft zu erhaschen, bis es dem Senn zu dumm wird. Was? fragt er. Was isch? Das seien die Nachrichten von Trauungen und Geburten und Todesfällen, wie sie alle zwei Wochen im Gmeindsblättli stehen.
Der Baumberger lächelt triumphierend und greift ganz automatisch zum Schnapsfläschli, nimmt einen tiefen Schluck, bevor er sagt: Ebe nöd. Geheiratet worden sei in den letzten 14 Tagen, stimmt, und so ein Würmlein sei auch auf die Welt gekommen, der Gebi Brunner und seine Anita hätten es endlich geschafft, wobei es ja eine Frühgeburt gewesen sei, aber das Kind werde durchkommen, sagt die Frau Löpfe von der Bäckerei, und die muss es wissen, ihre Schwägerin arbeitet im Spital. Aber, und der Baumberger stösst ein bisschen auf, so dass die Luft noch etwas alkoholhaltiger wird im «Ochsen»-Saal, aber gestorben sei in den letzten zwei Wochen niemand. Und auch nicht in den zwei Wochen davor. Und in den 14 Tagen vor jenen zwei Wochen. Und in den zwei Wochen vor diesen 14 Tagen. Seit gut und gern sechs Monaten sei in Rättigen keiner mehr unter den Boden gekommen. Kein Mensch. Die Herren Gemeinderäte könnten das gerne nachprüfen, bitte, das sei schnell kontrolliert. Und das, wo sie doch so viele alte Leute in Rättigen hätten, wo doch der Sargbauer bisher das einzige einträgliche Geschäft gemacht habe, wo doch hier das ganze Jahr über so fleissig gestorben werde. Und das erkläre auch, warum die alte Bertschinger jetzt gerade einen Jass klopfe, statt auf einer Wolke die Harfe zu zupfen. Es werde nicht mehr gestorben in Rättigen, schliesst der Baumberger und lässt das Schnapsfläschli wieder in die Tasche gleiten. No öppis, fällt ihm ein, für Viecher gelte das scheints auch, der fette Kater von der Witwe Zuber sei vom Zug überfahren worden und spaziere jetzt noch immer gefrässig durchs Dorf. Erzähle wenigstens die Witwe Zuber.
Huere Seich, entfährt es dem Reimann als erstem. Er, der nur an das glaubt, was er hört, fühlt, sieht oder wenigstens essen kann, nimmt dem Baumberger kein Wort ab. Man rieche ja den Williams bis über die Tischplatte, lacht der Reimann und gibt dem Bättig neben ihm einen Rippenstoss. Er solle doch auch sagen, was er von diesem Seich halte. Der Bättig ist ein Langsamer, und bevor er zu seiner kleinen Rede ansetzen kann, feuert schon der Senn los. Ob er, der Baumberger eigentlich wisse, welche Verantwortung der Gemeinderat hier zu tragen habe. Da gelte es, Baugesuche zu beurteilen, nur ein Beispiel, das sei hohe Politik, da könne man nicht jedem Galöri, der die Hausbar zusammengesoffen habe, wertvolle Zeit schenken. Der Senn haut seine mächtige Pranke über die Tischkante, wie ers immer macht, wenn er ausgeredet hat, und nickt dem Bättig zu, dass die Reihe jetzt an ihm sei.
Aber da fällt der Gemeindeschreiber Haslinger der Runde ins Wort. Es sei ja schon recht, wenn man da etwas fröhlich palavere, aber am Schluss müsse alles seine Ordnung haben, er habe nicht für nichts und wieder nichts die ganze Nacht das Gemeindereglement gewälzt. Man habe den Baumberger vorgelassen, also müsse man das jetzt vorschriftsmässig erledigen. Er schlage drum vor, dass man hier einen ordentlichen Antrag formuliere. Man solle abstimmen, ob die Geschichte vom Baumberger, wonach angeblich seit etwa sechs Monaten keiner mehr das Zeitliche segne in Rättigen, ob also diese Geschichte vom Gemeinderat untersucht werden solle oder ob man das Ganze einfach fallen lasse wie einen heissen Herdöpfel und den Baumberger zurück zum Schnaps schicke. Der Reimann und der Senn hätten ja wohl schon deutlich gemacht, wie es bei ihnen aussehe, das seien also zwei Stimmen gegen eine Untersuchung durch den Gemeinderat. Und jetzt sei die Reihe am Wiesmann. Aber zuerst müsse der Baumberger den Raum verlassen. Eine Abstimmung im Gemeinderat sei eine Art heilige Handlung, da könne niemand dabei sein, der nicht vom Volk gewählt werde. Und ausserdem sei der Williamsgeruch wirklich kaum mehr auszuhalten.
Der Baumberger steht auf und verschwindet in den Gang hinaus. Die Tür geht hinter ihm zu, und der versammelte Gemeinderat schaut zum Wiesmann, der als nächster seine Stimme abgeben soll. Degägä, sagt der Wiesmann kurz und bündig und malt ein bisschen weiter auf dem Notizpapier, wo sich Blumen und Figürli aneinander reihen, haufenweise, denn man sitzt ja schon ein Weilchen. Gägä was? fragt der Haslinger. Ein bisschen genauer müsse er schon sein. Aber gut, er könne sich schon vorstellen, was er meine, der Wiesmann, er sei einfach wieder einmal gegen das, was die vor ihm gesagt hätten, schon klar. Dann stehe es jetzt nach Stimmen zwei zu eins, und der Bättig könne die ganze Sache klar machen, er habe es in der Hand, rein rechnerisch.
Aber für den Bättig ist das gar nicht so einfach. Er findet ja auch, dass der Baumberger stinkt wie der Saal des «Ochsen» nach einer Austrinkete, und spinnen tut er offenbar auch, der Baumberger, denn dass hier in Rättigen nicht einfach mit dem Sterben aufgehört worden ist, das ist ja wohl klar. Aber dem Bättig seine alte Mutter liegt im Alois-Heim, und der Baumberger schaut der alten Frau gut und steckt ihr auch hin und wieder eine Süssigkeit zu. Der Bättig will dem Pfleger also nicht an den Karren fahren, und deshalb erklärt er lang und breit, dass die Sache natürlich schon etwas seltsam töne und er sich das auch nicht so richtig vorstellen könne, denn wenn man sich auf etwas verlassen könne auf dieser Welt, dann seien das ja bekanntlich die Steuern und das Sterben, und es scheine ihm schon mehr als gspässig, dass mit dem einen plötzlich aufgehört werde und mit dem anderen nicht, aber andererseits gebe es doch noch mehr zwischen Himmel und Erde, als man meine, und er könne jetzt hier nicht einfach ausschliessen, dass der Baumberger da vielleicht wirklich auf etwas gestossen sei, und deshalb werde er jetzt halt ausnahmsweise einmal gegen seine Parteikollegen stimmen, im Herzen tue es ihm weh, aber eben, manchmal müsse man seiner inneren Stimme folgen, und schliesslich sage der Volksmund doch auch, dass im Wein die Wahrheit liege, und so gesehen müsse der Bannwart also schon auch ein bisschen die Wahrheit sagen, so wie der nach Alkohol stinke, auch wenn es wohl kein Wein gewesen sei, aber das tue ja nichts zur Sache.
Nach dieser kleinen Rede ist es eine ganze Weile still im Ochsen-Säli. Der Wiesmann zeichnet jedem Figürli noch eine Zigarette in den Mund hinein, weil es ihn schampar gluschtet nach einem Stengel, der Reimann und der Senn sitzen mit offenen Mäulern da und starren den Bättig einfach an. Der Haslinger rechnet es zum x-ten Mal durch und kommt zum Schluss, dass es nach Stimmen zwei gegen zwei stehe und dass einer noch fehlt, aber bevor er etwas sagen kann, hat der Bannwart schon angefangen.
Die Entscheidung liege also bei ihm, und das sei schon recht so, fängt der Gemeindepräsident an und reibt sich die Nase, denn er stehe ja Rättigen vor, und wenn einer den Mut zu Entscheidungen haben müsse, dann ja wohl er. Und er scheue sich auch nicht, ein klares Wort zu sprechen, und dieses könne eigentlich nur darin bestehen, dass er den Baumberger zum Ausnüchtern ins Gemeindearchiv bringen lasse und dafür sorge, dass man den ganzen Seich einfach vergesse. Aber, sagt der Bannwart nach einer Kunstpause, als der Haslinger schon das Resultat der Abstimmung fein säuberlich eintragen will, aber auf der anderen Seite dürfe man es sich in so einer verantwortungsvollen Position wie der des Gemeindepräsidenten natürlich auch nicht zu einfach machen. Manchmal müsse man das scheinbar Widersinnige wagen, und sei es nur, um dem einfachen Volk zu zeigen, dass man es und seine Probleme ernst nehme, umso mehr, als im nächsten Jahr dann wieder gewählt werde, und ein schöner
Teil der Stimmen komme da ja immer von den Alten, und von denen sitzen die meisten im Alois-Heim, wo ja bekanntlich der Baumberger schlussendlich dafür zuständig sei, wer von den alten Leuten den Stimmzettel dann auch wirklich weitergeleitet bekomme.
Der Senn und der Reimann reissen wie auf Kommando ihre Köpfe hoch und starren den Bannwart an, nur der Wiesmann, der auf seine Wiederwahl pfeift, malt weiter. Er gedenke, sagt der Senn schliesslich, allenfalls seine Stimme noch einmal zu ändern. Der Punkt mit dem Volk und dass man dieses ernst nehmen müsse, der habe ihn überzeugt. Momoll, schliesst sich der Reimann an, das sei schon ein handfestes Argument, und der Bättig, froh darüber, dass er jetzt nicht mehr allein mit dem
Wiesmann auf einer Seite steht, der nickt, dass ihm der Grind fast auf der Tischplatte aufschlägt.
Degägä, sagt der Wiesmann jetzt kurz und sucht den Spitzer in seiner Schreibmappe, weil er jetzt doch tatsächlich den Bleistift stumpfgezeichnet hat. Gege was, fragt der Haslinger, aber eigentlich ist es ja klar, und so wartet er die Antwort gar nicht erst ab. Vier zu eins, rechnet der Gemeindeschreiber laut vor, bevor er aufsteht, um dem Baumberger das Ergebnis mitzuteilen und dann so schnell als möglich ordentlich zu lüften.
S‘git z‘tue, sagt der Bannwart und schaut verträumt durch das Fenster auf den Rättiger Dorfplatz gleich vor der Beiz.
Zu tun gabs in Rättigen lange genug nichts mehr. Das Dorf liegt in der Mitte. In der Mitte zwischen zwei Hügeln. In der Mitte zwischen zwei Tälern. In der Mitte zwischen einem See und einer Stadt. Rättigen liegt nicht auf dem Hügel noch im Tal noch am See noch bei der Stadt. Rättigen liegt in der Mitte, in der Mitte von allem, und damit liegt es nirgends so richtig.
Weil nur wenig Menschen in diesem Nirgends leben wollen, ist im Lauf der Zeit so mancher weggezogen. Geblieben ist, wer einen Hof hat oder ein kleines Gewerbe, geblieben ist, wer nichts anderes kennt oder wer Angst vor allem anderen hat. Geblieben ist, wer einen Ort gesucht hat, der im Nirgends liegt.
Einmal sollte ein Strich durch dieses Nirgends gezogen werden. Ein breiter, langer Strich. Eine Autostrasse, eine Verbindung zwischen Stadt und See, sollte gradwegs durch Rättigen hindurch geführt werden. Politiker und Verwaltungsleute sind ins Dorf gekommen, gefolgt von Ingenieuren, Pläne hat man entworfen, Vorträge gehalten. Der damalige Regierungspräsident des Kantons, ein gewisser Moser, ist an einem Abend höchstpersönlich in den Saal des «Adler» gekommen und hat den Rättigern gezeigt, was da entstehen sollte. Und als einer aus dem Volk gefragt hat, warum denn die Autostrasse genau durch Rättigen führen müsse, da hat der Moser ihn ein bisschen verwundert angeschaut, etwas nachgedacht und dann gesagt, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten eine Gerade sei. Das lerne doch jeder in der Schule. Und Rättigen liege nun einmal halt auf dieser Geraden zwischen Stadt und See. Die Leute in der Stadt wollen im Sommer schnell am See sein, und die Leute vom See
wollen im Winter schnell in der Stadt sein. Und wenn man da keine direkte Gerade mache, sondern einen Haufen Kurven und Schlangenlinien, dann dauere die Fahrt länger, übrigens auch die Bauarbeiten für die Strasse, das leuchte doch ein, eine Gerade sei am einfachsten zu bewerkstelligen.
Sonst sind damals keine Fragen aus dem Publikum gekommen, und die Rättiger haben auch nicht gross aufgemuckt gegen die Autostrasse. Immerhin hat der Moser an jenem Abend auch versprochen, es werde eine Ein- und Ausfahrt von und zu Rättigen geben, so dass auch die Rättiger schneller am See und in der Stadt seien.
Ein paar Tage später aber ist der damalige Gemeindepräsident, der Stierli Walter, der Vorgänger vom Bannwart, aus den Ferien zurückgekommen. Und der Stierli ist zwar auch zur Schule gegangen, aber er hat gar keine Freude gehabt an der Geraden zwischen zwei Punkten. Eine Autostrasse durch Rättigen werde es nicht geben, solange er lebe, hat der Stierli damals ausgerufen und seine Gemeinderatskollegen heruntergeputzt, weil die einfach untätig herumgesessen seien, während er weg
gewesen ist. Und weil der Stierli Walter den Regierungspräsidenten persönlich gekannt und gewusst hat, dass dessen Tochter die Matura nur darum bestanden hat, weil sie einen ihrer Lehrer gerne zwischen die Beine gelassen hat, ist dann mirakulöserweise eines Tages in der Zeitung gestanden, dass die Regierung des Kantons einen neuen Vorschlag für die Autostrasse habe, die nun plötzlich in einem schönen runden Bogen um Rättigen herum führen solle. So hat der Gemeindepräsident Stierli das Dorf
Rättigen vor der Autostrasse bewahrt, gut 20 Jahre ist das jetzt her, aber im Stillen fragt sich heute noch so manch einer, ob das so gescheit war. Gut, den Verkehr, den Lärm und den Gestank, den hat man nicht, den haben die anderen. Aber es fährt eben auch niemand durch Rättigen durch, niemand jedenfalls, der nicht aus unerfindlichen Gründen dorthin muss. Am Morgen rollt eine Blechlawine um Rättigen herum vom See in die Stadt, wo die meisten Leute eine Arbeit gefunden haben, an schönen Tagen fahren Völkermassen an Rättigen vorbei Richtung See, und am Abend braust das arbeitende Volk aus der Stadt wieder zum Wasser, aber natürlich ohne einen Halt in Rättigen, denn da kommt ja gar niemand vorbei. Im Dorfladen, an der kleinen Tankstelle bei der Autogarage vom Küffer, beim Bäcker und beim Metzger, im Bluemelädeli Köppel, überall fragt man sich von Zeit zu Zeit, ob die Kasse nicht besser klingeln würde, wenn der Stierli damals nicht das Dorf vor der Autostrasse bewahrt hätte.
So haben die Rättiger heute keine Autostrasse, aber eine Menge kleiner Strassen. Links und rechts von dem, was die Rättiger Hauptstrasse genannt haben, führen noch kleinere Strassen in die paar Siedlungen und Quartiere. In der Mitte zwischen Strassen und Strässlein und Quartieren und Wiesen und Feldern liegt der Dorfplatz mit der Kirche, der Schule und dem Gemeindehaus. Der Dorfplatz ist schmucklos, ein paar Bäume hats und einen kleinen Brunnen, und ein paar Parkfelder sind eingezeichnet, auch wenn jeder Rättiger sein Auto kreuz und quer parkiert, weil es eigentlich nichts und niemandem im Weg sein kann. Und dann steht da noch eine Laterne, mitten auf dem Dorfplatz, eine alte Laterne, von der keiner weiss, wie sie dorthin gekommen ist und was sie hier soll, in der Nacht wandert keiner über den Dorfplatz von Rättigen, da schlafen sie alle, weil sie viel arbeiten, die Rättiger, und wenn sie spazieren, dann tun sie das am Sonntag nach der Kirche. Aber die Laterne steht nun einmal da, und weil sie nun einmal da steht, lässt der Gemeindepräsident Bannwart die Laterne auch leuchten, die ganze Nacht durch, als Symbol der Erleuchtung gewissermassen, hat der Bannwart
einmal an einer Gemeindeversammlung auf eine entsprechende Frage gesagt, aber die Wahrheit ist, dass der Gemeindepräsident einmal sturzbesoffen aus dem Adler gekommen und in die Kirchenfassade gelaufen ist. Mit ein bisschen mehr Licht hätte er sich nicht die Nase blutig geschlagen und mühsam nach Ausreden suchen müssen zuhause, hat sich der Bannwart damals gesagt und die alte Laterne wieder in Stand stellen lassen. Jetzt brennt sie also die ganze Nacht durch, der einzige helle Fleck in
Rättigen in dunklen Nächten. Wer vom Hügel herunter aufs Dorf schaut, der sieht nur eine tiefschwarze Brühe und mittendrin einen kleinen, gelben, leicht flackernden Punkt. Ein bisschen so wie das Ewige Licht in der Kirche. Aber es schaut eigentlich eher selten einer auf Rättigen hinab, nicht einmal die Rättiger selbst tun das, die wohnen und leben und arbeiten und wollen in Ruhe gelassen werden, denn was war, das war, was ist, das ist, und dazwischen gibt es nichts.
Nur einer war da anderer Meinung. Seit gut fünfzehn Jahren liegt der Dorfschullehrer Paul Abderhalden unter dem Boden, und das ist gut so, sagen die Leute, denn er ist aufs Alter hin ein bisschen komisch geworden, die Pensionierung hat ihm nicht gut getan, mutmasst man, vielleicht auch der Tod seiner Frau und der beiden Söhne. Er hat Schule gegeben bis zum letzten Tag, der Abderhalden, dann ist er in die Stadt gefahren und mit einem Haufen grosser und kleiner Päckli wieder aufgetaucht, hat sich in
seinem Häuschen eingeschlossen und ist nicht mehr gesehen worden. Die Tochter vom Nachbarn Tischhauser ist einmal in der Woche für den Lehrer Abderhalden einkaufen gegangen, hat das bereitgelegte Geld unter der Matte vor der Haustür geholt und den vollen Korb danach vor die Tür gestellt. Einmal, erzählte das Mädchen später jedem, der sich ein bisschen gruseln wollte, habe sie nach ihrer Lieferung noch ein paar Minuten gewartet und gesehen, wie sich die Tür ein bisschen geöffnet hat und der Korb ins Haus gezerrt wurde. Aber das war das einzige, was jemals vom Lehrer
Abderhalden gesichtet wurde, bis ein paar Jahre später der Korb plötzlich tagelang vor der Tür stehen geblieben ist, die Tochter vom Tischhauser dem Gemeindepräsident Bescheid gesagt und ein paar Männer von der Feuerwehr die Tür aufgebrochen haben.
Da ist er dann tot in seinem Studierzimmer gelegen, der Abderhalden, den Kopf auf seiner Schreibmaschine und daneben ein dicker Stapel dicht beschriebener Seiten, 1500 exakt, wie der damalige Gemeindeschreiber, ein genauer Mann, später zählte. Der Abderhalden, allein und ohne Aufgabe, hatte die Rättiger Dorfchronik geschrieben, ohne dass ihn einer darum gebeten hätte. Der Gemeindeschreiber hat die Seiten mehr schlecht als recht binden lassen und das Werk im Gemeindearchiv deponiert
Wenn später ein Neuzuzüger gefragt hat, ob die Geschichte des Dorfes niedergeschrieben sei, dann hat man ihm den dicken Wälzer ins Sitzungszimmer gebracht. Aber keiner hat lange darin geblättert, denn der Abderhalden ist kein talentierter Schreiber gewesen, er hat seinen Schülern wohl gezeigt, wo das Komma hingehört, aber mehr auch wieder nicht, und so ist die Chronik vielleicht umfassend, aber keine schöne Lektüre, und es hätte sich einer schon sehr für Rättigen interessieren müssen, um sich durch die 1500 Seiten durchzulesen.
Nur einer hat es getan, seit der Abderhalden verblichen ist. Der Fiechter Toni, das Faktotum der Gemeinde, der im Winter Salz streut und im Sommer die Wiese hinter dem Gemeindehaus zurecht stutzt, der hat sich in der Chronik verloren, als er im Archiv hätte abstauben sollen. Den ganzen Tag und die ganze Nacht hat er durchgelesen, der Fiechter, und dann am nächsten Tag wieder und auch am Tag danach, ausgerechnet der Fiechter, einer, der seinen ganzen Lebtag noch kein Buch hinter sich gebracht hatte, eine volle Woche lang hat er gelesen, und wie er fertig war, hat er sich gefragt, ob der Abderhalden nicht vielleicht schon vor seiner Pensionierung mit der Chronik begonnen hat und darüber wahnsinnig geworden ist. Denn es war, fand der Fiechter, eine Lektüre zum Wahnsinnigwerden. Aber er hat damals keinem davon erzählt, denn mit dem Abstauben im Archiv hat es vor lauter Lesen natürlich nicht mehr gereicht, und der Gemeindepräsident hätte keine Freude gehabt, wenn der
Fiechter in der Beiz ein paar Anekdoten aus der Chronik vom Abderhalden zum Besten gegeben hätte, weil dann schnell klar geworden wäre, dass der Fiechter nicht das gemacht hatte, wofür er bezahlt wird.
Aber der Fiechter hat sowieso nicht vor, jemals einer Sterbensseele aus der Dorfchronik zu erzählen. Vergessen will er, vergessen, was er gelesen hat, und vergessen kann er es bestimmt nicht, wenn er mit den Geschichten vom Abderhalden hausieren geht. Es sind Geschichten, da ist sich der Fiechter sicher, erfundene Geschichten, richtig passiert ist das alles nicht, und überhaupt, eine Dorfchronik ist das ja wohl nicht, was der Lehrer hinterlassen hat, es sind doch nur Geschichten, aneinander gereiht wie Perlen an einer Schnur, oder doch nicht, Perlenketten sind schön, der Fiechter hat einmal eine gesehen, die sein Nachbar von den Ferien in Bali mitgebracht hat. Dem Abderhalden seine Geschichten sind nicht schön, es sind Geschichten rund ums Sterben, nein, nicht Sterben, Verrecken ist das richtige Wort, da wird verreckt eins ums andere in diesen Geschichten, und der Fiechter will nicht glauben, dass sie nicht normal gestorben sind in Rättigen über all diese Jahrhunderte. Dass kaum einer einfach eingeschlafen ist und nicht mehr aufgewacht, oder wenigstens bei der Arbeit einen Herzkasper gehabt hat oder sonst etwas, das schnell geht. Stattdessen sind sie verreckt, die Figuren, die der Abderhalden auf seiner Schreibmaschine erfunden hat, verblutet oder dahin gesiecht unter Qualen, verreckt halt einfach, buchstäblich verreckt. Und der Fiechter schläft schlecht, seit er die Chronik gelesen hat. Früher hat er nie geträumt. Gut, der altkluge Sohn von seinem Bruder sagt, dass jeder träumt, aber manche erinnern sich einfach nicht daran. Von mir aus, dann träume ich eben, sagt sich der Fiechter, aber erinnert habe ich mich früher nie daran. Aber jetzt ist alles anders, jetzt ist sein Kopf randvoll mit Träumen, wenn er aufwacht, randvoll mit Geschichten rund ums Verrecken.
Wenigstens, denkt sich der Fiechter, wird es anderen nicht ebenso ergehen. Ein paar Tage, nachdem der Gemeindearbeiter seine Nase zu weit in das Vermächtnis vom Lehrer Abderhalden gesteckt hat, ist ein Geschichtsprofessor aus der Stadt nach Rättigen gekommen und hat sich mit der Chronik ins Sitzungszimmer verzogen, weil er irgendwelche Studien machen wollte, und dort ist er prompt eingeschlafen, der Gelehrte, noch bevor er einen Blick ins Buch geworfen hat, eingeschlafen mit einem
dicken Stumpen im Mund, der Kopf ist ihm auf die Tischplatte gesunken und der Stumpen auf die Chronik gefallen, dem Abderhalden sein billiges Papier hat Feuer gefangen wiä nüt, und die Chronik ist Asche gewesen, bevor der Professor aufgewacht ist. Die Wimpern hat es ihm ein bisschen angesengt, dem Mann aus der Stadt, sonst ist er ganz geblieben. Da ist es vorbei gewesen mit der Dorfchronik über Rättigen aus der Feder vom Lehrer Abderhalden. Nur noch im Kopf von Fiechter sind die Geschichten, von denen er hofft, dass sie erfunden sind, nur noch in seinem Kopf, und sie lassen sich einfach nicht herausprügeln. Wenn er sie nur, nur nie einem erzählen muss.
Jetzt ist der Leo 35, kann sich so viele Steinschleudern und Floberts und Luftgewehre kaufen, wie er will, weil er von seinen Eltern anständig geerbt hat, hat sich stattdessen ein regelrechtes Arsenal richtiger Gewehre und Pistolen zugelegt, und inzwischen haben sie dank diesen Ökofundis und Tierschützern für jedes einzelne Viech in der Gemeinde ein eigenes Gesetz, so dass jeder, der auf etwas schiessen will, zuerst einen Papierkrieg ausfechten muss, und der Leo Feller sagt immer, er könne zwar gut schiessen, aber schlecht schreiben, also lässt er es. Stattdessen reist er einmal im Jahr
mit dem ererbten Geld nach Afrika und kommt ein paar Wochen später mit einigen Trophäen zurück, mit Löwenköpfen, Tigertatzen oder einem Gepardfell. Im Dorf ist der Feller für alle deshalb nur der «Grosswildjäger», und der Leo will längst nichts mehr mit Mäusen und Raben zu tun haben, selbst wenn der Papierkrieg nicht wäre, denn so ein Antilopengeweih über dem Stubentisch macht schon mehr her als ein toter Rabe unter einem Baum.
Geschossen hat der Leo Feller allerdings weder eine Antilope noch einen Tiger noch einen Löwen noch jemals einen Gepard, weil ihm die Viecher samt und sonders zu schnell sind. Genau genommen hat er als Jäger nie ein besonderes Gesellenstück abgeliefert. Die Mäuse sind damals von allein in die Falle spaziert, die Raben haben meistens schön still gehalten, weil sie vorher vom Beet des Sohns vom Bauern Frehner den Hanf weggefressen hatten und ein bisschen weggetreten waren, und der streunende Hund vom Gemeinderat Räber ist kurz vorher in eine Heugabel gelaufen und hat ordentlich gelahmt, als ihn der Leo auf Kimme und Korn genommen hat.
Das Schiessen hat er auf dem Jahrmarkt gelernt, und die Büchsen und die kleinen Schiessscheiben und die Plastikrosen in den Schiessbuden, die haben sich eben nie bewegt, und so schiesst er auch heute noch leidlich auf alles, was stillsteht, der Leo Feller, aber wehe, dieses Etwas macht einen unvermuteten Schritt, dann pfeift die Kugel sonstwohin. Davon ahnt im Dorf niemand etwas, und deshalb kauft sich der Feller bei jedem Afrikabesuch eine neue Trophäe und schleppt sie bei seiner Rückkehr quer durchs Dorf und nagelt sie zuhause an eine Wand, und keiner kommt auf die Idee, dass er das Tier nicht selbst geschossen haben könnte. Verschwätze kann sich der Feller auch kaum, weil er mit denen im Dorf wenig zu tun hat und nur selten das Haus verlässt.
Heute aber kommen sie zu ihm nach Hause, und da kann er schlecht ausweichen. Plötzlich klopfts, der Feller legt den Staubwedel zur Seite, mit dem er der Antilope eine Spinnwebe vom Schädel geputzt hat, und geht zur Tür. Draussen stehen der Gemeindepräsident und sein Gemeindeschreiber und schauen ihn beschwörend an, man wolle nur einen Moment hereinkommen, es gebe etwas zu besprechen, aber das wolle man lieber nicht hier draussen tun. Der Feller wundert sich, die Steuern bezahlt er immer pünktlich, und es sind nicht wenig, weil er ordentlich geerbt hat, und sonst hat er nichts zu tun mit der Gemeinde. Den Bannwart und den Haslinger kennt er nur, weil der Feller einmal im Jahr einen Diaabend im «Ochsen» veranstaltet und Bilder von seinen Jagdsafaris zeigt, auf denen er zuerst mit verschiedenen Gewehren und danach mit erlegten Tieren posiert, die ein Einheimischer geschossen hat, aber das sagt der Feller natürlich keinem, und an diesen Diaabenden lassen sich von der Gemeinde auch immer ein paar blicken, weil der Feller dann auch immer die Getränke spendiert.
Man setzt sich in die Stube, der Feller in seinen Lieblingssessel unter einem Giraffenschädel, der Bannwart unter das Löwenhaupt und der Haslinger in den Stuhl, an dessen Armlehnen zum Ende je eine grosse Bärentatze prangt, und der Feller fragt sich wie bei jedem Besuch, den er erhält, ängstlich, ob diesmal wohl die Frage kommen wird, wo um Gottes Willen in Afrika er denn einen Bären geschossen habe, aber der Haslinger streicht nur geistesabwesend über das weiche Fell und schaut
bewundernd im Zimmer herum.
Sie seien auf einer heiklen Mission, beginnt der Bannwart, nachdem er noch einmal kurz aufgestanden ist und geprüft hat, ob der Löwenkopf auch anständig an der Wand angemacht ist, weil er wenig Lust hat, den mächtigen Schädel auf den seinen zu kriegen. Was er, der Feller, jetzt zu hören bekomme, müsse er für sich behalten. Es gehe um den Tod, im weitesten Sinn jedenfalls, oder besser gesagt gehe es eben gerade nicht um den Tod, beziehungsweise es gehe um den Tod, den es nicht gebe
beziehungsweise den es zur Zeit nicht gebe, wenn er, der Feller, verstehe, was er damit sagen wolle.
Der Feller versteht nicht und ist sich einen Moment lang nicht sicher, ob er gut daran getan hat, den Gemeindepräsidenten in sein Haus zu lassen, und das erst noch ohne Flinte in Reichweite. Immerhin macht der Haslinger noch einen einigermassen vernünftigen Eindruck, aber vielleicht auch nur, weil er bisher noch keinen Satz gesagt hat. Jetzt aber macht der Haslinger den Mund auf, vermutlich, weil er auch findet, die Erklärung des Gemeindepräsidenten sei etwas dürftig gewesen. Der Schreiber erzählt
dem Feller vom Argwohn des Pflegers Baumberger, davon, dass die alte Bertschinger unverschämterweise noch lebe und dass die Gemeinde diese Umstände nun näher untersuche, Bevor man aber hingehe und feststelle, was da nicht stimme in Rättigen, wolle man zunächst sicher gehen, dass wirklich etwas nicht stimme. Und das wolle man gewissermassen auf empirischem Weg tun.
Empirisch, sagt der Feller und rutscht etwas tiefer in seinen Lieblingssessel unter der Giraffe, empirisch sei immer gut, das habe er schon immer gesagt. Aber jetzt grad so im Augenblick sei er nicht so sicher, wie das gemeint sei im Zusammenhang mit dieser Sache.
Jetzt beugt sich der Bannwart im Sessel vor und schaut den Feller beschwörend an. Das Problem sei doch, dass niemand sterbe, das sei nicht normal, und es könne nicht angehen, dass sie hier auf dem Land so neumodisches Zeug einführen und einfach mit dem Sterben aufhören, wo käme man da hin, und der Baumberger sei ja schon fast stigelisinnig geworden, weil er doch sonst jeden Todesfall voraussagen könne, da sehe man, dass das nicht gut sei, wenn anständige Bürger sogar mitten in der Nacht zu Kirsch und Williams greifen müssen.
Aber der Baumberger hat doch schon immer gesoffen, sagt der Feller und rutscht noch etwas tiefer in den Sessel, weil ihm allmählich schwant, was da auf ihn zukommt.
Das tue nichts zur Sache, zischt der Haslinger und beugt sich auch vor, und plötzlich hat der Feller die Köpfe seiner beiden Besucher ganz dicht vor sich, ist richtig eingepfercht zwischen ihnen, und über dem Bannwart starrt ihn der Löwe an und vom Haslinger seiner Seite aus scheinen die Bärentatzen nach ihm greifen zu wollen. Nüt, wiederholt der Haslinger. Entscheidend sei, dass in jedem anständigen Dorf gestorben werde, schliesslich habe man erst im letzten Jahr ein weiteres Stück Land neben dem
Friedhof enteignet und eingezont, damits den Toten nicht zu eng werde und man für die nächsten paar Generationen genug Platz zum Verscharren habe. Da könne man doch nicht zulassen, dass plötzlich mit dem Sterben aufgehört werde, ganz abgesehen davon, dass das Aloisheim heute schon überbelegt sei. Ausserdem habe man sich ein bisschen umgehört im Dorf, und es sei nicht der Baumberger allein, der von seltsamen Geschehnissen berichte. Die Witwe Zuber renne seit Tagen im Dorf herum und erzähle
jedem, dass ihr Kater vom Zug überrollt worden sei und noch lebe. Gut, jetzt könne einer sagen, man brauche schon eher einen Lastzug, um diesen fetten Kater zu erledigen, aber gschpässig sei es schon, und deshalb müsse er, der Feller, da eine kleine Kontrolle durchführen.
Der Feller schwankt zwischen Verständnis für dem Haslinger seine Position und der Angst vor dem, was da kommen mag. Er versucht, noch etwas tiefer in den Sessel zu sinken, aber er ist schon zuunterst angelangt, und so schiebt er sich stattdessen wieder etwas nach oben und wendet sich dem Bannwart zu, denn letztendlich ist der ja immer noch der Gemeindepräsident und hat das Sagen.
Und jetzt, sagt der Feller mit leiser Stimme, solle er ein wenig empirisch tätig sein? Das sei eigentlich kein Problem, aber er habe vorgehabt, bald wieder nach Afrika zu fliegen, er, der Bannwart, sehe ja selbst, dass der Löwe allmählich etwas zerfleddert aussehe, es sei Zeit für eine neue Trophäe, und auch die Tatzen am Stuhl vom Haslinger seien etwas abgegriffen, da tue Nachschub Not.
Der Haslinger schaut die Armlehnen an und überlegt einen Moment, aber bevor er fragen kann, wo um Gottes Willen in Afrika der Feller denn einen Bären geschossen habe, geht schon der Bannwart dazwischen. Das sei kein Problem mit Afrika, da werde er gehen können, keine Frage, schliesslich freue man sich auch auf der Gmeind auf den nächsten Diaabend, und was man dem Feller zugedacht habe, sei eine kurze Angelegenheit, für einen Profi wie ihn eine einfache Sache und rein empirisch und für die Wissenschaft, und er, der Feller, werde das ruckzuck erledigen, da gebe es keinen Zweifel, und das sei auch im Interesse des Gemeinderates, denn vielleicht sei der Feller ja erfolgreich, und dann sei der Baumberger mit seiner Theorie widerlegt und man könne sich wieder den üblichen Geschäften widmen und den Friedhof in Ruhe weiter amortisieren.
Dem Feller ist ein bisschen schlecht, er schaut zur Decke hoch, weil er spürt, wie es im den Magen dreht, und er hofft, dass sich das wieder einrenkt, wenn er ein bisschen die weisse Decke anstarrt, aber stattdessen starrt auf halbem Weg die Giraffe zurück, und der Feller hört förmlich den Schuss, mit dem das Tier erlegt wurde, er war ja nicht dabei, aber so ein Schuss hört sich überall auf der Welt gleich an, aber gegrinst hat diese Giraffe vorher noch nie, und genau das tut sie jetzt, sie grinst, sie lacht übers ganze Gesicht, sie verhöhnt den Feller regelrecht, und wie der Feller den Kopf wieder senkt, weil er dieses lachende Giraffengesicht nicht mehr länger erträgt, da starrt er auch schon wieder in die Gesichter vom Bannwart und vom Haslinger, aber die beiden grinsen nicht, sie sind so ernst wie der Gemeinderat Räber, als der seinen toten Hund auf dem Hof vom Salis abholen kam, und etwa so schlecht wie damals fühlt sich der Feller jetzt auch wieder, zum ersten Mal verflucht er seinen Bschiss, der ihn zum Grosswildjäger gemacht hat, denn das, was die beiden hier unter empirisch verstehen,
kann ja eigentlich nur eines heissen, und das ist mehr als Mäuse und Ratten und streunende Hunde. Der Feller schliesst langsam die Augen, und wie er sie bald darauf wieder öffnet, sitzt er allein im Zimmer, allein mit dem Getier, und er will sich eben gerade einbilden, er habe das alles nur geträumt, als er das Tausendernötli auf dem Stubentisch sieht.
Der Pfarrer Gnädinger setzt den Schreibstift wieder an, ein sattes Dutzend Mal hat er schon versucht, mit seiner Predigt anzufangen, er hat selten Probleme damit, das Schreiben geht ihm leicht von der Hand, normalerweise wenigstens, aber normalerweise sitzt auch nicht er in der anderen Ecke des Zimmers und grinst zu ihm herüber, und ausserdem stinkt es auch nach zwei Wochen im ganzen Haus immer noch nach schwerem, starkem Kaffee, und der Gnädinger atmet schon längst nur noch durch
den Mund, aber der ist schon ganz trocken. Es lässt sich nicht so leicht eine Predigt schreiben, wenn man nach Luft ringend da sitzt, wenn man das Gefühl hat, entweder zu ersticken oder im Kaffeegestank zu ersaufen, und in der anderen Ecke des Zimmers sitzt der Teufel und grinst und putzt sich die Fingernägel mit einem kleinen Silberkreuz, das er im Nachttischli im Gästezimmer gefunden hat. Gehts vorwärts? Der andere schaut kurz zum Pfarrer auf und vergräbt dann wieder die Spitze des Kreuzes tief unter seinem Fingernagel.
S’isch Samschtig.
Der Gnädinger zuckt zusammen, er hat nie Visionen, wie sie die Leute da in Fatima und Lourdes und La Salette haben, er mag auch nicht recht dran glauben, dass es solche Sachen gibt, denn sein Glaube ist zwar alt und stark, aber eben etwas bodeständig, aber jetzt hat er eine Vision, eine kurze nur, aber sie fährt ihm in die Glieder. Er schliesst die Augen und stöhnt auf, und da kommt sie wieder, die Vision, ein kurzer Film, wie er vorne beim Sprechpult steht, neben dem Altar, und vor ihm die
Rättiger, die ihm gebannt an den Lippen hängen, aber diese Lippen öffnen sich nicht, da kommt nichts heraus, kein Ton, kein Wort, und das Blatt vor ihm ist auch leer, schneeweiss und leer, weil ihm einfach keine Predigt eingefallen ist, und in der vordersten Reihe des Kirchenschiffs sitzt er und lacht lauthals und grübelt sich den Dreck aus den Fingernägeln mit dem kleinen Silberkreuz, das der Pfarrer Gnädinger zur Firmung bekommen hat, und irgendwann wird das Volk in der Kirche unruhig, es
rutscht auf den Bänken herum und flüstert, und plötzlich zieht einer nach dem anderen, Frauen und Männer, ein kleines Silberkreuz aus der Tasche und putzt sich die Fingernägel, und sie grinsen dazu, die Rättiger, und mit einem Mal stinkts in der Kirche zum Gottserbarme nach Kafi, nach schwerem, schwarzem, süttig heissem Kafi, und der Gnädinger klammert sich ans Stehpult, schwindlig ists ihm, schlecht, gottsjämmerlich schlecht, und es würgt ihn und er spürt, dass er sich übergeben muss.
Als es schliesslich passiert, als es ihm den Magen kehrt, versucht er noch, sich in die Sakristei zu schleppen, wo das Brünneli steht, wenigstens das, wenigstens so viel ürde, da passiert es plötzlich, als er erst den Altar erreicht hat, es lüpft den Pfarrer nädinger und er übergibt sich über den Altar, und ER in der vordersten Reihe lacht etzt schallend und schlägt sich auf die Oberschenkel vor Vergnügen und schreit: Gebenedeit! Gebenedeit!» und die Gemeinde fällt ein in seinen Schrei und putzt sich weiter die Fingernägel mit den Silberkreuzen, und der Pfarrer Gnädinger bricht neben dem Altar zusammen und holt ein letztes Mal tief Luft, weil er glaubt, das Ende sei gekommen, aber es riecht nach Kafi und Erbrochenem und es tropft vom Altar, so will er nicht sterben, und als er sich am Altar hochziehen und wieder aufrichten will, hört er die Stimme.
Söll der helfä?
Was? Der Gnädinger öffnet die Augen, die Vision ist vorbei, er sitzt im Zimmer, jetzt riecht es nur noch nach Kafi.
Der andere steht auf und geht im Zimmer auf und ab, schaut mal zur Decke, mal zu Boden. Er geht eine Weile so hin und her, bewegt die Lippen, als spräche er zu sich selbst, der Gnädinger versteht kein Wort, er schliesst die Augen, weil er sich plötzlich die Vision zurückwünscht, gut, sie ist furchtbar, die Bilder peinigen ihn, aber es ist doch am Ende nur eine Vision, aber dieser Mann im Zimmer ist die Wirklichkeit, und er hat das Gefühl, als greife diese Wirklichkeit nach ihm. Und wie der Pfarrer die
Augen schliesst, spürt er, wie sich seine Hände heben, ohne dass er es selbst so will, wie sie sich auf die Schreibmaschine senken, wie die Fingerkuppen zart die schwarzen Tasten berühren, wie sie langsam nach unten drücken, die Spitzen seiner Finger, die noch immer zu ihm gehören, ihm aber nicht mehr gehorchen, und da beginnt es schon zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. In den nächsten Minuten rattert es im Zimmer, es rattert und chlöpft ohne die kleinste Pause, und wie es plötzlich aufhört zu rattern, öffnet der Gnädinger die Augen wieder, und er sieht, wie seine Hände neben der Schreibmaschine ruhen, die Fingerkuppen gerötet, und aus der Schreibmaschine quellen Blätter, eng beschrieben, viele Blätter, schwarz auf weiss, und von den Blättern geht ein Kafiduft hoch.
Er sitzt wieder in der Ecke gegenüber vom Pfarrer, die Beine übereinander geschlagen, und fährt mit der Spitze des kleinen Silberkreuzes unter den Nagel des Zeigefingers. Seisch nöd danke? Er fragt es und blickt kurz auf. Sein Blick trifft den vom Gnädinger.
Der Pfarrer schüttelt langsam den Kopf. Er ist müde, er will die Augen schliessen, aber dann ist die Vision wieder da, und vielleicht ist sie ja doch schlimmer als die Wirklichkeit, vielleicht ist sie die Wirklichkeit, vielleicht treffen sich Vision und Wirklichkeit und paaren sich mitten auf seinem Altar, zwischen dreckigen Fingernägeln und Silberkreuzen und Erbrochenem. Vielleicht ist die Vision schlimmer als die Wirklichkeit und die Wirklichkeit schlimmer als die Vision, und vielleicht steht
zwischen den beiden ein Drittes, das noch schlimmer, viel schlimmer ist. Und vielleicht hat er dieses Schlimmere aufgeschrieben, zu Papier gebracht, auf diese Blätter, die neben der Schreibmaschine liegen, er mag sie nicht anschauen, er mag nicht lesen, was er da geschrieben hat, nein, was ER da aus ihm heraus geschrieben hat.
Nei, sagt er schliesslich. Nei. Einfach nur das. Und dann, den Blick fest auf ihn gerichtet, noch einmal. Nei.
Scho guet. Er sagt es ruhig, fast schon freundlich. Vielleicht später. Er steht auf, geht am Pfarrer vorbei zur Tür hinaus.
Der Gnädinger schaut noch eine Weile ins Leere, aber dann siegt die Müdigkeit, er lehnt sich zurück im Stuhl und schliesst die Augen trotz der Angst. Er hat Angst vor der Vision, aber die Lider sind ihm zu schwer geworden. Er muss denken, schnell an etwas denken, damit er ihr keinen Platz lässt, dieser Vision. Aber es fällt ihm nichts ein, dem Pfarrer, dem Studierten, leer ist sein Kopf und es ist ihm, als wäre da niemals etwas gewesen.
Als er schon das erste Bild vor Augen hat, das volle Kirchenschiff und ihn, wie er in der ersten Reihe sitzt und grinst, da weiss der Gnädinger, dass er an etwas denken muss, etwas, das er kennt, das ihn vertraut ist, das die Bilder in seinem Kopf vertreibt. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach.
Der Gnädinger atmet auf. Grad noch rechtzeitig ist ihm der Satz aus der Geheimen Offenbarung vom
Johannes eingefallen. Er denkt ihn sich noch einmal, stellt sich jedes einzelne Wort vor, er lässt die Wörter vor sich herumtanzen, und er spürt, wie die Vision undeutlich wird und verzerrt und brüchig und schliesslich verschwindet.
Dem Gnädinger wirds ein bisschen warm ums Herz und leichter. Er hört nicht, wie es unten von der Küche her lacht. Und lacht. Und lacht.
jedem Samstag. Gschalet und useputzt sind die beiden, weil sie eigentlich vorgehabt haben, in die Stadt zu fahren, in einen feinen Club mit feinen Damen, wie sie das jeden Samstag tun wollen, aber dann kehren sie immer für ein erstes Bier in den «Adler» ein, zur Einstimmung für das grosse Abenteuer in der Stadt, und aus einem Bier werden zwei oder drei, und irgendwann kommen noch zwei andere trinkfeste Männer dazu, und dann wird der Jassteppich ausgerollt und eine neue Runde bestellt, bis der Grob und der Stammer nicht mehr fahrtüchtig sind und sich kaum noch dran erinnern, dass
sie eigentlich in die Stadt wollen. So geht das jeden Samstag, das ganze Dorf lacht über die beiden, und es geht das Gerücht, dass sie es vor Jahren tatsächlich einmal geschafft haben, nach dem ersten Bier in die Stadt zu fahren, und da sind sie von einer Bartür zur nächsten abgewiesen worden, weil ein feiner Anzug den Landgeruch nicht ausmerzen kann, den die beiden mit sich tragen. Und seither bleiben sie eben im «Adler», wohin sich keine hübsche Junggesellin verirrt, aber das Bier ist kühl, und
rausgeworfen werden sie auch nicht. Aber an diesem Abend ist alles anders. Das Bier ist warm, sauwarm, der Stammer behauptet sogar steif und fest, er habe sich die Lippen am Glas verbrannt, und er macht ein mächtiges Gezeter und wirft den Jassteppich durch die Gegend, der Grob und er haben schon ein paar Flaschen intus, auch wenn das Bier warm ist und immer heisser zu werden scheint, und schliesslich kommt der Wirt, der Langenthaler, und wirft die beiden im hohen Bogen aus der Beiz. Er ist früher Schwinger gewesen und braucht genau eine Pranke pro Störenfried, und dann ist wieder eine Sterbensruhe im «Adler».
Der Fiechter Toni hat nur flüchtig zugesehen, wie der Grob und der Stammer unfreiwillig den Heimweg angetreten haben. Er will jetzt auch zahlen, müde ist er, er schläft schlecht, er weiss, dass er auch in dieser Nacht wieder kein Auge zutun wird, aber versuchen kann er es ja. Er zahlt beim Langenthaler seine Biere und will aufstehen, als sich die Tür der Beiz öffnet. Hoppla, denkt sich der Fiechter. Der Wenz und der Kilian haben wirklich alles Pech des Lebens. Da wollen sie jeden Samstag in die Stadt für einen Aufriss, bleiben dann im «Adler» hängen, besaufen sich und kehren in die leere Wohnung zurück. Und heute, wo sie unfreiwillig nicht mehr in der Dorfbeiz sitzen, kommt eine junge Frau herein, die hübsch ist und sauber und irgendwie ledig aussieht. Die Fritzi Gräulinger schaut auch ganz verwundert auf, und der Langenthaler steht mit offenem Mund hinter der Theke.
Isch do no öppis frei? Die junge Frau lächelt nett, aber ganz natürlich, als sie den Fiechter Toni fragt. Der lässt sich langsam auf den Stuhl zurück sinken und nickt nur und schaut der Frau zu, wie sie sich ihm gegenüber an den Tisch setzt. Sie hat lange, dunkelbraune Haare, grosse, dunkle Augen, und ihre Haut sieht so zart aus, dass sich der Fiechter ganz gedankenversunken selbst durch die Bartstoppeln fährt und sich fragt, wie eine Haut so zart aussehen kann.
Die Frau bestellt ein Bier, und wie der Langenthaler, der mit dem Staunen auch noch nicht aufgehört hat, eine Stange am Zapfhahnen einschenken will, schüttelt die Frau den Kopf und deutet auf die grossen Humpen auf der Theke. Der Langenthaler staunt noch ein bisschen mehr, aber schliesslich füllt er das grosse Glas randvoll mit Bier und stellt es vor die Frau hin und vergisst ganz, den Fiechter zu fragen, ob der auch noch etwas wolle.
Da sitzt der Fiechter vor einer leeren Stange und starrt die Frau an und fährt sich durch die Stoppeln und schaut zu, wie sie den Humpen zum Mund führt und in langen Schlucken trinkt und wie sie einen kleinen Bierschnauz hat, als sie das Glas abstellt, und als sie mit der feinen Spitze ihrer Zunge langsam um die Lippen kreist und die feinen Schäumchen auffängt, da ist es um den Fiechter geschehen, da ist ihm warm und kalt zugleich, einen schweren Stein hat er im Bauch, und trotzdem ist ihm so leicht, er könnte davonfliegen.
Jetzt setzt sie den Humpen noch einmal an, die Frau, und stellt ihn erst wieder ab, als er leer ist. Der Langenthaler muss von der Theke aus zweimal hinschauen, bis ers glaubt. Aber dann besinnt er sich seiner Pflichten als Wirt und fragt die Frau, ob er noch eines bringen dürfe. Die Frau schaut den Langenthaler gar nicht an, sie schüttelt nur den Kopf und erwidert den Blick vom Fiechter. Gömmer, fragt sie schliesslich, sie hat eine schöne warme Stimme, und steht langsam auf. Der Fiechter bleibt sitzen, er hätte die Frau gerne noch ein bisschen angesehen, weil er das mit dieser zarten Haut immer noch nicht ganz glauben kann, aber da sagt sie noch einmal: Gömmer. Und jetzt merkt der Fiechter, dass sie mit ihm spricht, er hat keine Ahnung, was sie meint, was sie hier tut, aber er weiss auch, dass er schleunigst aufstehen muss, wenn er jemals erfahren möchte, ob diese Haut wirklich so zart ist, wie sie aussieht.
Der Langenthaler starrt die Tür an, nachdem sie sich hinter dem Fiechter und dieser Frau geschlossen hat. Was will so ein junges, hübsches Ding vom Fiechter? Der ist doch schon einiges über 50, hat kaum mehr Haare auf dem Kopf, einen rechten Bauch und nicht viel im Grind. Er findet keine Antwort, der Langenthaler, aber eines ist sicher: Das ist eine Geschichte, die man die nächsten paar Wochen lang im «Adler» erzählen kann, immer und immer wieder, und die Gäste werden jedes Mal wieder zuhören. Der Langenthaler wird die Geschichte von Zeit zu Zeit etwas ausschmücken, er ist ja der einzige, der es gesehen hat, die Fritzi Gräulinger zählt er nicht, der glaubt keiner ein Wort, keiner kann sie leiden, weil das halbe Dorf als Kind zu ihr in die Klavierstunde gegangen ist und diese Klunker zu spüren bekommen hat.
Wie der Langenthaler so vor sich hin träumt, dass ganz Rättigen an seinen Lippen hängen wird, wenn er von der fremden Frau und dem Fiechter erzählt, ein bisschen angereichert mit seinen eigenen Ideen – tribe hends äs, grad uf em Tisch! – da öffnet sich die Tür der Beiz und der Wenz Grob und der Kilian Stammer kommen herein, setzen sich an den Stammtisch und rufen nach einem Bier. Der Langenthaler, aus den Träumen gerissen, traut seinen Augen nicht. Ob es ihnen noch recht gehe, was sie eigentlich glauben, wer sie seien, ruft der Beizer, er habe keine Lust, die zwei Saufbolde an einem einzigen Abend zwei Mal vor die Tür zu setzen wie eine Katze, die einfach immer wieder ins Haus schleicht, obwohl sie nach draussen gehört.
Der Grob und der Stammer schauen sich verständnislos an. Alles, was recht sei, meint der Grob, er habe ja nichts dagegen, wenn er, der Langenthaler, zwischendurch auch mal einen Schluck nehme hinter der Theke, aber übertreiben sollte er es nicht, denn wenn er weiter so mit den Stammgästen umgehe, werde man nächsten Samstag direkt in die Stadt fahren, ohne in dieser Dorfchnelle Zwischenhalt zu machen, dann sei die Beiz ganz leer und nicht wie jetzt nur fast. Und überhaupt nehme es ihn schon noch schaurig wunder, wovon er, der Langenthaler, überhaupt rede. Er und der Stammer seien heute das erste Mal im «Adler», und wenn der Wirt so weiter mache, dann sei es auch das letzte Mal, und das für länger.
Der Langenthaler schnappt hinter der Theke nach Luft. Freche Siäch, ruft er zum Grob herüber, er wisse ganz genau, dass er und sein sauberer Kumpan vor einer halben Stunde auf dem gleichen Stuhl gesessen seien und über das Bier lamentiert hätten und den Jassteppich durch die Gegend geworfen, ja genau, jetzt könne er, der Grob, wenigstens so viel Anstand haben und den vom Boden aufnehmen und wieder dort hin hängen, wo er hingehört. Aber dann, und der Langenthaler ballt eine seiner mächtigen
Pranken zur Faust, dann sollen sie sich zum Teufel scheren.
Der Grob und der Stammer schauen sich nur mit offenen Mündern an, während die Fritzi Gräulinger am Langenthaler vorbei an die Wand starrt. Was isch, fragt der Beizer. Die alte Fritzi hebt mit einiger Mühe ihre klunkerbesetzte Hand und deutet mit dem Finger hinter den Langenthaler. Der dreht sich um, sieht den Jassteppich dort hängen und versteht die Welt nicht mehr. Er hat das verflixte Teil garantiert nicht vom Boden genommen, das wäre ja noch schöner, liegen lassen wollte er den Teppich,
warten, bis diese Säufer nächste Woche wieder kommen, damit sie sich gleich selbst bücken können.
Der Langenthaler kommt hinter der Theke hervor und setzt sich zur Fritzi Gräulinger. Ob sie den Teppich wieder an die Wand gehängt habe? Es könne ja nur sie gewesen sein. Sie habe doch auch gesehen, wie er den Wenz und den Kilian aus der Beiz spediert hat. Die Fritzi schüttelt den Kopf. Sie sei vielleicht alt, sagt sie, aber nicht blind und nicht dumm, und wenn sie eines wisse, dann, dass sie hier schon den ganzen Abend sitze, und der Grob und der Stammer seien jetzt gerade zum ersten Mal heute hier herein gekommen, und fliegende Jassteppiche seien auch noch nicht erfunden worden.
Der Langenthaler schaut verzweifelt zu den beiden Männern, die sich vielsagend an den Kopf greifen und breit grinsen. Obs jetzt ein Bier gebe, fragt der Stammer, er könne dem Wirt schon den Weg zum Zapfhahn zeigen, falls er so ganz generell ein bisschen durcheinander sei.
Der Beizer steht langsam auf und schlurft hinter die Theke. Es will ihm nicht in den Kopf, was da los ist. Er hat doch die beiden am Schlafittchen gepackt und rausgeworfen, das weiss er ganz sicher. Aber die Fritzi Gräulinger behauptet steif und fest, dass es nicht so gewesen ist, und sie ist ja die einzige, die es gesehen hat. Oder nein, halt, noch einer hats ja gesehen! Dä Fiechter! ruft der Wirt hinter der Theke triumphierend. Der Fiechter habe es ja auch gesehen, er werde ihn morgen beim Frühschoppen zur Rede stellen, er wisse ja nicht, wieso die Fritzi so einen Seich erzähle, vielleicht, weil er, der Langenthaler, ein schlechter Klavierschüler gewesen sei, aber der Fiechter habe keinen Grund zu lügen, er könne bestätigen, wie es gewesen sei.
Die Fritzi Gräulinger steht so abrupt auf, dass der Stuhl hinter ihr auf den Boden kippt. Ihre Stimme zittert ein wenig, sie weint fast, als sie ausruft, dass das die Höhe sei, sie eine Lügnerin zu schimpfen, sie habe gesehen, was sie gesehen habe, oder eben vielmehr, was sie nicht gesehen habe, und so wahr ihr Gott helfe, der Wenz Grob und der Kilian Stammer seien vor ein paar Minuten zum ersten Mal an diesem Abend im «Adler» aufgetaucht, und sie habe nicht vor, noch länger in einer Beiz zu sitzen, wo der Wirt sie beleidige und nicht nur das, ganz offensichtlich habe der Langenthaler auch en Egge ab und wisse nicht, was er rede, denn der Fiechter, der sei heute abend überhaupt nicht im «Adler» gewesen, nicht für eine Minute.
Dem Langenthaler ists ein bisschen schwindlig, er schaut zu, wie die Fritzi aus der Tür verschwindet, obwohl das Glas Rotwein noch halb voll ist, nie würde sie das tun, wenn es ihr nicht wirklich drum wäre, und der Langenthaler weiss selber nicht mehr, was er glauben und denken soll. Gits das Bier, ruft der Stammer, und der Grob schickt ein gehässiges Lachen hinterher. Während der Wirt wieder hinter die Theke geht, sieht er aus dem Augenwinkel, wie sich die beiden an den Kopf tippen und tuscheln. Er hat nicht getrunken, der Langenthaler, so viel weiss er. Er hat den ganzen Tag nur Kaffee
gehabt, weil er gestern zu viel Alkohol erwischt hat. Daran kanns nicht liegen. Er liegt ihm ja jetzt noch in der Nase, der Duft vom letzten Kaffee. Schwer und stark und schwarz.
Das Alois-Heim liegt still und dunkel da, von irgendwo her knarrts, dann wirds wieder ruhig. Dem Leo Feller kommts ein bisschen vor wie in einem Film. Er geht langsam Richtung Eingang, schaut sich noch einmal um, sieht keine Menschenseele und drückt schliesslich auf den Klingelknopf. Er hört, wie es drinnen im Haus surrt. Jetzt muss alles schnell gehen. Der Feller stellt die Flasche auf die Türmatte und schlägt sich in den Busch gleich neben dem Eingang.
Bald geht die Tür auf, der Baumberger schaut raus. Er sieht niemanden, schaut noch einmal, grummelt unwillig und will eben die Tür wieder hinter sich schliessen, als er die Flasche am Boden sieht. Natürlich weiss der Baumberger, dass auch in Rättigen in der Nacht keine Schnapsflaschen von allein die Runde machen und an Altersheimtüren klingeln. Aber er will gar nicht viele Fragen stellen, sondern sich dieses Geschenk des Himmels gleich hinter die Binden kippen. Der Nachtpfleger zögert keinen Moment, packt sie und huscht wieder ins Haus. Er ist ein Kenner und hat sofort gesehen, dass es ein guter Schnaps ist und nicht irgendein billiger Fusel.
Der Feller, der eine Weile mit dem Atmen aufgehört hat, holt tief Luft. Jetzt muss er nur noch warten, ein halbes Stündchen vielleicht. Wenns ums Saufen geht, ist der Baumberger absolut verlässlich. Der Feller steckt sich eine Zigarette an und schlägt den Kragen seiner Jacke hoch. Es ist noch nicht richtig Herbst, aber die Abende werden kühler, beim Ausatmen formen sich schon kleine Wölklein, staunt der Feller, bis ihm einfällt, dass er ja eine Zigarette raucht. Er macht es sich im Gebüsch ein bisschen bequemer, weil er doch eine Weile warten muss.
Ums Geld geht es ihm nicht. Davon hat er selbst genug. Klar, jeder nimmt tausend Franken, wenn der Besuch sie einfach auf dem Stubentisch liegen lässt, aber in diesem Fall hätte er das Geld noch so gern zurückspediert. Er hat viel zu viel Angst vor dem, was ihn erwartet, dass ihn tuusig Stutz locken könnten. Und trotzdem ist er hier. Wegen dem Haslinger. Der Feller vergisst nicht, wie der Gemeindeschreiber die Bärentatzen am Sessel gemustert hat. Er ist nicht dumm, der Haslinger, er hat seine Schlüsse bestimmt gezogen. Und dann ist er ja auch Präsident des Rättiger Schützenvereins. Schon einmal hat er den Feller nach einer Gemeindeversammlung gefragt, ob er nicht beitreten wolle, und der Feller hat etwas Hilfloses gestammelt. Der Haslinger wird sich schon fragen, warum der angebliche Meisterschütze nicht zum Schützenverein will. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es im Dorf heisst, vielleicht habe der Leo ja das Schiessen gar nicht erfunden, und Geld genug habe er ja auch, um sich Trophäen zu kaufen.
Vorbei wärs mit den Diaabenden, mit der stillen Anerkennung, und der Feller hat keine Lust, woanders hinzuziehen, er ist müde vom ständigen Nichtstun, und deshalb hat er das Gefühl, es sei besser, wenn er dem Gemeinderat den Gefallen tut, wenn er diesen empirischen Beweis, wie es geheissen hat, erbringt, auch wenn es bedeutet, dass er wirklich schiessen muss, aber wenigstens auf kleine Distanz und auf ein Opfer, das sich bestimmt nicht gross bewegt, schon gar nicht nachts.
Der Feller holt die kleine Pistole aus der Jackentasche, ein Pistölchen ist es eher, klein und schwarz und handlich. Er hat es vor Jahren gekauft, als er noch geglaubt hat, mit etwas Übung werde er doch noch der Meisterschütze, für den ihn alle halten. Für wilde Tiere in Afrika würde es nicht reichen, das Pistölchen, aber für das hier schon. Der Feller zweifelt keine Sekunde daran, dass das Ganze tödlich enden wird, er gibt nichts auf den Unsinn, den der Baumberger beim Gemeinderat offenbar verzapft hat.
Er schaut auf die Uhr. Es ist Zeit. Der Feller klettert aus dem Gebüsch, huscht wieder zur Tür und klingelt erneut. Dann rennt er um das Haus herum Richtung Hintereingang. Der ist immer unverschlossen, das weiss jeder im Dorf. Und solange der Baumberger, beduselt vom Schnaps, beim Haupteingang herumschaut, kann der Feller von hinten ins Haus rein und in den oberen Stock, ohne dass ihn der Pfleger hört. Der Feller bezweifelt, dass der Baumberger überhaupt noch viel wahrnimmt, aber er will sich ganz sicher sein.
Und es funktioniert. Der Feller hat die Hintertüre geöffnet und ist schon die Treppe hoch, als er die schwere Haupttür ins Schloss fallen und den Baumberger fluchen hört. Dann wird eine zweite Tür zugezogen. Vermutlich hat sich der Pfleger jetzt mit dem Rest vom Schnaps zurückgezogen, wenn es überhaupt noch einen Rest gibt. Der Feller wartet noch einige Sekunden, dann schleicht er den Gang entlang. Die Türen sind nicht angeschrieben, er muss eine nach der anderen öffnen und hineinspähen, manches Mal muss er ins Zimmer huschen und sich übers Bett beugen, um zu sehen, ob er wieder falsch ist, aber dort, wo die Vorhänge nicht ganz zugezogen sind, reicht das Mondlicht, um die Gesichter auszumachen. Es ist ein Glück, dass er weiss, wie sie aussieht, er hat einmal an einem Nachmittag im letzten Frühling eine Diaschau im Alois-Heim veranstaltet, und da ist sie ihm unangenehm aufgefallen, weil sie einfach an ihrem Tisch weiter gejasst hat, was heisst hier gejasst, sie hat einfach Karten abgelegt, und immer, wenn der Feller gerade ein besonders schönes Bild gezeigt hat, hat sie grell und laut «Gwunne» gerufen. Er weiss, wie sie aussieht.
Im fünften Zimmer ist der Feller am Ziel angelangt. Er sieht es, als er neben dem Bett steht und leise atmend die Gestalt unter der Decke betrachtet. Da liegt sie, alt und bleich und mir wirrem Haar. Sie schnarcht ein bisschen, den Mund weit offen, offen und leer, das Gebiss schwimmt in einem schmutzigen Glas auf dem Nachttisch. Den Feller widerts an, es schüttelt ihn ein bisschen, und wie er versucht, seinen Blick von den künstlichen Zähnen zu nehmen, da fällt ihm ein, dass so ein bisschen Ekel jetzt gar nicht schlecht ist, dass er diesen Moment ausnützen muss. Der zahnlose Mund und die
Zähne neben dem Bett ekeln ihn an, jetzt schaut er ganz bewusst auf das Glas mit der Zahnprothese, dann wieder zu dem offenen schwarzen Loch zwischen den alten rissigen Lippen, sie hat den Mund jetzt sperrangelweit offen und schnarcht etwas lauter. Der Feller schaut immer wieder von den Zähnen zum Mund und wieder zu den Zähnen und wieder zum Mund, bis ihm speiübel ist, bis er richtig hässig ist auf diese alte Frau, die da in ihrem Bett liegt und schnarcht und rechtschaffene Leute mit ihren
schmutzigen dritten Zähnen belästigt.
Der Feller greift in die Jackentasche, holt die kleine Pistole hervor und richtet sie auf die Bertschinger. Die schnarcht jetzt noch lauter, jetzt ist es schon fast ein Sägen, es rollt und sägt vom Kissen her, und der Feller ist nahe dran, sich die Ohren zuzuhalten, aber das geht schlecht mit der Pistole in der Hand, und dabei fällt ihm ein, weshalb er hier ist. Er denkt kurz nach, geht dann auf leisen Sohlen zum Wandschrank und öffnet ihn langsam. Er hat richtig geraten. Da drin liegen Wolldecken, Kissen, eine
Bettflasche, ein Nachttopf. Der Feller nimmt eines der Kissen, ein dickes, weiches, flauschiges, dämpfendes Ding und schleicht zum Bett zurück. Er glaubt nicht, dass der Baumberger in seinem Zustand noch viel hört, aber sicher ist sicher.
Und jetzt? So einfach ist das alles nicht. Der Kopf ist das sicherste, denkt sich der Feller, aber wenn er das Kissen auf den Kopf von der Bertschinger legt, wird die garantiert aufwachen und einen Lärm veranstalten, noch bevor er abgedrückt hat. Also das Herz. Aber mit dem Kissen auf der Brust sieht der Feller nicht mehr, wo das Herz liegt, das kann also auch gehörig schief gehen.
Egal. Es muss einfach schnell gehen. Der Feller presst der Bertschinger mit der linken Hand das Kissen aufs Gesicht, setzt mit der rechten die Mündung der Pistole auf das Kissen auf und drückt ab. Einmal, zweimal, dreimal. Das Kissen dämpft die Schüsse nur leicht, der Feller zuckt bei jedem Knall zusammen, genauso wie die Bertschinger, die keinen Laut von sich gibt, aber bei jedem Schuss alle viere von sich streckt.
Vom Kissen her steigt dem Feller Rauch in die Nase. Unter dem Kissen rührt sich nichts. Er wartet noch einige Sekunden, dann steckt er die Pistole wieder ein, dreht sich um und geht zur Tür. Er ist ein bisschen enttäuscht, weil er so gar nichts spürt, keine Erregung, keine Angst und keine Euphorie. Einfach wars, der Gemeinderat wird zufrieden sein, und seinen Ruf als Jäger hat er auch gefestigt. Aber ein bisschen etwas fühlen könnte er trotzdem, findet er.
Bei der Tür angelangt, schaut der Feller noch einmal zurück ins Zimmer. Da liegt sie, die Bertschinger, und wird nie wieder an eine Dia-Schau gehen. Geschieht ihr recht. Was jasst sie auch, während er, der Feller, die Bilder seiner Safaris zeigt. Wenn sie wenigstens einfach geschlafen hätte oder gelesen oder Kreuzworträtsel gelöst, was diese alten Leute sonst eben so machen, aber nein, sie musste mitten im Saal jassen, und das nicht etwa leise, nein, gebrabbelt hat sie dauernd etwas, jeden Stich kommentiert, und obwohl sie ja genau genommen gegen gar niemanden gejasst, sondern einfach so ein bisschen die Karten abgelegt hat, obwohl es eigentlich gar keine richtige Stiche gegeben hat, trotz all dem hat sie dauernd gerufen, der Feller erinnert sich jetzt wieder ganz deutlich, immer, wenn er ein besonders eindrückliches Dia gezeigt hat und dem Publikum etwas hat erklären wollen, da ist ihm die Bertschinger ins Wort gefallen und hat es einfach laut herausgerufen, dieses –
«Gwunne!»
Der Feller lässt die Türfalle wieder los, als wäre sie glühend heiss, es reisst ihn richtig herum, zurück Richtung Bett, er schaut jetzt direkt dort hin, dort, wo er die alte Bertschinger kurz vorher erschossen hat, wo er drei Schüsse durch ein dickes Kissen hindurch in ihren alten Schädel gejagt hat. Der Wind hat den Vorhang durch das geöffnete Fenster zur Seite geweht, das Zimmer liegt im Mondschein, alles ist klar zu erkennen. Das Kissen liegt auf dem Boden, wo es hingefallen ist, als sich die Bertschinger im Bett aufgerichtet hat.
Gwunne, ruft sie noch einmal und lacht den Feller mit ihrem zahnlosen Mund an, aus einer grossen, klaffenden Wunde an ihrer Stirn fliesst Blut hinab in diesen offenen Mund, und in diesem Moment kommt der Wind noch einmal mit ganzer Kraft und bläht den Vorhang weit auf und lässt ein bisschen mehr vom Mondlicht ein und gibt den Blick frei auf diesen Mund, dieses schwarze Loch, über dem sich eine rötliche Blase bildet, als es die Bertschinger noch einmal hinausschreit:
«Gwunne!»
Der Feller merkt, wie es ihn würgt, wie es ihm den Mage kehrt, er will weg von hier, aber wie er die Bertschinger fest im Auge hält und hinter sich die Türfalle ertastet, spürt er, wie sie sich von selbst nach unten bewegt. Der Baumberger, natürlich, er ist noch nicht besoffen genug, er hat die Schüsse gehört, er ist da, und der Feller steht im Zimmer mit einer Pistole in der Jackentasche, und auf dem Bett sitzt die Bertschinger mit einem grossen Loch im Kopf und wirft Blutblasen aus dem Mund, der Feller weiss, dass er verloren ist, es bleibt ihm nur eines. Mit aller Kraft stemmt er sich rückwärts
gegen die sich öffnende Tür, reisst die Pistole aus der Jackentasche und schiebt sich die Mündung in den Mund. An der Tür hinter ihm rieglets und tuets, aber der Feller gibt keinen Moment lang nach, er zieht noch einmal zischend Luft ein und merkt, wie es in seinem Mund nach Metall schmeckt und nach Rauch, und wie der Druck in seinem Rücken stärker wird, zieht der Feller ab, er hört den Knall kaum, merkt nur, wie der Rauch den Metallgeschmack übertönt und wie plötzlich beides vom Blut weggeschwemmt wird, das von dort zu kommen scheint, wo vorher seine Zunge war oder der Kehlkopf oder beides.
Der Feller kippt vornüber ins Zimmer, der Baumberger platzt mit voller Wucht durch die Tür auf den Feller, die Bertschinger streicht sich übers Gesicht und verschmiert alles mit Blut und ruft jetzt salvenartig Gwunnegwunnegwunnegwunne. Der Baumberger rappelt sich hoch, sieht die Bertschinger, schüttelt sich ein wenig, um den Alkohol aus den Gliedern zu bekommen, am Boden kriecht der Feller Richtung Bett, stemmt sich mühsam am Nachttischli hoch, das Nachttischli kippt um, die Schubladen
fallen heraus, ein wüstes Durcheinander von Kamm und Parfümfläschli und Nagelscherli und Jasskarten ergiesst sich über den Boden, der Feller greift die Jasskarten, zieht sich am Bett hoch, lässt sich neben die Bertschinger fallen, will etwas sagen, aber es rasselt nur von dort, wo vorher der Kehlkopf war, und weil er nichts sagen kann, fängt der Feller an, die Karten zu mischen und auszugeben, und die
Bertschinger beugt sich vor, um ihre Karten aufzunehmen, und da geht wieder ein Gutsch Bluet und vermischt sich mit dem vom Feller, dem es aus den Mundwinkeln tropft, und die beiden haben noch keinen einzigen Stich gemacht, da ruft die Bertschinger schon wieder:
«Gwunne!»
Der Baumberger steht da und schaut und begreift es nicht und geht dann zurück zum Schnaps, nimmt noch einen tiefen Schluck und greift schliesslich zum Telefon.
Aussenseiter sein, nicht so wie der Wiesmann, den keiner ernst nimmt. Er ist Gemeinderat, er ist jemand im Dorf, und sein Vater wäre stolz auf ihn.
Hauptsache mit dem Strom schwimmen, hat er immer gesagt, der Vater, und der Bättig schwimmt fleissig, manchmal lässt er sich auch einfach treiben. So wie bei der Abstimmung über den Vorschlag vom Haslinger, dem Gemeindeschreiber. Alle sind sie dafür gewesen, dass man den Feller damit beauftragt. Damit man endlich weiss, woran man ist mit dieser Sache. Der Bättig wundert sich, wie leicht ihm das Ja gefallen ist. Es ist ihm in Fleisch und Blut, dieses Schwimmen mit dem Strom. Dabei hat er Tiere doch so gern. S’isch nur ä Chatz, sagt der Bättig plötzlich halblaut zu sich selbst, und die Frau und der Sohn schauen ihn verwundert an, weil auf dem Fernsehschirm weit und breit nichts von einer Katze zu sehen ist. Der Bättig winkt ab und stiert in den Fernseher.
Und? – Die Frau schaut den Fiechter lächelnd an und fährt ihm über den Bauch durch die Brusthaare zum Hals, wo sie ihn mit den langen Fingernägel ein wenig kitzelt. – Und? Gut?
Der Fiechter schnauft immer noch ein bisschen schwer und mag gar nichts sagen und nickt nur und lächelt zurück. Jetzt weiss er also, dass es das gibt, so zarte Haut. Nicht nur im Gesicht ist sie so zart, die fremde Frau, überall ist sie weich und zart und warm. Der Fiechter weiss es jetzt, aber alles ist gleichzeitig so unwirklich, dass er es eben doch nicht so richtig weiss. Und er ist bei aller Befriedigung auch ein bisschen enttäuscht, weil die fremde Frau zwar so viel gegeben, aber gar nichts genommen hat. Fast ein bisschen teilnahmslos ist sie gewesen, die ganze Zeit über. Gut, er hat auch nicht viel getan für sie, der Fiechter muss es zugeben, er ist zu sehr damit beschäftigt gewesen, seine Wünsche erfüllt zu sehen. Richtig gespenstisch ist es gewesen. Wie sie zu ihm nach Hause gekommen ist und gleich nach der Haustür ganz selbstverständlich die Kleider abgestreift hat, da sind tausend Wünsche in ihm wach geworden, und die Frau hat einen nach dem anderen davon erfüllt. Der Fiechter hat an das gedacht, die Frau hat das gemacht, er hat an dies gedacht, sie hat dies gemacht, er hat an jenes
gedacht, sie hat jenes gemacht. Es war wie ein Wunschkonzert, und er ist so damit beschäftigt gewesen, diese Wünsche entgegen zu nehmen, dass er gar nicht an ihre Wünsche gedacht hat.
Und du? Er ist wieder ein bisschen zu Atem gekommen, aber er schaut sie nicht an, als er sie fragt. Gut?
Sie antwortet nicht, er schaut sie an, und er sieht, dass sie gleich zu weinen beginnen wird, er weiss, wie das aussieht, wenn eine Frau gleich weint, es gibt noch keine Tränen und keine erstickte Stimme, aber man weiss sofort, dass es gleich soweit sein wird, und er versteht es nicht und ist überfordert und weiss nicht, was er tun soll.
Was denn? Was isch?
Und dann kommen die Tränen, und der Fiechter schwankt zwischen Stolz, weil er sie at kommen sehen, und Angst, weil er nicht weiss, was er mit der weinenden Frau tun soll.
S’isch nüt, sagt sie zwischen zwei Weinkrämpfen hinein, und dann sagt sie erst einmal lange nichts mehr, sondern vergräbt sich in die Kissen, und der Fiechter wünscht sich für ein paar Augenblicke zurück in den Adler vor ein Bier. Weil er nicht weiss, was er tun soll, macht er einfach nichts und wartet, bis die Tränen und das Schluchzen abgelöst werden von einem Schniefen.
Es liege nicht an ihm, sagt sie schliesslich, es sei ihr Problem. Sie habe da diesen komischen Tick, und kein Mann könne damit umgehen. Sie reise umher, von Stadt zu Stadt, auf der Suche nach dem, der ihr das geben könne, was sie brauche, aber es fange schon damit an, dass keiner verstehe, wovon sie überhaupt rede, und das mache die Sache nicht einfacher.
Der Fiechter versteht kein Wort, aber er nickt vorsichtshalber verständnisvoll und seufzt ein bisschen, als würde er das Problem kennen. Aber dann fällt ihm ein, dass er vielleicht doch nachfragen sollte, denn wenn die Frau auch bei ihm nicht findet, was sie offenbar so verzweifelt sucht, dann ist es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass sie wieder weiterzieht, weg von ihm, weg aus Rättigen, dass sie weitersucht, und dass er dann diese zarte Haut nie wieder spüren wird, dass ihm niemand mehr seine Wünsche erfüllen wird, kaum sind sie ihm durch den Kopf gegangen, und dass wieder niemand mit ihm sprechen wird, wenn er nach Hause kommt. Also schaut er sie jetzt doch an, fragend, er muss eine Weile schauen und ihrem Blick standhalten, bis sie die Augen niederschlägt und zu erzählen beginnt.
Es sei verruckt mit ihr, aber es sei niemals anders gewesen. Man könne lieb mit ihr sein, einfühlsam, gefühlvoll, der beste Liebhaber, sie habe doch nichts von der ganzen Übung, nichts mache ihr wirklich Spass, sie sei wie eine leere Hülle. Nur etwas gebe es, das sie wirklich errege, das ihr gut tue, aber weil niemand wirklich verstehe, was das sei, könne es ihr auch keiner bieten.
Was? Der Fiechter ist jetzt ganz eifrig, er sitzt auf im Bett und nimmt ihre Hand. Was denn?
Geschichten, sagt die Frau. Nur Geschichten.
Geschichten? Der Fiechter spürt den Klumpen, der sich in seinem Hals zu bilden scheint, er wird grösser und grösser.
Geschichten, sagt die Frau. Sie wolle Geschichten hören, von Menschen, von Dörfern, wahre Geschichten, Schicksale, Leben, Sterben, Glück, Unglück. Einfach Geschichten. Aber heute habe niemand mehr wirkliche Geschichten, alle plappern nur nach, was sie irgendwo gehört oder gelesen haben, keiner kann mehr wirklich erzählen, jede Geschichte habe sie schon einmal irgendwo gehört, sie wolle neue Geschichten, das sei das einzige, was sie befriedige, und sie werde solange durch die Welt ziehen, bis sie den Mann finde, der ihr Geschichten erzählen könne, die sie noch nicht kenne.
Der Fiechter schüttelt langsam den Kopf. Er atmet durch die Nase, weil ihm der Klumpen den Mund versperrt. Er kann jetzt gar nicht reden, selbst wenn er es gewollt hätte, aber er will auch nicht, um keinen Preis der Welt, er will endlich wieder schlafen können, er will diese Geschichten vergessen, die ihn Nacht für Nacht quälen, er will sich gar nicht ausmalen, was erst passiert, wenn er diese Geschichten von dort hervor holt, wo sie schlummern, wie abgedeckt mit einer dünnen Spanplatte, aber wenn er zulässt, dass er zu sehr an sie denkt, an diese Geschichten, dann zersplittert diese Platte
und alles wird nach oben geschwemmt und in seinen Kopf gespült. Das hält er nicht aus.
Aber dann geht sie. Wenn er den Mund nicht aufmacht, geht die Frau. Er weiss nicht einmal, wie sie heisst, sie haben ja kaum geredet, er weiss nur, dass er sie nicht vergessen wird, wenn sie gegangen ist, und wahrscheinlich wird er dann erst recht nicht schlafen können, aber wenn er macht, dass sie bleibt, dann spürt er diese zarte, warme Haut jede Nacht, und vielleicht schläft er dann endlich wieder, obwohl die Frau die Geschichten in seinen Kopf zurückspült, wo sie gopferdammi nicht hingehören, sie
gehören gejagt und gefangen und weggesperrt, diese Geschichten, aber das geht nicht, sie sind da, und wenn er damit diese Frau hier bei sich hält, dann lässt er sie eben wieder in seinen Kopf, was solls, er raucht wie ein Bürstenbinder, der Fiechter, so viele Jahre hat er sowieso nicht mehr, denkt er, und ein bisschen zarte Haut in den letzten Jahren, das ist mehr, als er sich jemals hat träumen lassen.
Er habe Geschichten, sagt der Fiechter schliesslich. Viele Geschichten. Sie seien aus einem Buch, dass sie, die Frau, bestimmt nie gelesen habe, und sie werde es auch niemals lesen, denn es habe nur ein einziges Buch mit diesen Geschichten gegeben, ein Exemplar nur, und das sei verbrannt, und der, der die Geschichten geschrieben hat, der sei tot, lange schon.
Wahre Geschichten? Die Frau schaut den Fiechter gespannt an, ihre Augen leuchten, erst jetzt fällt es dem Fiechter auf, dass ihre Augen bis zu diesem Moment stumpfe Flecken gewesen sind.
Weiss nöd. Und er weiss es wirklich nicht. Vermutlich. Es seien Geschichten aus Rättigen, und auch wenn er nach der Lektüre nicht geglaubt habe, dass sie alle wirklich passiert sind, so sei es doch unwahrscheinlich, dass sie sich jemand ausgedacht habe, alle zusammen. Also seien es wohl wahre Geschichten. Aber keine schönen. Ganz und gar keine schönen. Es seien Geschichten, die müsse man zu Ende lesen oder sich zu Ende anhören, wenn man einmal damit angefangen habe, aber kaum habe man sie zu Ende gelesen oder angehört, da wolle man sie auch schon wieder vergessen. Verzell, sagt die Frau, und jetzt ist das Leuchten in ihren Augen ein Brennen.
Verzell.
Unmöglich. – Der Bannwart sagt es fest und bestimmt und laut und zackig. – Unmöglich. – Um 10 sei Gottesdienst, das sei schon immer so gewesen, und er werde nicht zulassen, dass man in seinem Dorf wichtige Termine einfach verlege, nur weil sich ein paar Leute aus der Stadt so wahnsinnig wichtig vorkämen. Nach dem Gottesdienst, so um 11 Uhr, schätze er mal, es komme drauf an, wie redefreudig der Pfarrer Gnädinger sei, könne man dann über die Rättiger verfügen.
Soso, sagt der Rothenbühler von der Kantonspolizei und wischt sich den Schweiss von der Stirn. Es herbschtelet, es ist erst halb zehn Uhr morgens und überhaupt nicht heiss, aber der Rothenbühler hat geschätzte 150 Kilogramm auf den Rippen und hat heiss vom Aufstehen bis zur Nachtruhe, und in der Nacht genau genommen auch. Soso, sagt er noch einmal, der Kantonspolizist, und wirft seinen uniformierten Kollegen einen verzweifelten Blick zu. Die auf dem Land machens einem immer schwer, sagt der Blick, und die Kollegen nicken verständnisvoll.
Man solle sich in Ruhe in den Adler zu einem Kaffee setzen, schlägt der Rothenbühler dem Gemeindepräsidenten jetzt vor, dazu sei noch Zeit vor der Kirche, und dann werde er ihm erklären, was er wolle und wieso er es wolle und dass das nichts damit zu tun habe, dass er aus der Stadt komme, sondern dass er nur seine Arbeit mache.
Der Bannwart grummelt etwas, bevor er unwillig nickt. Der Haslinger, der Gemeindeschreiber, solle aber mitkommen, sagt der Bannwart, das gehöre sich so, wenn man etwas Amtliches mache. Der Rothenbühler nickt, es ist ihm denkbar egal, ob dieser Haslinger dabei ist oder nicht, er will einfach so schnell wie möglich wieder raus aus diesem Kaff, nach Hause unter die kalte Dusche, das tut immer so gut, nur dass er wieder heiss hat, kaum ist er aus der Dusche geklettert, es ist wirklich ein Klettern beim Rothenbühler, aber immerhin, im ersten Moment tut sie gut, die Dusche, und darauf freut er sich, der fette Mann, aber er weiss, dass es gut und gern noch einige Stunden dauern wird.
Kurz darauf sitzen der Rothenbühler, der Bannwart und der Haslinger vor Kafi und Gipfeli im Adler. Der Langenthaler hat ihnen die Sachen wortlos hingestellt und ist dann wieder hinters Buffet geschlichen, wie ein geschlagener Hund, denkt der Bannwart und wundert sich, aber da beginnt der Rothenbühler auch schon mit seiner kleinen Rede. Dann halte man diesen Gottesdienst eben um 10 ab, sagt der Polizist, von mir aus, dann gedulde man sich halt bis 11, aber danach erwarte er volle Kooperation von den Gemeindebehörden. Immerhin seien er und seine Kollegen von der Kantonspolizei seit den frühen Morgenstunden hier und auf den Beinen, man arbeite mit Hochdruck, da dürfe man wohl ein bisschen Unterstützung erwarten.
Der Haslinger stellt das Kafitässli ab, der Kaffee ist ihm noch zu heiss, und fixiert den Rothenbühler. Wie er das meine: Unterstützung. Er und der Bannwart und auch die restlichen Mitglieder des Gemeinderates seien keine Polizisten, man zahle Steuern, damit der Kanton Polizisten einstelle und die dann ihre Arbeit machen, gefälligst, aber mehr könne er, der Rothenbühler, wohl nicht von ihnen verlangen.
Der Rothenbühler greift zur Tasse, aber auch er merkt, dass der Kaffee noch süttig heiss ist, und das letzte, was er in dieser gottsjämmerlichen Hitze in dieser Dorfbeiz noch braucht, ist ein Gutsch heisser Kafi in den leeren Magen, dann schon lieber das Gipfeli, da beisst er jetzt rein und kaut und schaut den Haslinger an und überlegt und schluckt und kaut und beisst sicherheitshalber noch ein Stück ab und kaut und schluckt und kaut und redet schliesslich, während er die Brotbrösmeli vor sich auf dem Tisch
sorgfältig mit den dicken Fingern zusammenwischt.
Niemand müsse hier die Arbeit der Polizei machen, niemand ausser der Polizei selbst. Das sei keine Frage. Aber man habe es hier mit einer rätselhaften Tat zu tun, zwei Schwerverletzte habe man nach Mitternacht im Alois-Heim vorgefunden und ins Kantonsspital in der Stadt gefahren, und dann, kaum ist die Ambulanz abgefahren und hat das Dorf hinter sich gelassen, hätten beide gleichzeitig den letzten Atemzug gemacht. Dazu komme ein Pfleger, der zwar unverletzt, aber ganz offensichtlich vom
Schock getroffen und verwirrt sei. Er wolle nicht dramatisieren, aber letzte Nacht sei hier im Dorf geschossen worden, und jetzt wolle man bei den Leuten ein bisschen herumfragen und recherchieren und untersuchen, das sei ja wohl nur natürlich. Die beiden Schussopfer seien bekanntlich inzwischen tot und von daher also keine grosse Hilfe, auch wie sie noch gelebt haben, als die Polizei im Alois-Heim angerückt ist, habe man den beiden nichts Vernünftiges entlocken können. Die alte Frau habe trotz
ihrer drei Löcher im Kopf dauernd mit den Beamten jassen wollen, und dieser andere, der Feller, der ja offenbar auf die Frau geschossen habe und sich danach das Leben habe nehmen wollen, der habe zwar kurz vor seinem Tod aufmerksam zugehört, wenn man ihn etwas gefragt hat, aber reden können habe er ja schlecht, nachdem er sich den halben Kiefer weggeschossen habe. Also sei man angewiesen auf Beobachtungen aus der Bevölkerung.
Eben, sagt der Haslinger, weil der Bannwart gerade den Mund voll Gipfeli hat, das sei ja kein Problem, aber ganz sicher nicht gerade dann, wenn ein anständiger Rättiger in der Kirche sei. Das habe doch bestimmt noch ein Stündchen Zeit. Ausserdem, er wolle sich da wirklich nicht einmischen, aber das müsse nun doch gesagt sein, ausserdem werde da ja nun wirklich etwas übertrieben bei der ganzen Sache. Morgens um ein Uhr den Gemeindepräsidenten aus dem Bett zu holen, das halbe Dorf zu beleuchten, das Alois-Heim nahezu zu evakuieren – das sei schon etwas viel. Gut, ja, was passiert sei,
das sei tragisch, aber andererseits spreche man hier ja von einer alten Frau, die ohnehin bald das Zeitliche gesegnet hätte, und von einem brutalen Schiesswütigen, der wohl recht daran getan habe, die Pistole gegen sich selbst zu richten, wenn das auch, man müsse es in aller Deutlichkeit sagen, nicht auf Anhieb und erst mit etwas Verspätung dann auch geklappt habe.
Der Rothenbühler greift zum dritten Gipfeli, und weil der Stundenzeiger der Zehn immer näher rückt, redet er jetzt auch mit vollem Mund statt nur zwischen zwei Bissen. Ob die Frau sowieso bald das Zeitliche gesegnet hätte, ob der Tod vom Feller das Beste gewesen sei: Das alles zu beurteilen, das sei nicht seine Sache, er habe einen Auftrag, und der laute, herauszufinden, was hier passiert sei und warum. Man kenne den mutmasslichen Täter, stimmt schon, aber was derzeit noch fehle, sei ein Motiv. Also werde er hier im Dorf herumfragen müssen. Dass das ihnen, dem Bannwart und dem Haslinger, nicht gefalle, das sei wohl klar, jeder habe am liebsten Ruhe in seinem Dorf, aber es sei nicht die Schuld der Polizei, dass diese Ruhe gestört ist, er, der Rothenbühler, habe ja nicht herumgeschossen mitten in der Nacht, soviel sei sicher.
Der Bannwart deutet auf die Uhr an der Wand gegenüber, und der Haslinger nickt. Die beiden stehen auf und fragen den Polizisten, ob er nicht mitkommen wolle in die Messe, der Pfarrer Gnädinger sei ein guter Prediger. Der Rothenbühler winkt ab und greift zum nächsten Gipfeli. Das sei lieb gemeint und er schätze das Angebot, aber er mache sich lieber noch ein paar Gedanken über diesen Fall, bevor er dann später die Rättiger befrage, und er wolle nicht im Kirchenbank sitzen und so weltliche Gedanken
haben, das gehöre sich nicht, da bleibe er lieber an einem weltlichen Platz.
Schon recht, sagt der Bannwart, und der Haslinger nickt, schliesslich gehen beide zur Tür heraus, und der Rothenbühler sieht, wie sie zusammen mit dem restlichen Volk in die Kirche gegenüber vom Adler strömen. No en Kafi, ruft der Polizist dem Langenthaler zu, der vom Buffet aus schweigend zugehört hat. Das Tässli ist zwar noch fast voll, aber inzwischen dürfte der Kafi kalt ein. Der Wirt nimmt eine Flasche Mineralwasser, füllt ein grosses Glas, kommt hinter dem Buffet hervor und stellt das Glas vor den Rothenbühler. Der schaut den Langenthaler verwundert an. Ob er ihn nicht richtig verstanden habe, er habe laut und deutlich en Kafi bstellt.
Der Langenthaler setzt sich ungefragt neben den Polizisten. Trinked, sagt er und nickt aufmunternd. Probiered.
Der Rothenbühler nimmt das Glas. Es sei wohl besser, denkt er sich, denen auf dem Land nicht zu widersprechen. In so einem Kaff werde schnell mal geschossen, das habe man gesehen. Er hebt das Glas und schnuppert ein bisschen daran, und wenn er nicht selber genau sehen würde, dass das da im Glas klares und reines und farbloses Wasser ist, er würde schwören, er habe einen ungewöhnlich starken Kaffee vor sich. Trinked. Der Langenthaler grinst, aber es ist ein freudloses Grinsen. Der Rothenbühler setzt an und nimmt einen Schluck, aber dann stellt er das Glas ruckartig auf den Tisch
zurück. Heiss ist es, süttig heiss, die Lippen und die Zunge hat er sich verbrannt, und stark ist der Kaffee, der aussieht wie Mineralwasser, stark wie nichts, was der Polizist jemals in seinem Leben getrunken hat. Was isch das, entfährt es dem Rothenbühler. Vielleicht, sagt der Langenthaler, und er grinst jetzt noch breiter und noch freudloser, vielleicht predige der Gnädinger heute ja über die wundersame Verwandlung von Wasser in Wein. Er selbst, der Langenthaler, sei damals zwar nicht dabei gewesen, aber er könne sich schon vorstellen, dass das funktioniere. Seit heute Nacht glaube er
eigentlich an so ziemlich alles. Denn seit heute Nacht sei alles, was hinter dem Buffet oder im Keller in der Küche stehe und trinkbar sei, Kaffee. Schlicht und einfach Kaffee. Ob er nun eine Stange Bier abzapfe oder einen guten Tropfen aus dem Weinkeller hole oder was auch immer: Alles sei heisser, starker Kaffee. Man rieche es ja auch in der ganzen Beiz, so nach Kafi gstunke habe es noch nie hier drin. An so einem Sonntagmorgen, wo jeder Gast zuerst einmal nach einem Kaffee ruft, sei das gut
und recht, aber was, wenn das Kirchvolk zum Frühschoppen kommt und etwas mit weniger Bohnen und mehr Promille trinken will? Was dann?
Der Rothenbühler schaut den Wirt prüfend an, aber der scheint das alles ernst zu meinen. Was denn heute Nacht passiert sei, fragt der Polizist, dass man heute im Adler plötzlich aus Bierhähnen und Mineralwasserflaschen Kafi serviert bekomme?
Einiges, sagt der Langenthaler trocken. Aber er könne sich nicht mehr an alles erinnern. Ihm komme es ein bisschen so vor, als wäre sein Hirn ein Schwamm, der gierig alles aufgesaugt hat, was er gesehen hat, aber jetzt windet irgendeiner diesen Schwamm aus, bis zum letzten Tropfen, und so weiss er nur noch einiges, und anderes ist verblasst oder ganz weg.
Dann solle er eben das sagen, was noch nicht ausgepresst sei, meint der Rothenbühler. Es sei ja eine wilde Nacht gewesen in Rättigen, soviel habe der Wirt ja wohl auch mitgekriegt, es spreche sich ja herum, auch wenn die Polizei eigentlich nichts durchsickern lassen wolle, aber einige Leute seien im Zuge der Ermittlungen ins Vertrauen gezogen worden, und dann brauche es in so einem Kaff ja nicht viel, und plötzlich wisse jeder alles. Eine wilde Nacht sei es also gewesen, und deshalb interessiere ihn alles, was passiert sei in dieser Nacht.
Der Fiechter sei da gewesen, daran erinnere er sich noch genau, sagt der Langenthaler. Hier im Adler sei er gesessen, wie an jedem Samstagabend. Wer der Fiechter sei, fragt der Rothenbühler. Der arbeite bei der Gemeinde, er sei dort das Mädchen für alles, sagt der Wirt, der Fiechter kratze tote Katzen von der Strasse und repariere das Dach vom Gemeindehaus, wenn es mal wieder reinregne und so weiter. Der sei also hier gewesen, aber nach ein paar Bieren bald wieder gegangen. Nicht alleine allerdings.
Der Polizist horcht auf. Wieso er das so schicksalsschwanger sage, will er wissen. Es habe ihn wohl einfach ein Saufkumpan für die nächste Beiz abgeholt.
Der Langenthaler schaut den Polizisten triumphierend an. Eben nicht. Der Fiechter sei eher der Einzelgänger, der rede nur, wenn man ihn etwas frage, der trinke immer allein und stiere in sein Bier und studiere weiss der Herrgott an was herum. Nein, der Fiechter habe keine Saufkumpanen. Dafür, und jetzt beugt sich der Langenthaler ganz nah zum Rothenbühler, so dass dem eine Wolke aus schwerem Kaffeeduft entgegen weht, dafür habe der Fiechter neuerdings eine Freundin.
Schön, erwidert der Rothenbühler und lehnt sich etwas zurück im Stuhl, um wieder frische Luft zu atmen. Das gönne er dem Mann, auch wenn er ihn nicht kenne. Aber so ungewöhnlich scheine ihm der Vorgang nun auch wieder nicht. Da habe dieser Fiechter also eine Freundin. Und?
Erstens, sagt der Langenthaler und hebt den Zeigefinger hoch, dass er ein bisschen aussieht wie ein Schulmeister, erstens habe der Fiechter noch nie etwas mit einer Frau zu tun gehabt. Das wisse jeder im Dorf. Und zweitens, der Langenthaler nimmt den Mittelfinger zu Hilfe, sei es nicht irgendeine Frau gewesen. Sie sei wunderschön, gut gekleidet, so ein bisschen eine edle Erscheinung, jedenfalls keine, die auf Leute vom Land stehe. Und drittens, der Langenthaler präsentiert nun auch noch seinen Daumen, sei es eine fremde Frau gewesen. Das sei an sich schon bemerkenswert, weil er hier im
Adler nur Stammgäste habe. Da falle eine Fremde auf, vor allem, wenn sie ein grosses Bier kippe, als sei es Wasser und dann mit dem Fiechter im Schlepptau verschwinde.
Der Rothenbühler hört sich das alles an und denkt nach. Normalerweise wäre es ihm höchst egal, wer hier in dieser Beiz ein- und ausgeht, aber er weiss selbst, dass Fremde nur selten gesehen werden in Dorfbeizen, und eine Frau, noch dazu allein, das ist schon eine Nachricht in so einem Kaff. Dass die Frau genau in der Nacht hier auftaucht, als im Alois-Heim geschossen und fast gestorben wird, das ist für den Polizisten schon mehr, als er an Zufall gelten läst.
S’isch guet, sagt der Rothenbühler zum Wirt und steht auf. Er danke ihm für die Information. Er werde noch ein wenig durchs Dorf spazieren, bis der Gottesdienst vorbei ist. Vielleicht schaue er auf dem Weg noch schnell bei diesem Fiechter in Haus. Wo der denn wohne, will der Rothenbühler wissen. Der Langenthaler, der gerade aufgestanden ist und wieder hinter dem Buffet verschwinden will, schaut den
Polizisten an. Der Fiechter? Er könne ihm schon sagen, wo der wohne, aber weshalb er das denn wissen wolle.
Er habe schon ein paar Fragen an den Mann, gibt der Rothenbühler zurück, die Sache mit der fremden Frau sei gspässig. Fremdi Frau, sagt der Wirt fragend und schüttelt den Kopf. Der Fiechter habe doch seinen Lebtag lang nie etwas mit einer Frau gehabt, das wisse das ganze Dorf. Wie er denn auf die Idee komme.
Der Rothenbühler will etwas erwidern, da fällt ihm das mit dem Schwamm ein, der im Kopf vom Wirt sitzt und den jemand auswindet. Ein verrücktes Dorf, dieses Rättigen. Aber er soll vergessen, was er will, der Langenthaler. Das Wichtigste, denkt sich der Polizist, hat er ja schon gesagt.
Es tagt. Es ist eine lange Nacht gewesen. Die längste seines Lebens vielleicht. Der schweigsame Fiechter hat geredet und geredet, erzählt und erzählt. Gelitten hat er dabei wie ein Hund, aufhören hat er wollen, immer wieder, aber bitte, dann hat ihn die Frau jedes Mal ganz fassungslos und verzweifelt angeschaut, und er hat gewusst, dass er sie verliert, wenn er nicht weiter redet, und deshalb hat er genau das getan. Geredet. Erzählt. Hat die harmloseren Anekdoten aus diesem Rättigen zuerst genommen, hat versucht, sie abzuschwächen, hat sie ein bisschen anders erzählt, aber immer wieder ist dieser Blick von der Frau gekommen, ein ernüchterter Blick, ohne jede Erregung, als wüsste sie, dass der Fiechter den Hauptteil ausspart, als würde ihr das den Spass verderben, oder nein, nicht den Spass, sie lacht nicht, die Frau, nein, der Fiechter kanns nicht in Worte fassen, oder doch, er kann, aber er will nicht, sagen würde er das niemals, aber es ist unmöglich, an etwas nicht zu denken, an das man auf keinen Fall denken will, je weniger man daran denken will, desto mehr denkt man daran, dass man nicht daran denken will, und so denkt er es unaufhörlich, es ist ja auch das richtige Wort, es ist nur, dass er es nie benutzt hat, weil er es nur vom Hörensagen kennt, aber das hier ist genau das und nichts anderes, kein Zweifel, das ist aufrichtige und pure Geilheit. So, wie er in eine andere Welt eingetaucht ist, als er sich in der Nacht auf und in dieser fremden Frau hat austoben dürfen, so taucht die Frau weg, wenn er ihr Geschichten erzählt, böse und blutige und unbarmherzige Geschichten aus der Rättiger Dorfchronik, und wehe, er schwächt sie ab, da verschwindet sie schon aus den Augen der Frau, die Geilheit. Und wenn die verschwindet, verschwindet bald die ganze Frau.
Also. Alles tun, dass sie bleibt. Alles. Noch eine Geschichte.
Verzell. Verzellverzellverzell. Bitte. Verzell.
Sie sagt es nicht. Ihre Augen sagen es. Dann halt. Noch eine Geschichte. Wenn das nicht reicht, wenn sie dann nicht gewonnen ist, dann gibt der Fiechter auf, dann ist die Aufgabe grösser als er, dann ist er lieber wieder allein. Er zahlt einen hohen Preis, sowieso. Aber nicht jeden. Noch eine Geschichte. Noch eine. Aber nicht irgendeine. Die schlimmste. Die Geschichte, vor der er davon läuft, seit er sie gelesen hat. Die ihn um den Schlaf bringt. Die ihn zum Bier treibt. Die ihn zur Verzweiflung treibt.
Die Geschichte –
– vom Karl Granwehr.
Rättigen um 1930. Kirche, Schule, Gemeindehaus, eine Strasse rauf zur Stadt, eine Strasse runter zum See. Viel mehr ist da nicht. Am äussersten Dorfzipfel Richtung See, gleich beim Meierli-Wald, der so genannt wird, weil der Geni Meier sich dort Jahrzehnte vorher das Leben genommen hat, aber das ist eine andere Geschichte, die zu erzählen dem Fiechter wesentlich leichter gefallen wäre, jedenfalls gleich beim Meierli-Wald lebt der Karl Granwehr, genannt Kari, Bauer und Einsiedler und Einzelgänger und ein komischer Kerl, wenn man den anderen Leuten im Dorf glaubt. Hat in seiner Kindheit viel Schlechtes getrieben und im Spiel seinem eigenen Bruder das Leben genommen. Das muss so um 1900 gewesen sein. Auf dem Dach vom Stall ist man herumgeturnt, hat an nichts Böses gedacht, bis der Hansueli, der Bruder vom Kari, plötzlich abgerutscht ist. Der Kari hat ihn noch zu greifen bekommen, und weil der Hansueli der kleinere von den beiden gewesen ist, hätte er ihn sogar hinaufziehen können, einen Schrecken hätte er gehabt, der Kleine, kaum acht Jahre alt, der Kari war
elf, einen Schrecken, aber mehr nicht, nur dass der Hansueli, als er da so halb vom Dach herunter gehangen ist und sich vom Kari wieder hat raufziehen lassen und gemerkt hat, dass keine Gefahr mehr droht, dass der Hansueli da einen faulen Spruch hat fahren lassen, dass er gesagt hat, er, der Kari, habe eigentlich schon noch verdammt abstehende Ohren, wenn er ihn da so von unten her anschaue. Und der Kari hat keine Sekunde nachgedacht und hat die Hand von seinem Bruder losgelassen, und der
Hansueli ist vom Dach gesegelt wie ein Stein und hart aufgeschlagen auf dem Boden vor dem Stall und war tot, noch bevor der Kari wieder runtergeklettert ist.
Von da an hat der Karl Granwehr, genannt Kari, nicht mehr viel gesprochen. Hat etan, was ihm zuhause aufgetragen worden ist, ist zur Schule gegangen, hat danach eim Vater gearbeitet, den Hof übernommen, als Vater und Mutter innerhalb von enigen Wochen an Lungenentzündung gestorben sind, hat das kleine Stück Land lleine bewirtschaftet, hat nie nach einer Frau gefragt oder gesucht, ist nicht in die Beiz nd an keinen Tanz, hat sich nur ganz selten im Dorf sehen lassen, hat gelebt von dem, was der Hof hergegeben hat.
Und hat zu Gott gefunden.
Manchmal, an stillen Sommerabenden, wenn es bis spät noch hell gewesen ist, dass es einen ins Bett getrieben hat, da hat der Kari Granwehr ein Gefühl erlebt, dass er kaum bekannt hat, so eine komische Sache, die in seinem Kopf gesessen und herumgeturnt ist, keine Sache, ein Loch mehr, ein Nüüt. – Langeweile. – Dem Kari Granwehr ist langweilig gewesen. Und weil die Arbeit gemacht gewesen ist, hat er sich an seine Jugend erinnert, daran, dass ihm der Lehrer einst mit Müh und Not das Lesen beigebracht hat, und da hat sich der Kari aufgemacht und das Haus auf den Kopf gestellt und Bücher gesucht. Einfach wars nicht. Auf dem Granwehr-Hof hat nie einer gross gelesen, und so ist die Ausbeute dann auch mager ausgefallen. Zwei Bücher hat er gefunden, der Kari. Eine Bibel, wie sie jeder rechte Bauer zuhause hat, aber die ist so dick gewesen, da hat sich der Kari nicht herangetraut. Und dann ein Buch über Engel. Ein dünnes Bändchen nur, und dazu mit vielen Bildern – das ist die richtige Lektüre gewesen für den Kari Granwehr. Also hat er das Büchlein gelesen, und weil es erstaunlich flüssig gegangen ist, das Lesen, hat er es danach gleich noch einmal verschlungen und noch einmal und dann noch ein letztes Mal, bevor er dann endlich ins Bett gegangen ist, aber schlafen konnte er noch immer nicht, die Engel haben ihn nicht losgelassen.
Von diesem Tag an hat der Kari Granwehr gewusst, dass es Engel gibt, dass sie unter uns sind, dass sie einem helfen in schlechten Zeiten, aber nur denen, die auch an sie glauben. Und der Kari hat geglaubt. Und wie er geglaubt hat. Es ist ja auch keiner da gewesen, der es ihm hätte ausreden können.
In dem Büchlein ist gestanden, dass jeder, der wirklich an sie glaubt, die Engel sogar sehen kann. Man müsse nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Engel, hiess es da weiter, seien dienstfertig und kämen angerauscht, wenn man sie rufe. So manch ein Ungläubiger habe in Not unbewusst zu den Engeln gerufen und sei gerettet worden, aber natürlich seien sie nicht sichtbar gewesen, die Engel, hat das Büchlein gesagt, denn ein Ungläubiger, der hätte den Anblick eines Engels gar nicht ausgehalten. So strahlend, so voller Liebe und Güte und Geheimnisse, das halte nur aus, wer an Engel glaube.
Und weil der Kari Granwehr so sehr an Engel geglaubt hat, ist er hingegangen und hat es versucht. Er ist mitten am Tag ans Fenster gestanden und hat nach einem Engel gerufen. Er glaube wiä verruckt, im Fall, rief er aus, und er würde jetzt schon ganz gerne Besuch bekommen von einem Engel, er habe grad nicht so furchtbar viel zu tun.
Und in dem Moment ist ein Engel des Weges gekommen. Der Kari Granwehr hat sofort gesehen, dass es ein Engel ist. Wie Engel aussehen, hat er gewusst, denn in dem Büchlein waren Bilder. Kleine, weiss gekleidete Mädchen mit blonden Haaren und kleinen, zarten Flügeln sind da gezeichnet gewesen, und alle haben so lieb geschaut, dass es dem Kari Granwehr ganz anders geworden ist.
Und hier kommt so eine kleine, weisse Gestalt mit langen blonden Haaren und einem lieben Gesicht und spaziert geradewegs an seinem Hof vorbei. Hopp, ruft der Kari Granwehr und fällt vor Eifer fast aus dem Fenster, du da, Engelchen, hier bin ich. Und die kleine Gestalt sieht sich um und entdeckt den Bauern im Fenster und lächelt und winkt ihm fröhlich zu und geht weiter.
Der Kari Granwehr hat Freudentränen in den Augen und ganz rote Wangen. Das Engelchen hat ihm zugewunken. Gut, ja, es hat nicht angehalten, es ist nicht ins Haus gekommen und hat nicht vom Birewegge probiert, den der Kari an diesem Tag gemacht hat, aber das wäre wohl auch zuviel verlangt gewesen, so ein Engelswesen hat ja viel zu tun den ganzen lieben langen Tag, er ist ja wohl nicht der einzige, der gerne Besuch hat von einem Engelchen. Und es ist doch schon ein schönes Gefühl zu wissen, dass man recht hat mit seinem Glauben und dass es stimmt, was das Büchlein sagt: Ruf nach einem Engelein, und es kommt zu dir.
Von diesem Tag an ist der Kari Granwehr anders gewesen. Er hat sich wieder öfter ins Dorf getraut, hat dort im Lädeli eingekauft, auch mal ein Einerli Roten getrunken in der Beiz. Am Anfang haben sie ihn misstrauisch beäugt, die Rättiger, weil er sich jahrelang nicht hat blicken lassen, und dann ist da die Geschichte mit dem kleinen Hansueli, es ist nie ganz klar geworden, was damals passiert ist, aber der Kari ist auch auf dem Dach gewesen, als sein Bruder runtergefallen ist, soviel weiss man, und dass
er jähzornig ist wie eine Mohre, das ist auch bekannt, darum ist man gar nicht so böse gewesen, dass er sich nicht mehr hat blicken lassen im Dorf, und jetzt steht er plötzlich da und tut, als hätte er immer dazu gehört.
Aber mit der Zeit wird der Kari ein gern gesehener Gast in Rättigen. Erst hat er zwar nicht viel Geld, das er in der Beiz verprassen könnte, aber er macht den besten Birewegge weit und breit, und eines Tages fragt ihn der Bäcker Gerschwiler, ob er ihm nicht ein paar Birewegge machen würde, die könnte man wunderbar verkaufen im Laden, und aus dem Gewinn mache er halbehalbe mit dem Kari, dann sei beiden geholfen. Und so beginnt der Kari, im Akkord Birewegge herzustellen, von weit her kommen Leute in die Bäckerei Gerschwiler für die Leckerei, und plötzlich klimpern beim Kari Granwehr im Hosesack immer mehr Münzen, und jetzt sieht man ihn auch in der Beiz gern, und es ist nur logisch, dass er dort nicht immer nur so viel trinkt, wie es ihm gut tun würde.
An einem Abend sitzt der Kari Granwehr im Adler, den es damals schon gegeben hat, und bechert zügig. Zuerst ein paar Einerli Roten, dann wirft einer eine Runde Bier auf, und der Kari stellt geschwind auf Hopfen und Malz um, aus einem Bier werden vier oder fünf, bis er findet, man sollte nicht soviel durcheinander trinken und deshalb doch lieber wieder zu Rotwein wechselt.
Gegen Mitternacht ist der Kari Granwehr ganz schön verladen und will sich auf den Heimweg machen, solange er den noch findet, als ihn plötzlich der Lenggenhager fragt, was er eigentlich so treibe, wenn er nicht gerade im Adler den Durst ausmerze, er sitze da ja so allein auf seinem Hof unten beim Meierli-Wald, das müsse doch eine einsame Sache sein. Der Kari Granwehr winkt ab und sagt mit schwerer Zunge, er sei keineswegs allein, wenn es ihm nach Gesellschaft sei, dann rufe er einfach nach Gesellschaft, und schon stehe die vor der Tür.
Jetzt horcht der ganze Tisch, der Lenggenhager ist neugierig geworden und fragt weiter. Was denn, ob der Kari am Ende eine heimliche Liebschaft habe.
Der Granwehr blickt verlegen zu Boden, und am Tisch wird gekichert und geflüstert. So en Seich, sagt der Granwehr schliesslich. Mit Weibsbildern habe er nichts am Hut, keine Zeit, er müsse sein Land bewirtschaften und Birewegge im Akkord machen, da habe er keine Zeit für Frauengeschichten, und überhaupt, bis da eine Frau in den Granwehr-Hof einziehe, müsse sie schon etwas zu bieten haben, sie müsse der Mutter, Gott habe sie selig, das Wasser reichen können, sonst komme sie ihm nicht ins Haus.
Ja dann, sagt der Lenggenhager und lächelt listig, sei es am Ende keine Frau, sondern ein Mann? Jetzt lacht der ganze Tisch schallend, und der Granwehr wird hässig und chlöpft mit der Faust auf den Tisch, dass die Gläser und Flaschen nur so hüpfen, hör uuf, sagt er, fertige Chabis, er sei ein aufrechter Mann und kein Sauhund, der anderen Männern aufs Füdli schiele, und überhaupt, der Lenggenhager und die anderen hätten ja keine Ahnung von den Geheimnissen des Lebens, sie seien Ungläubige, rennen in die Kirche am Sonntag, aber von den wahren Wundern Gottes wüssten sie nichts, er hingegen, der Kari Granwehr, sei ganz nah bei Gott, er habe seinen Weg gefunden, es reiche, wenn er ein Wort sage, und schon sei Gott bei ihm, nicht selbst natürlich, dafür habe er zuviel zu tun, aber seine Engel kämen, wann immer er, der Granwehr nach ihnen rufe, einer auf jeden Fall, ein Engelein, so schön, dass es kaum auszuhalten sei, er habe es versucht vor ein paar Monaten, mit all seinem Glauben, und siehe da, da sei as Engelchen vor der Tür gestanden, und davon könnten sie alle hier am Tisch ja wohl nur träumen.
Ganz still ist es geworden im Adler, alle schauen den Kari Granwehr an, wie er sich in Wut geredet hat, der Alkohol tut seine Wirkung, er redet wirres Zeug von Engeln, sie haben ja gewusst, dass er nicht alle Sinne beieinander hat, aber man hat doch gehofft in der letzten Zeit, dass er auch ganz anders kann, und jetzt spinnt er wieder, aber gut, mag sein, vielleicht ist es wirklich nur der Alkohol. Am besten wirds sein, denken die anderen, man lässt ihn in Frieden ziehen und seinen Rausch ausschlafen, morgen wird er wieder seine Birewegge für den Bäcker Gerschwiler machen und sie ins Dorf bringen und sein Einerli trinken, und alles wird vergessen sein.
Aber der Lenggenhager hat Blut gerochen. Engel, sagt er und schaut verdutzt. Soso. Er habe ja als Kind in der Schule auch gehört, dass es die gebe, warum auch nicht, er glaube an Gott und Jesus Christus und den Heiligen Geist und die Muttergottes und den Papst in Rom, da könne er genau so gut auch an Engel glauben. Keis Problem, sagt der Lenggenhager und hat ein heimlifeisses Lächeln im Gesicht. Aber er höre zum ersten Mal, dass man einen Engel bestellen könne wie den Pfarrer für die letzte Ölung. Das sei ganz erstaunlich. Ob er, der Kari, ihm und den anderen das nicht schnell vorführen könne, das müsse ja ein Ereignis sein, wenn man da nach einem Engel rufe, und dann komme prompt einer zur Wirtshaustüre rein.
Der Kari Granwehr schaut unsicher im Kreis herum. Die ganze Beiz glotzt ihn erwartungsvoll an. Den Mund hat er voll genommen, dabei hat er den Engel als sein Geheimnis bewahren wollen, aber bitte, vielleicht ist es ganz gut so, dann wird er ihnen zeigen, was im Granwehr-Bauern steckt, dann werden sie ihn künftig mit mehr Respekt behandeln. Seit er die Birewegge für den Gerschwiler macht, hat er es zwar recht im Dorf, aber so richtig respektiert wird er immer noch nicht, vermutlich wegen dieser alten Sache mit dem Hansueli, ein Unfall wars, mehr nicht, was kann man einem das ein Leben lang vorwerfen, also dann, zeigen wir ihnen, wer näher bei Gott hockt, sie oder ich.
Das könne er schon machen, sagt der Kari, wert sei sie es zwar nicht, diese Lumpenbande hier drin, die an nichts glaube, was man nicht mit den Händen fasse könne, aber bitte, die Gnade Gottes sei ja für alle da, er werde also den Engel rufen, grad so, wie er es bei sich zuhause gemacht hat. Und der Kari Granwehr steht auf, geht durch die Beiz, öffnet ein Fenster und ruft heraus, ruft nach dem Engelchen, dieser mädchenhaften Gestalt mit dem weissen Gewand und dem lieben, zarten Gesicht, es
solle doch mal schnell vorbei kommen, es gelte, ein paar ungläubigen Gesellen zu zeigen, wie schnell so ein Engelwesen daher komme, wenn man es rufe, also bitte, nur auf einen Sprung.
Der Kari wartet und schaut zum Fenster heraus auf den Kirchplatz, er schaut nach links, er schaut nach rechts, er schaut nach vorne und einmal dreht er sich sogar wieder um, weil das Engelchen ja vielleicht von oben herab direkt in die Beiz geschwebt ist, aber nein, da sitzt kein Engel, da sitzt nur eine Horde Beizengänger, die ihn angrinsen und vielsagend mit den Augen rollen, und der Kari dreht sich wieder zum Fenster und ruft noch einmal, ruft, dass es sich um einen Notfall handle, dass es ausnahmsweise
rassig gehen müsse. Und immer noch passiert nichts. Ein paar Minuten vergehen, und irgendwann kichert einer der anderen ein bisschen, und das ist wie ein Signal für die Lawine, die Lachlawine, sie schütten sich aus vor Lachen, Leute im Adler, sie klopfen sich auf die Schenkel und wischen sich die Lachtränen aus dem Gesicht und prusten und schallen.
Der Kari Granwehr dreht sich langsam um, er sieht, wie man ihn verhöhnt, wie es plötzlich wieder genau so ist wie früher, wie er mit einem Moment wieder der Nichts und Niemand ist, der er vorher schon war, bevor dem Bäcker Gerschwiler die Birewegge in die Nase gestochen sind. Er hält das Lachen nicht aus, der Kari Granwehr, er stürmt aus der Beiz und rennt den ganzen weiten Weg runter zum Meierli-Wald, in sein Haus, in sein Zimmer, wirft sich auf das Bett, vergräbt sein Gesicht und schluchzt und stöhnt und schreit, bis der Schlaf stärker ist als der Schmerz, aber noch im Schlaf, im Traum, wütet der Hass in ihm.
Am nächsten Tag schläft der Kari Granwehr bis zum Mittag. Immer wieder wacht er auf und zwingt sich in den Schlaf zurück, er will nicht mehr wach sein in dieser Welt, die ihn verspottet und wo ihn sogar die im Stich lassen, von denen er geglaubt hat, sie seien seine einzigen wahren Freunde.
Die Engel.
Jawohl. Die Engel. Die sind schuld an der ganzen Misere. Oder besser gesagt dieser Engel, der ihn da in die Irre geführt hat, diese elfenartige Gestalt, die einmal gekommen ist, wie er nach ihr gerufen hat, und dann wieder einfach weggeblieben ist, wo er sie so nötig gebraucht hätte. Das Engelchen ist schuld daran, dass er wieder sein miserables Leben führt und der Bäcker Gerschwiler künftig bestimmt auf die Birewegge pfeift, wer will schon Esswaren von einem, der zu spinnen scheint. Scheint! Denn der Kari Granwehr ist sich sicher, dass es Engel gibt, dass er recht hat, dass er keineswegs spinnt, dass aber dieser Engel einfach keine Lust hatte, zu kommen, ein schlecht erzogener Engel sozusagen, ein niederes Geschöpf aus Gottes Garten Eden, oh, komme ihm dieser Engel nur einmal noch vor die Augen, dann aber...
Da hört er es. Vom Bett aus hört er es. Ein Pfeifen. Ein fröhliches Liedchen vom Weg vor dem Haus aus. Der Granwehr ist misstrauisch. Nicht viele Leute gehen hier beim Meierli-Wald vorbei. Er geht zum Fenster, im Unterhemd und Unterhosen, schaut heraus und sieht es. Das Engelchen. Wieder im weissen Gewand, wie beim letzten Mal. Steht vor dem Granwehr seinem Hof und bückt sich und schaut sich die Blumen im Garten an, als wäre es ein ganz normaler Tag. Als hätte dieses Engelchen gestern nicht das Leben vom Granwehr zerstört.
Der Kari Granwehr heult auf wie ein angeschossenes Tier, er rennt die Treppe herunter, nicht einmal Hosen zieht er sich an, halbnackt rennt er in den unteren Stock und durch die Verbindungstür in den Verschlag beim Stall, wo die Sense hängt, er packt sie mit sicherem Griff und rennt weiter zum Stall und zur Stalltüre nach draussen, ein schöner Herbsttag ists, warm, sonnig, aber der Granwehr hat keine Augen für das Wetter, nur für das Engelchen, es steht da vor seinen Blumen und scheint sich zu überlegen, ob es eine davon pflücken soll. Der Granwehr stürzt mit langen Schritten auf das kleine Wesen im weissen Gewand zu, und bevor es begreift, was passiert, lässt der Granwehr die Sense sausen, einmal, zweimal, er möchte noch ein drittes und ein viertes Mal, aber das macht keinen Sinn, das Wesen ist so klein und zerbrechlich, er hat es mit der Sense förmlich entzwei gerissen, in zwei zuckende blutende Hälften, so von Hass und Kraft erfüllt ist sein Schlag gewesen, dass das Engelchen nun zerrissen vor ihm liegt, die Hand noch um eine Blume verkrampft, die es eben pflücken wollte, aber das hat der Granwehr nicht zugelassen.
Gerechtigkeit, denkt der Granwehr, Gerechtigkeit, nur Gerechtigkeit ist es gewesen. Dieses Engelswesen hat büssen müssen, diese Gestalt mit dem weissen Gewand, den langen blonden Haaren, dem lieben Gesicht, den Flügeln.
Flügel. Der Granwehr zuckt zusammen. Flügel. Die obere Hälfte der Gestalt liegt auf dem Bauch, den kleinen, blutverschmierten Rücken dem Granwehr zugewandt, aber da sind keine Flügel. Jesses nei, denkt der Granwehr und lässt die Sense fallen. Jesses nei.
Drei Tage später wird die Tochter vom Schuhmacher Angehrn zu Grabe getragen und der Granwehr weggeschlossen.
verdreht, der Fiechter hat es schon mit der Angst bekommen, aber dann hat er gemerkt, dass es nur die Wollust ist, und er hat das Schauspiel gebannt verfolgt und erleichtert aufgeatmet. Vielleicht würde sie jetzt ja bei ihm bleiben.
Wie spät ist es? Die Frau ist jetzt wieder ganz sachlich, als wäre das alles nicht passiert, noch vor wenigen Augenblicken.
Bald 10, sagt der Fiechter. Verwundert, enttäuscht. Er hat etwas anderes erwartet.
Muess go. Die Kirche beginnt gleich. Die Frau steht auf und zieht sich an, schnell, geschäftig, ohne zu zögern. In die Kirche. Der Fiechter ist erstaunt. Aber bitte, was kann ihn denn wirklich erstaunen an einer Frau, die er so gut wie gar nicht kennt. Dann eben in die Kirche, warum auch nicht. Das ist kein Problem, aber –
Chunnsch wieder? Eine Frage, gestammelt, gehetzt, ängstlich.
Die Frau lächelt still. Nickt nicht, schüttelt nicht den Kopf, zieht sich nur an und huscht dann zum Bett und drückt dem Fiechter einen Kuss auf die Stirn und geht zur Tür.
Soll ich mitkommen? Gerade noch bringt es der Fiechter heraus. Nein, sagt die Frau. Und ist aus der Tür und weg und fort. Der Fiechter liegt da und ist einen Moment lang so verwirrt, dass er sich keine Sorgen mehr darum macht, ob die Frau zurückkommt. Die Frau. Ja, das ist sie, kein Zweifel, er hat es ja in dieser Nacht recht zu spüren bekommen, dass er es mit einer Frau zu tun hat. Aber eines ist seltsam, er hat ja nicht viel Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, aber das scheint ihm wirklich
unverständlich. Die Frau ist aus dem Haus gegangen, direkt aus dem Bett, ohne auch nur einen Blick in den Spiegel zu werfen.
Die letzte Gestalt ist eben zwischen den schweren Türflügeln ins Innere der Kirche verschwunden, als es anfängt zu regnen. Ohne jede Vorwarnung prasselt es auf Rättigen nieder, dass es nur so kracht und chlöpft und tätscht. Staunend sehen die Rättiger durch die Kirchenfenster, wie sich der Himmel in kurzer Zeit dunkelgrau verfärbt, wie es an die Scheiben klatscht. In der Kirche ist es meist kühl und düster und unwirtlich, und dann all die Heiligen, die einen von oben herab anglotzen, die Kirchenorgel ist auch ein bisschen verstimmt und das jüngste Mitglied im Kirchenchor geht gegen die siebzig, ein Vergnügen ist es also nicht, hier in der Kirche zu sitzen und nicht zu wissen, ob man sich mit den Händen warmreiben oder doch lieber die Ohren zuhalten soll, aber heute, wo es draussen tobt und tut und macht, da ist es schon fast heimelig auf den harten Bänken im Kirchenschiff.
Als alles bereit sitzt und sich noch ein bisschen räuspert und hustet und die kleinen Klänge sich mit dem Prasseln auf den Glasscheiben vermischen und durch den grossen Raum hallen, da setzt die Orgel ein, der Lehrer Füglistaler greift in die Tasten, dumpf und ein bisschen sphärenhaft, er wäre gerne ein berühmter Komponist geworden, der Füglistaler, aber dafür hat sein Talent dann doch nicht gereicht, und jetzt spielt er halt wenigstens beim Einzug in die Kirche seine eigenen Werke, und er findet, das heutige Stück mache sich wunderbar zum Regen draussen.
Jetzt kommt der Pfarrer Gnädinger aus der Sakristei hervor, hinauf zum Altar, gefolgt von den beiden Ministranten. In den Bänken geht ein Tuscheln und Wispern los. Den einen Ministranten kennt man, den Sohn vom Dorfschneider Ochsner, der ministriert schon lange, der Bub, aber der andere ist nicht aus dem Dorf, er ist grösser als der Ochsner, kein Kind mehr, ein Halbwüchsiger eher, und doch trägt er einen ganz normalen Ministrantenrock, der ihm viel zu klein ist, und ein paar der Rättiger würgts
im Hals, weil sie lachen wollen, aber lachen ist so ziemlich das letzte, was man in einer Kirche tut, also räuspern sie sich noch ein bisschen mehr und husten verlegen, und der Füglistaler muss noch ein bisschen stärker auf die Tasten schlagen, um das Gehuste und Geräuspere zu übertönen, und gleichzeitig wird der Regen noch stärker, so dass es in der Kirche mit einem Mal ohrenbetäubend laut ist, es orgelt und prasselt und hustet und räuspert.
Der Gnädinger scheint von all dem nichts zu hören, er beginnt mit dem Gottesdienst und zelebriert und betet vor, als wenn nichts wäre, und die Rättiger machen fleissig mit, sitzen steif in den Bänken, knien hin und stehen auf, wenns Zeit ist, bewegen die Lippen mechanisch zu den Worten des Pfarrers, bekreuzigen sich da und dort flüchtig und hängen dabei so ihren Gedanken nach.
Er kommt durch, denkt der Fredi Bürgi senior und meint damit den Fredi Bürgi junior, der angeschmörzelt bis zu den Haarspitzen beim Dorfarzt liegt und nichts davon ahnt, dass sie zuhause das Rollschinkli gegessen haben, das eigentlich für ihn gedacht gewesen ist. Er kommt durch, dem Herrgott sei Dank. Es gibt noch Wunder auf dieser Welt. Gut, ja, man wird noch ein paar Probleme zu lösen haben in der nächsten Zeit. Der Fredi junior braucht noch lange medizinische Pflege, und übertrieben versichert ist man nicht gewesen im Haus der Bürgis. Heute morgen hat der Alder angerufen und
angetönt, was man alles noch einrichten müsse zuhause, bevor der Bub heimkommen könne, und dass er in den nächsten Wochen fast ständig gepflegt werden müsse, recht kompliziert hat sich alles angehört, man glaubt nicht, an was man alles denken muss, wenn einer nicht mehr ganz soviel Haut auf den Knochen hat, weil ihn der Blitz getroffen hat. Einfach wirds nicht, die Paula wird ihren kleinen Beruf aufgeben müssen, sie hat bei der Dorfschneiderin Gehrig ausgeholfen, drei Nachmittage die
Woche nur, aber der Zustupf hat schon gut getan, das muss der Fredi senior eingestehen, auch wenn er ganz am Anfang der Meinung gewesen ist, eine Mutter von vieren müsse nicht noch ausser Haus gehen und dazu verdienen. Aber inzwischen hat man sich an das Geld gewöhnt, und damit ist es jetzt wohl vorbei, im Gegenteil: Noch enger wird man durchmüssen, weil der Fredi junior zmitzt im Sturm über die Felder striehlen musste, Auslagen wird man haben, so viele, dass das Rollschinkli nur noch
eine schwache Erinnerung bleiben wird. Und Weissbrot sowieso. Wunder, denkt sich der Fredi Bürgi senior, Wunder gibt es noch, und er wäre der letzte, der Gott dafür nicht danken würde, aber bei Licht betrachtet macht dieses Wunder, der vom Blitz getroffene und quicklebendige Fredi junior, die ganze Familie ja nicht gerade reicher. Alles wird mühsamer und umständlicher und teurer. Klar, so eine Beerdigung ist auch kein Klacks, aber bitte, da bezahlt man einmal und bekommt dafür alles, was man
braucht, und damit hat es sich. Hin und wieder ein neues Blüemli auf dem Grab vielleicht, aber das geht ja wohl weniger ins Geld als literweise Desinfektionsmittel und ein Spezialbett und Verbände und eine Pflegekraft und so weiter und so fort. Und überhaupt, der Fredi Bürgi senior will nicht undankbar sein, aber er fragt sich schon, was Gott studiert hat, dass er grad jetzt ein bisschen Wunder vorführen musste. Der Bürgi geht in die Knie, weil es links und rechts von ihm in die Knie geht, er hört nicht recht, was der Pfarrer Gnädinger sagt, vielleicht etwas über die Wunder, die Gott immer wieder anstellt, und der Bürgi senior kniet da und bewegt die Lippen mechanisch, weil es um ihn herum ein bisschen raunt, da wird ein Gebet mitgesprochen, so siehts aus, schön, Wunder sind etwas Schönes, ja, aber bitte sehr, zur rechten Zeit am rechten Ort.
Man kann nie wissen, was aus einer Sache wird, denkt sich der Haugental-Bauer zwei Reihen weiter hinten. Wie er da den kleinen Bürgi auf dem Feld gefunden hat, da hat er nicht geglaubt, dass der Kleine das überlebt. Und jetzt kann er, so heissts wenigstens im Dorfgeschwätz, schon bald nach Hause. Gut, denkt sich der Bauer, nicht grad überschwenglich, das ist nicht seine Art, aber er findet schon, dass es ein bisschen früh gewesen wäre für den kleinen Fredi, das Zeitliche zu segnen. Aber am selben Tag ist im Nachbardorf Glauberschen eine Kuh verendet, die der Haugental-Bauer hat kaufen
wollen. Ein schönes Tier, ein Prachtsstück, und der Wismer Salomon, der Besitzer und ärmste Bauer von Glauberschen, hätte die Kuh zu einem Spottpreis gegeben, nur um wieder einmal zu ein bisschen Geld zu kommen. Und dann verreckt ihm das Vieh des Nachts im Stall ohne Grund. Wie wenn der Herrgott in Glauberschen hätte kompensieren wollen, was er in Rättigen nicht eingezogen hat. Jetzt kann man sagen, schön, gut, einen Buben am Leben und eine Kuh im Himmel – das ist ein anständiger Tausch. Und der Haugental-Bauer würde dem in der Öffentlichkeit auch niemals anders sagen. Aber wenn er ehrlich zu sich selbst ist – jetzt verliert er kurz den Faden, der Bauer, weil um ihn herum alles aufsteht, also erhebt er sich auch vom harten Bank, es ist ein Sichsetzen und Aufstehen und Niederknien und Sichsetzen, nie hat man seine Ruhe, gopfverdammi – jedenfalls, wenn er ehrlich ist zu sich selbst, der Bauer, dann hätte er den Tod des kleinen Bürgi weniger schmerzhaft gespürt als den Tod der Kuh vom Salomon Wismer. Ein Schnäppchen wär sie gewesen, die Kuh, und erspartes Geld ist verdientes Geld, das hat schon der Haugental-Bauer senior gesagt, also hat er, der Junior, an diesem Tag kein Geld verdient, will heissen, er hat Geld verloren, und dann hat er auch noch Zeit verloren, weil er ja in der Weltgeschichte herumtelefonieren musste, damit sie den Jungen holen kommen, und Zeit ist auch Geld, und wenn er so richtig darüber nachdenkt, dann hat er eigentlich nur verloren und verloren und noch einmal verloren, weil der Blitz so halbherzig eingeschlagen hat. Der Bauer grummelt ein bisschen unwillig, bis ihn seine Frau von der Seite her anschaut, von der Seite her
und von unten, und der Bauer merkt, dass die anderen schon wieder sitzen und lässt sich auch wieder auf den harten Holzbank plumpsen.
Dieses fette Tier, denkt der Georg Senn, genannt Schorsch, in der zweitletzten Reihe, der einzige Arbeitslose in Rättigen. Dieses fette Tier schleicht den ganzen Tag durchs Dorf und kriegt die feinsten Happen, und wie er, der Schorsch, die Witwe Zuber einmal um ein paar magere Fränkli anpumpen wollte, da hat sie ihm wüst gesagt und ihn von der Tür weggeschickt wie einen erbärmlichen Hausierer, dabei sind sie Nachbarn, und dem Schorsch seine Eltern waren zu Lebzeiten gut Freund mit der alten
Zuber. Aber die Witwe stopft lieber ihren Kater mit teuren Fressalien voll, als dass man einem Menschenkind weiterhelfen würde, und dann am Sonntag in die Kirche sitzen und fromm tun und dabei so ein schlechter Mensch sein, das kann sie, denkt sich der Schorsch Senn und schielt hasserfüllt drei Bänke nach vorne, ganz links, wo die Witwe Zuber sitzt. Getan hat sie, als sei seine Misere seine eigene Schuld, dabei weiss jeder, dass die Zeiten schlecht sind, auch wenn man arbeiten will, und bitte sehr, hat etwa der Munz, dieses fette Stück von einem Kater, je im Leben etwas Sinnvolles gemacht? Liegt da in der Sonne den ganzen Tag und lässt sich die gebratenen Tauben mundgerecht zerschnitten vors Maul legen. Einmal hat der Schorsch Senn geglaubt, es gebe doch noch Gerechtigkeit. Das war, als er zu sehen geglaubt hat, wie der Munz gerade unter den Zug kommt. Ganz genau hat ers eigentlich gesehen, vom Fenster aus, er hat einfach zugeschaut, wie der Kater umgespickt isch, und da hat der Schorsch gleich eine gute Flasche Wein geköpft, aber noch bevor er einen Schluck genommen
hat, ist dieses fette Vieh von den Gleisen her Richtung Haus gewatschelt.
Sie wird keine Freude haben, denkt die Paula Bürgi, die zwischen ihrem Mann und den drei Töchtern sitzt, die Frau Gehrig wird ein bisschen missbilligend den Kopf schütteln und den Mund verziehen und dann abwinken und sich wortlos umdrehen. Sie ist keine liebe Frau, die Gehrig, aber sie zahlt recht gut, wenn man mit Nadel und Faden umgehen kann, und bitte, die Paula Bürgi kann das, muss es auch können bei vier noch recht kleinen Kindern und einem Mann, der nicht genug heimbringt, dass man dauernd neue Kleider hätte kaufen können. Aber es ist ja nicht nur das Geld, das die Frau Gehrig wie in grauer Vorzeit immer noch alle Woche in einem kleinen Säcklein bar übergibt. Es ist auch schön, ein bisschen aus dem Haus zu kommen, denn die Kinder wachsen einem dann und wann über den Kopf, und der Fredi ist auch keine Stütze, Angst hat er gehabt, er müsse jetzt mehr zu den Kindern schauen, wenn sie plötzlich arbeiten geht, aber sie hat das organisiert, so dass er fast gar nichts davon merkt, im Organisieren sind die Frauen ja sowieso besser als die Männer, denkt sich die Paula, aber wenn der Fredi junior nach Hause kommt, dann hilft alles Organisieren nichts mehr, dann muss sie zuhause bleiben und den Buben pflegen, anders geht es nicht, das weiss die Paula, aber Hauptsache, ihr Sohn ist gesund, darauf kommt es an, und dafür verzichtet sie noch so gerne auf das Nähen und das Geld. Jawohl, noch so gern. Noch so gern. Noch so gern. Die Paula sagt sich’s wieder und wieder, aber sie merkt, dass es nur Worte sind, hohle Phrasen, eben erst hat sie sich ein bisschen Freiheit geschaffen,
und jetzt wird sie wieder ans Haus angebunden sein, nein, sie kann nicht behaupten, dass sie das noch so gern habe.
Und so hängen alle Rättiger ihren Gedanken nach, nur selten sind es gute, denn in der Stille der Kirche, wo jeder durch seine Anwesenheit den Schein der blossen Frömmigkeit um sich gelegt hat, da schwirren einem die dunklen Gedanken nur so im Kopf herum, man lässt sich auf sie ein, weil rundherum alles so sicher und heilig und fromm ist, und im Alltag, da haben die Rättiger keine Zeit für böse Gedanken, da müssen sie arbeiten, aber in der Kirche, wo der Pfarrer alles macht und man selbst nur ein bisschen die Lippen bewegen und aufstehen und absitzen und niederknien muss, da denkt es sich einfach leichter und tiefer, und tief unten sitzen eben die bösen Gedanken, und sie kriechen hervor hinter dem lieben Lächeln, das man aufgesetzt hat.
Der Gnädinger zelebriert vorne vor sich hin, bis es Zeit für die Predigt ist. Er steigt icht auf die Kanzel, lange schon tut das der Pfarrer nicht mehr, wie an vielen Orten ist n der Rättiger Kirche die Kanzel nur noch schmuckes Beiwerk, der Pfarrer will nicht ber seinen Gläubigen stehen, genau genommen tut er das vorne am Sprechpültchen war immer noch, aber nicht mehr so überdeutlich. Er steht da vorne, büschelet die apiere vor sich ein bisschen, bis es ganz ruhig ist in der Kirche, wobei es nie ganz ruhig wird, weil es weiter hustet und räuspert. Aber irgendwann muss er ja anfangen, der Pfarrer, allen Hustern zum Trotz, und das tut er nach einem letzten salbungsvollen Blick über die gut gefüllten Bankreihen, kerzengerade steht er vor seinem Pültchen und beginnt.
Was der Pfarrer Gnädinger an diesem Sonntag predigt, weiss später keiner mehr, weil alle so in ihre Gedanken versunken sind. Aber es ist, da ist man sich auf dem Weg nach draussen durchs Kirchenschiff einig, eine schöne Predigt gewesen.
Während fast ganz Rättigen in der Dorfkirche den Worten des Pfarrer Gnädingers lauscht oder eben nicht lauscht, ist anderswo der Teufel los.
Zum Beispiel beim Marcel Kaiser, Metzgermeister im Dorf, der ein schweres Leben hat, seit dieser Grossverteiler auf der Strecke zwischen Rättigen und der Stadt eine Filiale aus dem Boden gestampft hat und das Fleisch zu einem Preis anbietet, dass es dem Kaiser nur so die Tränen in die Augen treibt. Nie und nimmer kann das noch ein Geschäft sein, da ist sich der Kaiser sicher, diese Lumpen zahlen drauf, aber nur so lange, bis es seine Dorfmetzg lupft, kaum ist er weg, werden auch bei denen die Preise steigen, da ist sich der Kaiser sicher, dann bluten all die Verräter, die jetzt zu diesem Akkordschlachter rennen, dann werden sie es selbst sehen, er predigt es in einem fort in sämtlichen Beizen in Rättigen, auf der Strasse, im Laden. Er sagt es jedem, der es hören will, er sagt es jedem, der weghört, er bekommt aufmunternde Worte zurück und verständnisvolles Nicken und tröstende Blicke, und einen Moment später sind die Leute weg und fort und im Grossverteiler und decken sich mit Cervelat und Koteletts und Siedwürscht und Schüblig ein, dass man meinen könnte, der Krieg breche aus, aber bitte, was soll man machen, bei den Preisen, ein Narr wäre da, wer noch beim
Kaiser einkauft, und selbst wenn es stimmt, was er sagt, man ist gerne bereit, später auch ein bisschen mehr zu bezahlen, denn, jetzt mal ehrlich, die Ware ist mindestens so gut wie in der Dorfmetzg, vielleicht sind die Schweine und Rinder, die der Kaiser bei Bauern in der Umgebung kauft, zu Lebzeiten glücklicher gewesen, aber nach dem Tod schmecken sie nach dem übereinstimmenden Urteil der Rättiger beim Grossverteiler nicht schlechter, und wenn man vom ersparten Geld dann noch den Kartoffelstock und die Röschti und das Brot und das Gemüse und vielleicht noch einen Schluck Wein zum Fleisch dazu kaufen kann, dann fällt die Wahl nun wirklich nicht schwer.
Inzwischen kauft kaum mehr eine Seele beim Marcel Kaiser ein, mit der Kasse gehts bergab, bald muss man selber um das Fleisch auf dem Teller bangen, und für einen Metzger gibt es kaum eine schlimmere Aussicht. Oder doch. Was dem Kaiser seinen Lebenswillen endgültig gebrochen hat, ist bald danach seine Frau gewesen, als die ihn bekniet hat, sich eine Stelle als Metzger beim Grossverteiler zu suchen. Oder nein, vielleicht war es doch eher die Tochter, die sich für die Schulreise ihr Grillfleisch bei der Konkurrenz geholt hat. Dass die Rättiger nicht mehr in die Dorfmetzg finden, ist
schlimm genug, aber als sich die eigene Familie von ihm abwendet, will der Marcel Kaiser endgültig nicht mehr. Er schickt an diesem Sonntag die Familie allein in die Kirche, gibt vor, es sei ihm nicht so hundertprozentig wohl, knöpft sich, als er endlich alleine ist, einen Strick, nicht formschön, aber zweckmässig, montiert ihn an einem der Haken, an denen in besseren Zeiten Schweinehälften zu hängen pflegten, steigt auf einen Stuhl, legt sich die Schlinge um den Hals und verlässt den Stuhl dann wieder auf dem Weg, auf den er ihn bestiegen hat – mit ein bisschen mehr Schwung allerdings.
Der Stuhl kippt gehorsam um, als der Kaiser mit den Beinen zappelt und um sich schlägt, und das ist ganz gut so, da kann er es sich nicht mehr anders überlegen, und die Gefahr würde durchaus bestehen, denn es gibt, das entdeckt der Metzger, durchaus Angenehmeres, als sich auf diese Weise aus dem Leben zu verabschieden.
Nur, dass er genau das eben nicht tut, aber das ahnt er in diesem Moment noch nicht. Er weiss nicht, dass er hier noch gute drei Stunden hängen und japsen und würgen und ums Verrecke nicht sterben wird. Solange dauert es, weil seine Frau nach der Messe noch auf einen Schwatz auf dem Kirchplatz stehen bleibt, als es kurz auftut und nicht mehr vom Himmel strätzt und dann auf dem Heimweg noch schnell bei der Lotti Kurer auf einen Kaffee einkehrt und dann, als sie endlich zuhause ist, zunächst nicht etwa nach ihrem Mann sucht, sondern zuerst einmal das Fernsehprogramm durchforscht, wenn sie das Gerät nun schon einmal für sich alleine hat. Erst, als sie merkt, dass der heilige Sonntag unterhaltungsmässig nicht viel herzugeben scheint, fragt sie sich, wo ihr Mann ist und stösst bei der Suche früher oder später auf einen rot angelaufenen, vom Metzgerhaken hängenden Mann, schreit, rennt aus der Metzgerei, holt einen Nachbarn, mit vereinten Kräften wird der Marcel Kaiser aus der Schlinge geholt, dann ist nur noch ein Husten und Keuchen und Würgen zu hören, der Kaiser liegt zuckend am Boden, es wird Zeit seines Lebens nie wieder einen vernünftigen Ton von sich geben können, aber das ist vielleicht auch besser so, denn einerseits ist die Invalidenrente anständiger als das, was ihm die Metzg zuletzt noch eingebracht hat, und andererseits würde es ihm wohl keiner glauben, wenn er sagen könnte, dass er Punkt 10 Uhr, als die Glocke zur Messe gerufen hat, von dem Stuhl gesprungen ist.
Etwa 10 Uhr muss es auch gewesen sein, als der Hund von Küde Schott mitten im Hausgang geräuschlos zusammenbricht und ein bisschen weissen Saft sabbert und die Augen verdreht und mehr tot als lebendig aussieht, und wenn es auch wirklich so wäre, dann würde man jetzt den Fiechter anrufen, der kratzt ja auch die überfahrenen Tiere von der Strasse, da würde er wohl gegen ein paar Franken auch den Hasso entsorgen, den Boxer vom Küde Schott, aber dafür ist es noch zu früh, der Hasso macht zwar keinen Wank mehr, aber atmen tut er, und einen atmenden Hund würde nicht einmal der Fiechter auf den Müll kippen, also fährt der Küde Schott stattdessen mit dem Hasso zum Tierarzt Peier, der hat am Sonntag bis zum Mittag die sogenannte Notfallsprechstunde, weil die Kühe in Rättigen so verstockte, eigensinnige Viecher sind, dass sie meistens zu dieser Unzeit mit Komplikationen kalben, also hat es der Peier längst aufgegeben, den Sonntag als Ruhetag zu geniessen, da kann er genau so gut offizielle Sprechstunde abhalten.
Aber heute hat es keine Kalbereien gegeben, der Küde Schott und sein Hasso sind die einzigen Kunden, und der Peier sieht bald, dass das ein schnelles Geschäft ist, der Hund ist 15 Jahre alt und schon immer kränklich gewesen, und jetzt geht es definitiv bergab mit ihm, da hilft nichts anderes als eine Spritze, da mag die Frau vom Küde Schott noch so laut flennen, was nimmt er sie auch mit, denkt sich der Peier, einfacher wäre es ohne, aber bitte, da heisst es einfach möglichst schnell machen, damit er dieses weinende Weib endlich aus der Praxis weg hat, ein paar erklärende Worte, dann wird der Hasso noch ein bisschen gestreichelt, wobei er selber davon längst nichts mehr merkt, dann kommt die Spritze, der Küde Schott und seine Frau schauen weg ins Leere, der Peier sagt, so, das sei es schon gewesen, und die Frau Schott heult noch ein bisschen und der Küde bedankt sich beim Tierarzt und nimmt seine Frau, und zusammen verlassen sie die Praxis, und der Peier atmet auf, endlich, denkt er, die Hunde- und Katzenhalter sind die schlimmsten, wenn einem Bauer ein Tier wegstirbt, dann ist das auch eine traurige Sache, aber diese Trauer hat Hand und Fuss, da ist ein
Stück vom Geschäft weggestorben, ganz im Gegensatz zu diesen Haustieren, die man für wenig Geld in jedem Tierheim ersetzen kann, da versteht der Peier das ganze Getue nun wirklich nicht, und als er aus dem Fenster den Schotts nachschaut, wie sie händchenhaltend wegspazieren und die Frau Schott immer mal wieder von einem Weinkrampf geschüttelt wird, als sich der Peier gerade überlegt, ob er heute etwas früher schliessen soll als sonst, in diesem Moment winselt es auf dem Schragen hinter
ihm, nicht laut, nicht deutlich, aber es winselt.
Der Peier hat die Praxis für diesen Tag wirklich geschlossen. Aber er hat weiter gearbeitet. Er hat diesem Boxer, diesem elenden Hasso, eine Spritze nach der anderen reingejagt, und jedes Mal hat das Tier ein bisschen mehr gesabbert und elender ausgesehen, aber es hat gar nicht daran gedacht, zu sterben. Irgendwann hats der Peier nicht mehr ausgehalten, er hat den Hund ins Auto gepackt und ist zu seinem Schwager nach Glauberschen gefahren, der ist nicht Tierarzt, aber Schreiner, und der hat das richtige Werkzeug, wenn es darum geht, einen Hund, der sich ums Verrecken nicht einschläfern lässt, ins Jenseits zu befördern. Aber das ist gar nicht nötig gewesen, denn kurz nachdem der Peier Rättigen hinter sich gelassen hat, da hat es nicht mehr gewinselt und gesabbert, da ist der Hasso endgültig gegangen. Die Luft in Rättigen, denkt sich der Peier da, ist einfach zu gesund.
Der Gemeinderat Bättig hat den Gottesdienst an diesem Sonntag ausgelassen, er hat in der Nacht davor kaum ein Auge zugetan, am nächsten Morgen hat er im Spiegel ausgesehen wie sein eigener Schatten, und schliesslich hat sich seine Frau allein Richtung Kirche aufgemacht. Sie hätte auch lieber ausgeschlafen, ihr Mann hat die halbe Nacht laut geträumt und seltsame Geräusche von sich gegeben, viel Schlaf hat sie also auch nicht gefunden, aber im Nachhinein ist sie froh, dass sie sich aufgerafft
hat, denn was nach der Messe auf dem Kirchplatz verhandelt wird, das hätte sie nicht verpassen wollen. Niemand weiss etwas Genaues, aber vor dem Alois-Heim stehen Polizeiwagen, ein paar Kirchgänger wollen in der Nacht Schüsse gehört haben, beim Feller zuhause seien auch Uniformierte im Garten herumgeschlichen, berichtet ein anderer – und so reimt man sich eben zusammen, was da gewesen sein könnte und kommt dabei der Wahrheit erstaunlich nahe.
Und diese Wahrheit erzählt die Frau Bättig gleich nach ihrer Rückkehr ihrem Mann, der immer noch bleich und schläfrig im Bett liegt, in allen Details, und davon wird der Gemeinderat Bättig immer bleicher und immer weniger schläfrig. Als sich seine Frau schliesslich in die Küche begibt, um den Sonntagsbraten vorzubereiten, bleibt der Bättig liegen und legt sich die Hände über die Augen und schüttelt langsam den Kopf. Zviel isch alles, denkt er, zviel, und noch viel schlimmer, als er gedacht hat. Man hat darüber geredet beim Gemeinderat, wie man die Theorie vom Pfleger Baumberger
überprüfen könnte, und irgendwann hat einer, der Reimann glaubs, schliesslich vorgeschlagen, man könne ja an der angeblich unsterblichen Katze von der Witwe Zuber ausprobieren, ob es mit dem Ende des Sterbens etwas auf sich habe, oder eben, was wahrscheinlicher klingt, nicht. Wenns der Kater überlebe, wisse man, woran man sei, wenn er das Experiment nicht überstehe, sei der Verlust gering, ausser vielleicht für die Witwe Zuber.
Darüber hat man geredet, und der Bättig ist der einzige, der dagegen gestimmt hat, es scheint ihm einfach unmoralisch, ein Leben zu opfern, um Gewissheit zu haben, und wenn es auch nur das eines Tieres ist. Der Wiesmann hat sich der Stimme enthalten, weil er immer gegen das ist, was die anderen finden, und die anderen sind ausnahmsweise gar nicht einer Meinung gewesen, also bitte, wie hätte er sonst stimmen sollen? Damit sind drei Stimmen für das Experiment zusammengekommen,
und daraufhin haben der Bannwart und der Haslinger dem Feller einen Besuch abgestattet. Und jetzt geht der hin und schiesst auf die Bertschinger. Der Bättig atmet schwer und fasst das alles nicht und ist abwechslungsweise entsetzt und ungläubig und verängstigt. Die Polizei ist im Dorf, da ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis das alles auf den Gemeinderat zurückfällt, vielleicht hat der Feller geredet, bevor er gestorben ist, und dann, dann hängt er, der Bättig, mit drin. Gut, ja, er ist dagegen gewesen, aber verhindert hat er es nicht. Und wie will man je beweisen, dass man den Grosswildjäger auf einen fetten Kater und nicht auf die Bertschinger losgeschickt hat?
Der Bättig sieht schon die Schande über das Dorf und seinen Gemeinderat ereinbrechen. Aber er sieht nicht ein, warum er da mitgerissen werden soll, wo er och von Anfang an gegen die Aktion gewesen ist. Wenigstens seine eigene Haut will r retten, der Herr Gemeinderat, und er muss es schnell tun. Der Bättig steigt aus dem ett und in die Kleider, geht ohne ein Wort der Erklärung an seiner Frau vorbei aus em Haus Richtung Adler. Dort wird das Ganze jetzt Dorfgespräch sein, vermutet er, dort wird man ihm sagen können, wo man die von der Polizei trifft.
Als er im Adler ankommt, sitzen zwar nur einige Gestalten an mehreren Tischen verteilt, keiner redet, es ist nicht anders als an jedem Sonntag. Aber der Bättig sieht sofort, dass einer der Gäste nicht von hier ist, er weiss, dass er hier richtig ist. Er bestellt beim Langenthaler einen Kafi, setzt sich zu dem Fremden und fängt an zu erzählen.
Einen Tag danach, am Montag, ist es in Rättigen ruhiger und unruhiger zugleich.
Ruhiger ist es an der Oberfläche. Weil keiner genau weiss, was hinter den Mauern des Alois-Heimes geschehen ist, beginnen sich die Schilderungen des Wenigen, das bekannt ist, zu wiederholen, und selbst die Rättiger, gierig nach Neuigkeiten, die auf dem Land selten genug sind, haben bald genug von ein- und derselben Geschichte. Man schüttelt vielleicht noch ein wenig den Kopf, wenn man am Altersheim vorbei geht, aber mehr gibt es nicht mehr zu tun, wenigstens nicht, bis man wieder ein
bisschen mehr weiss und die Gerüchteküche wieder heiss kocht.
Es ist also wieder ruhig in Rättigen.
Und zugleich unruhig. Ein fast schon hektisches Treiben findet im Ochsen-Saal statt, der jetzt fast rund um die Uhr zum Sitzungssaal des Gemeinderats umfunktioniert wird. Der Bannwart und der Haslinger haben sich dort verschanzt, flüstern trotz verschlossener Türen, manchmal kommen der Senn und der Reimann dazu, den Wiesmann hat man nicht eingeladen, der ist zu unzuverlässig, und der Bättig lässt sich am Telefon verleumden, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Aber der Bannwart und sein Gemeindeschreiber haben schon immer die Fäden gezogen in Rättigen, also tun sie es auch in der Krise ohne fremde Hilfe, und eine Krise, da ist man sich am Montag im Ochsen-Saal einig, herrscht gerade.
Er habe nie von der Bertschinger gesprochen, kein Wort, er wisse nicht, wie der Feller auf die alte Frau gekommen sei, da habe er etwas gründlich missverstanden. Der Haslinger hat rote Backen und ein paar Schweissperlen auf der Stirn, und er beschwört eine Unschuld nicht zum ersten Mal. Der Bannwart hat vor ihm gesprochen, hat auch zum hundertsten Mal wiederholt, er könne sich nicht erklären, was in den Grosswildjäger gefahren sei, verrückt geworden müsse er sein, schlicht und einfach. Es sei doch klar gewesen, dass er an der Katze ein Exempel statuieren müsse und nicht an der Bertschinger.
Der Reimann und der Senn hören zu und werfen sich vielsagende Blicke zu, und schliesslich will der Senn noch einmal die ganze Geschichte vom Besuch beim Feller hören, und als der Haslinger mit seinem Bericht fertig ist, er hat das jetzt wirklich zur Genüge erzählt, da meint der Senn zögernd, wenn er das richtig verstehe, dann habe man dem Feller gar keinen richtigen Auftrag gegeben, sondern ihm einfach die ganze Geschichte erzählt, die Katze und die alte Bertschinger als Beispiele genannt und das Geld auf dem Tisch liegen lassen.
Der Bannwart zuckt zusammen, zum einen, weil der Senn Recht hat und der Gemeindepräsident es sich selbst auch schon überlegt hat, ob der Auftrag vielleicht ein bisschen missverständlich gewesen sei, zum anderen, weil der Senn noch nie an einer Gemeinderatssitzung so gesprochen hat, das klingt ja fast schon wie eine Widerrede.
Und jetzt kommt auch noch der Reimann und sekundiert den Senn. Der Feller sei doch wohl kein Hellseher. Wenn man ihm da in die Stube trample und von überfahrenen Katern und überlebenden alten Frauen erzähle, dann könne der Feller ja nicht wissen, was von beidem sich der Gemeinderat unter dem empirischen Versuch vorstelle. Vielleicht sei der Feller auch ein Katzenfreund und habe deshalb die für ihn angenehmere Variante gewählt. Wie auch immer, wissen habe er es nicht können, also seien der Bannwart und der Haslinger mitschuldig an der Misere.
Im Gesicht vom Bannwart zuckt es gefährlich, allmählich wird es ihm zu bunt, seit er im Amt ist, hat noch keiner so mit ihm gesprochen, und er hat nicht vor, hier neue Traditionen einzuführen, aber noch bevor er zum Gegenschlag ausholen kann, hat schon der Senn wieder vom Reimann übernommen.
Das Schlimmste, sagt der Senn, das Schlimmste sei aber, dass man trotz allem noch immer keinen Beweis dafür habe, dass in Rättigen wirklich nicht mehr gestorben werde. Der Feller und die alte Bertschinger jedenfalls hätten die Himmelfahrt angetreten, wobei sie offenbar noch gelebt hätten, als sie die Ambulanz im Alois-Heim aufgelesen hat, also weiss keiner, wie es damit steht. Seltsam genug sei es aber, dass der Feller die Bertschinger und sich selbst erfolgreich aus dem Leben spediert habe,
denn man müsse ja vermutlich grosse Fragezeichen hinter dem Feller seine Schiesskunst setzen.
Jetzt sind es keine Schweissperlen mehr auf dem Haslinger seiner Stirn, jetzt ist es schon ein kleiner Strom. Er ahnt, was kommt. Und tatsächlich. Genüsslich wiederholt der Senn, was der Haslinger über die exotische Ausstattung im Wohnzimmer vom Feller erzählt hat. Bärentatzen? Er, der Haslinger, müsse ihm zuerst einen Bären in Afrika zeigen, dann könne man wieder darüber reden. Neinei, lacht der Senn, soviel Schulbildung habe er grad no, Bären gebe es auf dem schwarzen Kontinent so viele
wie Giraffen am Nordpol, und er habe den leisen Verdacht, dass der Feller sich seine Ausstellungsstücke aus dem Katalog bestelle und selber nie den Finger am Abzug habe. Das hätte dem Haslinger doch an Ort und Stelle auffallen müssen, und spätestens da hätte klar sein müssen, dass man beim Feller falsch ist und er das Ganze nicht zuverlässig erledigen werde.
Drückend eng scheint es plötzlich im Saal, keiner sagt etwas, der Haslinger schwitzt vor sich hin, der Bannwart zuckt nervös, der Senn und der Reimann grinsen triumphierend vor sich hin, zum ersten Mal haben sie ein bisschen Mut gezeigt im Gemeinderat, aber dann fällt ihnen ein, dass sie die ganze Sache mit ausgeheckt haben, ihnen beiden schiesst es gleichzeitig durch den Kopf, das Grinsen friert ihnen im Gesicht ein, und die Fratzen lösen sich erst wieder, als plötzlich ein Knall durch den Saal geht, ein Schuss, denken sich alle, schreckerstarrt, aber dann fällt ihr Blick auf die Hand vom Bannwart, wo ein unschuldiges Kafitässli sein Leben lassen musste, weil es der Gemeindepräsident in der Anspannung zerdrückt hat.
Nur eine Sekunde später wieder ein Knall, aber diesmal ist es nur das entschlossene Klopfen des Ochsen-Wirt, der Wagner, der gleich darauf die Tür aufreisst und ankündigt, draussen warte eine Delegation, die unbedingt zum Gemeindepräsidenten wolle, sie hätten es zuerst im Gemeindehaus versucht, aber dann schnell erfahren, dass der Gemeinderat lieber in der Beiz seine Sitzung abhalte.
Was, ruft der Bannwart, es werde immer schöner, jetzt werde auch schon unangemeldeter Besuch zum Gemeinderat vorgelassen, wie wenn nichts wäre, nicht zu fassen, und überhaupt, das könne wohl warten, man sei da gerade mitten in einem wichtigen Amtsgeschäft.
Der Wagner mustert das kaputte Kafitässli vor dem Bannwart, sagt aber nichts dazu, denn der Gemeinderat ist gute Kundschaft. Das sei wohl wahr, meint er schliesslich, dass es ein wenig unüblich sei, und im Normalfall störe er die Herren Regierenden ja nun wirklich nie, aber das sei gewissermassen eine ausserordentliche Situation, die Delegation sei mit einem Kleinbus vorgefahren, und der blockiere den ganzen Parkplatz vor dem Ochsen, so ungeschickt haben die Herrschaften parkiert, und mit sich reden lassen sie auch nicht, es sei also als Beizer in seinem wirtschaftlichen
Interesse, wenn das so schnell wie möglich über die Bühne gehe, und deshalb lasse er die Leute jetzt vor, umso schneller seien sie auch wieder weg. Der Wagner tritt einen Schritt zurück, und da platzen auch schon Herren ins Sitzungssäli, der eine um die 50 Jahre alt, von Kopf bis Fuss im schwarzen Gewand, der andere ebenso gekleidet, aber ein junger Mann mit einem frömmlichen Grinsen im Gesicht.
Hosianna, ruft der ältere der beiden, während der Wagner hinter sich die Tür zuzieht und verschwindet. Und dann noch einmal, um ganz sicher zu gehen, dass die frohe Botschaft auch ankommt: Hosianna! Und der jüngere faltet die Hände und blickt verklärt zur Decke.
Die Gemeinderäte schauen sich verwundert an, der Haslinger will eben das Gemeindereglement zücken, um nachzuschauen, was in einer solchen Situation angebracht ist, da beginnt der ältere der beiden Besucher schon seinen Monolog. Er danke für den warmen Empfang, er sei sich nun ganz sicher, dass man hier in Rättigen im richtigen Ort sei, die Bestimmung habe ihn und seinen Assistenten hierher geführt, die göttliche Bestimmung, und, seien wir ehrlich, wann hat die jemals ihr Ziel verfehlt?
Sie beide, erklärt er weiter und gestikuliert mit den Händen und wandert im Saal herum, während der Assistent still vor sich hin zu beten scheint, sie beide seien Abgesandte der Freien Kirche Der Auserwählten Des Ewigen Himmelreichs, und sie hätten wertvolle Fracht mitgebracht, einen Kleinbus voll mit gläubigen Anhängern, allesamt über 80 Jahre alt und kränklich und dahinsiechend und – Gott weiss immer, was Er tut! – zufällig auch äusserst wohlhabend und willens, ihre Besitztümer nach dem Tod der Freien Kirche zu hinterlassen. So viel Edelmut müsse belohnt werden, tagelang sei man in der Gegend herumgefahren, um ein schönes Plätzchen zu finden, wo man in Ruhe mit den lieben Siechenden beten und feiern könne, bis schliesslich der Tag gekommen sei, die Herrschaften verstehen, lange könne es auch nicht dauern, aber man sei froh um die Gastfreundschaft, eben nur solange, bis die Gläubigen sterben. Und dafür habe man sich Rättigen erwählt.
Usgrechnet, entfährt es dem Senn, und der Bannwart schaut ihn sofort scharf an.
Jetzt sei man also hier, fährt der Kirchenführer fort, sein Name sei im übrigen Thedeus Brocker, und das hier neben ihm sei der willige Assistent Shlomo Süssbaum, aber man solle sich nicht von dem Namen ablenken lassen, schon Shlomos Vater habe dem Zionismus abgeschworen und zur Freien Kirche gefunden, jedenfalls sei man nun hier und suche eine Unterkunft, man habe sieben Siechende im Bus, nein, eine Pflege werde nicht erwartet, die verlängere möglicherweise das Siechtum, und das sei ja in niemandes Interesse, nur ein Dach über dem Kopf, ein Massenschlag tue es schon, jedenfalls für die Gläubigen, er selbst und Shlomo würden natürlich gerne angebrachter hausen, es habe doch da bestimmt entsprechende Institutionen im Dorf, und es müsse wohl kaum erwähnt werden, dass man nicht gedenke, für die Unterkunft für die Siechenden zu berappen, immerhin sei man ja in göttlichem Auftrag unterwegs.
Der Bannwart brummt erst etwas vor sich hin, er muss nachdenken, allmählich wächst ihm sein Amt ein bisschen über den Kopf. Scho guet, sagt er schliesslich, in Rättigen habe man eine lange Tradition der Gastfreundschaft, und er sei der letzte, der jemanden wegschicke, aber so einfach sei das nicht. Gästezimmer habe es nur im Adler, und auch dort gerade mal drei Stück, das gehe wohl für den Herrn Freikirchenchef und seinen Assistenten, aber er wüsste in Gottes Namen nicht, wohin er mit sieben Siechenden sollte, das Altersheim sei voll und derzeit nicht gerade der Platz, an den man jemanden mit guter Absicht hinschicke, aber das sei eine andere Geschichte.
So denn, sagt Thedeus Brocker und tätschelt beruhigend den Kopf des Assistenten, der ein bisschen sensibel gebaut zu sein scheint und angesichts der fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten den Tränen nahe ist, es werde ja wohl beispielsweise ein Pfarrhaus geben, man spreche dort ja sozusagen von Gottesvertreter zu Gottesvertreter, und dafür seien die Pfarrhäuser doch da, um den Armen und Siechenden Heimstatt zu sein in schweren Zeiten.
Der Haslinger, der in der Zwischenzeit das Gemeindereglement durchgeblättert hat, ohne fündig zu werden, schüttelt den Kopf. Wenn er das richtig verstehe, dann seien der würdige Herr Brocker und dieser Herr Birnbaum oder Apfelbaum oder wie immer er heisse Abgesandte einer Freikirche, und in Rättigen gebe es bis auf ein paar muslimische Flüchtlinge, die einem der Kanton aufs Auge gedrückt habe, nur Katholiken, also auch nur einen katholischen Pfarrer und auch nur ein katholisches Pfarrhaus.
Der Shlomo Süssbaum weint jetzt ganz ungeniert, und der Brocker tätschelt ihn ein bisschen mehr, er haut ihn jetzt schon fast auf den Kopf, dermassen tätschelt er, und der Süssbaum wankt unter den Schlägen und weint weiter, und schliesslich sagt der Brocker, während er weiter den Kopf seines Assistenten mit Schlägen malträtiert, das sei ja wohl kein Problem, er selbst sei offen gegenüber allen Konfessionen, es bestehe zwar kein Zweifel, dass am Ende der Tage nur die Anhänger der Freien Kirche Der Auserwählten Des Ewigen Himmelreichs das Letztere erreichen würden, aber bis dahin bemühe man sich um Toleranz, und deshalb sei er zur Not auch bereit, die Gastfreundschaft eines Katholiken anzunehmen, diese Pfarrhäuser seien ja sowieso immer hoffnungslos überdimensioniert, und das, wo doch der Pfarrer allein lebe oder höchstens mit einer Haushälterin, also werde er dort anklopfen, er bitte den Herrn Gemeindepräsidenten, seine Ankunft anzukündigen, damit er dem Pfarrer nicht die ganze Geschichte noch einmal erzählen müsse, danke, besten Dank.
Nach einem letzten Tätschler auf den Kopf vom Assistenten Süssbaum, der jetzt schon ein bisschen wankt, aber wenigstens wieder frömmlich-dümmlich grinst, weil es nun besser aussieht mit einer Behausung für die Siechenden, ziehen die beiden wieder ab. Die Gemeinderäte starren ihnen nach, sie starren noch, als die Tür schon längst wieder zu ist. Schliesslich steht der Haslinger auf. Irgendeiner muss ja dem Gnädinger Bescheid geben.
Nur ein paar Meter weiter vor dem Adler herrscht auch Unruhe. Der Kantonspolizist Rothenbühler ist mit dem Auto vor die Beiz gefahren, bleibt ein Weilchen sitzen, um sicher zu gehen, dass niemand in Sichtweite ist, aber da ist niemand, nur ein kleiner Bus vor dem Ochsen, aber da sitzen nur halbtote Pensionäre drin, also steigt er aus, öffnet die hintere Tür, greift in den Wagen und lupft schliesslich ein kleines Geschöpf heraus, ein Mädchen im weissen Hemdchen, die Wangen eingefallen, die Augen tief in den Höhlen, bleich und krank. Der Rothenbühler schleicht zum Eingang des Adlers und gleitet in die Tür, die nur angelehnt ist. Drinnen ist alles vorbereitet.
Unruhe herrscht auch beim Bättig zuhause. Er ist krank geschrieben, sitzt am Esstisch, wartet. Irgendetwas, denkt er, wird geschehen. Er hofft, dass es ihn nicht trifft. Aber schliesslich hat es die Polizei ihm zu verdanken, dass sie Bescheid weiss. Dieser Rothenbühler hat aufmerksam zugehört, hat nicht schlecht gestaunt darüber, dass Rättigen das Sterben nicht mehr zu kennen scheint und versprochen, dass er tätig wird. Soll sich nur nicht zu lange Zeit lassen. Die Nerven vom Bättig sind nicht mehr die besten.
So lebhaft ists im Pfarrhaus zu Rättigen schon lange nicht mehr zugegangen. Den ganzen obersten Stock haben die Freikirchler in Beschlag genommen, unter lautem Getöse schleppen Brocker und Süssbaum alte Matratzen und Bettgestelle vom Estrich herunter und basteln ein Massenlager, das es eben tun muss für die Siechenden, die in der Zwischenzeit auf dem Boden sitzen und vor sich hin starren, schon mehr tot als lebendig, aber eben doch nicht ganz. Der Gnädinger und sein Gast sitzen in der Küche beim Kaffee, der Gnädinger brütet dumpf vor sich hin, der Teufel grinst vergnügt und schüttet Zucker nach und rührt mit dem Finger und schleckt ihn genüsslich ab.
Die Freikirchler seien ihm die liebsten, verkündet er schliesslich lachend, die seien so herrlich schön naiv, ein Gottesdienst bei denen sei für ihn die reinste Komödie, da sitze er gerne zuweilen hinein und lache sich innerlich halb zu Tode, wie die rumhüpfen und lobpreisen, und als wolle er den Teufel bestätigen, lässt der Brocker von weiter oben gerade ein lautes Hosianna ertönen, weil er noch eine siebte Matratze gefunden hat, und der Satan lacht, sogar der Pfarrer Gnädinger erwischt sich, wie er einen Sekundenbruchteil lächelt, bis er sich wieder eines Besseren besinnt.
Nun wohne man ja schon ein paar Tage unter einem Dach, meint da sein Gast plötzlich und in ernstem Tonfall, da werde es Zeit, dass man ein bisschen miteinander ins Gespräch komme. Ob er, der Pfaffe, sich schon einmal überlegt habe, dass er eigentlich froh sein müsste um den Besuch des Leibhaftigen?
Der Gnädinger nimmt einen Schluck Kaffee, er hat sein Kafitrauma überwunden, allmählich geht es wieder, und er hat sich auch schon fast an die Anwesenheit des nderen gewöhnt, der schläft ohnehin die meiste Zeit oder schaut Fernsehen oder liest die Bibel und lacht dabei lauthals vor sich hin, aber er mischt sich selten in des Pfarrers Geschäfte ein, ausser bei dieser Predigt vom Sonntag, aber der Gnädinger kann sich selbst nicht mehr daran erinnern, was er gepredigt hat, tausend andere Gedanken sind ihm durch den Kopf, während er zur Gemeinde gesprochen hat. Also, alles in allem hat sich der Teufel bis jetzt ganz manierlich benommen, und der Gnädinger beschliesst, sich auf das Gespräch einzulassen.
Wie er das meine, fragt er zurück.
Nun, bis jetzt habe er ja einfach glauben müssen, der Pfarrer, ihm sei das wohl nicht schwer gefallen, man habe ihm den Glauben wohl schon von früh auf eingetrichtert, aber hin und wieder, er solle da ganz ehrlich sein, habe es wohl Momente gegeben, da habe auch er an Gottes Güte – oder sogar an seiner Existenz! – gezweifelt, und nun, da er hier sitze und mit dem Leibhaftigen käfele, da müsse er nicht mehr glauben, da wisse er plötzlich.
Der Gnädinger denkt kurz nach und schüttelt dann den Kopf. Das sei zu einfach gedacht. Nur zu glauben und nicht zu wissen, das sei kein Problem, sondern im Gegenteil der halbe Segen. Glauben, ohne zu wissen, sei sogar das ganze Geheimnis des Glaubens. Er habe nie gezweifelt, dass es Gott gebe, und er brauche keinen Beweis.
Soso, macht der Teufel ein bisschen enttäuscht und trinkt Kaffee und schüttet noch etwas Zucker nach, der Pfarrer wird morgen einen neuen Sack voll kaufen müssen. Soso. Aber trotzdem sei es doch beruhigend zu wissen, dass man nicht sein Leben lang falsch gelegen habe, oder? Eines wolle er nur noch vom Pfaffen wissen: Wieso der an der Tür sofort gewusst habe, wer sein Besucher sei.
Was. Der Gnädinger schaut verwundert. Das sei ja wohl ein Witz. Den Teufel erkenne selbst ein kleines Kind. Er solle halt in den Spiegel schauen, er sei ja ein Musterbeispiel für einen Satan. Die Hörner, das Ziegenbärtlein, der Geissenfuss.
Der Teufel lacht laut und lang, und der Gnädinger befürchtet, dass die Freikirchler im obersten Stock hören, dass da noch ein Gast ist, ein Gast, an dem der Gnädinger diesen Sektenmenschen und seine Siechenden sorgfältig vorbeigeschleust hat.
Er habe ja keine Ahnung, sagt da der Teufel, immer noch prustend. Er, der Gnädinger, sehe ihn, den Teufel, vielleicht so. Für andere sehe er aus wie ein ganz normaler Mann in den besten Jahren. Wieder andere hätten einen Greis vor sich, aber er sei den Leuten auch schon vorgekommen wie ein kleines Kind, eine schöne Frau. Jeder habe sein eigenes Bild des Teufels, und jeder sehe ihn so, wie er ihn sehen wolle.
Mag si, erwidert der Gnädinger. Für ihn mache es keinen Unterschied, wie er aussehe. Satan bleibe Satan.
In diesem Moment tritt der Freikirchler Brocker ein, nickt dem Pfarrer zu und grüsst, als wenn nichts wäre, den unbekannten zweiten, der dort vor dem Kaffee sitzt, und der Teufel grinst den Gnädinger triumphierend an.
Er und sein Gehilfe würden nun in den Adler gehen und dort zwei Zimmer nehmen, verkündet der Brocker, es sei ja gut und recht hier im Pfarrhaus, aber man habe es gerne ein wenig intimer, und überall die Bilder vom Papst, das müsse er sich nun wirklich nicht antun, das verstehe der Herr Pfarrer sicherlich. Der Gnädinger nickt langsam und schaut dem Brocker und dem Süssbaum zu, wie sie aus der Tür verschwinden und ihn in dem Haus zurücklassen, allein mit dem Teufel und sieben hinsiechenden Freikirchlern, alle von ihnen guten Willens, ihre irdischen Güter dem Thedeus Brocker und seinem göttlichen Werk zu hinterlassen.
Nur wenige Minuten später stehen Brocker und Süssbaum vor dem Adler- Wirt und fragen nach zwei Zimmern. Der Langenthaler kratzt sich hinterm Ohr, es sind wirklich verrückte Zeiten hier in Rättigen, drei Fremdenzimmer hat er, und die sind bis gestern vor Dreck und Staub gestanden, weil es nie auch nur einen einzigen Touristen ins Dorf verschlagen hat, und gestern ist dieser Polizist aufgetaucht, hat hier in der Beiz Leute befragt, dann ist der Bättig gekommen und hat mit dem Polizisten herumgeflüstert, ist wieder gegangen, und kurz darauf hat der Rothenbühler plötzlich verkündet, er wolle ein Zimmer mieten, also hat der Langenthaler seiner Serviertochter einen Lumpen in die Hand gedrückt und sie ein Zimmer putzen lassen, und weil sie gerade bei der Arbeit war, hat er sie angewiesen, gleich auch in den beiden anderen zum Rechten zu sehen, und jetzt stehen zwei seltsame Gesellen vor ihm und wollen die verbliebenen zwei Zimmer, jänu, ihm solls recht sein, er drückt ihnen die Schlüssel in die Hand, und der ältere der beiden ruft Hosianna! und der jüngere weint vor Freude, während ihm der ältere mit Wucht den Kopf tätschelt. Ein komisches Paar. Aber bitte, zahlen tun sie
in bar, was will man mehr als Beizer in diesen Zeiten.
Der Brocker und der Süssbaum beziehen ihre Zimmer mit den Nummern 2 und 3. In der Nummer 1 sitzt der Rothenbühler auf einem Stuhl beim Bett zu, er hält die Hand seiner Tochter, die dort liegt und flach atmet und bleich ist und kühl und heiss zugleich, seit Tagen schon scheint es zu Ende zu gehen mit dem Mädchen, die Ärzte lassen keinen Zweifel daran, dass es eine Frage der Zeit ist. Zeit, denkt der Rothenbühler, Zeit ist alles, was er braucht. Jahrelang hat er geschuftet, hat sich nicht um die Familie gekümmert, dann ist ihm die Frau gestorben, er hat weiter gearbeitet und eine Haushaltshilfe geholt, die ihm auch auf das Töchterlein schaut, er hat alles perfekt organisiert, damit es so bleiben kann, wie es ist, aber eben, dann ist die Krankheit gekommen, man hat ihm gesagt, dass nicht viel Zeit bleibt, und da ist ihm klar geworden, wie viel Zeit er schon verschenkt hat, wieviel Zeit er für das, was wichtig wäre, nicht gefunden hat, Zeit zuhause, Zeit bei seinem Töchterchen, Zeit, die er sich jetzt so gerne nehmen würde, und genau jetzt zerrinnt sie ihm zwischen den Fingern.
Zeit.
Es sei denn, dieser Bättig hat die Wahrheit gesagt. Es sei denn, hier in diesem Kaff werde wirklich nicht mehr gestorben. Dann, der Rothenbühler kann eigentlich gar nicht daran glauben und tut es gerade deshalb doch, dann mag es sein, dass ihm noch etwas Zeit geschenkt wird. Und er wird nicht von diesem Bett weichen, in keiner Minute, die es wie ein Wunder Gottes für ihn noch vom Himmel regnet.
Hosianna, ertönt es durch die dünnen Wände aus dem Nebenzimmer.
Hosianna!
Manchmal, wenn der Fiechter ins Bett geht, kommt eine der Geschichten mit ihm. Manchmal steigt eine Geschichte mit ihm ins Bett wie eine Hure, die er nicht eingeladen hat, die er nicht bei sich haben will, die er aber irgendwann, vor langer Zeit, bezahlt hat, und die ihn jetzt begleitet, ohne ihn zu fragen.
Manchmal kommt eine Geschichte mit ihm und besteigt ihn und reitet auf ihm, und er geniesst es nicht, er hasst es, aber er kann sie nicht abschütteln, die Geschichte. Es ist jedes Mal eine andere Geschichte. Eine Geschichte aus dem Nachlass vom Dorflehrer Abderhalden.
Wie die Geschichte vom Roger Aduwar.
Rättigen um 1950. Das neue Schulhaus ist soeben fertig gestellt worden. Das Dorf ist gewachsen in den letzten Jahren, der Egger Albert senior ist nicht der einzige, der elf Kinder hat. Jetzt steht es da, das grosse Schulhaus, es wirft einen Schatten auf das alte, es thront mitten im Dorf. An diesem Wochenende sind die Einweihungsfeierlichkeiten. Keine ausgelassenen, dafür ist der Anlass zu ernst, aber gefeiert wird doch. Die kleinen Mädchen führen ihre einstudierten Tänze vor, die Jugendkapelle bläst dazu, der Kinderchor singt vorher und nachher und dazwischen erst recht. Dann die Blockflötengruppe, ein Handorgel-Trio aus der fünften Klasse, noch einmal die Tänzerinnengruppe, die Rede vom Schulratspräsidenten, die Rede vom Gemeindepräsidenten, die Rede vom Pfarreiratspräsidenten, ein Stück vom Kirchenchor, ein Stück vom Männerchor, dann noch einmal der Schulratspräsident, der die Dankesworte vergessen hat, dann wieder die Blockflötengruppe, irgendwann wird gegessen, die Gemeinde gibt Würste aus, später wird noch ein Spanferkel angeschnitten, Bier und Wein werden ausgeschenkt, und jetzt ist die Feier doch ein bisschen ausgelassen, die Kinder bekommen Traubensaft, und manchmal erwischen sie ein Glas Wein, weil der fast genau so aussieht, und dann sagen sie niemandem etwas und giggelen und lachen und am nächsten Tag ist ihnen schlecht, aber das haben sie beim nächsten Dorffest wieder vergessen.
Die Feier nähert sich ihrem Höhepunkt, jetzt treten Kirchenchor und Männerchor und Handorgel-Trio und Blockflötengruppe und Jugendkapelle und die kleinen Tänzerinnen alle gleichzeitig auf, geplant ist das nicht und sie spielen auch nicht dasselbe Stück, aber bitte, der Wein und das Bier haben ihre Wirkung getan, und die meisten Rättiger haben mit dem Zuhören längst aufgehört.
In diesen Minuten hält der Zug aus der Stadt in Rättigen an. Ein Mann steigt aus, gross und hager, mit einem Gesicht zum Fürchten, pockennarbig, die Nase krumm, die Zähne noch krummer. Roger Aduwar ist der Name dieses Mannes, der Rättigen vor über zehn Jahren verlassen hat, der eines abends halb besoffen aus der Beiz gestürchelt und ohne einen Rappen im Sack in die Fremde gezogen ist, weil ihn keiner ernst genommen hat im Dorf, weil er nicht dazu gehört hat, weil er nicht dazu gehören wollte.
Aber das ist vorbei. Ein Jahrzehnt lang ist der Roger Aduwar in der Welt herum gereist, hat manchmal wochenlang nichts zu essen gehabt, hat gelebt wie ein Tier im Wald, hat mit keiner Menschenseele geredet, wollte sterben, dann und wann, hat aber nicht gewusst, wie ers anstellen soll, hat dann doch weiter gelebt, gelebt und gehorcht, in sich selbst hinein gehorcht, Stimmen sind zu ihm gekommen, haben ihm gezeigt, wo Beeren wachsen und wo Wasser fliesst. Er hat mit ihnen gesprochen, mit den Stimmen, und er ist ruhiger geworden, friedlicher, und irgendwann hat der Roger Aduwar beschlossen, nach Hause zu fahren, nach Rättigen, wo er nicht mehr sein wollte und sie ihn nicht mehr haben wollten, aber zuerst hat er einen Brief nach Hause geschrieben, an die Gemeinde, weil er keine Verwandten mehr gehabt hat im Dorf, hat sein Kommen angekündigt, hat geschrieben, dass alles anders werden wird, dass der Roger Aduwar zu sich selbst gefunden hat, dass er seinen Jähzorn überwunden hat, dass er arbeiten und ein aufrechter Bürger sein will. Der Brief ist auch angekommen bei der Gemeinde, dort hat man zuerst gestaunt, aber dann ist man sich einig gewesen, dass man dem Aduwar eine Chance geben soll, dass man ihm vielleicht sogar einen kleinen Empfang bereitet, fein säuberlich hat er ja hingeschrieben, wann er ankommen wird in Rättigen. Man werde das später besprechen, heissts im Gemeindehaus zunächst, der Brief verschwindet in einem Register.
Also steht der Roger Aduwar am Tag seiner Ankunft am Bahnhof, gottverlassen ists, noch gottverlassener als sonst, kein Mensch zu sehen. Schöner Empfang, denkt sich der Rückkehrer, schöner Empfang. Den muss man suchen gehen. Und das tut er dann auch, spaziert ins Dorf hinein, riecht seine Heimat, die nicht anders riecht als tausend andere kleine Bauernkäffer irgendwo in diesem Land und eben doch so einzigartig.
Als er immer weiter ins Dorf hinein spaziert, hört der Aduwar die Musik, das Lachen, das Holz, das sich unter tanzenden Füssen biegt. Er zittert leicht, das hat er nicht erwartet, nicht so. Aber dann sieht er, dass es so ist: Ganz Rättigen ist da zusammen gekommen auf dem Platz vor dem Schulhaus, nein, vor den beiden Schulhäusern, offenbar ist da ein neues dazu gekommen, während er weg gewesen ist. Da sitzen sie und essen und trinken und tanzen, und ein Rednerpult hats auch, die Fahnen hängen im Wind, lustig habens die Leute, lustig und laut, und das alles, weil er, der kleine Roger Aduwar, nach Rättigen zurückgekommen ist.
Nachdem er sich satt gesehen hat, sich ein wenig geräuspert hat, damit ihm keine Chrott im Hals sitzt, falls er selbst auch noch etwas sagen muss dort vorne am Rednerpult, da traut er sich langsam an die Festgemeinde heran, geht zu einem der Holztische, an denen die Leute tafeln, da schaut ihn eine Frau an, die dort sitzt, die Tochter vom Spengler Rechsteiner könnte es sein, er ist sich nicht sicher, sie ist noch klein gewesen, als er das Dorf verlassen hat, der Aduwar lächelt das Fräulein an, grüezi, ich bins, der Roger Aduwar, und das Fräulein starrt ihn an, ohne zu verstehen, und er erkennt in ihren Augen den Ekel, mit dem ihn die meisten Leute anstarren, gut, ja, sie kennt ihn nicht, woher soll sie wissen, dass er es ist, den man heute hier feiert, den verlorenen Sohn, aber jetzt dreht sich die Dame neben dem Fräulein zu ihm, ah ja, eben, es ist die Frau Rechsteiner, eben doch, und sie kennt den Roger Aduwar, keine Frage, und er sieht sofort, dass sie ihn erkennt, aber sie erkennt ihn nicht wie einen,
den man feiert, sie zuckt zusammen und wendet sich ab und flüstert ihrem Mann etwas ins Ohr, der Spengler Rechsteiner schaut ihn jetzt an, schüttelt den Kopf, nimmt einen langen Schluck Bier, stellt das Glas wieder hin und fragt schliesslich, ohne dem Aduwar richtig in die Augen zu schauen.
Was willsch?
Der Roger Aduwar merkt, wie ihm die Glieder schwer werden, wie er sich jetzt am liebsten hingelegt hätte, hinlegen und sterben, aber das hat er schon so oft versucht, und jetzt will er etwas anderes versuchen, nicht sterben, leben, leben in Rättigen, mit den Rättigern, die ihm alles verziehen haben, die feiern, nur weil er zurückgekommen ist.
Wieso grad jetzt? Der Rechsteiner fragt es ruhig, aber er spuckt dem Aduwar mit jeder Silbe seinen Widerwillen direkt vor die Füsse. Das neue Schulhaus feiere man, und genau jetzt müsse er, der Haderlump, zurück kommen. Das sei ja wirklich ein schöner Zufall. Ob man denn nicht einmal in Ruhe etwas Schönes, Gelungenes feiern könne.
Im Aduwar drin arbeitet es, es rattert in seinem Kopf, und als er endlich begreift, da sind ein paar Minuten vergangen, und in diesen Minuten wird’s still auf dem Platz vor dem schönen neuen Schulhaus, weil inzwischen jeder den Aduwar gesehen hat, alle schauen zu ihm herüber, keiner lächelt, alles schaut misstrauisch oder argwöhnisch oder böswillig, nur der Gemeindepräsident erhebt sich, siedend heiss ist ihm der Brief eingefallen, der Aduwar hat sich ja angekündigt, aber bei all den Vorbereitungen für das grosse Dorffest hat keiner mehr daran gedacht, er weiss nicht recht, was er den Leuten jetzt sagen soll, der Gemeindepräsident, und wie er so da steht und überlegt und es rund um ihn herum schweigt, da reisst der Roger Aduwar plötzlich die Augen weit auf, rennt quer über den Platz zur Festwirtschaft, reisst dem Metzger, der gerade das Spanferkel aufspiessen will, den dicken Metallspiess aus den Händen und stösst ihn sich in den weit geöffneten Rachen, bis vom Spiess nur noch ein kleines Ende aus seinem Mund ragt, und es gurgelt, als würde da einer beim Zahnarzt liegen und nicht wissen, wohin er mit dem Speuz hin soll, der aufgespiesste Roger Aduwar torkelt auf den Metzger zu und fällt direkt ins offene Feuer, das die Pfadi Rättigen für das Spanferkel angerichtet hat, und aus dem Feuer heraus zischt es und es riecht nach verbranntem Fleisch und Metall.
Niemand schreit in Panik, keiner läuft davon, alle sitzen sie da und starren auf die Feuerstelle, und als es irgendwann nicht mehr gurgelt und zischt, da drehen sich die Köpfe zum Gemeindepräsidenten, der immer noch da steht und sich schliesslich zu den Leuten dreht und sich räuspert und sagt, dass der Roger Aduwar angekündigt habe, er wolle nach Rättigen zurück kehren. Aber bislang habe ihn keiner gesehen im Dorf. Oder? Der Gemeindepräsident fragts ins Volk, und dort schüttelt man den Kopf und
greift zum Glas oder zur Wurst, und irgendwann winkt der Gemeindepräsident dem Dirigenten des Männerchors zu, und der gibt seinen Mannen ein Zeichen, und gleich darauf ertönts vom Schulplatz her: «Alles Leben strömt aus dir.»
Der Fiechter zieht sich die Decke über den Kopf, es fröstelt ihn, er weiss nicht, ob er m nächsten Tag noch aufstehen mag, liegen bleiben sollte man können, liegen bleiben nd tief atmen und warten und atmen und warten und irgendwann nicht mehr atmen. rgendwann nicht mehr atmen. Irgendwann nicht mehr atmen sollte man können.
Er ist hin und wieder in der Stadt, aber der Gnädinger staunt jedes Mal von Neuem, wie völlig anders die Welt eine Viertelstunde von Rättigen entfernt aussieht. Nicht, weil die Häuser grösser und die Strassen voller Autos sind. Es sind die Menschen. In Rättigen geht einer aus dem Haus, weil er zur Arbeit muss oder in den Volg oder zur Post oder zur Gesangsprobe. Hier in der Stadt brauchen die Menschen keinen Grund. Viele schlendern einfach so herum, ziellos, zeitlos.
Nicht so der Gnädinger. Nicht heute. Er pressiert. Er will es hinter sich haben. Er will erzählen, was es zu erzählen gibt und dann auf den Rat warten. Und ein Rat wird kommen, da ist sich der Gnädinger sicher. Im Pfarrhaus hält es der Pfarrer sowieso nicht mehr aus. Im oberen Stock richten sich die Freikirchler ein und sein anderer Gast sitzt seit einer Stunde in der Badewanne und singt lauthals.
Schon nach wenigen Minuten Fussmarsch sieht der Pfarrer die grossen, weinroten Fensterläden, die ihn von dem stolzen Gebäude herab anglotzen. Der Gnädinger schaut schnell zu Boden, er fühlt sich immer klein und unwürdig, wenn er hierher kommt, oft ist das nicht, nur, wenn er gerufen wird, aber heute hat er sich selbst angemeldet, denn heute hat er es mit einem zu tun, dem er selber nicht gewachsen ist, für den es eine höhere Instanz braucht.
Der Dorfpfarrer klingelt. Dann wartet er. Das ist immer so hier. Besucher lässt man warten, damit sie sich besinnen können, sich vorbereiten auf den Gastgeber, der seine Zeit nicht gerne verschwenden lässt. Oder vielleicht lässt er seine Gäste auch einfach warten, um ihnen zu zeigen, dass er nicht auf sie gewartet hat. Dass er sie nicht braucht. Aber der Gnädinger braucht ihn. Also wartet er geduldig. Schliesslich geht die Tür auf und eine ältere Dame mit strengen Gesichtszügen winkt den Pfarrer herein. Die Frau schaut so herrisch und von oben herab wie die Fensterläden. Sie wartet, bis der
Gnädinger abgelegt hat, dann geht sie ihm voraus, durch einen breiten Gang, eine Treppe hoch, durch einen noch breiteren Gang, bis sie beide vor einer hohen Tür stehen. Die Frau klopft kurz und leise, mustert den Gnädinger noch einmal abschätzig und verschwindet schliesslich in einer kleineren Tür am anderen Ende des Gangs.
Der Pfarrer wartet wieder einige Minuten, er kennt das Spiel, er steht ganz ruhig und etwas geduckt da, bis es schliesslich hinter der hohen Tür hervor tönt.
Ja. Inne.
Der Gnädinger drückt die schwere Klinke, stösst die schwere Türe auf, duckt sich noch ein bisschen mehr und betritt den Raum. Es ist mehr eine Halle, dem Pfarrer kommts immer ein bisschen vor wie aus 1001 Nacht, aber der Vergleich ist schlecht, das weiss er, denn das hier ist nicht der Orient, das hier ist tiefstes Abendland, und hinter dem riesigen Arbeitstisch am Ende der Halle sitzt kein Sultan, sondern der Bischof.
Sitzed ane.
Der Gnädinger tippelt leise durch die Halle, setzt sich auf den kleinen, klapprigen Stuhl vor dem Tisch, hinter dem der Bischof thront. Eine fette Zigarre hat er sich angesteckt, sein Chef, und fett ist er auch selbst, der Bischof, fett und feist, ganz kleine Augen hat er, weil sie kaum Platz haben zwischen all dem Fett.
Was, fragt der Bischof. Was isch?
Er habe nicht viel Zeit. Ein Abendessen habe er in zehn Minuten, ein Essen mit einem Gesandten aus Rom. Darauf werde er nicht verzichten. Also. Was?
Der Gnädinger holt tief Luft. Er habe einen Gast, sagt er. Er habe einen Gast, der nicht mehr gehen wolle. Und er, der Pfarrer, habe nicht die Kraft, ihn aus dem Haus zu weisen.
Der Bischof starrt den Gnädinger eine Weile lang an. Dann öffnet er eine Schublade, nimmt eine riesige Tafel Schokolade hervor und bricht ein gewaltiges Stück ab. Es knackt laut. Der Bischof schiebt sich das Stück in den Mund, er schluckt es, ohne gross zu kauen. Er nimmt ein weiteres Stück. Es verschwindet in dem kleinen, feuchten Mund des Bischofs. So, sagt der Bischof, nachdem er geschluckt hat. Er, der Gnädinger, wolle ihm also erzählen, dass er nicht Manns genug sei, jemandem die Tür
zu weisen. Nun gut. Er, der Bischof, begreife zwar nicht, wie ein Mann Gottes, ein Hirte, der dem einfachen Volk Sonntag für Sonntag predige, was recht sei und was billig und was des Teufels, der zeige, welcher Weg ins Himmelsreich führe und welcher in die ewige Verdammnis, dass also ein solcher Mann nicht imstande sei, sein eigenes Haus in Ordnung zu halten. Oh nein, verstehen könne er das nicht, in keinem Fall, aber, und der Bischof bricht mit einem lauten Knacken wieder ein grosses Stück Schoggi ab und kaut kurz darauf herum, bevor er schluckt und spricht durch einen feuchten Mundwinkel weiter, aber es sei nun einmal so, und er werde dem Gnädinger helfen, soweit es in seiner Macht stehe.
Gern, flüstert der Gnädinger und schaut zu Boden und hört, wie der Bischof hinter dem riesigen Pult vor sich hin kaut und schluckt und wieder ein Stück Schokolade abbricht und wieder kaut und schluckt. Gern, sagt der Gnädinger noch einmal und wartet geduldig.
Die Polizei, sagt der Bischof und stösst ein bisschen auf, bevor er die Schoggistücke in seinem Mund mit einem Schluck Kaffee runter spült, das wäre das Einfachste. Aber daran habe der Gnädinger selbst wohl auch schon gedacht, oder? Der Pfarrer nickt und schaut weiter zu Boden.
Aber getan habe er es nicht, stellt der Bischof fest. Er habe die Polizei nicht geholt, der Herr Dorfpfarrer. So. Da werde es wohl Gründe dafür geben. Also keine Polizei. Der Bischof zieht eine weitere Schublade aus dem grossen Pult hervor und holt eine grosse Wurst heraus. Der Gnädinger, der kurz nach oben blinzelt, hat noch nie eine so gewaltige Wurst gesehen, rot ist sie und glänzt vor Fett, sie glänzt wie das Kinn des Bischofs, der die Wurst liebevoll betrachtet und einen scharfen Brieföffner vom Pult nimmt und anfängt, Rädli abzuschneiden und sie sich in den Mund zu schaufeln, grosse, dicke, weiche Wursträdli, die in dem grossen schwarzen Loch im Gesicht vom Bischof verschwinden, und dem Gnädinger wird ein bisschen schlecht.
Jänu, schmatzt der Bischof laut, jänu, keine Polizei halt. Dann werde er halt seinen Messgehilfen schicken, das sei ein kräftiger Kerl, der mache den Leuten schon Angst, wenn er nur vor ihnen stehe. Aber die Auslagen habe er, der Gnädinger, zu tragen, das sei klar. Der Pfarrer schaut auf. Jetzt liegt nur noch ein Wurstzipfeli vor dem Bischof, der satt und zufrieden hinter seinem Pult sitzt und seine Finger abschleckt, die vom Fett der Wurst triefen.
Der Gnädinger flüstert etwas Richtung Boden.
Was? Der Bischof nimmt den Daumen aus dem Mund. Er verstehe kein Wort, der Pfarrer solle gefälligst deutlicher reden.
Ob er nicht selbst kommen könne. Der Gnädinger sagts so schnell, dass er sich selbst dabei nicht aufhalten kann. Es sei eine Sache, bei der kein Messdiener dieser Welt etwas ausrichten könne. Es brauche einen Mann Gottes, aber einen aus den oberen Reihen. Ob er, der Bischof, nicht vielleicht doch selbst nach Rättigen komme.
Die Augen des Bischofs sind träg und müde und wässrig, als er den Kopf schüttelt. Wer auch immer das sei, den der Gnädinger da im Pfarrhaus beherberge, so bleibe es doch seine eigene Sache, wie er das löse, die Kirche sei föderalistisch organisiert, der Bischof könne sich nicht um jede einzelne Pfarrei persönlich kümmern, wo käme man da hin, nirgends käme man da hin, antwortet der Bischof gleich selbst auf seine Frage.
Mit diesen Worten wischt er die Fettspuren auf dem Pult weg und zieht ein paar Akten aus einer Schublade und legt sie vor sich hin ihn, so, dass der Gnädinger merkt, dass die Audienz vorbei ist und er nicht mehr geduldet ist.
nicht sehen kann, also dreht er sich nicht um, sondern rennt atemlos durchs dunkle Dorf, bis er vor der Kirchentür steht. Er weiss nicht genau, was er hier soll, er weiss genau genommen nicht einmal, wie er zur Kirche hereinkommt, mitten in der Nacht, aber er weiss, dass er nicht zuhause bleiben kann, keine Minute länger, im Bett herumgeworfen hat es ihn. Im Schlaf verfolgen ihn grauenhafte Träume, aber wenn er aufwacht, sind es Visionen, die dem in nichts nachstehen, er kann also weder schlafen noch wachen, der Fiechter, und wenn es einen Platz gibt, der einen behüten kann vor bösen Träumen und Visionen, dann ja wohl das Haus Gottes.
Der Fiechter schaut sich um und überlegt, womit er die Tür aufbrechen könnte, er betrachtet den Türrahmen fachmännisch und legt die Hand prüfend auf die Falle, und wie er diese, mehr aus Gewohnheit als mit echter Hoffnung, herunterdrückt, geht die Tür auf. Der Fiechter starrt ungläubig aufs Kirchenschiff, das da im Halbdunkel vor ihm liegt, sichtbar nur dank dem ewigen Licht, dass beim Altar vorne von der Decke hängt, seltsam ist das, die Kirche ist ja offen für alle armen Sünder, aber das Kirchenhaus ist nachts geschlossen, soviel weiss der Fiechter, nur schon wegen der Leute, die in der Not gern mal einen Opferstock mitlaufen lassen. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass seit dem Abgang vom Mesmer hier keiner mehr zum Rechten schaut.
Langsam schleicht der Fiechter zwischen den Bänken durchs Kirchenschiff, nicht, weil er Angst hat, einer könnte ihn hören, sondern weil er nicht viel sieht und sich hier auch nicht gerade blind auskennt, dafür ist er zu selten im Gottesdienst, nichts gegen den Gnädinger, der macht seine Sache bestimmt recht, und an Gott glauben tut der Fiechter auch, weil er es nicht anders gelernt hat, aber das Beten ist nicht seine Sache, und er hat auch nicht vor, jetzt damit anzufangen, er wüsste auch gar kein Gebet, aber in der Kirche, so rechnet es sich der Gemeindearbeiter aus, da ist er Gott ja zumindest
geografisch schon um einiges näher und damit wohl auch sicher vor dem Bösen.
Im zweitvordersten Bank lässt sich der Fiechter nieder, er kniet, weil er das für demütiger hält als das Sitzen, und ein bisschen Demut kann im Moment nicht schaden, immerhin will er ja auch etwas, er kommt als Bittsteller, er will befreit werden von seinen Ängsten. Der Fiechter hofft, dass das ganz von allein passiert, denn er wüsste beim besten Willen nicht, wie man sich etwas von Gott erbittet. Wie er so da kniet und wartet und hofft, hört der Fiechter plötzlich Stimmen, sie kommen von der rechten
Seite, aber im Kirchenschiff sitzt keiner, soviel sieht er im trüben ewigen Licht, und ausserdem, was sollte einer mitten in der Nacht hier? Wobei, fällt dem Fiechter ein, er selbst hat hier ja auch nichts verloren, und ausserdem war die Tür ja offen, wie er sich jetzt erinnert, also hätte jeder hereinspazieren können, und irgend jemand hat das offenbar auch gemacht, nein, zwei müssen es mindestens sein, es sei denn, einer führt Selbstgespräche.
Der Fiechter schwankt zwischen Angst und Neugier. Schliesslich setzt er sich auf, reibt die Knie ein bisschen und rutscht dann so geräuschlos wie möglich auf dem Bank nach rechts, näher an die Sakristei, von wo die Stimmen kommen müssten. Als er auf dem äussersten rechten Zipfel der Bank sitzt, versteht der Fiechter jedes Wort.
Wie lange er das noch zu tun gedenke, wieso er immer noch hier sei, wann er endlich seine Pflicht wahrnehme, fragt ein Mann ins Dunkle hinein. Der Fiechter denkt nach, er kennt die Stimme, dieses leichte Lispeln, es ist einer vom Dorf, soviel ist klar, er hat die Stimme schon gehört. Bald, sagt ein zweiter Mann, Zeit brauche ich, noch etwas Zeit. Diese Stimme ist dem Fiechter unbekannt. Jetzt lacht der erste Mann, aber es ist ein nervöses Lachen, so, als wenn er lieber weinen würde, aber damit gar nicht erst anfangen will, weil er befürchtet, nie wieder aufhören zu können. Säged au, lacht er, Zeit brauche der Herr also, soso. Er sei nun schon den zweiten Tag hier im Dorf, ohne Anstalten zu machen, für Recht und Gesetz zu sorgen.
Der Bättig, denkt der Fiechter, der Bättig aus dem Gemeinderat. Was sitzt der mitten in der Nacht in der Sakristei? Der Bättig ist in einer gewissen Weise der Chef vom Fiechter, denn der Gemeinderat entscheidet darüber, wer in Rättigen die Steuern einsammelt oder die Identifikationskarten ausstellt oder eben die toten Katzen von der Strasse kratzt. Deshalb vergisst der Fiechter für einige Zeit seine Angst, es nimmt ihn schaurig wunder, wieso sein Chef die Nacht mit einem Mann in der Kirche verbringt und dabei so nervös lacht und seltsame Fragen stellt.
Was es ihn denn überhaupt angehe, dass er noch immer hier sei, fragt jetzt die unbekannte Stimme. Er solle froh sein, dass er seine Arbeit nicht gewissenhaft erledige, denn würde er das tun, so würde er, der Bättig, bald gesiebte Luft einatmen.
Fertige Seich, entgegnet der Bättig, und er tönt plötzlich nicht mehr nervös, eher recht entschlossen. Er sei es ja gewesen, der der Polizei reinen Wein eingeschenkt habe, ohne ihn würden sie alle noch im Dunklen tappen, und es sei von Anfang klar abgemacht gewesen, dass er, der Bättig, aus dieser Sache herausgehalten werde, sobald er, der Rothenbühler, die Ermittungen abgeschlossen habe. Aber bisher sei ja wohl von Ermittlungen nicht viel zu merken gewesen.
Der Fiechter versteht kein Wort, er lauscht atemlos in die Stille, die jetzt in der Sakristei herrscht und hirnt darüber, was er gehört hat. Der zweite Mann scheint also dieser Rothenbühler von der Kantonspolizei zu sein, das wenigstens hat der Fiechter verstanden, und er ist ja nicht ab der Welt, er hat auch gehört, dass die Polizei nach der Sache im Altersheim in Rättigen eingefahren ist und dass sich einer von ihnen im Adler häuslich niedergelassen hat, aber der Fiechter hat sich dabei nicht sonderlich viel gedacht, denn er weiss im Grunde nichts von der Polizeiarbeit. Jetzt sagt der
Rothenbühler wieder etwas, und der Fiechter beugt sich etwas näher zur Sakristei.
Er werde in dieser Sache ermitteln, ganz gewiss, aber er habe seine eigenen Methoden, der Bättig müsse ihn nicht belehren, und es gebe für alles einen richtigen Zeitpunkt, und der sei eben noch nicht gekommen. Und überhaupt, warum der Bättig es so eilig habe damit, dass Licht in diese Sache komme, das scheine ihm schon noch seltsam.
Ein leises Klicken kommt aus der Sakristei, gefolgt von einem kleinen Räuchlein. Da hat sich einer eine Zigarette angezündet, denkt der Fiechter und fragt sich, ob es wohl der Bättig ist, der hat ja mit dem Rauchen schon vor Jahren aufgehört, das war damals ein Thema im Gemeinderat, weil der Bättig plötzlich rauchfreie Sitzungen verlangt hat, damit ihm das Aufhören ein bisschen leichter gemacht werde, aber die anderen Gemeinderäte waren der Meinung, es sei dem Bättig sein Problem, wenn der plötzlich ein gesundes Leben führen wolle und haben weiter geraucht.
Mit Rättigen gehe es vor die Hunde, sagt der Bättig in diesem Moment, bevor er einen hörbaren Zug von der Zigarette nimmt, der Gemeinderat sei seit dieser Sache im Altersheim nicht mehr funktionstüchtig, es würde ihn auch wundern, es sei ja ein Verein von Mördern, nein, von Auftraggebern, aber das sei im Grunde dasselbe, jedenfalls entgleite dem Bannwart sein Amt allmählich, und noch immer sei nicht klar, warum der Friedhof im Dorf allmählich verwaise, nichts mehr habe der Gemeindepräsident im Griff, das sei kein Zustand, und wenn der Bannwart das selbst
nicht einsehe, dann helfe nur etwas, dann müsse man ihn und seine Helfer hinter schwedische Gardinen stecken, und er, der Bättig, der einzige, der von Anfang an dagegen gewesen ist, dass man zum Feller gehe mit diesem irrwitzigen Auftrag, er könne dann zunächst interimistisch und danach hoffentlich ordentlich gewählt die Gemeinde führen, damit alles wieder seine Ordnung habe im Dorf.
Ah so, sagt der Rothenbühler. Von da weht der Wind. Der Bättig wolle ein bisschen Karriere machen. Das verstehe er ja, er habe selbst einiges unternommen, um vom kleinen Korporal aufzusteigen bis zur Kriminalpolizei. Schon recht, kein Problem, es sei ihm egal, wer hier in Rättigen auf dem Thron sitze, aber er werde ganz gewiss nicht einfach von heute auf morgen ein paar Leute in Untersuchungshaft setzen, nur um dem Bättig den Weg zu ebnen.
Genau das werde er tun, entgegnet der Bättig mit zischender Stimme, sonst werde in den nächsten Tagen ein Telefon an den Polizeikommandanten gehen, und es könnte ihm einer erzählen, dass der Beamte Rothenbühler nicht, wie offiziell angegeben, bei einem familiären Notfall anwesend sein müsse, sondern dass er sich mit seinem kranken Töchterlein in einem Rättiger Dorfspunten verschanze, weil er eine halbwollige Geschichte vom Ende des Sterbens für bare Münze nehme und dass er dabei noch Verbrecher schütze, indem er Beweise missachte.
Der Fiechter sitzt so weit rechts aussen auf dem Kirchenbank, dass er fast in die Sakristei hinein fällt. So richtig kann er immer noch nicht verstehen, von was die Rede ist, aber dumm ist er nicht, und es scheint jedenfalls, als wenn der ganze Gemeinderat Dreck am Stecken habe und der Bättig das für sich nutzen wolle.
Als wollte er bestätigen, dass der Fiechter auf dem richtigen Pfad ist, zieht der Bättig jetzt Bilanz und sagt dem Rothenbühler noch einmal deutlich, was er von diesem erwartet. Er solle das morgen in Ordnung bringen und schauen, dass der Bannwart und Konsorten zur Rechenschaft gezogen werden, ohne dass er, der Bättig, davon etwas abbekomme. Dann könne er von ihm aus bis zum jüngsten Tag mit seinem Töchterlein im Adler hocken, das gehe ihn nichts an.
Der Fiechter ahnt, dass der Rothenbühler auf das nicht mehr viel zu entgegnen weiss und schleicht sich leise durchs Kirchenschiff und zur Tür hinaus.
der Gnädinger den Kopf in die Hände legt und das alles nicht fassen kann.
In diesem Moment klingelt es an der Tür, aber der Gnädinger macht keine Anstalten, aufzustehen, er erwartet niemanden, und überhaupt, wann immer er in letzter Zeit die Tür aufgemacht hat, ist etwas hereingekommen, auf das er hätte verzichten können, also bleibt er in der Küche sitzen, der Pfarrer, während es draussen allmählich Sturm läutet. Kurz darauf hört er, wie die Tür aufgeht, abgeschlossen hat er nicht, wozu auch, wovor soll sich der Gnädinger schützen, wenn das Schlimmste, was einen im Leben treffen kann, schon lange im eigenen Haus sitzt, und kurz darauf steht der Kantonspolizist Rothenbühler in der Küche, auf den Armen trägt er ein kleines Mädchen, das zu schlafen scheint, und sogar der Brocker hört jetzt auf zu lamentieren und wartet gespannt darauf, was jetzt kommt.
Es tue ihm leid, er platze nicht gern einfach so in ein fremdes Haus, beginnt der Rothenbühler, aber es sei ein Notfall, er müsse dringend wieder in die Stadt, es gebe eine Entwicklung in dieser Sache rund ums Alois-Heim, aber sein Töchterlein müsse er hier im Dorf lassen, und weil er keinen kenne in Rättigen, habe er sich halt gedacht, das Pfarrhaus sei die beste Adresse, es gehe nur um ein paar Tage, das Meitli mache auch kaum Umstände, es esse nichts als Haferflocken an warmer Milch, viel trinken müsse es, aber ansonsten sei es ruhig und still.
Der Gnädinger, der Brocker und der Süssbaum schauen alle gleichzeitig vom Rothenbühler zum Mädchen und wieder zurück zum Rothenbühler. Dass das Mädchen keine Umstände macht, glauben sie alle, es sieht mehr tot als lebendig aus, auch wenn sich der kleine Brustkorb noch ein bisschen zu heben und zu senken scheint. Der Gnädinger senkt den Blick zum Kafitässli, er wisse nicht, wie er es sagen soll, aber was der Rothenbühler da verlange, sei völlig unmöglich, er sei Pfarrer und betreibe
hier kein Kinderheim, zudem habe er das Haus jetzt schon voll bis unters Dach, es sei wohl gescheiter, der Rothenbühler nehme sein Töchterlein mit in die Stadt, er habe dort doch bestimmt noch Familie.
Der Rothenbühler schüttelt den Kopf, nein, eben nicht, er habe niemanden, den er fragen könne, und es sei ja auch nur für ein paar Tage. Während der Gnädinger immer weiter den Kopf schüttelt, drücken sich der Brocker und der Shlomo Süssbaum am Rothenbühler vorbei aus der Küche heraus, sie wollten noch einmal oben nach dem Rechten sehen, sagt der Brocker, manchmal gehe es ja überraschend schnell bei den Alten, und wie sie aus der Küche draussen sind, hören der Pfarrer und der Kantonspolizist, wie sie im Gang jemanden grüssen, au das no, denkt der Gnädinger, sein anderer Gast ist auf dem Weg hier herein, und er überlegt sich schon, welche Geschichte er dem Rothenbühler auftischen könnte, als der Teufel die Küche betritt und der Rothenbühler rote Backen bekommt vor Freude und triumphierend zum Gnädinger schaut.
Bitte, das sei doch die Lösung, lacht der Rothenbühler triumphierend, weshalb der Herr Pfarrer nicht erwähnt habe, dass er eine Haushälterin habe, die wisse doch mit Sicherheit mit Kindern umzugehen, so lieb und fürsorglich, wie sie dreinschaue, und dass sie nicht mehr die jüngste sei, komme gerade recht, er halte viel von Erfahrung, hier könne er sein kleines Meitli mit bestem Gewissen lassen, bis er wieder hier sei, und mit diesen Worten legt der Rothenbühler dem Teufel sein Töchterlein in die
schweren Pranken, nickt dem Pfarrer noch einmal zu und eilt aus dem Haus.
Jedem das seine, ruft der Teufel und wirft das kleine Mädchen in die Luft und fängt es geschickt wieder auf und lacht dabei dem Gnädinger ins Gesicht. Jedem das seine.
Einfach ist es, denkt sich der Fiechter, er muss sich nur erinnern, er hat ja alle diese Geschichten gelesen, und es hat ihn schon beim Lesen angeekelt, aber aufhören konnte er doch nicht, und so richtig zum wahnsinnig werden ist es erst geworden, als er sich erinnert hat, als die Geschichten angefangen haben, in ihm drin lebendig zu werden. Also wird er sich erinnern, ganz bewusst erinnern, wird sich die Chronik vom Lehrer Abderhalden in Erinnerung rufen, und zwar jetzt gleich, sofort, er will nicht mehr warten, der Fiechter, er erinnert sich an –
– das Schlusswort der Chronik.
Im Grunde war Rättigen schon immer des Teufels.
Wo am Sonntag die Kirche gerammelt voll ist und keiner auch nur eine Sekunde daran denkt, einmal den Herrgott Herrgott sein zu lassen und vielleicht doch lieber noch ein bisschen Holz zu schlagen am freien Tag hinter dem Haus statt in die kalten Bänke zu knien, wo also alles gut ist und fromm und treu und fest verankert im Glauben, wo keine Seele zweifelt und alle Hände sich schliessen, wenn der Pfarrer vorne das Weihrauch durch die Gegend schleudert, wo Gott also überall ist und in jedem und
allem, da ist er im Grunde genommen nirgends.
Wo jede gute Tat getan wird, weil man schon immer gut zueinander war und nicht weiss, wie schön es sein kann, Schlechtes zu tun, da wird im Grunde nichts Gutes getan, denn wo die Versuchung fehlt, da kann niemand fehlgehen, und wo keiner fehlgehen kann, da kann sich keiner etwas darauf einbilden, es nicht zu tun. Deshalb war der Teufel lang schon in Rättigen, bevor ihn einer hier gesehen oder gespürt oder geahnt hätte, in jeder guten Tat, jedem guten Gedanken und jedem Gebet ist der
Leibhaftige gesessen, weil sie hier ja nicht mit dem Herzen gut waren, die Rättiger, sondern aus Gewohnheit. Und die Gewohnheit ist der Nährboden der Sünde, und der Teufel musste nur warten.
Im Grunde war Rättigen schon immer des Teufels.
Wenn sie gestorben und verreckt und verendet sind in Rättigen, dann war das wie ein Psalm für den Leibhaftigen, Mal für Mal, nicht weil sie gestorben und verreckt und verendet sind, nein, das tun sie auch an anderen Orten auf dieser Welt, damit lockt keiner den Teufel, aber hier in Rättigen, hier werden sie nicht müde, von Gott zu sprechen und von der Rechtschaffenheit und vom Teilen und von der Frömmigkeit und wie gut sie sind, die Menschen auf dem Land, und nichts freut den Teufel mehr als wenn die Leute, die sich als die Musterkinder Gottes wähnen, so senkrecht vom Weg abkommen und es nicht einmal merken, weil sie sich gegenseitig so lange die Ohren vollgeheuchelt haben, dass sie keine Sekunde lang an ihrem edlen Tun zweifeln können, und hier fühlt sich der Teufel wohl, das ist sein Paradies, und deshalb kommt er immer wieder.
Ich habe ihn gesehen, als ich noch ein Kind war. Er ist mitmarschiert in der Blasmusik, beim Kreismusiktag, den die Rättiger ausgerichtet haben, er hat die vierte Trompete gespielt, die vierte nur, die ersten drei Stimmen hat er diesen mittelmässigen Bläsern aus dem Dorf überlassen, dabei hat er tausendfach besser gespielt als sie, aber keiner wollte ihn sehen, weder die Musikanten noch die Zuschauer, denn für einmal hat sich die Blasmusik Rättigen nicht ganz so schlecht angehört, und das letzte, was sie wollten, wäre gewesen, dass irgend einem Fremden dieser Ruhm zugesprochen würde.
Ich habe ihn später nie wieder gesehen, den Teufel, aber gehört habe ich ihn, wie er zu mir gesprochen hat, als ich diese Chronik geschrieben habe, als ich diese Geschichten gesammelt habe, an denen er sich weidet, Nacht für Nacht hat er mir in den Schlaf hinein geredet und mich ermuntert, weiter zu schreiben, das habe ich getan, nicht für ihn, für mich, und wie ich fast fertig war mit der Chronik, wie ich nur noch das Schlusskapitel schreiben musste, da hat er mir gesagt, dass er sich überlegt, ganz
hierher zu ziehen, in dieses Dorf, auf das Land, denn hier, unter all diesen Gläubigen und Gottgefälligen, hier gefalle es ihm besonders, die Leute hier machten ihm viel Freude, wie sie genau wüssten, was richtig ist und was falsch und wie sie zielsicher das Falsche tun, wenn es ihnen nützt und dann noch behaupten, es sei in den Augen Gottes das Richtige gewesen. Gefallen täte ihm das, hat er mir gesagt, der Teufel, wenn ich zu schlafen versuchte, und eines Tages werde er mit Sack und Pack hierher ziehen und bleiben, aber er werde nicht mit leeren Händen kommen, nein, im Gegenteil, er werde ein tüchtiges Stück seiner Macht mitbringen und dafür sorgen, dass fortan ganz Rättigen sein herrlich heuchlerisches Getue bis in alle Ewigkeit tätigen könne, weil es den Tod nicht mehr geben werde hier, für niemanden, für die Menschen nicht wie für das Vieh. Eines Tages werde er komme, sein Geschenk werde er vorausschicken, damit auch jeder wisse, dass seine Ankunft nahe sei. Mag er
kommen. Der Chronist wird es nicht mehr erleben. Basta!
Paul Abderhalden, alt Lehrer in Rättigen.
Hinter dem Fiechter macht es einen Klapf, er fährt zusammen und duckt sich, aber wie er vorsichtig aufschaut, sieht er, dass es nur ein Buch ist, dass aus dem Regal gefallen ist, keine teuflische Chronik, ein altes Schulbuch. Der Fiechter schüttelt sich ein wenig und schliesst die Augen, er ist bereit für ein weiteres Kapitel, er will noch viel mehr hören, der Abderhalden hat so viel Entsetzliches aufgeschrieben, dass es reichen würde, um hundert Mal wahnsinnig zu werden. Aber bevor dem Fiechter eine neue Geschichte einfällt, kommt ihm ein anderer Gedanke. Der nämlich, dass der
Abderhalden vielleicht doch nicht einfach ein Spinner war, wie die Leute im Dorf sagen, dass er mit manchem recht gehabt hat und dass der Bättig und der Rothenbühler deshalb in der Sakristei gesessen sind gestern Nacht. Und wenn wirklich der Teufel in Rättigen hockt und sich einen Spass mit den Leuten macht, dann muss der Fiechter das einem erzählen, der ganz bestimmt weiss, was da zu tun ist.
Der Fiechter steht auf und nimmt den Mantel und geht aus dem Haus. Suchen und finden muss er ihn. Er weiss auch, wo.
aussergewöhnlichen Massnahmen zu greifen. Eine Notlage sei es sicher, hat der Haslinger gemeint, wenn im Dorf so selten gestorben werde, dass es nicht einmal mehr der Messner hier aushalte.
Der Bannwart ist von Anfang an skeptisch gewesen. Zum einen kann er sich nicht vorstellen, dass in irgend einem amtlichen Dokument davon die Rede ist, dass die Rättiger plötzlich mit dem Sterben aufhören, und zum anderen möchte er also den Richter noch sehen, der grosszügig darüber hinweg sieht, dass einer Pensionärin im Altersheim der halbe Kopf weggeschossen wird, nur weil der Gemeinderat findet, es sei jetzt an der Zeit für aussergewöhnliche Massnahmen.
Jetzt ist es Dienstag Vormittag, der Senn und der Reimann, die ja nur ehrenamtlich und gegen Spesenentgelt im Gemeinderat sitzen, sollten schon lange wieder im Betrieb bei der Arbeit sein, der Bannwart und der Haslinger werden im Gemeindehaus wahrscheinlich schon vermisst, und allmählich sieht auch der Gemeindeschreiber ein, dass es nichts Schriftliches gibt, mit dem sich das Problem juristisch aus dem Weg befördern lassen würde.
Vergesse, sagt der Bannwart und reibt sich die übernächtigten Augen, chönnds vergesse. Man müsse ganz einfach hoffen, dass für die Polizei die Sache mit dem Tod vom Feller abgeschlossen sei, man habe einen Täter und ein Opfer, und zufällig seien beide tot, das sei doch ein Traum von jedem faulen Beamten, wo kein Kläger, da kein Richter, sagt der Bannwart dann noch, und er ist ein bisschen stolz, dass ihm die Redensart im richtigen Moment eingefallen ist.
Der Haslinger, der einen Bundesordner mit Handänderungen durchstöbert, schüttelt heftig den Kopf. Darauf wolle er sich nicht verlassen, man müsse für jede Eventualität vorbereitet sein, die Polizei sei schliesslich immer noch im Dorf, zumindest einer, dieser dicke, und wie er, der Haslinger, vor einer halben Stunde schnell nach Hause gegangen ist, um den Hund in den Garten zu lassen, da habe er mit dem Langenthaler gesprochen, der vor dem Adler in der Schautafel die Menükarte gewechselt hat, und
wenn man dem Wirt glauben dürfe, dann sei der Polizist, dieser Rothenbühler, gestern abend zusammen mit dem Bättig in der Beiz gesessen, und das heisse vielleicht gar nichts, vielleicht aber auch sehr viel.
Der Senn und der Reimann schauen sich mit gequälten Gesichtern an. Das vom Bättig hat der Haslinger bis jetzt für sich behalten, und es sind keine guten Neuigkeiten. Der Bannwart kann sich auch nicht recht vorstellen, was der Bättig mit einem von der Kantonspolizei verloren hat, und so stehen die vier alle recht unentschlossen und nervös im Zimmer, als die Tür plötzlich aufgeht und der Ochsen-Wirt, der Wagner, herein kommt, er hat es längst aufgegeben, sich zu fragen, wieso der halbe
Gemeinderat seit bald zwei Tagen im Sitzungszimmer logiert, er ist auch nur hier, um Besuch anzumelden, der Herr Rothenbühler von der Kantonspolizei warte am Eingang und bitte die Herrschaften, sich doch umgehend nach unten zu begeben, es gebe da etwas zu besprechen.
Der Bannwart wird kreideweiss im Gesicht, der Haslinger starrt ängstlich in Richtung Fenster, als könnte der Rothenbühler von dort ins Zimmer herein schauen, dabei sitzt der Gemeinderat ja im zweiten Stock, der Senn fängt an, wie ein altes Schlachtross zu schnaufen, er macht einen Heidenlärm, und der Reimann hält sich die Ohren zu, aber weniger wegen dem Senn, sondern weil er das, was er da gehört hat, lieber nicht gehört hätte, aber dafür ist es jetzt zu spät.
Der Bannwart geht zum Fenster und schaut auf den Vorplatz hinunter, er sieht das Auto vom Rothenbühler, ihn selber sieht er nicht, er wird wohl vor der Tür stehen und einer seiner Männer an der Hintertür, der Rothenbühler ist ja nicht dumm, denkt der Bannwart, aber Herrgott, er, der Gemeindepräsident, ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, und soweit kommts noch, dass er in seinem eigenen Dorf quasi vom Stammtisch weg verhaftet wird, das kommt gar nicht in Frage, nicht auszudenken, was das für ein Gerede geben würde. Der Bannwart zermartert sich das Hirn, als er
plötzlich sieht, wie der Haslinger in die Jacke steigt.
Wohin er wolle, was er vorhabe, schön da zu bleiben habe der Herr Gemeindeschreiber, ruft der Bannwart und packt den Haslinger mit einer Hand am Arm, während er mit der anderen den Wagner aus dem Zimmer scheucht, der kein Wort versteht, aber sofort gehorcht.
Use wolle er, ruft der Haslinger zurück und befreit sich vom Bannwart, er wolle runter zum Rothenbühler, so diskret wie möglich, und er empfehle dem Bannwart und den zwei anderen, es auch so zu machen, denn wenn die Polizei mit einem reden wolle, dann mache sie das auch, je nachdem früher oder später beziehungsweise mit mehr oder weniger Umständen, sich zu wehren habe jedenfalls gar keinen Sinn, im Gegenteil, es mache einen schlechten Eindruck, besser sei es, jetzt einfach das zu tun, was der Rothenbühler will und dann frühestens auf dem Posten laut zu werden, dort, wo nicht das ganze Dorf zusieht wie auf einer Schaubühne.
Der Bannwart reibt sich die Nase, ihm ist immer noch halb schlecht von der Aufregung, in Gedanken sieht er sich auf dem elektrischen Stuhl, aber das ist Unsinn, so etwas gibt es hier gar nicht, das hat es nie gegeben, und das Schlimmste, was dem Gemeindepräsidenten passieren kann, ist, dass er im Gefängnis landet und seine Arbeit verliert und seine Familie ihn verlässt, und für dem Bannwart seinen Geschmack reicht das eigentlich auch aus an schlechten Aussichten, aber was der Haslinger sagt, macht auf den zweiten Blick eben doch Sinn.
Vier gegen einen, ruft da der Senn dazwischen, ganz egal, was der Rothenbühler sich da zusammengesponnen habe und was er irgend einem Richter erzählen werde, es stehe immer das Wort des Kantonspolizisten gegen vier Stimmen aus dem Rättiger Gemeinderat, vier gestandene, währschafte Mannen, alle unbescholten. Der Haslinger habe Recht, übernimmt der Reimann das Wort, man solle jetzt einfach so schnell und unauffällig wie möglich zum Rothenbühler in den Wagen steigen und sich abchauffieren lassen, alles weitere könne man dann in der Stadt regeln, bis zum Abend seien sie alle wieder zuhause vor dem Znacht, und keine Menschenseele werde bis dann gemerkt haben, dass Rättigen für ein paar Stunden ohne politische Führung gewesen ist.
Die politische Führung im Dorf ist im Moment dem Bannwart sein kleinstes Problem, das sieht man ihm an, er reibt sich immer noch die Nase und wirft dann und wann einen Blick aus dem Fenster, aber dort sieht es immer noch genau gleich aus wie vor fünf Minuten, und dem Bannwart wird klar, dass das mit dem diskreten Verschwinden im Wagen von Rothenbühler nur funktioniert, wenn er sich bald entscheidet, wenigstens, bevor ein Kommando von der Kantonspolizei die Treppe im Ochsen
heraufgestürmt kommt, denn dann ist es vorbei mit der Diskretion, dass weiss auch der
Gemeindepräsident.
Guet, sagt er schliesslich, gömmer, aber es müssten alle vier zusammen bleiben, keine Extrawürste, und jeder solle die Geschichte genau so erzählen, wie sie gewesen sei, es glaube es einem vielleicht kein Mensch, aber es sei die Wahrheit, und die Wahrheit sei halb so wild, wenn man es recht bedenke, es sei um eine Katze gegangen, um einen vollgefressenen Kater und um nichts anderes, und wenn der Feller das falsch verstanden habe, sei das sein Problem.
Der Bannwart geht aus dem Sitzungszimmer heraus zur Treppe, der Haslinger, der Senn und der Reimann gehen ihm schön im Einerreiheli nach.
Jahren im Gemeinderat, der Bättig, und den Respekt der Rättiger hat er sich ordentlich verdient, aber ausser einem kleinen Abschnitt im Jahresbericht der Gemeinde, wo der Bättig über sein Verantwortungsgebiet, die öffentliche Kehrrichtabfuhr und die Stromversorgung, berichten muss, ist er noch nie gezwungen gewesen, sich öffentlich zu äussern, das hat immer der Bannwart gemacht, aber der ist jetzt mitsamt dem Haslinger, dem Senn und dem Reimann in der Stadt bei der Kantonspolizei, und wenn der Bättig dem Bannwart seine Nachfolge antreten will, dann darf er sich nicht zum Hanswurst machen vor allen Leuten.
Rein organisatorisch läuft alles wie am Schnürchen. Kaum hat der Bättig den Rothenbühler mit dem halben Gemeinderat im Auto abfahren sehen, hat er die zwei Gemeindeverwaltungslehrlinge mit einem Handzettel durchs Dorf geschickt, von Haushalt zu Haushalt, und auf dem Zettel ist gestanden, dass der Gemeinderat Bättig alle Stimmberechtigten wegen eines unvorhersehbaren Notfalls noch für heute abend in die Kirche zur ausserordentlichen Bürgerversammlung lädt. Der Bättig bezweifelt, dass die Lehrlinge an diesem Nachmittag die Runde in ganz Rättigen machen können, aber vermutlich ist das gar nicht nötig, denn die Nachricht wird sich ganz von allein verbreiten, spätestens, wenn sie einmal in der Bäckerei Löpfe angelangt ist, die Frau vom Bäckermeister Löpfe bedient im Laden und ist mehr wert als der ganze Nachrichtendienst der Armee, wenn es darum geht, im Dorf eine Meldung kursieren zu lassen. Drei Mal hat der Bättig den Stiften eingeschärft, möglichst früh bei der Frau Löpfe vorbei zu gehen.
Wenn dann die Bürger in der Kirche versammelt sind, so will der Bättig die Wahrheit und nichts als die Wahrheit verkünden, wenigstens fast, lügen wird er nicht, aber gewisse Sachen vielleicht weniger deutlich sagen als andere, zum Beispiel, wieso der Bannwart mitsamt dem Senn und dem Reimann und dem Gemeindeschreiber Haslinger bei der Polizei sitzt, er wird sich da ein bisschen sehr ungefähr ausdrücken, aber auf jeden Fall kommt er dann zum Schluss, dass das kein Zustand sei fürs Dorf, wenn es quasi aus einer Zelle heraus regiert werde, man bedenke bloss, was passiert, wenn die Presse davon erfährt, und damit wird der Bättig die Rättiger hinter sich haben, den Schreiberlingen gegenüber sind sie sehr misstrauisch. Der Bättig ist optimistisch, dass es gar nicht nötig sein wird, gross ins Detail zu gehen, es reicht ja wohl, dass seit ein paar Tagen hier im Dorf geschossen und verhaftet wird, in einer Gemeinde, in der seines Wissens vorher noch nie geschossen oder verhaftet worden ist.
Er glaubt fest daran, dass alles gut gehen wird und er ruhig ein bisschen träumen darf.
Am Bach unten ists dem Pfarrer Gnädinger wohl. Seit er in Rättigen ist, kommt er immer wieder gerne hierher, ruhig ists und grün, und der Bach rauscht zwar nur leise und nicht so gewaltig wie ein Fluss, aber es ist ein schönes Geräusch, wenn man schweigen kann, der Gnädinger ist ja keiner, der mit sich selbst spricht, und er ist meistens allein am Bach, auch jetzt wieder, und wie er so da steht und dem Bach zuschaut, fragt er sich, wen genau er denn eigentlich hierher mitnehmen würde, wenn er für einmal nicht allein sein will am Bach, und weil ihm niemand einfällt, überlegt sich der Gnädinger, ob er allenfalls nicht nur deshalb immer allein hier unten ist und schweigt und lauscht, weil ihm das so gut tut, sondern vielleicht auch, weil er gar niemanden hat, der mit ihm zusammen schweigen und lauschen würde.
Hinter dem Bach fängt Glauberschen an, er ist die Grenze zwischen den beiden Dörfern, und im Moment scheints dem Pfarrer, als wenn da drüben eine ganze neue Welt anfangen würde, da hinten in Glauberschen steckt das Leben, während es auf seiner Seite des Baches tötelet, der Gnädinger weiss natürlich, dass das so nicht stimmt, im Gegenteil, tot ist eben gerade gar nichts in Rättigen, er hat sehr wohl gemerkt, dass hier nicht mehr gestorben wird, er ist ja schliesslich der Pfarrer, wer sollte das früher merken als er, aber er hat halt angenommen, dass es eines von Gottes Werken ist, die man nicht zu hinterfragen hat, und auch wenn nicht gestorben wird, so tötelet es doch sehr in diesem Rättigen, die Leute sind tot, von innen heraus gestorben, und dass sie nicht wirklich sterben können, das macht die Sache eigentlich nur noch trauriger.
Er hat noch nie vorher so viel Leben im Pfarrhaus gehabt, der Gnädinger, mit all den Alten im oberen Stock, die länger leben als es den Freikirchlern recht ist, mit dem Meitli vom Rothenbühler, mit seinem Gast, der nicht gehen will. Es ist ein volles Haus, aber der Gnädinger ist heute Vormittag vor der Leere davon gerannt, die Leere ist es, die ihn fast erdrückt hat, es war nicht zum Aushalten, und er ist gegangen und hat das ganze Haus sich selbst überlassen, weil er sowieso das Gefühl hat, dass er nichts tun kann oder das alles, was er tut, für nichts und wieder nichts ist. Er zweifelt nicht an Gott und seiner Grösse, das tut der Gnädinger nicht, das hat er noch nie getan, aber er denkt sich, dass Gott vielleicht in diesem Fall gerade ein bisschen wegschaut.
Der Gnädinger weiss, dass er irgendwann zurück muss, zurück ins Dorf, zurück in sein Haus, vielleicht kommt heute der Bischof, vielleicht holt der Rothenbühler sein Töchterlein wieder, als Pfarrer muss er Ordnung halten in seinem Haus, aber er kommt ich ein bisschen vor wie eine Hausfrau, die nach einem Erdbeben die Brotbrösmeli rund ums Brotbrettli sorgfältig zusammenwischt, während um sie herum das ganze Haus zusammengefallen ist, vielleicht ist ja irgendwann wirklich wieder Ordnung im
Pfarrhaus, vielleicht geht der andere doch noch eines Tages wieder dorthin zurück, von wo er gekommen ist, auch wenn er sagt, dass er für ewig bleibt, dann ist wieder Ruhe m Pfarrhaus, aber andererseits kann sich der Pfarrer Gnädinger nicht recht vorstellen, dass es jemals wieder so ist wie früher, und wenn er ehrlich ist mit sich selber, dann muss er sagen, dass er gar nicht mehr weiss, wie es früher gewesen ist.
Der Gnädinger schaut noch einmal sehnsüchtig ins Dorf Glauberschen hinüber, er ist in all den Jahren in Rättigen vielleicht drei oder vier Mal im Nachbardorf gewesen, es gibt ja eigentlich auch keinen Grund dazu, in Rättigen haben sie alles, was es zum Leben braucht, aber, und jetzt lächelt der Pfarrer ein bisschen in den Bach hinein, das reicht eben nicht, alles zu haben, was es zum Leben braucht, jetzt wäre manch einer froh, wenn man das hätte, was es zum Sterben braucht, vielleicht braucht man zum
Leben den Teufel und zum Sterben Gott, den Gnädinger schüttelts selber, als ihm dieser komische Gedanke kommt, er schaut vom Bach herauf Richtung Himmel, da ist alles wie immer, und überhaupt, wenn Gott in diesen Tagen ein bisschen wegschaut von Rättigen, dann wird er ja nicht genau in dem Augenblick wieder hinschauen, wenn der Pfarrer Gnädinger einen komischen Gedanken hat.
Hinter dem Gnädinger knackt ein Zweiglein, er dreht sich um und sieht ihn da stehen, wie er versonnen auf den Bach schaut und lächelt und schweigt. Warum er ihn nicht einmal hier unten in Ruhe lassen könne, sagt der Pfarrer, es reiche ja wohl, dass er in seinem Haus wohne. Der Mann schaut den Gnädinger fast schon entschuldigend an. Er habe nicht stören wollen, auf keinen Fall, er sei nur hier, falls er, der Herr Pfarrer, ihm etwas zu sagen habe, im Haus habe man ja keine Ruhe mehr für ein gutes Gespräch zwischen Männern, das sei ja der reinste Taubenschlag geworden, aber hier unten am
Bach, da lasse es sich gut plaudern.
Der Gnädinger wüsste beim besten Willen nicht, was er mit dem Teufel zu besprechen hätte, es reicht schon, dass er ihn den ganzen Tag um sich hat. Schweigend starrt er ins Wasser und wartet, aber er merkt, dass der andere keine Anstalten macht, zu gehen. Vielleicht muss er ihn etwas fragen, bis er verschwindet, denkt der Gnädinger, und er fragt, ohne vom Bach aufzuschauen.
Wieso Rättigen?
Ja, wieso, fragt der andere zurück. Wieso in Gottes Namen. Er habe sich das auch schon gefragt, denn eigentlich habe er ja die Wahl, und es sei eine grosse, weite Welt. Aber irgendetwas ziehe ihn immer wieder zurück in dieses Kaff. Und schön sei es hier, einfach schön. Und er müsse keine Angst haben, dass es am nächsten Tag weniger schön sein, nein. Rättigen bleibe Rättigen. Das sei viel wert heutzutage.
Dem Gnädinger sein Blick geht wieder zum Nachbardorf.
Ob er glaube, dort sei es besser, fragt der andere. Ob er denke, Rättigen sei etwas Spezielles, und die Leute in Glauberschen würden ihm besser zuhören bei der Sonntagspredigt und dann nach Hause gehen und Gutes tun und Gutes denken und sich auf den nächsten Sonntag freuen. Ob er das wirklich glaube, fragt er den Pfarrer, und es hört sich mitleidig an.
Der Gnädinger hört nicht mehr zu, er ist müde und er hat ein bisschen Hunger, aber da fällt ihm die Wurst ein, die der Bischof gegessen hat und die Fettspur auf seinem Kinn, und der Hunger ist schon weg, als der Pfarrer langsam wieder Richtung Dorf geht. Er will nach Hause, in sein Haus, das trotz allem eben immer noch sein Haus ist, er will keinen sehen und mit keinem sprechen und für den Rest des Tages schlafen. Es ist ihm egal, dass der andere neben ihm her geht, als wären sie zusammen auf einem beschaulichen Waldspaziergang, er merkt nicht einmal, dass der andere weiter auf ihn einredet und plötzlich sogar den Arm um ihn legt und ihm aufmunternd die Schulter drückt.
Der Fiechter starrt hinter dem Baum hervor. Er sieht den Pfarrer Gnädinger. Und er sieht die Frau, die ihn hat sitzen lassen. Den feinen Stich im Herzen merkt er kaum.
Aber kalt ist ihm.
Wenn einer in der Kirche so ein bisschen halblaut vor sich hin hüstelt, dann hüsteln nachher ein paar dutzend. Das ist zwar kein heiliges Gesetz, aber es funktioniert immer, es ist, als wenn allen anderen plötzlich einfällt, dass sie selbst schon zu lange nicht mehr gehustet haben, und wenn sie einmal damit angefangen haben, merken sie, dass dieses Husten hier drin viel mehr schallt und tönt als zuhause, und weil sie nicht ganz sicher sind, schicken sie noch einen Huster nach und vielleicht noch einen, und
bis dann ist die halbe Gemeinde angesteckt.
Dem Bättig ists auch ums Husten oder eher ums Räuspern, er hat eine Chrott im Hals, als er langsam Richtung Altar spaziert, wo das Sprechpültli mit dem Mikrofon aufgestellt ist. Die Kirche ist gut gefüllt, es sind viele Rättiger gekommen, die Frau Löpfe hat ganze Arbeit geleistet, natürlich sitzt nicht das ganze Dorf da in den Bänken, das hätte gar keinen Platz hier, zu den meisten Bürgerversammlungen kommt ja sowieso immer nur ein kleiner Teil der Stimmberechtigten, diesmal sinds sogar ein
bisschen mehr als sonst, die Neugier wird sie getrieben haben, es ist ja seltsam genug, so kurzfristig und dann noch von einem ganz normalen Gemeinderat und nicht vom Gemeindepräsidenten eingeladen zu werden.
Hinter dem Sprechpültli richtet sich der Bättig jetzt zuerst einmal ein, zuerst faltet er das Blatt sorgfältig auseinander, auf dem seine Notizen stehen, dann klopft er ein bisschen aufs Mikrofon, und es klopft sofort in der ganzen Kirche, in ein paar Bänken meint der eine oder andere, es sei gehustet worden und hustet zurück, der Bättig ist zufrieden, alles funktioniert, er kann also anfangen, nein, er muss anfangen, er kann ja nicht das halbe Dorf in der kalten Kirche versammeln und dann allen einen schönen Abend wünschen und nach Hause gehen und vor den Fernseher liegen, jetzt muss er denen etwas liefern.
Er begrüsse das Rättiger Stimmvolk ganz herzlich zu dieser ausserordentlichen Bürgerversammlung, fängt der Bättig an, seine Stimme zittert ein bisschen, es sei schön, dass so viele so kurzfristig hätten kommen können, das sei doch wirklich gelebte direkte Demokratie, wie sie eben nur auf dem Land möglich sei, man müsse sich einmal vorstellen, wie viele Verwaltungslehrlinge man in der Stadt hätte
losschicken müssen, um alle Stimmberechtigten einzuladen. Der Bättig lächelt in die Menge, er erwartet einen kleinen Lacher an dieser Stelle, aber da kommt nichts, zwei oder drei Huster, die sich aber nicht fortpflanzen, dabei könnte er das gerade jetzt so gut gebrauchen, es ist für ein paar Sekunden ein bisschen peinlich, und der Bättig beschliesst, das Witzeln jetzt doch besser zu lassen.
Das mit der Kurzfristigkeit tue ihm schaurig leid, es sei aber leider nicht anders möglich gewesen, denn die Ereignisse in Rättigen hätten sich heute Nachmittag gewissermassen etwas überstürzt, und er halte es für seine Pflicht, das Volk keinen Tag länger als unbedingt notwendig im Ungewissen zu lassen. Es gehe darum, dass die Herren von der Kantonspolizei heute den Gemeindepräsidenten Bannwart, die Gemeinderäte Senn und Reimann sowie den Gemeindeschreiber Haslinger abgeführt
und in die Stadt gebracht hätten, fährt der Bättig fort, und jetzt kommt die Reaktion, die er erwartet hat, keiner hustet mehr, dafür geht ein Tuscheln und Flüstern und Köpfeschütteln und Händeverwerfen in den Kirchenbänken los. Jetzt kann sich der Bättig endlich ausgiebig räuspern, offiziell, um für Ruhe zu sorgen, inoffiziell, um die Chrott im Hals loszuwerden.
Soviel er wisse, fährt der Bättig fort, müsse das alles mit der Sache im Alois-Heim zu tun haben. Dass er nicht mehr wisse, hänge eben damit zusammen, dass er selbst und der geschätzte Wiesmann von der Radikalen Opposition von den Gemeinderatskollegen in den letzten Tagen im Dunkeln gelassen worden seien, die anderen vier hätten ihre Machenschaften irgendwo in einem Schlupfwinkel im Ochsen
ausgebrütet, während der Wiesmann und er, der Bättig, der ordentlichen Gemeinderatsarbeit nachgegangen seien. Es sage aber wohl mehr als genug, dass sie beide hier und heute anwesend seien, während der Bannwart und Konsorten bei der Polizei Rechenschaft ablegen müssen.
Ein paar Rättiger machen einen langen Hals und versuchen, den Wiesmann ausfindig zu machen, aber der ist nirgends zu sehen, es wäre auch neu, dass der an einer Bürgerversammlung teilnehmen würde.
Noch wisse man nicht, was nun weiter gehe, macht der Bättig schnell weiter, natürlich gelte die Unschuldsvermutung, die habe ja immer zu gelten, aber der gesunde Menschenverstand sage wohl etwas anderes, man habe hier im Dorf in den letzten Tagen Zustände gehabt, wie sie nicht einmal im alten Rom an der Tagesordnung gewesen seien, schiesswütige Gesellen hätten auf unschuldige, wehrlose alte Frauen geschossen, die halbe Gemeindespitze sei von der Polizei überwältigt und verhaftet worden, ruft der Bättig ins Mikrofon, und wie er das so sagt, sehen die Rättiger ganze
Wildwest-Szenen vor ihrem geistigen Auge, ganz Rättigen schwimmt in einer Blutlache und von allen Seiten stürmen bewaffnete Kommandos auf den Bannwart und seine Kollegen ein, die sich hinter dem Ochsen in einem Schützengraben verschanzen.
Er, der Bättig, sei zusammen mit dem Wiesmann der letzte Rest der ordentlich gewählten Gemeindeführung, der Wiesmann wolle künftig politisch etwas kürzer treten, aber er selbst sei bereit, die Verantwortung zu übernehmen, man könne nicht warten, bis die Polizei die Verhafteten freigebe und dann irgendwann in ein paar Jahren das Bundesgericht ein abschliessendes Urteil fälle, wie auch immer die Anklage laute, so viel Zeit habe man nicht, in Rättigen müsse wieder Ordnung geschaffen
werden, die grassierende Kriminalität müsse man eindämmen.
Der Bättig hat sich richtig ins Feuer geredet, aber er merkt jetzt, dass das die letzte Notiz auf seinem Blatt gewesen ist, und er weiss nicht, wie es jetzt genau weiter geht, der einzige, der Schritt für Schritt sagen kann, wie so eine Bürgerversammlung abzulaufen hat, ist der Haslinger, und der kaut im Moment vermutlich an einem Stückli trockenem Brot herum und ist dem Bättig keine Hilfe. Vielleicht könnte man einfach darüber abstimmen lassen, ob man ihn zum neuen Gemeindepräsidenten wählen will, aber allenfalls muss man dafür zuerst auch den Bannwart abwählen oder so, der Bättig ist sich wirklich nicht sicher und ist darum fast froh, als sich aus einer der hinteren Reihen die Frau Löpfe von der Bäckerei meldet. Sie danke dem Bättig für die offenen Worte, auch wenn sie das alles natürlich längst gewusst habe, man sei ja informiert und am Puls der Zeit als aktiver Dorfladen, aber es schade nie, solche Sachen auch noch aus berufenem Mund zu hören, manchmal seien es ja nur Gerüchte ohne wahren Kern, das liege daran, dass heute jeder einfach ein bisschen in der Weltgeschichte
herumpalavern müsse, ohne darüber nachzudenken, was das alles auslösen könne. Jedenfalls sei das ja alles denkbar beunruhigend und unschön, und das sei genau die Art von Schlagzeilen, die Rättigen wirklich nicht brauche. Aber wenn schon Unangenehmes auf den Tisch komme, so sei das vielleicht ein guter Zeitpunkt für eine allgemeine Aussprache, es gebe da noch eine andere Angelegenheit, die alle angehe, sie, die Frau Löpfe, könne nicht beurteilen, ob es damit etwas auf sich habe, sie könne ja auch nur das nachschwätzen, was ihr andere sagen, und auch das mache sie nur ungern, aber es sei in den letzten Wochen immer wieder die Rede davon gewesen, dass Rättigen ein so gesundes Pflaster sei, dass das schon fast ein bisschen ungesund wirke, die Rede sei davon, dass man hier im Dorf machen oder lassen könne, was man wolle, man könne sich mit voller Länge einem Blitz in den Weg stellen oder sich quer aufs Gleis legen oder was auch immer, aber das alles reiche nicht, um das Zeitliche zu segnen, und auch wenn sich das im ersten Moment nach einem wahren Segen anhöre, so gebe es doch auch Stimmen im Ort, die finden, dass das keine Art sei, es habe ja sowieso zu wenig auf der Welt, auf das man sich verlassen könne, die Steuern und das Sterben seien fast die letzten zwei, und über kurz oder lang könne es im Dorf für Aufregung sorgen, dass jetzt nicht einmal mehr das gesichert sei.
Der Bättig schaut die Frau Löpfe schweigend an und nestelt ein bisschen am Mikrofon herum. Auf seinem Zettel hat es keine passende Antwort, denn er hat gehofft, dass kein Rättiger das Thema anschneiden wird. Natürlich, fängt der Bättig schliesslich an, habe an diese Gerüchte auch schon im Gemeinderat behandelt, aber man sei nach ausgiebigen wissenschaftlichen und empirischen Studien zum Schluss gekommen, dass aus demografischen Gesichtspunkten derzeit kein Handlungsbedarf bestehe und man deshalb für den Moment einfach abwarten wolle. Für allgemeine politische Schritte sei es jedenfalls zu früh, man werde stattdessen jeden Fall aus der Bürgerschaft einzeln und gesondert beurteilen, was konkret heisse, dass sich ab morgen jeder im Gemeindehaus melden könne, der der Meinung sei, er könne einen berechtigten Anspruch auf das Sterben geltend machen. Jeder Einzelfall, wiederholt der Bättig, werde seriös geprüft.
Sie habe nicht vor, ein amtliches Sterberecht einzufordern, versichert die Frau Löpfe dem Bättig, aber sie und vermutlich noch manch ein anderer Rättiger würde ganz gerne wissen, woran es liege, dass sogar Leute, für die es nicht nur von Amtes wegen, sondern schlicht und einfach aus gesundheitlichen Gründen höchste Zeit zum Sterben wäre, das nicht fertig bringen würden. Aus den Bänken vor und hinter der Rednerin kommen zustimmende Rufe, irgendwo klatscht einer sogar, die Frau Löpfe bekommt ein bisschen rote Backen und setzt sich schnell wieder hin.
Der Bättig holt tief Luft und will ausholen, weil er aber nicht weiss, was er sagen soll, holt er vorsichtshalber noch ein bisschen länger Luft, vor lauter Luftholen erstickt er schon fast, als plötzlich im hintersten Winkel des Kirchenschiffs einer aufsteht und sich lautstark zu Wort meldet. Die Rättiger drehen sich um und fangen an zu tuscheln, den Fiechter haben sie noch nie hier drin gesehen, weder an einer Bürgerversammlung noch an einer Messe, als Gemeindeangestellter dürfe er nicht an
Bürgerversammlungen, hat der Fiechter einmal im Dorf herum erzählt, geglaubt hats ihm keiner so richtig, und selbst wenn, in die Messe dürfte der Fiechter mit Sicherheit, aber auch da taucht er nicht auf, doch jetzt steht er plötzlich da, aufrecht und laut, als wenn er die Kirche bestens kennen würde.
Wenn es irgend einen hier drin ernsthaft interessiere, dann könne er den Rättigern schon verraten, warum man hier keinen mehr zu Grabe trage. So etwas bringe nur fertig, wer mit dunklen Mächten im Bunde sei. Und er, der Fiechter, wisse genau, wer das sei.
* * *
Im Pfarrhaus erwacht der Gnädinger aus einem unruhigen Schlaf, er reibt sich die Augen und schaut aus dem Fenster und sieht, dass in der Kirche Licht brennt, er kann sich das nicht erklären, aber gut, seit der Mesmer aus Rättigen verschwunden ist und eine Aushilfe an zwei Tagen pro Woche nach dem Rechten schaut, kommt es hin und wieder zu solchen Zwischenfällen, dann wird er halt selber schauen, dass die Kirche wieder dunkel wird, Strom für nichts und wieder nichts verbrauchen, das kann sich
auch die Pfarrgemeinde nicht erlauben. Der Gnädinger steigt in seinen Morgenmantel und huscht leise aus dem Haus.
* * *
Ob denn keiner gemerkt habe, fährt der Fiechter fort, dass im Pfarrhaus nichts mehr sei wie früher, dubiose Gestalten gehen ein und aus, der Pfarrer betreibe ein halbes Hotel, und die Gäste seien alles andere als koscher, dieses Freikirchenpack, das der Gnädinger beherberge, von denen lasse er sich vermutlich dick bezahlen dafür, dass ein paar alte Sektenanhänger bei ihm logieren, während gleichzeitig die Pfarrgemeinde die Miete fürs Pfarrhaus bezahle, das sei ja wohl ein Skandal, und dann habe man auch gehört, dass sich der Pfarrer ein minderjähriges Meitli im Haus halte wie eine Gespielin, er, der Fiechter, habe wenig Fantasie, aber er wolle gar nicht wissen, was der Gnädinger in einsamen Stunden mit dem Kind alles anstelle, und dann, und das sei der Gipfel vom Eisberg, sei da noch die Sache mit der Frau aus der Stadt, die sich der Pfarrer offenbar bestelle wie ein anderer den Stromer oder den Dachdecker, er selbst, der Fiechter, habe heute gesehen, wie der Gnädinger mit der Frau aus dem Wald heraufgekommen sei, eng umschlungen, er, der Pfarrer, wer so tief gesunken sei, der paktiere auch mit dem Bösen, für ihn sei es keine Frage, dass alles, was dieser Tage und Wochen und Monate in Rättigen passiere, seinen Ursprung im Pfarrhaus habe, und wenn einer noch einen Beweis mehr brauche dafür, dann solle er sich doch einmal Gedanken darüber machen, warum zum Henker der Pfarrer einfach zuschaue und nichts dagegen unternehme, dass in der Gemeinde seit Monaten keine anständige Beerdigung mehr gefeiert worden sei.
Die Rättiger hören dem Fiechter aufmerksam zu, so kennen sie ihn gar nicht, den Mann, der sonst die toten Katzen von der Strasse kratzt, er hat feurige Augen und eine entschlossene Stimme, und was er sagt, das hört sich so klar und richtig an, der Pfarrer Gnädinger macht seine Arbeit recht, aber wenn sie es sich genau überlegen, die Rättiger, dann sind sie schon immer der Meinung gewesen, dass er ein bisschen ein seltsamer Geselle ist, er hat nie richtig zum Dorf gehört, meistens verschanzt er sich im
Pfarrhaus oder geht ganz allein spazieren, Gott weiss, was er da treibt, im Pfarrhaus und auf den Spaziergängen, und wie der Fiechter da so aufzählt, was alles gegen den Gnädinger spricht, fragen sich die Rättiger nach und nach, warum sie denn nicht früher gemerkt haben, dass mit ihrem Pfarrer etwas nicht stimmt, und vermutlich hat der Fiechter recht, sobald sie einen anderen Pfarrer im Dorf haben, hat alles wieder seine Ordnung hier.
* * *
Der Pfarrer Gnädinger geht auf die Kirchentür zu, er hätte schwören können, dass er eine Stimme gehört hat, aber es kann ihn kaum mehr verwundern, dass er jetzt schon Stimmen hört, wo gar niemand ist, er muss einfach wieder einmal richtig schlafen und wieder mehr an den Bach hinunter gehen, dorthin, wo es grün ist und wo es so gemütlich rauscht. Aber zuerst muss er hier in der Kirche für Ordnung sorgen, der Gnädinger, er öffnet die Tür und steht mitten drin in der ausserordentlichen
Bürgerversammlung vom Gemeinderat Bättig, der dort vorne am Sprechpültli steht und den Fiechter fixiert, der laut zu den Rättigern redet und jetzt plötzlich zur Tür starrt und den Gnädinger sieht und wild mit den Armen fuchtelt.
* * *
Mehrere Männer aus den hinteren Reihen packen den Gnädinger und schleifen ihn nach vorne zum Altar, wo ihnen der Bättig mit offenen Mund zuschaut, die Bürgerversammlung ist ihm ein bisschen aus den Händen geraten, er würde gerne noch einmal auf diese Sache mit dem Gemeindepräsidium zu sprechen kommen, aber der Bättig merkt, dass der Zeitpunkt nicht günstig ist, denn die Rättiger drücken den Pfarrer Gnädinger neben dem Sprechpültli auf den Altar und halten ihn fest, die anderen, die bis jetzt in ihren Bänken sitzen geblieben sind, scharen sich um den Altar, alle rufen irgend etwas durcheinander, sie starren den Gnädinger an, der nicht weiss, was mit ihm geschieht.
* * *
Der Mann setzt sein Franzosenchäppli auf und nimmt die Ledertasche unter den Arm. Leise öffnet er die Tür, er will die Siechenden im oberen Stock nicht wecken, und geht ins Freie und spaziert an der hell erleuchteten Kirche vorbei durchs Dorf. Ruhig ists, weder im Adler noch im Ochsen scheint eine Menschenseele zu sitzen. Der Mann wandert gemütlich auf der verlassenen Hauptstrasse bis zur Abzweigung Richtung Meierli-Wald, von dort aus geht’s weiter auf einen kleinen Kiesweg.
* * *
Der Gnädinger will um sich schlagen, aber es sind zu viele Hände, es müssen dutzende sein, und noch mehr Gesichter, sie umringen den Altar, auf dem er liegt, ein paar Gesichter kennt er, andere hat er noch nie gesehen, das sind keine Kirchgänger, aber sie schauen den Gnädinger so hasserfüllt an, als hätte er sie an jedem Tag ihres Lebens gequält, dabei hat er sie nie zuvor gesehen, der Pfarrer. Jetzt fängt einer der Männer an, auf den Gnädinger einzuschlagen, er schlägt mit der blossen Faust, ein anderer machts ihm nach, noch einer und noch einer, der Gnädinger windet sich unter den Schlägen,
und plötzlich sieht er, wie sich einer an den anderen vorbei drängt, bis er ganz nah am Altar steht, direkt vor dem Gnädinger, der da liegt und sich krümmt, und aus dem Augenwinkel sieht er, dass der andere ein schweres, grosses Kreuz aus Eisen schwingt, das muss er in der Sakristei von der Wand gerissen haben, er schwingt es und holt aus, er will den Gnädinger mit dem Kreuz traktieren, aber da ruft einer von denen, die bis jetzt nur zugeschaut haben, er solle aufhören, das könne er nicht machen, mit dem Kreuz könne man ja einen Menschen erschlagen, aber der mit dem Kreuz lacht dem anderen nur ins Gesicht und ruft zurück, ah ja, das sei ihm neu, dass man hier in Rättigen irgend jemanden erschlagen könne, soviel er wisse, könne man in diesem Kaff einen vielleicht halb tot oder fast tot schlagen, aber sterben werde der Pfarrer ja ganz bestimmt nicht, soviel wisse man mit Sicherheit.
Das ist das Signal für die Rättiger. Überall in der Kirche reissen und schränzen sie Kreuze und Madonnenfiguren und Apostelbilder ab und drängen sich zum Altar vor und schlagen auf den Gnädinger ein.
* * *
Vom Kiesweg geht es ein kleines Stücklein durch den Wald bis zum Bach. Der Mann kniet nieder und schöpft ein bisschen Wasser und trinkt. Fein, denkt er, und schön rauschen tut es auch, wenn man still ist. Er steht wieder auf und spaziert langsam in den Bach hinein, das Wasser reicht ihm bis zum Knöchel, weiter nicht, es ist nur ein Rinnsal.
Was ist die Ewigkeit, denkt der Mann. Ich habe eigentlich ewig bleiben wollen. Aber vielleicht wird die Ewigkeit langweilig mit der Zeit. Und die schönsten Versprechen sind die, die man brechen kann. Und man soll gehen, wenn es am schönsten. Immer dann, wenn es am schönsten ist.
Jetzt watet er weiter durch das kleine Bächlein und das Port auf der anderen Seite hinauf, über die Dorfgrenze, hinaus aus Rättigen. Vor ihm liegt eine Wiese.
* * *
Der Gnädinger wünscht sich nichts so sehr wie den Tod, aber er weiss, dass der nicht kommen wird, keiner stirbt in Rättigen, die Wege des Herrn sind unergründlich, aber er wird den Verdacht nicht los, dass es diesmal gar nicht die Wege des Herrn gewesen sind, und wie er sich zum zweiten Mal an diesem Tag bei einem unheiligen Gedanken ertappt, stirbt der Pfarrer Gnädinger.
Als erster merkt es der mit dem Kreuz aus Eisen, als er gerade wieder ausholt und zuschlagen will und wartet, bis der Gnädinger die Augen aufmacht und ihn ansieht, aber dem Gnädinger seine Augen sind zu, und der Mann mit dem Kreuz brüllt wütend auf und reisst dem Gnädinger die Augendeckel nach oben und alles, was ihn anschaut, sind zwei gebrochene Pupillen. Ufhöre, flüstert der mit dem Kreuz denen zu, die immer noch schlagen und prügeln, ufhöre.
Der Gnädinger liegt blutüberströmt auf dem Altar, um ihn herum die Rättiger mit blutverschmierten Kreuzen und Heiligenfiguren und Messbechern, sie atmen schwer, keuchen, begreifen gar nichts mehr. Der Bättig, der die ganze Zeit am Sprechpültli stehen geblieben ist, räuspert sich ein bisschen ins Mikrofon, aber keiner hört ihm noch zu, alle lassen ihre Kreuze und Messbecher und Statuen fallen und gehen langsam zum Ausgang. Als der letzte aus der Tür ist, packt der Bättig seine Notizen und geht auch zur Kirche hinaus.
Der Mann steht mitten auf der Wiese. Er öffnet die Ledertasche, holt eine Karte heraus, faltet sie auseinander. Langsam streicht er mit dem Finger über die Karte, zeichnet die Grenzen und Flüsse und Berge nach. Unten rechts ist ein kleiner Kompass abgebildet.
Vier Himmelsrichtungen. Himmel? Der Mann lächelt. Er schliesst die Augen und zieht mit dem Zeigefinger den Kreis des Kompass nach, immer schneller, bis er schliesslich anhält und die Augen öffnet und auf die Karte schaut.
Er macht sich auf den Weg.
ENDE
Stefan Millius, 2002 - 2007