Kurzgeschichte
Blumenstrasse 11
Kategorie Kurzgeschichte
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
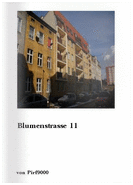
Blumenstrasse 11
Blumenstrasse 11
Es war an einem schwülwarmen Freitag kurz vor Ladenschluss, als Roloph Meiers, Medizinstudent im sechsten Semester, mit der Rolltreppe hinunter zur Lebensmittelabteilung eines grossen Kaufhauses im Stadtzentrum fuhr. Er wollte noch schnell einige Sachen für das Wochenende einkaufen. Mit dem quitschenden Einkaufswagen im Visier durchstreifte er die vollgestopften Verkaufsregale, immer darauf bedacht, nur Artikel in den Wagen zu legen, die er sich auf einem Zettel, den er in erbärmlichem Zustand aus der Tasche nestelte, notiert hatte. Als auch noch die mit Plastikringen aneinandergeketteten Bierdosen, die die darunterliegenden Früchte zu erdrücken drohten, im randvollen Wagen gestapelt waren, steuerte er den ungeduldig wartenden Menschenschlangen an den Kassen zu. Die Dinge auf das laufende Band stapelnd, schaute er der jungen attraktiven Kassiererin zu, wie sie mit atemberaubender, routinierter Fingerfertigkeit auf die Zahlentasten hämmerte. An ihrem Gesichtsausdruck, ihrem kunstvoll angesetzten Lidstrich und den manikürten, feuerrot lackierten Fingernägeln war abzulesen, dass dieser Job sicher nicht das in ihrem Leben war, was sie sich erträumt hatte. Eilig packte Roloph seine Sachen in mehrere Tüten und fuhr wieder hinauf zum Ausgang. Im letzten Moment erwischte er noch den Bus mit der Nummer dreizehn, der hinaus zu den tristen grauen Wohnsilos etwas ausserhalb der Stadt fuhr.
Von der Bushaltestelle waren es nur noch wenige Schritte zu dem Mehrfamilienhaus, in dem er eine Mansarde bewohnte. Er lebte bereits seit zwei Jahren hier, der Weg zur Uni war eben bestechend günstig. Als er den Briefkasten beim Hauseingang öffnete und eine Flut von bunten Werbeprospekten herausquoll, kam gerade Frau Solbach aus der Türe, eine alte, freundliche Dame, die eine grosse Wohnung im ersten Stock bewohnte. Als ihr Mann noch lebte, sah man die beiden häufiger. Sie waren sehr gesprächig und hilfsbereit. Jetzt lebte sie viel zurückgezogener, ging nur noch zum Einkaufen und für ihren täglichen Kirchgang aus dem Haus.
Das Haus an der Blumenstrasse war mindestens sechzig Jahre alt. In den achtziger Jahren wurde es einmal renoviert, das Mauerwerk isoliert, die Fassade gestrichen, und die angerosteten Balkone bekamen ein neues Make-up. Im Innern wurde nur das Notwendigste gemacht. Die sanitären Installationen hätten dringend einer Sanierung bedurft, mussten aber noch einige Jahre durchhalten. Rund um das fünfstöckige Haus wuchs ein gelblich durstiger Rasen, ein paar Quadratmeter nur, spärlich und von blühendem Löwenzahn überwuchert. Sein Zustand spottete im Übrigen jeder Beschreibung. Die dafür zuständige Hausmeisterfamilie nahm ihre Pflichten eben nicht so tierisch ernst, dafür aber ihre Rechte um so mehr.
Roloph war sichtlich froh, dass er an diesem Abend keinem der Familienmitglieder des Hausmeisters begegnete. Erst letzte Woche hatte er wieder einmal eine dieser ärgerlichen Auseinandersetzungen mit Herrn Markovitz, dem Hausmeister in der offenen blauen Schürze, die er sicherlich auch nachts trug. Es ging einmal mehr um Rolophs Fahrrad, das angeblich den ganzen Kellergang versperrte. Noch schlimmer war Makovitz’ Frau. Roloph verglich sie gerne mit einer Concièrge, einem alten, neugierigen Fischweib, das breitbeinig unten in ihrer Loge sass, eine Kippe im Mundwinkel und den ganzen lieben langen Tag nichts anderes zu tun hatte, als sich keifend und besserwisserisch um die Angelegenheiten anderer Leute zu kümmern. Er hatte da seine Erfahrungen, als er damals ein Studienjahr in Paris verbrachte, um seine Sprachkenntnisse zu vertiefen.
Schnell stieg er die frisch gebohnerte, bei jedem Auftreten laut knarrende Holztreppe hoch, immer zwei oder drei Tritte auf einmal überspringend und war sichtlich erleichtert, als er vor seiner Türe stand. Der Lift war wieder einmal ausser Betrieb, aber damit zu fahren war sowieso mit unvorhersehbaren Risiken verbunden. Einmal steckte er mehrere Stunden in diesem engen, nach Schweiss und Urin stinkenden Gehäuse, schrie, läutete und klopfte, bekam schiere Atemnot und war kreidebleich, als ihn der Hausmeister endlich da herausholte. Dieser konnte sich aber seine vorwurfsvollen Äusserungen über eine angeblich bewusste Fehlbedienung nicht verkneifen.
In der obersten Etage gab es nur drei Mansardenwohnungen, ein Badezimmer und eine gemeinsame Küche. Am Ende des Gangs war ein ovales Fenster eingelassen, ähnlich einer Schiesscharte und durch das man im Sommer gerade mal das Haupt durchstecken konnte. In einer solch akrobatischen Stellung war es aber unmöglich, den Kopf in eine andere Richtung zu drehen, um ihn auch sicher und unversehrt wieder zurückziehen zu können. Er hatte es letztes Jahr einmal ausprobiert und hatte danach prompt für mehrere Tage hartnäckige Nackenschmerzen. Zumindest gab es eine einfache Toilette im Zimmer. Roloph machte dies nichts aus, denn am Vormittag hatte er einen Aushilfsjob in der städtischen Leihbücherei, und nachmittags - manchmal auch abends - war er an der Uni. Wegen der Miete konnte man sich im Grunde nicht beklagen. Er schätzte sie für die Verhältnisse als angemessen ein. Neben Rolophs Zimmer lebte ein Nachtportier, der tagsüber zu schlafen versuchte und abends zur Arbeit in ein im Zentrum liegendes Hotel fuhr. Auf der anderen Seite des Ganges gab es noch eine Mansarde, die seit etwa vier Monaten leer stand, da sich um die Weihnachtszeit ein bedauernswerter Einzelgänger, des Lebens überdrüssig und von dem man nie etwas gehört hatte, darin aufgehängt hatte. Der Hausmeister war wegen des bestialischen Gestankes und nach Intervention verschiedener Mitbewohner erst nach drei Wochen darauf aufmerksam geworden.
Er stellte seine Tüten auf den Boden, kramte den Schlüssel aus der ausgebeulten Hosentasche und steckte ihn in das Schloss. Manchmal brauchte er beide Hände, um den Riesenschlüssel im Schloss drehen zu können. Vermutlich hatte sich die Türe durch die extremen Temperaturunterschiede im Laufe der Jahre etwas verzogen, im Winter war es auf dem Gang bitterkalt, und im Sommer drückte die Schwüle durch das flache Dach auf den niedrigen Flur. Es waren noch alte, voyeuristische Schlösser, die man mit grossen Bartschlüsseln öffnete, nicht die modernen kleinen und sicheren Zylinderschlösser. Er drückte die Türklinke hinunter und musste mit dem Fuss immer noch etwas nachhelfen, damit sie sich öffnen liess. Mit den Tüten betrat er sein Zimmer. Eine Miefschwade von erkaltetem Zigarettenrauch schlug ihm ins Gesicht. Mitten im Zimmer stand ein runder Holztisch, von zwei Stühlen eingeklemmt. Er war zugleich Arbeits- wie auch Esstisch. Einen winzigen Kühlschrank konnte er sich im letzten Jahr durch einen Kommilitonen günstig beschaffen. Es gab nur zwei Fächer und keine Tiefkühlvorrichtung, aber für Rolophs tägliche Bedürfnisse reichte das Gerät vollkommen. Nachdem er seine Einkäufe verstaut hatte, streifte er seine schweissdurchtränkten Schuhe ab, ohne sie zu öffnen und warf sich auf das ungemachte Bett, das in der Ecke neben dem Fenster stand, um sich etwas auszuruhen. Sein Ordnungssinn war nicht besonders ausgeprägt, hatte etwas Chaotisches. Neben dem Bett auf dem Boden lagen die verschiedensten Bücher und Notizen herum. Auf dem überladenen Regal über dem Kopfteil des Bettes standen Enzyklopädien, Anatomie- und andere Lehrbücher, die das dünne Brett, auf dem sie standen, bedenklich durchhängen liessen. Roloph drehte sich auf die Seite, drückte auf die Abspieltaste seines Kassettenrecorders und gab sich einem dumpfen Schweigen hin. Aus den Lautsprechern, die er über der Türe angebracht hatte, ergoss sich eine Welle von heulenden, herzzerreissenden Tönen einer sogenannten Newcomerband, die wahrscheinlich genauso schnell wieder im Untergrund verschwinden wird, wie sie in die Charts kam. Die Boxen hatten sichtlich akustische Probleme, die Bässe, die sich wie enorme Dampfhämmer in einer Stahlhütte anhörten, wiederzugeben. Die Membranen zuckten im Rhythmus des Taktes, ähnlich wie das Herz eines Sprinters nach hundert Metern in Neunkommazwei Sekunden.
Vom Boden her hörte man Klopfgeräusche, die gar nicht so recht zum Sound passen wollten. Vermutlich war den Nachbarn im unteren Stock das Ganze doch etwas zu laut, dachte Roloph. Als das Hämmern von unten bedrohlich zu werden schien, drehte er die Lautstärke doch etwas zurück. Unter ihm wohnte ein junges Ehepaar mit einem zwei Monate alten Säugling, das wahrscheinlich einen anderen Musikgeschmack hatte, wenn man hier überhaupt von Geschmack reden konnte.
Evelin Seiters und ihr Mann Martin sassen gerade beim Abendessen, als sie das dumpfe, an- und abschwellende Grollen von oben vernahmen. Also beim Essen war das nun wirklich eine Zumutung, sonst war man ja etwas toleranter. Ausserdem hatten sie es mit viel Mühe geschafft, das Baby zum Schlafen zu bringen. Es gab aufgewärmten Eintopf vom Mittag, eine Mischung zwischen Bohnengemüse und Gulasch. Beim näheren Hinsehen hätte es auch eine Suppe sein können. Evelin, eine dunkelblonde, zierliche Frau von dreiundzwanzig Jahren, schien als junge Mutter doch etwas überfordert mit der neuen Situation, selbständig einen Haushalt zu führen, ein Baby zu versorgen, halbtags Heimarbeit zu machen und dann auch noch dreimal am Tag zu kochen. Seit das Kind da war, sah man ihr die Unlust und die Anstrengungen ins Gesicht geschrieben. Sie schien unausgeschlafen und gab sich verschlossener, nicht mehr so fröhlich wie früher. Also nahm Martin einen Besen, drehte ihn um und klopfte mit dem Stiel an die Decke. Da immer auch die Emotionen etwas mitspielen, sah man deutlich, dass er das schon öfters praktiziert hatte. Die tiefen Abdrücke an der Gipsdecke waren deutliche Spuren der Misshandlung. Schliesslich konnte man nicht ständig nach oben springen, um dem Ruhestörer begreiflich zu machen, dass es entweder schon nach zehn Uhr abends oder Mittagszeit war. Beim Unterschreiben des Mietvertrages hatten doch alle die Hausordnung durchgelesen.
Es war manchmal schon eine Zumutung mit den verschiedenen Aktivitäten in diesem Haus. War da doch der fünfzehnjährige, pickelgesichtige und einzige Sohn des Hausmeisters, dem es anscheinend grossen Spass machte, mit seiner Clique auf dem Dachboden die freie Zeit zu verbringen. Damit wollte der schmächtige Junge natürlich auch sein Privileg, das er als Hausmeistersohn genoss, voll auskosten. Die Halbwüchsigen hatten sich hier oben ein richtiges Freizeitparadies geschaffen, selbstverständlich mit der Einwilligung des Vaters. Denn wo sonst sollten die gelangweilten, schulmüden Jugendlichen schon ihre Energien und Frustrationen loswerden. Heute war wieder einmal das Skateboard an der Reihe. Man stelle sich die Situation vor, wenn ein schreiender, von Leichtsinn getriebener Jungendlicher im Stimmbruch, mit seinem stahlgeräderten Brett über den betonierten Dachboden donnert, meinte man noch im Keller, dass ein Airbus beim Landeanflug das Dach gestreift haben musste. Das war dann auch dem Hausmeister zuviel, und er jagte die unverschämt lachende Bande mit Tiraden von autoritären Bemerkungen und Belehrungen nach draussen.
Frau Markovitz machte wie jeden Abend ihren obligaten Kontrollgang durch das Haus, angefangen im Keller. Die Kellerabteile der einzelnen Mieter waren in einem abgeschlossenen Raum untergebracht, getrennt durch Holzgitterwände, der Boden ein feuchter modernder Naturboden aus Kies. Neugierig wie sie war, musste sie natürlich jedes einzelne Abteil observieren. Bewaffnet mit einer Taschenlampe, die die Leuchtkraft eines Scheinwerfers hatte, ging sie von Tür zu Tür, den Lichtstrahl in das Abteil gerichtet, um möglichst jede Ecke ausspähen zu können. Es bereitete ihr offensichtlich unsagbares Vergnügen zu sehen, was die anderen Leute so alles im Keller verstaut hatten. Zu ihrem grossen Bedauern konnte sie die einzelnen Abteile nicht betreten, da jeder Bewohner ein individuelles Schloss angebracht hatte. Die einen hatten hier in einem wilden Durcheinander ihren im Laufe der Jahre angesammelten Gerümpel gestapelt, den man sicherlich nicht mehr brauchte, aber eigentlich doch zu schade war, um weggeworfen zu werden. Die anderen hatten sich selbstgezimmerte Gestelle eingebaut und mit einer akribischen Hingebung alles übersichtlich gestapelt oder eingeräumt. Und was so manche Leute an Weinen im Keller horteten, quittierte Frau Markovitz nur mit einem neidischen Kopfschütteln.
Als sie zum letzten Kellerabteil kam, spürte sie um die Fussknöchel einen leichten, kalten Windhauch. Hatte doch wieder einer im Haus das Fenster offengelassen, dachte die Hausmeisterin empört. Mit der Lampe versuchte sie das Fenster zu orten, das tatsächlich sperrangelweit offenstand. Das Abteil, vor dem sie stand, hatte kein Schloss, war leicht geöffnet. Die Gelegenheit, ja fast eine Einladung, die Dinge einmal genauer zu betrachten, überkam es Frau Markovitz freudig. Geräuschlos öffnete sie die Holzgittertüre, schlüpfte auf Zehenspitzen hinein, die Türe wieder leise hinter sich zuziehend. Mit der Lampe überprüfte sie die Lage. An der rechten Mauer stand ein grosser Mottenschrank. Sie tastete sich weiter vor, der Lichtkegel erfasste die kleine Nische neben dem Schrank und erleuchtete ein dunkles tiefliegendes Augenpaar. In der Ecke erhob sich eine grosse, schwarz bekleidete Gestalt, in der Hand etwas Glattes, dessen polierte Oberfläche den Lichtstrahl der Lampe reflektierte. Frau Markovitz, starr vor Entsetzen, unfähig sich zu bewegen, stand wie angewurzelt vor dem Schrank. Die Lampe glitt ihr aus den zitternden Händen, klatschte zu Boden. Glas splitterte - ein Schrei - Dunkelheit.