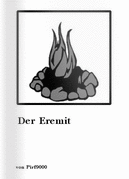Der Eremit
Dicke, zähe Nebelschwaden quollen über die spitzen steinigen Hügel. Seine undurchsichtigen Fangarme ergossen sich wie Lava in das eingekesselte Tal. In einem steilen, sattgrün begrasten Abhang trotzte ein altes, mit bunten Blumenkisten geschmücktes Bauernhaus den Naturgewalten, verbissen und dennoch respektvoll. Aus dem russgeschwärzten, brüchigen Schamott des Kamins kroch eine dünne, graue Rauchfahne, die, von der feuchtkalten Umgebung der Wärme beraubt, gnadenlos nach unten gedrückt wurde.
Seit über dreissig Jahren lebte der Bergbauer Konrad Menzi in diesem Tal: mit sich, der Natur, seinem treuherzig dreinblickenden schwarzen Mischlingsrüden, einigen dieser prähistorisch anmutenden langzottigen schottischen Hochlandrinder mit den an Bisons erinnernden spitzen Hörnern, den fünf eigensinnigen schneeweissbärtigen Ziegen, aus deren Milch er schmackhafte würzige kleine Käselaiber herstellte, die er gelegentlich auf dem Wochenmarkt verkaufte. Unten im Dorf nannten sie ihn nur den Eremiten. Er wurde von den Dörflern mit herablassender Verachtung und von deren Kindern mit schelmischen Hänseleien bestraft, da er den Kontakt zu den Eingeborenen mied, wo immer er nur konnte. Nur einmal im Monat sah man ihn mit Rucksack und Pfeife im Mund, den Hund wohlerzogen an der Flanke, mit den alten ausgelatschten Militärschuhen an den Füssen, deren in die Sohle eingeschlagenen Nägel wie riesige, amalgamgefüllte Backenzähne Halt auf dem steinigen Weg fanden, hinunter ins Tal steigen. Dann kaufte er sich im Dorfladen neue Vorräte für die kommenden Wochen, packte seinen ausgebeulten Rucksack voll und verschwand sogleich wieder. Manchmal ertappte er sich dabei, wie er, immer schneller schreitend, mit verstohlenem misstrauischem Blick zurücksah, als hätte er den Teufel im Nacken sitzen, um sich zu vergewissern, dass ihm auch niemand folgte, zu nahe kam oder gar einen Versuch unternahm, um mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Menzi stand breitbeinig unter dem rissigen Dachvorsprung, die qualmende Pfeife verhüllte für einen Augenblick sein Gesicht. Er blickte mehr aus Gewohnheit, die eine Hand wie ein Sonnendach an die Stirn gelegt - obwohl man weit und breit auch nicht den leisesten Ansatz eines durch den Nebel dringenden Sonnenstrahls entdecken konnte -, hinab zu seinen Tieren. Vier Ziegen standen um einen riesigen, zerklüfteten Felsbrocken, aus dessen Ritzen allerlei Buschwerk spriesste und der seit Urzeiten einsam mitten auf dem Gras lag. Wo aber war die fünfte? Menzi nahm die Pfeife aus dem Mund, legte den Kopf in den Nacken, blies den Rauch gegen den Himmel und liess seinen Blick erneut über die Wiese streifen, um abermals zu zählen. Tatsächlich, eine Ziege fehlte, er konnte sie nicht sehen. Schnell machte er sich auf, nach der Ziege zu suchen. Vielleicht war sie in das nahe gelegene Wäldchen gelaufen, das von einem quellwasserführenden eiskalten Bergbach durchflossen wurde. Mit grossen, weiten Schritten glitt er den ungemähten Hang hinab. Unter den ersten Bäumen stehend, sah er sie. Die Ziege stand am sprudelnden Bach und blökte Menzi mit hochgezogenen Lippen zähnefletschend entgegen, den Kopf frech in die Höhe gereckt, die abstehenden Ohrtrichter leicht schüttelnd. Nur - wie das neugierige Vieh den Bach überqueren konnte, schien ihm rätselhaft. Mit der linken Hand hielt er sich an einer jungen Tanne fest, um die restlichen, sehr steilen Meter über moosbewachsene Felsbrocken besser hinuntersteigen zu können.
Im gleichen Augenblick gab die Tanne nach, und Menzis ausgestreckte Hand mit den zu Krallen geformten Fingern griff ins Leere. Die Szene lief ab wie in Zeitlupe. Mit den Füssen voran rutschte er über einen Felsvorsprung, stürzte, vielleicht zwei, drei Meter in die Tiefe; dabei fiel er derart unglücklich, dass sich sein rechtes Bein beim Aufprall zwischen zwei Felsvorsprüngen verkeilte. Mit einem höllischen Aufschrei, zusammengekniffenen Augen und rasenden Schmerzen im Bein versuchte Menzi sich zu befreien - erfolglos. Mit klammen Fingern tastete er das Bein ab und spürte, wie ein stummer steter Blutstrom aus der klaffenden Wunde des heraustretenden Schienbeins troff. Bei der kleinsten Bewegung peinigte ihn der Schmerz mit tausend Messern, eisige Schauer jagten ihm über den Rücken, und kalter Schweiss stand ihm auf der Stirn. Menzi geriet in Panik und war einer Ohnmacht nahe. Mit letzter Kraft pfiff er durch die zittrigen, fast gefühllos gewordenen Finger und hoffte, dass sein Hund in der Nähe war. Nach nur wenigen Augenblicken jagte der Hund heran, rannte um Menzi herum wie ein Verrückter und überkugelte sich fast. Dabei leckte er Menzi das Gesicht, als wolle er ihm sein Mitgefühl ausdrücken. Wild gestikulierend bemühte sich dieser, dem Tier klarzumachen, dass es ins Dorf rennen solle, um Hilfe zu holen. Endlich schien der Hund begriffen zu haben, dass Menzi sich ohne die fremde Hilfe nicht mehr befreien konnte, und fegte los, aus dem Wäldchen hinaus, den Hang hinab, in Richtung Dorf.
Wie jeden Morgen war der Wildhüter im Wald unterwegs, lauernd, die Schrotflinte im Anschlag, den gekrümmten Finger am Abzug. Er hatte es auf ein wilderndes, Kleinwild reissendes Tier abgesehen, das ihn seit einiger Zeit in Trab hielt. Als er sah, wie plötzlich ein schwarzer Hund wenige Meter neben ihm vorbeiraste, hob er die Flinte, legte an und schoss. Der Knall, das donnernde Echo des Schusses zerrissen die Idylle des Waldes. Mitten im Sprung überschlug sich der Hund mehrmals, blieb mit heraushängender Zunge hechelnd liegen, röchelnd. Der Wildhüter trat näher, Erleichterung zeichnete sein Gesicht; hab ich dich endlich erwischt.