Kurzgeschichte
Geruch des Meeres
Kategorie Kurzgeschichte
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
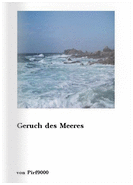
Geruch des Meeres
Geruch des Meeres
Die Schalterbeamtin wendet das dünne Couvert, kontrolliert auf der Rückseite das Vorhandensein des Absenders und beschreibt mit unleserlicher, fliessender Handschrift den Quittungsblock. Routiniert reisst sie aus einem schwarzen Buch die entsprechenden Briefmarken, fährt mit der gummierten Seite über ein armseliges, ausgebleichtes Schwämmchen und klebt die Frankatur auf das Couvert. Mit Wucht knallt der Stempel auf den Brief, der im selben Augenblick in einem bereits überfüllten Plastikkorb verschwindet.
Morgen werden sie ihn erhalten, sinniert Gebi Landolt schadenfroh, faltet sorgsam die Quittung und verlässt erleichtert, ja beinahe erheitert das Postamt. Es ist kurz vor sechs. Draussen wartet seine Frau, ungeduldig hin- und hergehend. In kurzen Intervallen hebt sie ihren Arm, blickt nervös auf die Uhr, dann wieder hinüber zur gläsernen Drehtüre. Ab und zu sieht sie einem kleinen Mädchen zu, das mit langsamen Bewegungen auf einem Bein über kreidegezeichnete Kästchen hüpft, deren verwaschene Linien kaum mehr zu erkennen sind. Gebi Landolt fasst seine Frau sanft unter und streicht ihr beruhigend über die kalte Hand. Dann gehen sie mit flotten Schritten hinunter zum See, wo in der Klubschule die letzte Stunde des Englisch-Intensivkurses stattfindet, den sie immer mit Begeisterung besucht haben. Ausgerechnet heute erscheinen sie als Letzte, platzen mitten in eine angeregte Konversation, huschen leise auf ihre Plätze. Gebi murmelt etwas Entschuldigendes, in Englisch versteht sich, das die strengen Augen der anderen Kursteilnehmer glättet und besänftigt. Einige können sich seiner rollenden Aussprache wegen gar ein ausladendes Schmunzeln nicht verkneifen. Nach dem Verteilen der Diplome wird man wohl oder übel eine Runde aufwerfen müssen, denkt Gebi und fährt mit der Hand zur Gesässtasche, wo das Portemonnaie sitzt.
Den Entschluss, in ihr Cottage an der Südwestküste Irlands zu übersiedeln, haben sie spontan, durch Verkettung verschiedener Umstände gefasst. Das behutsame und dennoch kontinuierliche Drängen und Bohren seiner Frau hatten Gebi zugesetzt, und ihn nachdenklich werden lassen. Vorsichtig und berechnend hatte er abgewägt. Seine Überzeugung war von Tag zu Tag gewachsen. Er wusste, dass in Irland Armut oder Reichtum belanglos sind, der Tagesablauf weitgehend durch die Natur bestimmt wird, Zeit relativ ist und die Bügelfalten ihre schneidende Schärfe verlieren.
Gespart hat man genug, allerdings werden die Rücklagen immer kleiner, da Miete, Versicherungen und Lebenskosten immer unverschämter zu Buche schlagen. Als letzte Woche die Steuerveranlagung ins Haus flatterte, in der die unverbesserlichen Bürokraten wieder an seinen mit Belegen fundierten Abzügen herummanipuliert hatten - natürlich zu seinen Ungunsten -, da war gerade dies der eigentliche Auslöser, das springende Fünkchen gewesen.
Am nächsten Morgen sitzt Gebi Landolt wie gewohnt Zahlenreihen kontrollierend über einem dicken Stoss vollbedrucktem Endlospapier und hat sichtlich Mühe, sich zu konzentrieren. Jeden Moment muss es soweit sein, und er würde zum Chef gerufen. Der Gedanke ist noch im Raum, gegenwärtig, als ihn das Telefon aufschrecken lässt. Die Krawatte zurechtrückend, fährt er mit dem Lift hinauf in den siebten Stock, setzt sich auf den angebotenen Stuhl und wartet, bis sich sein überrascht scheinendes Gegenüber hinter den geschickt gestapelten Aktenbergen hervorwindet. Der Personalchef, ein biederer Endvierziger mit schütterem Haar und tadellosem Anzug, kann es kaum fassen, dass er, Gebi Landolt, wenige Jahre vor seiner Pensionierung den Mut aufbringe und mir nichts dir nichts einfach die Stelle kündige. Man sei auch immer sehr zufrieden gewesen mit ihm. Nie habe es Anlass zu irgendwelchen Klagen gegeben. Seine Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit seien geradezu beispielhaft. Ob er es sich auch gut überlegt habe? Die Kürzung der Pensionsgelder und all das? Gibt es Probleme mit seinen Kollegen? Man hätte eben schon früher reden sollen.
Reden, immer nur Reden, denkt Landolt, worüber denn? Über die seit Jahren fällige Beförderung? Es ist für Landolt nicht leicht, den beredten, händeringenden Personalchef zu überzeugen, dass es ihm einfach reiche, er genug habe und sein Leben in noch etwas andere Bahnen lenken wolle. Ausserdem sei es seine persönliche Entscheidung, von der er sich nicht abbringen lasse. Landolts Gegenüber schüttelt unablässig den Kopf, ungläubig und achselzuckend, nicht zuletzt auch darum, weil die Weltanschauung des einen nicht mit der des andern konkurrieren kann.
Als Gebi Landolt nach einer halben Stunde wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, ist er doch sichtlich erleichtert und nimmt sich für den Rest des Tages frei, da es ihm im Moment unmöglich ist, sich weiter auf seine Arbeit zu konzentrieren. Überhaupt ist sein Ferien- und Überstundensaldo in den vergangenen zwei Jahren so angewachsen, dass er bis zum Ablauf der Kündigungsfrist noch höchstens eine Woche in der Firma bleiben muss. Die Hände salopp in den Taschen, schlendert er durch eine mit künstlichem Licht durchflutete Einkaufspassage, bestaunt das mehrstöckig gewundene Kunstwerk aus marmoriertem Stein und blitzendem Chrom, an dessen gläsernen Verstrebungen Wasser leise ins drunterliegende Becken plätschert, sich sammelt und wieder durch die engen Düsen eines Springbrunnens gepumpt wird. Dazwischen bleibt er vor den mit Sicherheitsglas geschützten Auslagen der Geschäfte stehen, erschrickt über die ausgeschilderten Preise. In einer originellen Brasserie, gleich neben der stark frequentierten Rolltreppe, bestellt er ein kühles Bier, lehnt sich zufrieden zurück, beobachtet das bunte Gewirr von beladenen und durcheinanderhastenden Menschen. Babylonische Sprachfetzen dringen an sein Ohr, fremd und unverständlich. Mit einem Gefühl der Leichtigkeit geht er zu seiner Bank in der Nähe des Bahnhofs. Gebi schiebt dem Kassier ein vorbereitetes Formular unter dem Panzerglas durch und geniesst den augenscheinlich verdutzen Gesichtsausdruck des Bankangestellten, als dieser sieht, dass die Landolts ihre gesamten Ersparnisse auf ein Konto bei der "Bank of Ireland" überweisen.
In den kommenden Wochen muss viel organisiert werden: Gänge zu den Ämtern, Abmeldungen, Umleitungsaufträge, Kündigungen und einige wenige feuchtfröhliche Abschiedsfeste für die engsten Freunde und Bekannten. Dann ist es endlich soweit. Die Wohnung ist geputzt, der künstliche Duft von Zitrone zieht durch die leeren, hallenden Räume, die Tapeten sind erneuert, die Küche frisch gestrichen. Der Vermieter, mit einer speckigen Mappe unter dem Arm und der zehnjährigen Mängelliste in der Hand, unterschreibt nach zähen, nervenaufreibenden Disputen das Übergabeprotokoll. Am Abend wird der alte Kombi mit den absolut notwendigsten Utensilien, Kleidern und persönlichen Erinnerungen, aber auch mit Entbehrlichem vollgestopft. Hände werden geschüttelt, Tränen fliessen.
Im Innern des Wagens haftet der Geruch von Öl, faulendem Wasser und ätzenden Abgasen, als die Landolts aus dem riesigen Rumpf der Fähre herausfahren. Den freundlichen, aber misstrauischen Zollbeamten von Rosslare werden die Papiere gezeigt. Es dauert seine Zeit, bis die Ladung kontrolliert und durchgekämmt ist. Bei strömendem Regen geht die Fahrt weiter über wellenartige, von wilden Fuchsienhecken gesäumte Landstrassen, vorbei an kleinen Seen, die ihre Farbe schnell wechseln, die sich jeder sich in ihnen spiegelnden Wolke anpassen. Man erblickt exotische, vom Wind zerzauste Palmen, die einsam und fremd in der Landschaft stehen und dem launischen Wetter trotzen.
In Midleton, wo die riesigen Kamine der traditionsbewussten Whiskeybrennerei in den bleiernen, wolkenbehangenen Himmel ragen, machen sie einen kurzen Halt. In einem winzigen, bis zur Decke vollgestopften Supermarkt an der Hauptstrasse werden die wichtigsten Lebensmittel eingekauft. Gebi sieht auf einem Regal neben dem leeren Zeitungsständer die Gläser mit selbstgemachter Konfitüre, lädt sie in seinen Korb, alle, bis zum letzten. Eine Schwäche von ihm. Die Besitzerin des Ladens staunt und sagt, dass sie im Keller noch weitere Sorten lagert, hat aber Verständnis dafür, dass die Menge auf dem Ladentisch für mindestens ein Jahr ausreicht. Im O’Doohans, einem düsteren Pub an der Ecke, wollen Gebi und seine Frau auf den neuen Lebensabschnitt anstossen, bestellen an der Bar ein frisch gezapftes Guinness, das lakritzig dunkle Bier mit der schmalen, sämigen Schaumkrone und dem bitteren Geschmack.
Als sie gegen Abend ihr abgelegenes Cottage erreichen, werden die Sicherungen eingedreht, der Kühlschrank in Betrieb genommen, der mit ausrangierten Decken isolierte Boiler im Dachstock eingeschaltet, das Auto entladen und die Vorräte in der Küche gestapelt. Gebi hantiert im angebauten Schuppen an der angerosteten Wasserpumpe, die einfach keinen Wank machen, nicht funktionieren will. Zu Hause undenkbar, meint Landolt, schlägt mit der Zange auf das verplombte Schaltgerät und lässt sich, schweissgebadet, zu einer ohrenbetäubenden Fluchtirade hinreissen. Endlich beginnt die Pumpe zu arbeiten, stockend und hustend.
Im Wohnraum ist es kalt, feucht und miefig. Gebi legt einige Torfbriketts in die verrusste Feuerstelle und wartet, bis die rote Flamme über die dunklen Klumpen leckt und graue Schwaden beissenden Rauchs durch den breiten Schlund des Kamins steigen. Er geht nach draussen, atmet die frische Luft ein, tief und mit geschlossenen Augen. Der Rhododendron neben dem Haus steht in voller Blüte, und die Oleanderbüsche wiegen im Wind. Die Sonne taucht wie ein glühender Feuerball in den Atlantik, gibt ihr Licht an den sichelförmigen Mond ab. Feiner Dunst zieht über die Wiesen, und stete Dunkelheit legt sich über das grüne Tal.
In der Nacht rütteln heftige Sturmböen an den Fenstern, fegen beängstigend über das ächzende Dach und bringen das morsche Gebälk zum Erzittern. Die Landolts schrecken auf, Steine und Dachziegel poltern in ihre Träume hinein. Gebi setzt sich auf, starrt in die Dunkelheit, ohne recht zu begreifen, was los ist. Mit dem Schlaf ist es vorbei. Die Regentropfen prasseln wie Kieselsteine gegen die Fenster. Dann wird es hell, die schwarzen Wolken verziehen sich, lösen sich auf. Der Wind flaut ab, und die Sonne spiegelt sich in den Tautropfen an den hängenden Gräsern. Nach einem ausgiebigen Frühstück wird die Gegend erkundet, zu Fuss. Sie begegnen dem Bauern Michael O’Neill, ihrem einzigen Nachbarn in der Gegend, der mit seinem gutmütigen Wallach das karge Stück Land zu zähmen versucht und der noch das kehlige Gälisch spricht. Er ist wie alle Iren freundlich, aber distanziert. Gebi wird es mit einem Schlag bewusst, dass man hier immer ein Fremder bleiben wird, wenn man nicht mit alten Gewohnheiten bricht und sich bedingungslos den geltenden Konventionen unterwirft.
In dem grossen Topf auf der Kochplatte gart ein Stew, das erfahrungsgemäss Stunden braucht, bis es die richtige Konsistenz, den fehlenden Biss hat und die fetten, faserigen Fleischstücke zu braunen Fäden zerfallen. Er hebt kurz den Deckel. Kondenswasser tropft auf seine Füsse, und ein Schwall heissen, aromatischen Dampfes zieht über sein Gesicht. Den Blick zur Türe gerichtet vergewissert er sich, dass ihn seine Frau nicht beobachtet, sticht mit der Gabel in eine Kartoffel und befindet, dass das Ganze noch seine Zeit braucht. Mit einem kurzen "Bin gleich zurück" verabschiedet er sich und verlässt pfeifend das Haus. In der Luft hängt der strenge Geruch von schwelenden Torffeuern, klebt an Kleidern und Haaren, mischt sich mit der frischen Brise, die vom Atlantik über die Klippen weht. Nach zehn Minuten gemächlichen Gehens erreicht er seinen Lieblingsplatz, von dem aus man einen herrlichen Rundblick geniessen kann. Steil abfallende Klippen direkt vor ihm, dahinter die unendliche Weite des Meeres, ruhig und dennoch voller Geheimnisse. Er setzt sich ganz aussen auf einige borstige Grasbüschel, die bei jedem Windhauch erzittern, und lässt seine Beine über dem Abgrund baumeln. Für einen Moment treiben seine Gedanken, kraftlos, ohne Ziel; Ruhe breitet sich in ihm aus. Gebi kann sich nicht genug sattsehen. Der Geruch der Tiefe schlägt ihm entgegen, und ein kribbelndes, euphorisches Gefühl wächst in ihm. Unvermittelt entdeckt er unten zwischen den Felsen etwas Glänzendes, das sich in der Brandung auf- und abbewegt, etwas, das den gelbroten Strahl der untergehenden Sonne blitzend reflektiert. Neugierig geworden steigt er schnell über die steilen, arg zerklüfteten Vorsprünge hinab zum Meer, hinab zu den muschelbewachsenen Felskegeln, die das Meer jetzt bei Ebbe entblösst. Abgerissene Algenbüschel reiten auf dem schäumenden Wasser, kleben sterbend an den Steinen. Mit ausgestreckten Armen balanciert er über messerscharfe Felsen, sie schneiden tief in die dicken, weichen Gummisohlen. Plötzlich kippt er nach hinten, seine Arme zeigen zum Himmel, er verliert das Gleichgewicht, gleitet haltlos über eine Klippe. Mit den Füssen voran rutscht er über einen Felsvorsprung, spürt den ungeheuren Schlag im Rücken, fällt derart unglücklich, dass sich seine Beine beim Aufprall zwischen zwei jähen Felsschlünden verkeilen. Mit einem Aufschrei schlittert er tiefer, versucht sich zu befreien — erfolglos. Gebi tastet mit klammen Fingern sein gefühllos gewordenes Bein ab, soweit es geht. Er spürt, wie ein stummer, warmer Blutstrom aus der klaffenden Wunde trieft, spürt die rauhe Bruchstelle des heraustretenden Knochens; jede Bewegung trifft ihn wie tausend kleine Messer. Kalter Schweiss steht auf seiner Stirn, und schwindelnde Schauer jagen über seinen schmerzenden, wie gelähmten Rücken. Der Wind frischt auf, das tosende Meer erwacht, saugt, schlürft, reibt sich an den schroffen Felsen und will diesen hilflosen Menschen packen. Es schleudert seine weisse Gischt brodelnd wie kochendes Wasser über blanke, ausgewaschene Steine. Die aufgeworfenen Dampfwolken zersteuben, und die feinen Tröpfchen verteilen sich im Wind. Erschöpft lehnt Gebi sich zurück. Salzige Tränen rinnen langsam aus seinen geschlossenen Augen, ziehen glänzende Furchen über die blutleeren Wangen. Mühsam öffnet er seine weissverkrusteten Lider, schaut auf die wogende Wüste, denkt an seine Frau, die auf ihn wartet, nichtsahnend. Übelkeit überkommt ihn. Er blickt in die Weite, vermutet irgendwo am Horizont seine wirkliche Heimat und bereut zutiefst, hierhergekommen zu sein. Wellen springen über die Gesteinsbrocken, branden mit Donnergeräuschen an die ausgewaschenen Riffe, bespritzen ihn, umspülen nach und nach seine eingeklemmten Fussgelenke, färben das Wasser rot; tote Algen schlingen sich um seinen Körper. Nur die gierig schreienden Möwen, die, von Papageitauchern flankiert, beutesuchend über der Bucht kreisen, sind die einzigen Zeugen als sie kommt - die Flut.
Kommentare
Kommentar schreiben
| kullerchen Ein Umzug, - um das Alter zu genießen, geschrieben, als wäre er tatsächlich geschehen und nun, weiß ich als Nichtbiertrinkerin endlich, wie Guinnes schmeckt, ohne es je getrunken zu haben Die Gerüche, ich kann sie auch riechen, bis hin zum Meer und ich drehe nachdenklich die eingmachte Konfitüre in den Händen. Alles deutet darauf hin, dass es ruhig wird, sehr ruhig. Nun das wird es werden, für seine Frau, sehr ruhig, wenn ihn nicht noch jemand findet, ihn, der die Freiheit bis zum Ende genoß! Aller guten Dinge sind drei! Doch eine Frage, warum schreibst du mit so enorm vielen Bindestrichen? Das ist keine Kritik und es störte auch nicht, doch ich bin so fürchterlich neug.., nein wissbegierig! :0) Bis dann, sicher, Simone |