Romane & Erzählungen
Heinz Benecke - Aus der Psychoszene
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Schriftsteller und Philosoph M.A.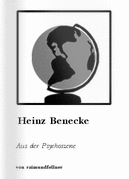
Heinz Benecke - Aus der Psychoszene
Beschreibung
Die Begegnung zweier Verlierer am Rande der Gesellschaft auf dem Gel├Ąnde einer "Irrtumsanstalt". Zur Erinnerung an den verstorbenen Heinz Benecke.
Heinz Benecke
┬á ┬áWarum er in die forensische Psychiatrie geraten war, dar├╝ber sprach er nie. Wahrscheinlich aus Selbstschutz. Auch von anderen war dar├╝ber nichts zu erfahren. Es war auch nicht wichtig. Dieser leidende Mann, dessen Gesicht einen Verlierer unserer Gesellschaft ausdr├╝ckte, war mir sympathisch, weil seine Miene so maskenlos ungek├╝nstelt offen sprach. Da bedurfte es keiner Worte, um von seinem Leben zu erfahren. Auch seine geb├╝ckte unf├Ârmig-hinf├Ąllige Gestalt wies ihn als Verlierer aus.
   Mir war dieser Mensch lieber als jene geschniegelten Siegertypen, die sich mit mir freilich nicht abgaben, weil ich für ihr Fortkommen keinerlei Vorteile bieten konnte. Heinz redete wenigstens mit mir in einer Zeit, als ich noch nichts anderes als die vage Hoffnung auf ein besseres glücklicheres Leben hatte.
┬á┬á Es war eine Begegnung von Versagern auf dem Gel├Ąnde der Haarer Psychiatrie, die nichts darstellten und von vielen verachtet waren, mit denen Normale nichts zu tun haben wollten, vielleicht weil diese Normalen selbst ihre Abgr├╝nde erahnten. Hier durfte ich so sein, wie ich war. Von mir wurde nichts gefordert. Die Miene durfte traurig sein, die Kleidung schlottrig, meine Haare ungewaschen str├Ąhnig. Ich durfte ein Aussehen haben, das der Spie├čer oder die Spie├čerin seit den 1980er Jahren pauschal mit dem Wort „ungepflegt“ verurteilte. Der andere Leidensgenosse hingegen hatte Verst├Ąndnis, weil er sich ebenso f├╝hlte. Dass ich es zu nichts gebracht hatte, war f├╝r Heinz kein Thema.
┬á┬á Freilich hatte ich eine Wohnung au├čerhalb und fuhr immer wieder wegen der lockeren ungezwungenen Menschen nach Haar bei M├╝nchen. Auch um mich mit meinem Freund Hubert Weigl zu treffen, der mich mit Heinz Benecke bekannt gemacht hatte.
┬á┬á Heinz Benecke allerdings ging es noch schlechter als mir. Er musste auf dem Haarer Gel├Ąnde wohnen und vormittags arbeiten, wof├╝r ihm so wenig bezahlt wurde, dass er mit seinem Geld nicht ausreichte. Keine Gewerkschaft nimmt sich der Interessen dieses Prekariats an, das unter Ausbeuterl├Âhnen geringer als im Manchester-Kapitalismus zur Deppeles-Arbeit gezwungen ist, um sich Bier und Zigaretten leisten zu k├Ânnen, nach denen die Ungl├╝cklichen und Gedem├╝tigten s├╝chtig sind.
┬á┬á Ich, der ich mit dem Rauchen aufgeh├Ârt hatte und mich niemals auf Alkohol eingelassen hatte, erkl├Ąrte Heinz immer wieder, dass er aus seiner Arbeitstretm├╝hle entk├Ąme, wenn er nicht rauchen und Alkohol trinken w├╝rde, denn dann sei er nicht auf diesen miesen Job angewiesen, k├Ânne aussteigen und nur von der staatlichen St├╝tze leben. Er br├Ąuchte sich diese Ausbeutung nicht gefallen lassen. Heinz bekam n├Ąmlich eine staatliche St├╝tze, weil er von dem geringen Lohn seiner Arbeit nicht h├Ątte leben k├Ânnen, selbst wenn er wie ein Asket gefastet h├Ątte. Im Manchester-Kapitalismus konnten die Arbeiter wenigstens ihre Grundbed├╝rfnisse, wie Essen, Wohnung und Kleidung von ihrem Lohn einigerma├čen bezahlen, was mit dem himmelschreiend geringen Lohn von Heinz nicht m├Âglich war. Darum brauchte er eine staatliche St├╝tze, denn sterben wollte ihn die Solidargemeinschaft auch nicht lassen aus einem Rest von Humanit├Ąt heraus.
┬á┬á Das staatliche Steuergeld brauchten im gr├Â├čeren Ma├če die betr├Ąchtlichen Geh├Ąlter der Arbeitsaufseher auf. F├╝r die L├Âhne der Armen blieb kaum etwas ├╝brig. Freilich rechtfertigten sich die Arbeitsaufseher damit, dass ihr Geld von einem anderen staatlichen „Topf“ k├Ąme, was aber kein g├╝ltiges Argument ist, weil beide „T├Âpfe“ von der Solidargemeinschaft des Staates oder der Gemeinde bef├╝llt werden. Dem Prekariat w├Ąre mehr geholfen, wenn diese Deppeles-Arbeit abgeschafft w├╝rde und ihm das Geld direkt gegeben w├╝rde. Dann w├Ąren die Aufseher ├╝berfl├╝ssig und ihre betr├Ąchtlichen Geh├Ąlter st├╝nden den Armen zur Verf├╝gung. Die Aufseher freilich verstehen ihre Interessen durchzusetzen im Gegensatz zum Prekariat, das ohne Interessenvertretung ist.
┬á┬á Heinz f├╝hlte nur leidend seine schwache Position gegen├╝ber diesen Arbeitsaufsehern, die ihn zu dieser miesen Arbeit zwangen. Er konnte sich nicht dar├╝ber ausdr├╝cken, weil er wegen des Alkohols unf├Ąhig war, zu denken und sein ganzes Elend in dieser Sucht ertr├Ąnkte. Da er aufgrund dieser ausbeuterischen Ungerechtigkeit mit seinem Geld nicht auskam, steckte ich ihm jedes Mal, wenn ich ihn traf, einige M├╝nzen zu mit den Worten, dass er dieses Geld nicht br├Ąuchte, wenn er von seiner Sucht ablie├če. Anstatt nun Argumente mit mir gegen diese Suchtmittel zu suchen, was seinen Ausstieg erleichtert h├Ątte, suchte Heinz immer Argumente daf├╝r, die ich aber alle entkr├Ąften konnte.
┬á┬á Mit meiner Freigiebigkeit handelte ich nach dem Wort Jesu: „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon.“ So versicherte mir Heinz, dass ich f├╝r ihn ein wirklicher Freund sei. Denn Freundschaft besteht nicht nur aus sch├Ânen Worten, sondern auch aus Hilfe und, wenn n├Âtig, aus finanzieller Unterst├╝tzung, wie mein Philosophieprofessor, Elmar Treptow, mir auf den Weg gegeben hatte.
┬á┬á Als es Heinz gesundheitlich noch schlechter ging und sein nahe bevorstehender Tod zu erahnen war, sagte ich zu ihm: „Ich habe dir immer ein wenig Geld gegeben. Falls du gestorben bist und bei Gott bist, dann sorge, bitte, daf├╝r, dass mir das Geld nie ausgeht. Denn ich meine, so ist das Verschenken von Geld eine bessere Geldanlage als bei einer Bank oder Versicherung.“
   Heinz haderte im Stillen damit, ob für ihn die Wirklichkeit nach dem Tod so günstig ausginge. Einzig sprach er immer wieder darüber, wie Jesus Christus verlacht und angespuckt wurde, wenn er über Gott sprach. In ihm hatte er den besten Leidensgenossen. Für eine Glückseligkeit hielt er sich nicht für würdig, weshalb er sich eigentlich nur Leidfreiheit, also das Nichts nach dem Tod wünschte.
┬á┬á Ich setzte dagegen, dass jeder, wenn er es nur wolle, zu Gott und in den Himmel komme, fr├╝her oder sp├Ąter. Es sei nur eine Frage der Zeit, die er brauche, um sich g├Ąnzlich zu l├Ąutern. Im ├ťbrigen w├╝rde Gott den Weg dahin kr├Ąftig unterst├╝tzen, denn Gott habe die Menschen zum Gl├╝cklichsein erschaffen, wof├╝r die Metapher „Himmel“ stehe.
   Diese Ansicht hatte ich mir nach dem Lesen vieler Bücher gebildet, und ich meine immer wieder, ich müsse davon den Menschen mitteilen. Heinz las gar keine Bücher. Auch keine Zeitung, worin eh wenig Heilsames steht. Meiner Meinung nach.
┬á┬á Weil ich auch so eine alte verlorene ungl├╝ckliche Liebe habe, die nicht rostet, fragte ich Heinz einmal danach, ob es f├╝r ihn auch eine g├Ąbe, die ihm die Liebste sei. Er ging tief in sich und holte aus dem Innersten die alte Erinnerung hervor und meinte nachdenklich: „Ja…, - aber die war sehr schlimm. – Sehr schlimm.“
┬á┬á Diese Antwort, dass diese Liebste „schlimm“ war, gab mir zu denken und regte in mir einen neuen Gedanken in meiner philosophischen Theorie ├╝ber die erotische Liebe an: Das Schicksal eines Menschen h├Ąngt nicht nur von seinem Milieu, seiner Genetik oder seinem Willen ab, wie die bisherigen Theorien besagen, sondern ist auch reziprok-korrelativ zu seinem Idol, also zu seiner Liebsten. Denn der Mensch steht in Wechselwirkung mit seinem Idol. Wenn die Liebste sich, wie bei Heinz, „schlimm“ verhielt, so hatte das Auswirkungen auf ihn, auf seine Gedanken und auf sein Verhalten. Und davon war sein Schicksal bestimmt.
   Ich besprach diesen neuen Gedanken mit Heinz durch und fand Zustimmung. Auch ihm wurde dadurch vieles klar.
┬á┬á Wenige Wochen sp├Ąter erfuhr ich von meinem Freund, Hubert Weigl, dass Heinz Benecke gestorben war. Mochte er jetzt vers├Âhnt mit seiner Liebsten in ungetr├╝bter Freude und Lust zusammen sein, w├╝nschte ich ihm und wandte mich mit dieser Bitte an Gott.
   Was das Geld betrifft, so hatte ich bisher immer mein Auskommen. Es bleibt mir sogar ein wenig übrig, dank der jenseitigen Hilfe von Heinz.