Romane & Erzählungen
NEU! Das Erbe der Rappoltstein - Kapitel 1 - 3
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
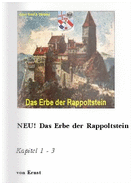
NEU! Das Erbe der Rappoltstein - Kapitel 1 - 3
Beschreibung
1. Kapitel: Das fahrende Volk 2. Kapitel: Ein geheimes Treffen 3. Kapitel: Im ForĂšt Domaniale de Marckolsheim
Â
Das Erbe der RappoltsteinÂ
Â
1. Das fahrende Volk
Â
Â
Â
Die Wittichs sind eine jenische Familie, die ĂŒberall im Lande als umherziehende HĂ€ndler bekannt sind. Sie fahren mit ihrem Wohngespann die Moselauen entlang, um ĂŒberall dort, wo sie hinkamen, ihre Töpfe und Pfannen zu verkaufen.
Sie liebten die Reisen von Ort zu Ort, aber sie litten auch unter der Unsesshaftigkeit, und mehr noch unter ihrer Heimatlosigkeit.
„Jetzt ein eigenes Haus und ein Dach ĂŒber dem Kopf, und die Sache wĂ€re geritzt!“, dachte Ludolf Wittich. Manchmal trĂ€umte er davon, ein eigenes Schloss zu besitzen, in dem er mit seiner Familie ein glĂŒckliches Leben fĂŒhren wĂŒrde.
Er hĂ€lt die ZĂŒgel fest in der Hand und achtet auf den Weg, der an dieser Stelle eine Kurve machte.
Ludolf wirft einen Blick auf seinen Hund Balduin, der hechelnd vor seinen FĂŒĂen liegt. Es ist ein ungarischer Hirtenhund. Einer jener Rasse, die auch Wölfe und BĂ€ren angreifen.
„Na Balduin, du hast es gut. Du weiĂt, wo du hingehörst!“
„Wow, Wuff!“, machte er, als hĂ€tte er seinen Herrn verstanden.
Irgendwie beneidete er den Hund Balduin. Er, Ludolf, wusste nÀmlich nicht, wo sein Zuhause war. Stattdessen kutschierte er bei Regen und bei Wetter in der Gegend herum.
Bei so einem Mistwetter jagte man auch keinen Hund vor die TĂŒre, sagte er mehr zu sich, als zu dem Hund.
Besorgt betrachtet er die dĂŒsteren Wolken am Himmel. WĂŒrden sie es noch rechtzeitig schaffen, die nĂ€chste Stadt zu erreichen, bevor der Himmel ĂŒber sie hereinbrach?
Das Wetter sah ganz danach aus, als ob im nĂ€chsten Moment ein Sturm losbrechen wĂŒrde, und sie gezwungen werden, irgendwo fĂŒr sich und ihre Tiere Unterschlupf zu finden. Aber wo? Weit und breit gab es auf weiter Flur nichts, wo sie sich hĂ€tten unterstellen können.
„Hab Erbarmen, Herr!“, murmelte Ludolf ein stilles Gebet gen Himmel und blickte zu den dĂŒsteren Wolken hinauf.
Am Heck ihres AnhÀngers waren zwei Esel angebunden, die mit Körben und SÀcken beladen, bereits unruhig blökten.
Ihre HandelsgĂŒter waren auf dem Dach des Gespanns gestapelt und gaben dem Wagen eine gewisse InstabilitĂ€t. Seitlich hingen zusĂ€tzlich die neuesten Töpfe und Pfannen.
Seit Generationen sind sie fahrende HĂ€ndler, Messer und Scherenschleifer. Sie ĂŒberbringen Nachrichten und transportierten Briefe fĂŒr Freunde und Bekannte ihrer Kunden je, nachdem wohin ihre Reise geht.
Kurz gesagt die Wittichs besaĂen das Vertrauen vieler Leute und waren angesehene HĂ€ndler.
Ludolf Wittich ist 48 Jahre alt, hat eine untersetzte stĂ€mmige Figur, dunkelgewelltes Haar und tiefbraune Augen. Seine buschigen Augenbrauen verstĂ€rkten seinen sanften, gutmĂŒtigen Blick, doch konnten diese tiefbraunen Augen auch Feuer spucken und jemandem tief in die Seele blicken.
Die Schule hatte er niemals besucht. Das Lesen, Schreiben und Rechnen brachte ihm seine Mutter Notburga bei, und Kesselflicken und Messerschleifen lernte er von seinem Vater Gunther, die sich nun beide im Inneren des Wagens aufhielten.
Bereits seit den frĂŒhen Morgenstunden ist er mit seiner Sippe unterwegs, die sich, wegen des Regens, im Inneren des Wagens aufhĂ€lt. Hierzu gehören, seine Ehefrau Hedewig, die Töchter Maria und Emma, sein Sohn Wilhelm und seine beiden Eltern Notburga und Gunther Wittich. Ihr Fuhrwerk ist eines jener typischen alten ZigeunerwĂ€gen, mit grĂŒnbeplankten Holzaufbauten und einem, ĂŒber den Fahrerstand, vorgezogenem Dach. Eine rundum befestigte Schanz verhinderte das Herunterfallen ihrer Waren.
Die rot bemalte HolztĂŒre und vier bunt verzierte Sprossenfenster mit Gardienen verliehen dem Gespann zusĂ€tzlich das typisch Aussehen eines nostalgischen Zigeunergespanns. Zwei Ofenrohre ragten aus den DĂ€chern und rundeten das Bild einer fahrenden Zigeunersippe ab.
Ihr zweiachsiger AnhĂ€nger war in Ă€hnlicher Weise gebaut, wie der Hauptwagen, hatte jedoch eine HecktĂŒre und jeweils nur ein seitliches Fenster. Er diente ihnen vor allem als Vorrats- und Lagerraum.
Doch gerne wurde der wÀhrend der Fahrt von den beiden Töchtern, Emma und Maria, als Aufenthaltsort benutzt. Schon als Kinder diente er ihnen als Versteck und war ihr Abenteuerspielplatz.
Maria ist eine junge Frau mit 22 Jahren und Emma, ihre Schwester, war vor einer Woche gerade 18 Jahre alt geworden. Beide sehen sich sehr Ă€hnlich. Jede trĂ€gt langes, gewelltes braunes Haar, das ihnen weit auf den RĂŒcken herabfiel. Beide haben die gleichen tiefbraunen Augen, wie ihr Vater, die viel Temperament verraten. Wobei die Ăltere, Maria, etwas schielte.
Eine Reihe ebenmĂ€Ăig weiĂer ZĂ€hne, einen schön geschwungenen Mund, und GrĂŒbchen in den Wangen, sowie der brĂ€unliche Teint ihrer Haut, lieĂen ihre Gesichter bezaubernd erscheinen. Man konnte ohne Ăbertreibung von zwei Schönheiten sprechen. Das LĂ€cheln und der Schalk in ihren Augen verlieh ihnen etwas Kindliches, doch gleichzeitig erkannte man das SpitzbĂŒbische in ihren Gesichtern.
Beide sind in Ă€hnlicher Weise gekleidet, tragen lange Röcke, die bis auf die Knöchel herab reichen, weiĂe Blusen und darĂŒber Strickwesten. Lediglich die blaue SchĂ€rpe von Maria lieĂ sie etwas reifer erscheinen.
FĂŒr heute wollte die Familie möglichst viele Ortschaften erreichen, um ihre Töpfe und Pfannen an den Mann zu bringen. Doch das Wetter machte ihnen da einen Strich durch die Rechnung.
Die Fahrt mit dem Fuhrwerk ging Ludolf wegen des matschigen Weges, es hatte seit Tagen in Strömen geregnet, einfach zu langsam.
„Wenn das so weiter regnet“, schimpft er vor sich hin, „dann verkaufen wir heute wieder nichts!“
Ludolf war an und fĂŒr sich ein GemĂŒtsmensch, den nichts aus der Fassung zu bringen konnte. Doch dieses Wetter lieĂ ihn allmĂ€hlich verdrieĂlich werden. War es an und fĂŒr sich schon nicht einfach, Töpfe und Pfannen zu verkaufen. Doch bei solch einem Wetter blieben die Leute Daheim, hinter ihren sprichwörtlichen Ăfen sitzen.
Der Gedanke, heute wieder nichts zu verkaufen, lieĂ Ludolf ein leichtes Magenzwicken verspĂŒren. Er machte sich Sorgen wegen seiner Familie, Sorgen um die Zukunft seiner Kinder. Was wird aus der jĂŒngsten Tochter Emma, was aus Maria und wie wird Wilhelms Zukunft aussehen? Das waren Fragen, die ihn sehr tief bewegten und ihm im Augenblick durch den Kopf schossen. Wie sehr wĂŒnschte er sich mit seiner Familie sesshaft zu werden und genĂŒgend Geld zu besitzen, um seinen Kindern eine solide Ausbildung zu ermöglichen.
Wiewohl er stets davon trĂ€umte, wies er den Gedanken doch als unmöglich erreichbar von sich. Zu lange waren sie schon auf der StraĂe, zogen von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort und waren an das Zigeunerleben gewöhnt.
Gerade jetzt setzte wieder ein dĂŒnner Nieselregen ein.
„Himmel Herrgott, will das denn gar nicht aufhören?“, schimpfte Ludolf vor sich hin, angelte sich eine Zigarre aus seiner Westentasche und zĂŒndete sie hinter vorgehaltener Hand an. Das tat er stets, wenn seine Laune sich zu verschlechtern drohte.
„Verzeih mir Gott, ich wollte nicht fluchen!“ Dabei dachte er sich, na ja ein Stumpen schmeckt wenigstens bei jedem Wetter! GenĂŒsslich zog er an seiner Zigarre und blies die Rauchkringel in die Luft. Damit war die Welt fĂŒr ihn einstweilen wieder in Ordnung.
Â
Es ist SpĂ€tsommer des Jahres 1951, als sich eine Verschwörung ĂŒber den Köpfen der Familie Wittich zusammenbraute. Nichtsahnend, dass man ihn und seine Familie seit einiger Zeit beobachtete, fĂ€hrt Ludolf die unbefestigte UferstraĂe entlang. Der Weg glich hier viel eher einem ausgefahrenen Feldweg, denn einer StraĂe.
PappelbĂ€ume und die dazwischen wachsenden StrĂ€ucher wechselten das Bild der Moselauen immer wieder von neuem ab. Die Weinberge schickten ihr saftiges GrĂŒn von den HĂ€ngen herab und spiegelte sich im flachen Wasser der Mosel. Ein idyllischer Anblick, der einem Naturliebhaber das Herz in der Brust hĂ€tte höher schlagen lassen. Doch dafĂŒr hat Ludolf Wittich im Moment keinen Blick ĂŒbrig. Seine Zigarre im rechten Mundwinkel richtete er seine ganze Aufmerksamkeit auf den ausgefahrenen und matschigen Feldweg vor ihm, um nicht mit dem Gespann in den Spurrillen auszugleiten und im nĂ€chsten Augenblick einen Achsbruch zu riskieren. Immer wieder kam das Fuhrwerk auf dem durchnĂ€ssten Untergrund ins Schlingern und der AnhĂ€nger hinten drohte umzukippen. Doch Ludolf war ein erfahrener Pferdelenker und hielt das Gespann fest in der Spur.
Unbemerkt folgte ihnen seit geraumer Zeit ein Mann, auf einem klapprigen Fahrrad. Von Zeit zu Zeit bleibt der Fremde halten, um dem langsam vorausfahrenden Fuhrwerk nicht zu nahe zu kommen.
Von diesem Verfolger bemerkte Ludolf nichts, zumal jener sich stets im Windschatten des Gespanns aufhielt und jede Wegbiegung ausnutzte, um nicht entdeckt zu werden.
Dennoch wurde der Fremde beobachtet, nĂ€mlich von Emma, der jĂŒngsten Tochter der Wittichs. Diese saĂ mit ihrer Schwester im hinteren Wagen und blickte durch das rĂŒckwĂ€rtige Fenster.
Wegen des Nieselregens und der beschlagenen Fensterscheibe konnte sie den Mann auf dem Fahrrad nur schemenhaft erkennen und sah nur, dass dieser des Ăfteren mit dem Fahrrad anhalten blieb. Was treibt einen Menschen bei diesem Wetter auf die StraĂe, fragte sie sich?
„Schau mal Maria, da fĂ€hrt jemand mit dem Fahrrad hinter uns her!“
„Dann will ich nur hoffen, dass er bei diesem Regen auf dem Matschweg nicht ausrutscht und auf die Nase fĂ€llt! Wie kann man bei so einem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs sein?“
Sie schĂŒttelte verstĂ€ndnislos mit dem Kopf und hĂ€kelte, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken, an der angefangenen Tischdecke weiter.
„Ich bin wirklich froh, wenn wir bald wieder festen Boden unter den RĂ€dern haben!“, sagte Emma.
„Wir sind ja bald in der Stadt, liebste Schwester!“
Emma setzte sich auf einen der Kisten und fragt:
„Wo fahren wir denn genau hin, hat Vater was gesagt?“
„Ich weiĂ es auch nicht, ins Französische hinein glaube ich!“
„Nach RibeauvillĂš vielleicht?“, fragte Emma schnell.
„Ich weiĂ es nicht!“, antwortete Maria. „Aber was reizt dich so sehr an RibeauvillĂš?“ Maria blickte fragend von ihrer Arbeit auf.
„Ach nichts Besonderes! Ich erinnere mich nur an diese Stadt noch vom letzten Jahr. Dort war es sehr schön!“
Maria legte ihre HĂ€kelsachen beiseite, stand von ihrer Holzbank auf und blickte durch das Heckfenster. Von dem Fahrradfahrer war nichts mehr zu sehen.
„Der Radfahrer scheint irgendwo abgebogen zu sein!“ Sagte sie und setzte sich wieder auf die Bank, nahm die Blechkanne vom Tisch und schenkte sich und ihrer Schwester kalten Tee in ihre Becher.
Die Einzigen, die das Ziel der Reise kannten, waren Ludolf, dessen Frau Hedewig und die beiden GroĂeltern Notburga und Opa Gunther. Die Letztgenannten saĂen zusammen mit Sohn Wilhelm im Wohnwagen und spielten zum Zeitvertreib „Mensch Ă€rgere dich nicht“..
„Ob wohl heute noch die Sonne herauskommt?“, fragte Notburga.
„Das will ich doch sehr hoffen!“, erklĂ€rt Hedewig und blickte durch das seitliche Fenster. „Wir werden wohl heute doch noch einige Töpfe und Pfannen verkaufen können!“, meinte sie dann, als sie wieder dem Tisch zugewandt war.
„Frag doch mal am Besten deine Tarotkarten, Oma!“, sagte Wilhelm zu Notburga, wĂŒrfelte eine Sechs und schmiss Opa Gunther vom roten Startfeld.
„Mit euch macht das Spielen keinen SpaĂ, ich gehe lieber nach drauĂen und leiste Ludolf etwas Gesellschaft!“ Opa stand von seiner Bank auf, öffnete die TĂŒr zum Kutschbock und sagte: „Rutsch mal ein StĂŒck rĂŒber, mein Sohn!“ Gunther setzte sich neben Ludolf auf den Bock und legte sich eine Pferdedecke ĂŒber die Knie.
„Na GroĂvater, hat Wilhelm mal wieder gewonnen?“
„Ja, der Knilch schummelt beim WĂŒrfeln. Das hat er wohl von dir geerbt!“ Frotzelte Opa Gunther.
Ohne auf die Frotzelei seines Vaters einzugehen, lenkte Ludolf das Gespann einen leichten Abhang hinunter, wo er unten verschiedene Wegweiser vorfand. Dort las er auf verwitterten Schildern die Hinweise: Schweich – Föhren – Trier. Darunter auf stand einem Extraschild: „Route de Paris.“ Sein nĂ€chstes Ziel war die Kleinstadt Trier an der Mosel, eine alte Garnisonsstadt aus der Römerzeit.
„Wir sind auf dem richtigen Weg!“ Meinte Ludolf zu Opa und deutet auf das Hinweisschild.
„Wir sind immer auf dem richtigen Weg!“, antwortet Opa lakonisch. „Wir fahren stets irgendwo hin und fahren auch wieder weg, nur ankommen tun wir nie!“
Ludolf gab seinem Vater im Stillen recht, wusste er doch, dass auch sein Vater sich nach Heimat sehnte.
Er war sich sicher, innerhalb der nĂ€chsten halben Stunde in Trier anzukommen. Sein Ortsinstinkt und sein ZeitgefĂŒhl hatten ihn bisher noch nie im Stich gelassen. Im ĂŒbrigen besaĂ er, wie fast alle fahrende Leute, den untrĂŒglichen Instinkt, der allen Zugvögeln eigen ist.
Inzwischen regnete es nur noch schwach. Doch hin und wieder trieb der SĂŒdwestwind Ludolf vereinzelte Regenböen ins Gesicht. Seine SchirmmĂŒtze hat er sich deshalb tief ins Gesicht gezogen. So fĂ€hrt er stoisch den ausgefahrenen und matschigen Uferweg die Mosel entlang.
„Dieses Mistwetter könnte bald aufhören!“ Schimpfte Ludolf und lieĂ die Zunge seiner Peitsche ĂŒber den Köpfen der Pferde knallen, damit diese in der Spur blieben.
Eine halbe Stunde spĂ€ter hatte Ludolf tatsĂ€chlich die alte römische Kleinstadt Trier erreicht. Von Weitem konnte er die ersten TrĂŒmmer und Hausskelette ausmachen, die der Zweite Weltkrieg ĂŒbrig gelassen hatte.
Der Regen hatte zum GlĂŒck inzwischen ganz aufgehört und die Sonne bahnte sich allmĂ€hlich den Weg durch die verhangene Wolkendecke.
„In Trier werden wir Rast machen und die Pferde trĂ€nken!“ ruft Ludolf nach hinten in den Wagen.
„In Trier werden wir unsere Töpfe und Pfannen verkaufen. Es hat ja zum GlĂŒck mit Regnen aufgehört!“, ertönt eine weibliche Stimme aus dem Inneren des Wagens.
„Ja, Frau!“, murmelte Ludolf und zog genĂŒsslich an seiner, inzwischen fast aufgerauchten, Zigarre. Den restlichen Stummel schnippte er im hohen Bogen auf den Weg.
Im Schritttempo fĂ€hrt er weiter und ein paar Minuten spĂ€ter befand er sich bereits auf einer befestigten StraĂe.
Die Pferde liefen jetzt merklich ruhiger und man hörte ihr stetiges Hufgeklapper, als „Klackedieklack“, auf dem Kopfsteinpflaster widerhallen.
Die Fahrt fĂŒhrte sie weiter an der Mosel entlang, in die Stadt hinein und an einer alten RömerbrĂŒcke vorbei. Irgendwann bog Ludolf nach links in eine Allee, um alsbald das schwarze Römertor, die Porta Nigra, zu erreichen.
Kurz, nachdem Ludolf sein GefĂ€hrt in die StraĂen der Stadt gelenkt hatte, erschien der Fremde mit dem Fahrrad am Stadtrand und verschwand schnell in einer der Gassen.
Als Ludolf das schwarze Römertor passiert hatte, wurde sein Fuhrwerk von einer Horde Kinder entdeckt, die auf einer der ĂŒbrig gebliebenen HĂ€usertrĂŒmmern spielten. Diese kamen schnell herunter gerannt und liefen schreiend und kreischend dem Gespann hinterher.
Emma öffnete die hintere WagentĂŒre und hĂ€lt den Kindern einen Korb voll Ăpfeln entgegen.
„Kommt her Kinder, ich habe frische Ăpfel fĂŒr euch!“
Schnell greifen mehrere kleine HĂ€nde zu, um sich jeweils einen der Ăpfel zu sichern.
Da das Fuhrwerk nur im Schritttempo fuhr, was es den Kindern ein Leichtes, dem GefĂ€hrt zu folgen. Ein kleines MĂ€dchen mit Zöpfen nĂ€herte sich der WagentĂŒre, wo Emma nun auf den hinteren Trittstufen saĂ und fragte:
„Bist du das Schneewittchen?“
„Nein, ich bin nicht das Schneewittchen!“, lachte Emma. EntzĂŒckt ĂŒber soviel kindliche Fantasie.
„Du bist aber so schön, wie sie!“
„Oh, ich danke dir, du bist auch sehr schön!“, antwortet Emma ganz gerĂŒhrt.
„Dann bist du sicher eine Prinzessin!“ Meinte das MĂ€dchen mit Bestimmtheit, wobei es auf das Wappen deutend, welches an der RĂŒckwand des Wagens zu sehen war.
„Nee, das sind doch Zigeuner!“, sagte einer der Ă€lteren Jungs wissend.
„Zigeuner?“
„Hurra, die Zigeuner, - die Zigeuner sind da!“, rufen die Kinder im Chor, vor Freude ĂŒber die seltene Abwechselung in der Stadt.
„Die Zigeuner!“, schreien sie immer wieder, hinter dem Fuhrwerk herlaufend, wobei sie von einem Bein auf das andere hĂŒpfen. „Die Zigeuner, hurra die Zigeuner!“
„Zigeuner?“ Wurde ĂŒberall gefragt.
Fenster gehen auf und man hörte warnende Rufe: „Ja, es sind Zigeuner in der Stadt, macht schnell die FensterlĂ€den dicht und nehmt die WĂ€sche von der Leine!“
Die WĂ€sche von der Leine? Wer hĂ€ngt denn bei so einem Wetter seine WĂ€sche auf die Leine? Fragte sich Ludolf und schĂŒttelte verstĂ€ndnislos mit dem Kopf.
Er wusste aus Erfahrung, dass die Leute es eigentlich gar nicht böse meinten, wenn sie bei ihnen von Zigeunern sprachen. Dieses Szenario kannten er und seine Familie ja fast nun von jeder Stadt, in der sie mit ihrem nostalgischen GefÀhrt auftauchten.
Die Nachricht, dass die Zigeuner in der Stadt seinen, verbreitete sich rasend schnell und an den BĂŒrgersteigen versammelten sich bereits die ersten neugierige Gaffer.
„Das sind keine Zigeuner“, hörte man eine Ă€ltere Dame dazwischen rufen, die zufĂ€llig des Weges kam. „Das sind die Wittichs, die kenne ich! Das sind ehrbare Fahrensleuteleute, aus der Sippe der Jenischen!“
„Jenisch, Jenische ..., was sind das fĂŒr Leute?“ Fragend sehen sich einige Passanten an. Der Begriff – jenisch – war ihnen bisher noch nie zu Ohren gekommen.
Da drĂ€ngt sich ein Mann mit Schlapphut durch die Zuschauermenge und ruft: „Ich kenne die Jenischen, das sind keine Zigeuner, aber Gauner, Bettler und Strauchdiebe, ohne festen Wohnsitz. Die streunen ĂŒberall herum und klauen, wo sie nur können, diesen Leuten darf man nicht ĂŒber den Weg trauen!“
Ludolf wurde leicht rot im Gesicht, und brachte das Gespann zum stehen. Er wollte sich gerade dem Sprecher zuwenden, als die Àltere Dame auf ihn zukommt und sagt:
„Hören Sie nicht darauf, Herr Wittich, was der Mann da sagt, ich kenne Sie besser. Mein Mann hat mir viel von Ihnen erzĂ€hlt und er wusste nur Gutes ĂŒber Sie und ihre Familie zu berichten!“ Das sagte sie laut, dass alle Umstehenden es hören konnten.
Dankend winkt Ludolf der Àlteren Frau zu, die ihn zu kennen schien. Als sie nÀher kam, erkannte er in ihr die alte Dame vom letzten Jahr wieder.
„Ach Sie sind`s, Frau Lauer! Ich danke Ihnen fĂŒr ihre FĂŒrsprache, wie geht es Ihnen?“ Ludolf reichte der alten Dame die Hand vom Kutschbock herunter und nahm dabei seine Kappe vom Kopf.
„Geht es ihrem Mann wieder gut, er war doch so krank im letzen Jahr?“
„Mein Hubert ist leider vor vier Monaten verstorben, Herr Wittich!“ Antwortet diese und stĂŒtzte sich neben dem Fuhrwerk auf ihren KrĂŒckstock.
„Das tut mir aber sehr leid, verehrte Frau Lauer! Was machen Sie denn nun ohne ihren Mann?“
„Ich habe leider nur eine kleine Witwenrente und dem, was die Leute mir hin und wieder aus ihrem Garten zukommen lassen!“
„Hm!“, machte Ludolf und schien zu ĂŒberlegen.
Als Ludolf seinen Blick wieder hob, um in die Menschenmenge zu blicken, war der Fremde mit Schlapphut verschwunden. Leider hatte er ihn nicht genau betrachtet, um ihn spÀter wiedererkennen zu können.
Dann wandte er sich vom Kutschbock herunter an die umstehende Menge:
„Hört Leute! Ihr könnt heute ausnahmsweise euere Messer und Scheren zum Sonderpreis bei mir schleifen lassen. Töpfe und Pfannen gibt es auch zum Sonderpreis. Einen Teil des Geldes erhĂ€lt dann die Witwe Lauer von mir. Ihr findet uns also nachher auf dem Viehmarkt!“
Ludolf verabschiedete sich von der alten Dame, ergriff die ZĂŒgel und fuhr im Schritttempo weiter.
„Ăbrigens“, ruft er den Leuten im Vorbeifahren zu, „das fahrende Volk sind auch Menschen, und zwar nicht die Schlechtesten!“
Die Wittichs waren keine Zigeuner, sondern eine alte germanische Fahrensfamilie, deren Wurzeln bis tief ins Mittelalter zurĂŒckreichten. Doch wurden sie von der Bevölkerung stets als Zigeuner betrachtet, da diese, Ă€hnlich den Sinti und Roma, UnstĂ€ndige waren und keinen festen Wohnsitz hatten.
Wer wusste schon um die Geschichte und dem Schicksal einzelner deutscher Fahrensfamilien, die nach den Wirren des DreiĂigjĂ€hrigen Kriegs 1618 – 1648 heimatlos geworden und entwurzelt waren?
Die Wittichs waren sogar Abkömmlinge eines der Ă€ltesten Familienclans, die schon zur Zeit Kaiser Ferdinands III. 1431, als Pfeifer und MinnesĂ€nger, das Recht als freie Fahrensleute zuerkannt bekamen. Eine alte Urkunde aus jener Zeit, die sie als einziges Erbe mit sich fĂŒhrten, bewies dies.
An die Geschichte seiner Familie musste Ludolf gerade denken, als er mit dem Fuhrwerk in Richtung Viehmarkt fuhr. Es war ihm doch nicht so ganz egal, wenn man ihn und seine Familie immer wieder als umherziehende Vagabunden und Zigeuner beschimpfte. Aus diesem Grunde sehnte er sich samt seiner Familie nach einem Ruhepol, nach einem festen Wohnsitz.
Der Viehmarkt war bald erreicht und der mitgefĂŒhrte Schleifstein schnell aufgebaut.
Einzelne Leute kamen bereits mit ihren KĂŒchenmessern, Scheren und Sicheln hinter dem Fahrzeug her, um diese zum Sonderpreis schleifen zu lassen. Nicht zuletzt, um damit der alten Frau Lauer zu helfen.
Bald hörte man auf dem Viehmarkt das regelmĂ€Ăige Sirren des Schleifsteins. Ludolf Wittich saĂ dort auf einem Schemel und taucht bereits ein Messer nach dem anderen in einen bereitgestellten Blecheimer mit Wasser. Daneben stand sein Sohn Wilhelm, der fleiĂig an der Kurbel drehte, damit der Stein stĂ€ndig in Schwung blieb.
„So, gnĂ€dige Frau, dieses Messer ist wieder so scharf, damit können Sie den Bart Ihres Mannes rasieren!“
Zum Beweis zog er das Messer durch eine alte Zeitung.
„Mein Mann ist im Krieg gefallen, welchen Bart soll ich da noch abschneiden?“ fragte die Frau, welcher das Messer gehörte.
„Das tut mir leid!“, antwortet Ludolf etwas beschĂ€mt ĂŒber seine unbedachte ĂuĂerung und gab ihr das Messer mit den Worten zurĂŒck: „Entschuldigen Sie bitte, das wusste ich nicht!“
„Mache Sie sich keine Gedanken, der Herr!“ Die Frau nahm das geschliffene Messer, bezahlte die verlangten Groschen und ging.
„Was kostet denn jetzt das Schleifen von Messern?“, meldete sich eine andere Frau, die scheinbar mehrere stumpfe Messer zum Schleifenlassen mitgebracht hatte.
„Heute kostet das Schleifen nur ein Groschen pro Messer!“
„Einen Groschen? Das ist aber wirklich gĂŒnstig! Ich habe auch nur eine kleine Witwenrente, wie die Frau Lauer. Mein Mann ist ebenfalls im letzten Krieg gefallen.
Hier habe ich noch zwei Messer und eine alte Schneiderschere. Wissen Sie, ich verdiene mir ein paar Mark im Monat durch NĂ€hen und Ănderungsschneiderei hinzu.
Was kostet das Schleifen der Schere?“ Sie holt die besagten GegenstĂ€nde aus ihrer Manteltasche und reichte sie Ludolf hin.
„Eine Schere schleifen zu lassen kostet normal fĂŒnfzig Pfennige, Madame! Von Ihnen aber nehme ich nur drei Groschen! Sind Sie damit einverstanden?“
„Also, einverstanden, hier gebe ich Ihnen eine Mark, davon ist ein Groschen fĂŒr die Frau Lauer! Wissen Sie, die Lauer ist meine Nachbarin und hat mir viel von Ihnen erzĂ€hlt.“
Mit diesen Worten legte sie Ludolf sechs stumpfe Messer und eine Schere in seine LederschĂŒrze und drĂŒckte ihm das Geld in die Hand.
Ludolf steckte das Geld ein und sagte:
„So, so, die ehrenwerte Frau Lauer hat Ihnen von uns erzĂ€hlt?“
„Ja, sie hat zu mir gesagt, dass man Messer bei den Zigeunern auch Schuri nennt!“
„Richtig, genau so nennt man das bei den Zigeunern!“ Antwortete Ludolf und hielt die Schneide des ersten Messers gegen das Licht, um es zu prĂŒfen. Dann zog er die Messer nacheinander ĂŒber den Schleifstein und kĂŒhlte sie danach im Wasser ab.
Nachdem die sechs Messer und Scheren geschliffen waren, drÀngten sich immer mehr Leute um ihn herum, einerseits um ihm beim Schleifen zuzusehen und andererseits, um ihre eigenen Messer schleifen zu lassen.
Ein halbwĂŒchsiger Knabe in Lederhosen drĂ€ngte sich vor, brachte sein Taschenmesser aus der Tasche zum Vorschein, und fragte:
„Kannst du mir mein Messer auch schleifen, Onkel? Ich habe aber kein Geld!“
„Komm her mein Junge, das schleife ich dir schnell umsonst!“ Damit nahm er dem Jungen das Messer aus der Hand und schliff es von beiden Seiten.
„So, hier hast du dein Messer wieder zurĂŒck, aber pass gut auf, dass du dich damit nicht selbst in den Finger schneidest!“
„Danke, Onkel!“, sagte der Junge und verschwand schnell in der Menge.
Diese Geste kam bei den Leuten sehr gut an und immer mehr kamen herzu, um ihre Messer schleifen zu lassen.
„Wo kommen Sie denn her?“, wurde Ludolf von einigen Leuten gefragt.
„Von ĂŒberall und nirgends!“, gibt er zur Antwort. „Wie Sie sicherlich wissen, gehören wir zum fahrenden Volk und sind mal hier, mal dort. Fragen Sie einen Vogel, woher er kommt? Er kann es Ihnen auch nicht sagen!“
„Und wo fahren Sie als NĂ€chstes hin?“, will ein Mann wissen.
„Wissen Sie der Herr, wenn ich das mal so sagen darf: Es ist immer besser seinen Weg zu verschweigen, damit einem die Gefahr nicht vorauseilt, verstehen Sie das?“ Mit diesen und Ă€hnlichen Antworten mussten sich die Leute zufriedengeben.
Â
Die Wittichs besaĂen, wie bereits beschrieben, ein Wohnwagen aus uralter Zeit, den sie liebevoll ihren; „Chambre du voyage“ nannten.
Auch hier standen einige Leute herum und bewunderten das gut erhaltene GefÀhrt.
Nachdem Ludolf und Wilhelm den Schleifstein aufgebaut hatten, breiteten die vier Frauen, GroĂmutter Notburga, Mutter Hedewig sowie die beiden Töchter, einen groĂen Teppich vor dem Wagen aus und drapierten darauf ihre Töpfe und Pfannen.
Sofort fanden sich einige Frauen ein, die gerne die neuen Pfannen und Töpfe Begutachten. Schnell entspann sich auf dem Viehmarkt ein lebhafter Handel.
Wie zufĂ€llig nĂ€hert sich der Sippe ein Mann mit Filzhut und grauem Anzug. Bei den Wittichs angekommen frage er, scheinbar ohne einen besonderen Grund dafĂŒr zu haben:
„Bleiben sie in der Stadt oder fahren Sie heute noch weiter?“
„Das Wissen wir noch nicht!“ antwortet die jĂŒngste Tochter Emma. „Da mĂŒssen sie meinen Vater fragen!“ Dabei deutet sie mit der Hand auf Ludolf, der fleiĂig mit Schleifen der Messer beschĂ€ftigt war. Wilhelm hatte den Mann bereits erspĂ€ht, der sich da an seine Schwester herangemacht hatte. Misstrauisch beobachtet er den Fremden.
Hatte er den Mann schon einmal irgendwo gesehen? Wenn ja, dann mindestens hundert Mal oder nirgends.
Jedenfalls besaĂ der Fremde ein Allerweltsgesicht, war unrasiert und trug den besagten grauen StraĂenanzug, der ihm viel zu groĂ an den Leib geschneidert war. Die Hosenbeine standen ihm auf den Schuhen auf, und das Jackett war offensichtlich fĂŒr einen wesentlich gröĂeren Mann angefertigt worden.
So sehen in aller Regel nur Landstreicher aus, dachte sich Wilhelm. Und so kleiden sich meist Diebe, die sich zu groĂ geratene Kleidung von einer fremden WĂ€scheleine geangelt haben. Das ganze Aussehen des Mannes gefiel Wilhelm zudem nicht, stand es doch im krassen Gegenteil, zu einer vertrauenserweckenden Person. Was wollte dieser Kerl von seiner Schwester, fragte er sich? Er nahm sich vor, diesen Mann im Auge zu behalten. Falls der Kerl seine Schwester belĂ€stigen sollte, dann gnade ihm Gott. UnwillkĂŒrlich spannten sich die Muskeln seiner Oberarme.
Nach zwei Stunden waren Ludolf und Wilhelm mit Messerschleifen fertig und packten den Schleifstein zusammen. Auch die Frauen schienen inzwischen gute GeschÀfte gemacht zu haben.
Der Fremde stand noch immer in der NĂ€he des Fuhrwerks und betrachtete inzwischen das Wappen sehr aufmerksam, welches auch auf der rechten Seite des Wohnwagens zu sehen war, nachdem man die darĂŒber gehangenen Töpfe entfernt hatte. Gleichzeitig benahm er sich, vor aller Leute Augen so, als ob er zu den Wittichs dazu gehöre. Er grinste die Leute im VorĂŒbergehen an, hob seinen Hut zum GruĂe und machte Bemerkungen wie: „Da haben Sie heute aber einen guten Kauf getĂ€tigt, gnĂ€dige Frau!“
Ludolf hatte den Mann auch seit einiger Zeit im Visier und ging nach dem Schleifen direkt auf den Mann zu und fragte barsch:
„Kann ich was fĂŒr dich tun, Gatsch?“ Gatsch ist der typische jenische Ausdrucksweise fĂŒr – Kerl, Mann oder Fremder.
Erschrocken, ĂŒber den barschen Ton, fuhr der Mann einen Schritt zurĂŒck und stammelte verlegen: „Entschuldigen Sie, ich habe ihre Tochter nur gefragt, ob sie heute noch hier bleiben, oder weiter Reisen wollen!“
„Was geht das dich an Gatsch, warum fragst du so neugierig?“
„Ja, das ist so, eh, wie soll ich sagen? Ich besitze selbst auch ein Fuhrwerk, nur nicht so groĂ und nostalgisch, wie das Ihre. Auch trĂ€gt es kein Wappen, wie ich es hier an ihrem Wohnwagen sehe. Ist das ihr Familienwappen?“
„Ja!“, antwortet Ludolf kurz. Doch wusste er selbst nicht genau, was es mit dem Wappen auf sich hatte. Opa Gunther hatte es vor Jahren angefertigt und bemalt.
„Nun komm endlich zur Sache! Was willst du von uns?“
„Ich wĂŒrde mich Ihnen gerne anschlieĂen, wenn ich wĂŒsste, wohin ihre Reise geht!“
„Warum möchtest du das wissen?“
Dass Ludolf nicht gerade freundlich mit dem Fremden sprach, lieĂ darauf schlieĂen, dass er dem Mann nicht traute.
„Wissen Sie, in einer gröĂeren Gemeinschaft, ist Reisen sicherer, und ihr scheint eine gute Truppe zu sein. Ich hingegen bin allein, und man weiĂ ja nie! Sie fahren doch heute noch weiter, oder?“
„Das wollten wir eigentlich“, antwortet Ludolf jetzt im sachlichen Ton, „Doch das Schleifen der Messer und Scheren hat mich lĂ€nger aufgehalten als ich dachte und wir wĂŒrden vor Abend unser Ziel nicht mehr erreichen. Wir bleiben darum heute hier und fahren erst morgen in der FrĂŒh von hier fort!“
„Wo fahren sie denn von hier aus hin?“, wollte der Fremde wissen.
„Ins Elsass hinein!“
„Aber das ist ja genau mein Weg!“, tat er erfreut. „Darf ich mich ihnen mit meinem Wagen morgen anschlieĂen, ich werde ihnen bestimmt nicht zur Last fallen?“
"Was wollen sie denn im Elsass?“, fragte Ludolf misstrauisch und blickte dem Mann scharf ins Gesicht.
„Ich möchte dort auf den MĂ€rkten GeschĂ€fte machen!“
„Was fĂŒr GeschĂ€fte, wenn ich fragen darf?“
„Ich treffe mich in Frankreich mit einem GeschĂ€ftsfreund, wir wollen einen Weinhandel beginnen!“
„Ein Weinhandel, im Elsass, in Frankreich? Aber da gibt es doch schon genug davon. Das ist ja, wie Eulen nach Athen tragen!“ lachte Ludolf unglĂ€ubig. Nun war ihm klar, der Mann hatte eine Meise. Vor solchen Menschen brauchte man wahrlich keine Angst zu haben.
HÀtte Ludolf gewusst, welches Schlitzohr da vor ihm stand, er hÀtte sich wesentlich mehr in acht genommen und ihm vor allem nicht soviel erzÀhlt.
„Mit was wir unsere GeschĂ€fte machen, ist unsere Sache, Herr...?“
„Ludolf ist mein Name, Ludolf Wittich, um genau zu sein!“
„Und wie heiĂen Sie?“
„Man nennt mich Raoul!“, antwortete der Fremde. "Darf ich mich Ihnen nun anschlieĂen, oder muss ich alleine Reisen, Herr Wittich?“
Da dieser Fremde ihn so instĂ€ndig bat, und er offensichtlich nicht ganz dicht im OberstĂŒbchen war, bot Ludolf ihn die gewĂŒnschte Hilfe an:
„Nun gut, sie können sich uns morgen frĂŒh anschlieĂen. Wir brechen pĂŒnktlich mit den ersten Sonnenstrahlen auf! Wir nehmen die Strecke ĂŒber Nancy, dann weiter Richtung StraĂburg! Wo haben Sie denn ihr Fuhrwerk eigentlich?“
„Auf einem nahegelegenen Bauernhof, auĂerhalb der Stadt!“
„Also, bis morgen FrĂŒh. Ich bin schon sehr auf ihr Fuhrwerk gespannt!“
„Ich werde pĂŒnktlich da sein, Herr Wittich!“
Der Fremde verabschiedete sich, fasste sich kurz an seine Hutkrempe, warf noch einen Blick auf das Wappen und ging raschen Schrittes davon.
Ludolf blickt ihm nachdenklich hinterher und meint:
„Komischer Kauz! Sieht in seinem Anzug aus, wie eine Vogelscheuche und will im Elsass Wein verkaufen, dass ich nicht lache!“
„Traust du ihm etwa, Vater?“, wird er von Wilhelm gefragt.
„Trauen hin, trauen her, uns kann er nichts anhaben, wir werden aber in jedem Fall aufpassen!“
Nun griff Ludolf in seine Tasche und zÀhlte das Geld, welches er mit Messerschleifen verdient hatte und sagt zu seinem Sohn:
„Das war ja wirklich ein sehr gutes GeschĂ€ft!“ Er zĂ€hlte Wilhelm zwei Mark in Groschen und FĂŒnfzigpfennigstĂŒcken in die Hand. „Hier, das ist fĂŒr dich!“
„Danke Vater!“, sagte Wilhelm und nahm das Geld. „Du hast ganz schön geschwitzt, Papa!“
„Ach was, die meisten Messer waren nicht einmal stumpf, und mussten nur leicht nachgeschliffen werden!“
„Und du wolltest nur eine Stunde in Trier Rast machen!“ Hört er seine Frau Hedewig neben sich sagen. Seine Frau Hedewig ist eine kleine kugelrunde Frau mit roten Pausbacken und grau-schwarzem Haar, dass sie hinten zu einem langen dicken Zopf zusammen geflochten hatte.
„Von hier kommen wir heute nicht mehr fort“, sagt sie, „die Mittagszeit ist lĂ€ngst vorĂŒber und ich kann mit dem Geld noch in die Stadt einkaufen gehen. Wieviel hast du denn ĂŒberhaupt verdient, Gatsch?“
„Genau 46 Mark, MoĂ (Frau) und sechs Groschen, also fast 47 Mark!“ Rasch greift seine Frau zu und nimmt ihm das Geld aus der Hand.
„Wenn wir schon einmal hier in der Stadt sind, kann ich gleich einige Besorgungen machen!“
Ludolf ĂŒberlieĂ ihr das Geld, da seine Frau ohnehin die Haushaltskasse fĂŒhrte, und behielt fĂŒr sich selbst nur vier Mark zurĂŒck.
„Das sind doch nur 40 Mark und sechs Groschen, wo ist denn das restliche Geld?“
„Das habe ich behalten, weil ich das Geld der Witwe Lauer versprochen habe. Ein Teil davon hat Wilhelm als Lohn erhalten!“
„Nun gut, ich werde gleich mit GroĂmutter zum Einkaufen gehen! Gibt es noch etwas, was wir unbedingt benötigen?“
„Bring mir Zigarren mit, es sind nur noch wenige als Vorrat hinten im Wagen, und besorge noch Pfeifentabak fĂŒr GroĂvater!“
„Ich weiĂ, ich weiĂ, habe schon an alles gedacht, ich bringe auch noch Zigaretten fĂŒr unseren Wilhelm mit, der raucht ja auch schon seit einiger Zeit!“
Hedewig ruft nach ihrer Schwiegermutter, worauf Notburga aus dem Wagen gestiegen kommt. Beide machten sie sich auf den Weg, zur Innenstadt.
Wilhelm versorgte inzwischen die Tiere mit Heu, dass sie eigens in JutesĂ€cken dafĂŒr mit sich fĂŒhrten. Die beiden Esel, die sie am Fuhrwerk mitfĂŒhrten, bekamen auch jeweils einen Sack mit Futter umgebunden.
Emma und Maria baten ihren Vater, in die Stadt gehen zu dĂŒrften, um sich die SehenswĂŒrdigkeiten der alten Römer anzusehen. In Wahrheit hatten sie jedoch etwas Anderes vor. Sie wollten dem Fremden hinterher schleichen und beobachten, was dieser tat.
So blieben Wilhelm und GroĂvater Gunther, bei ihrem Gespann zurĂŒck.
Gunther ist zwar fast ein Greis mit beinahe 80 Jahren, aber das „Zigeunerleben“ hatte seinen Körper gestĂ€hlt und so er nahm noch aktiv am Leben seiner fahrenden Sippe teil. Unterwegs flocht Gunther meist Körbe aus Weiden, oder schnitzte Flöten aus Haselnussholz.
Ludolf ging los, um der alten Frau Lauer das Geld zu ĂŒberbringen. Ihre Wohnung lag nur ein paar StraĂen vom Viehmarkt entfernt. Nach einigem Suchen hatte er das Haus gefunden, wo er im letzten Jahr war. Er befindet sich vor der offenstehenden EingangstĂŒre. Ein Blick in das dunkle Treppenhaus sagte ihm, dass er hier richtig war. Es roch nach Bohnerwachs. Ludolf betritt das Haus und geht die knarrenden Stufen hinauf. In der zweiten Etage fand er dann das Messingschild, worauf – Lauer stand. Eine Klingel gab es nicht. So klopfte er gegen die altdeutsche Glasscheibe des TĂŒrrahmens.
„Hallo Frau Lauer, sind Sie da?“
Schlurfende Schritte ertönen und die TĂŒre wurde geöffnet.
„Ach, Herr Wittich, Sie sind das. Kommen sie herein!“ Die TĂŒre offen stehen lassend, geht Frau Lauer in ihre Stube. Ludolf folgt ihr.
„Nehmen Sie Platz, Herr Wittich, ich habe gerade frischen Kaffee aufgebrĂŒht!“
Ludolf setzte sich und zĂ€hlte zehn Mark auf den Tisch. „Dank ihrer FĂŒrsprache, Frau Lauer, konnten wir sehr viele Messer schleifen und auch einige Töpfe und Pfannen verkaufen!“
„Das ist schön!“ Sagte sie ihm mit dem RĂŒcken zugewandt.
Frau Lauer brachte den Kaffee an den Tisch und sah das Geld dort liegen. „Doch nicht soviel, Herr Wittich. Sie mĂŒssen doch mit ihrer Familie davon Leben!“
„Nehmen Sie es ruhig, Frau Lauer, wir kommen schon gut zurecht!“
Sie nahm das Geld, ging zum KĂŒchenschrank, und legte es in ihre Zuckerdose. Dann setzte sie sich wieder an den Tisch.
„Das Leben ist doch bestimmt Ă€uĂerst hart, immer auf Achse zu sein, ohne ein eigenes Zuhause?“
Damit hatte sie, ohne es zu ahnen, Ludolfs wunden Punkt erwischt.
„Wo geht denn ihre nĂ€chste Reise hin?“, will die alte Dame wissen, die aus aufrichtigem Interesse fragte.
„Ins Elsass hinein!“
„Wie, was, zu den Fransusen? Dann geben Sie acht, dass es Ihnen nicht so geht, wie meinem Mann. Der ist nĂ€mlich an einem Granatsplitter gestorben, der noch in seiner Brust steckte. Einer Granate, von den Fransusen, verstehen Sie Herr Wittich? Fahren Sie bloĂ nicht dorthin! Die können die Deutschen immer noch nicht leiden!“
„Aber ...!“ Ludolf kam gar nicht erst zu Wort. „Warten Sie, ich gebe Ihnen etwas mit!“
Die Frau verschwand im Schlafzimmer und kam kurz darauf mit einer Angeltasche zurĂŒck, deren Inhalt ziemlich schwer zu sein schien, denn sie schleppte sich regelrecht mit der Tasche ab.
„Das wird sie vor den Fransusen schĂŒtzen!“, sagte sie.
„Was, eine Angel?“
„Ăffnen Sie bitte die Tasche und sehen Sie hinein!“ Ludolf tat, wie ihm gesagt. „Oh, was sehe ich denn da? Das ist ja ein Gewehr, ein alter Karabiner K98 aus dem Ersten Weltkrieg!“
„Der gehörte meinem Mann. Nehmen Sie ihn mit, Herr Wittich, ich brauche ihn nicht. Aber Ihnen kann er auf ihrer Reise nĂŒtzlich sein. Warten Sie, ich hole nur noch die Munition und das dazugehörende Bajonette!“ Sie verschwand wieder im Schlafzimmer und kehrte kurz darauf mit einem Jutesack zurĂŒck. „Hier drin befinden sich die Sachen!“ Mit einem schweren GerĂ€usch landete der Jutesack auf dem Tisch.
Obwohl diese Dinge illegal waren, nahm Ludolf sie doch gerne an. Man wusste schlieĂlich nie!
Die Lauer schien voll in ihrem Element zu sein. Man konnte regelrecht meinen, sie rĂŒste Ludolf fĂŒr einen Krieg gegen die Franzosen auf.
Nachdem Ludolf seinen Kaffee getrunken hatte, bedankte er sich, nahm die Angeltasche samt Jutesack und ging zur TĂŒr. „Also, Frau Lauer, nochmals vielen Dank!“
Sie war ihm bis zur TĂŒre gefolgt, drĂŒckte ihm nochmals ihre knochige Hand und sagte: „Passen Sie besonders in den Vogesen auf, Herr Wittich, mein Mann hat mir von dieser gefĂ€hrlichen Gegend erzĂ€hlt!“ Dann fiel die TĂŒre hinter ihm ins Schloss.
Kurze Zeit spĂ€ter befand sich Ludolf zurĂŒck auf dem Viehmarkt. Ohne von den Anderen gesehen zu werden, versteckte er die Angeltasche nebst Jutesack, im hinteren Teil des Wagens.
Es verging der Nachmittag ohne dass noch etwas besonderes geschah. Die Frauen hatten reichlich eingekauft, und auch die beiden MĂ€dchen kehrten unversehrt zurĂŒck. Nachdem man zu Abend gegessen hatte, legte sich jeder zum Schlafen nieder.
Am anderen Morgen, im Osten ging gerade die Sonne auf, machten sie sich auf den Weg. Von dem Fremden war weit und breit nichts zu sehen. Also fuhren sie ohne ihn los.
Nach einer halben Stunde erreichen sie den Ortsausgang. Dort angekommen sehen sie ein kleines einachsiges Fuhrwerk am Wegesrand halten. Es war ein alter schÀbiger Kastenwagen aus roh gezimmerten Brettern und einem seitlich rausragenden Ofenrohr. Vor das GefÀhrt war ein Kutschengaul gespannt, der schlecht im Futter stand und offensichtlich lange keinen Stall mehr gesehen hatte.
Als Ludolf an dem Wagen vorbeifÀhrt, erkannte er den Fremden von gestern wieder. Heute trug er keinen Anzug, sondern eine zerschlissene Cordhose und ein Baumwollhemd. Um die Schulter hatte er sich zum Schutz gegen die morgendliche KÀlte eine Wolldecke gelegt.
Als er Ludolf vorĂŒberfahren sieht, nickte er diesem nur einen stummen MorgengruĂ zu und setzte sein Gespann in Bewegung. Er folgte im Abstand von fĂŒnf PferdelĂ€ngen, offensichtlich darum bemĂŒht, sein Versprechen von gestern wahr zu machen und die voranfahrende Familie nicht weiter belĂ€stigen. Doch in seinem Kopf spielten sich ganz andere Gedanken ab.
Â
Â
Â
2. Ein geheimes Treffen
Â
Â
Lange, bevor sich die Wittichs auf den Weg gemacht hatten, stieg ein gewisser Marcel Herzberger am Hauptbahnhof von Trier in den Zug, um nach der französischen Kleinstadt Nancy zu fahren. Er hatte von Raoul erfahren, dass die Wittichs diese Strecke nehmen wĂŒrden. Irgendwo zwischen Nancy und StraĂburg wollte er dann mit Raoul wieder zusammentreffen.
Der Weg nach Frankreich fĂŒhrte Ludolf weiter am rechten Ufer die Mosel entlang. Er beabsichtigte, in etwa vier Stunden, die französische Grenze zu erreichen. Die Pferde waren in den frĂŒhen Morgenstunden noch frisch und ausgeruht. Daher spornte er sie zu einer schnelleren Gangart an, was jedoch wegen der Schwere des Gespanns nur Streckenweise möglich war. Die StraĂe folgte immer den Moselschleifen und war gut ausgebaut.
„Hoffentlich kann der Dinnelo da hinter uns, (Dinnelo bedeutet auf Jenisch: Depp oder Narr) mit uns Schritt halten“, sagt Ludolf zu seinem Sohn lakonisch, der neben ihm auf dem Kutschbock saĂ.. „Der Gaul von ihm sah mir nicht besonders gesund aus!“
„Das kann uns doch egal sein, Vater. Der findet seinen Weg auch allein. Ich traue dem Burschen da hinter uns ohnehin nicht ĂŒber den Weg. Ich glaube, der stellt sich bloĂ so, als wĂ€re er doof!“
„Wer in Frankreich als deutscher Landsmann, Wein verkaufen will, der ist doof, mein Sohn!“
TatsĂ€chlich fiel Raoul mit seinem Einachser immer weiter zurĂŒck und konnte die Wittichs nur wieder einholen, sobald diese etwas langsamer fuhren.
„Ihr wollt mich wohl gerne loswerden?“ schimpfte er hĂ€misch lachend vor sich hin. „Das könnte euch so passen, so leicht werdet ihr mich nicht los! Euere Wagen sind schwerer als der Meine, und vor der Grenze geht es bergauf. Haha!“ Raoul spukte verĂ€chtlich auf die StraĂe und gab dem Pferd die ZĂŒgel.
Er behielt recht, an manchen Stellen ging die StraĂe wirklich steil hinauf. Das verzögerte die Fahrt der Wittichs erheblich und Raoul holte wieder auf.
Viele kleine Ortschaften, idyllisch inmitten der Weinberge gelegen, sÀumen das rechte Moselufer.
Auf der anderen Seite der Mosel sahen sie das FĂŒrstentum Luxemburg. Auch dort wurde das Ufer von Weinbergen und vielen kleineren Ortschaften gesĂ€umt.
Beim Anblick der Dörfer juckte es Ludolf regelrecht in den Fingern anzuhalten, um dort seine KĂŒnste als Scherenschleifer und Kesselflicker erneut unter Beweis zu stellen. Hatte er doch gestern in der Stadt Trier soviel Geld damit verdient. Doch leider zwang ihn die knappe Zeit, die Ortschaften links liegen zu lassen.
In zwei, spÀtestens drei Tagen wollte man die Stadt RibeauvillÚ, zu Deutsch Rappoldsweiler erreicht haben, um dort noch rechtzeitig einen Standplatz zu ergattern.
Ludolf beabsichtigte am diesjĂ€hrigen legendĂ€ren Pfifferfest von RibeauvillĂš teilzunehmen, ein Fest, dass an die frĂŒhen ZĂŒnfte der MinnesĂ€nger und Pfeifer des Mittelalters erinnerte. Gleichzeitig hatte er eine Verabredung, in der NĂ€he von RibeauvillĂš, mit einem Freund einer anderen Sippe. Er und seine Familie ahnten nicht, dass ihnen besondere Ereignisse und wichtige Begegnungen bevorstanden, die ihnen Aufschluss ĂŒber ihre wahre Herkunft geben sollten und ihr Leben verĂ€nderten.
„HĂŒh!“ Erscholl Ludolfs Stimme durch die Landschaft. Die beiden starkknochige Haflinger zogen, den ZĂŒgeln Ludolfs folgend, die schweren Wagen, die inzwischen wieder holpriger gewordene SchotterstraĂe entlang. Das Fuhrwerk knirschte und Ă€chzte, als drohe es in jeden Moment auseinanderzubrechen. Die Radnaben der HolzspeichenrĂ€der geben bei jeder Umdrehung ein quietschendes GerĂ€usch von sich. Immer wieder muss Ludolf deswegen anhalten, um die trocken gelaufenen Radlager zu fetten.
„Wenn das so weiter geht, schaffen wir es nicht rechtzeitig bis RibeauvillĂš!“, sagt er zu seiner Frau, die hinter ihm sitzend aus dem Wagenfenster schaute.
„Das schaffen wir schon!“, antwortet sie zuversichtlich.
„Wollen es hoffen!“, erwidert Ludolf. „Wenn der Wagen nicht so voll beladen wĂ€re, kĂ€men wir wesentlich schneller voran. Im ĂŒbrigen muss ich stĂ€ndig auf den Dinnelo (Narr) da hinter uns achten, sonst verpasst er den Weg noch nach Frankreich. Will im Land der Weine, Wein verkaufen. Dass ich nicht lache!“ Dieser Gedanke lieĂ Ludolf nicht mehr los.
UnauffĂ€llig beobachtete Raoul jede Bewegung der vor ihm fahrenden Familie, wobei ihm nicht entgangen war, dass Ludolf unterwegs des Ăfteren anhalten musste, um die Radnaben zu fetten.
Maria und Wilhelm liefen inzwischen, gefolgt von ihrem ungarischen Hirtenhund Balduin, dem Gespann zu FuĂ hinterher, und achteten darauf, dass keines der GepĂ€ckstĂŒcke unterwegs verloren ging. Ab und zu blickten sie zurĂŒck, um sich zu vergewissern, ob der Fremde ihnen noch folgte.
Emma setzte sich zu ihrem Vater nach vorn und nahm ihm die ZĂŒgel aus der Hand.
„Lass mich fahren, Vater!“, sagte sie. Und so lenkte sie das Gespann, mit sicherer Hand, die befestigte StraĂe entlang.
„Das machst du gut, mein Kind!“, lobte er seine Tochter.
„Das hast du mir ja auch beigebracht, Papa!“, antwortet sie schelmisch, aber doch geschmeichelt ĂŒber das Lob ihres Vaters.
„Ich hoffe, wir erreichen morgen abend RibeauvillĂš!“
„RibeauvillĂš?“, fragt Emma freudig ĂŒberrascht. „Das, hoffe ich auch sehr, Vater!“, sagte sie gut gelaunt und mit leicht verklĂ€rter Stimme. „Du solltest ĂŒbrigens keine groĂe RĂŒcksicht auf diesen Fremden da hinter uns nehmen. Er kann ja unserer Wagenspur folgen, um ins Elsass zu gelangen. Ich traue dem Mann sowieso nicht ĂŒber den Weg.
„Du traust ihm also auch nicht?“
„Merkst du denn nicht, dass er uns die ganze Zeit unauffĂ€llig beobachtet, und wenn du wegen der Radnaben anhĂ€ltst, hĂ€lt er sich immer in gehöriger Entfernung, anstatt heranzukommen und zu fragen, ob er dir helfen kann. Irgendetwas hat der Gatsch da hinten zu verbergen, das spĂŒre ich!“
„Er will uns halt nur nicht belĂ€stigen, wie er gesagt hat, zumal ich ihn gestern ziemlich barsch angefahren habe!“
„Nein, Vater, das ist es nicht. Er hat bestimmt irgendwas vor, ich kann das spĂŒren! Der kam gestern auch nicht zufĂ€llig vorbei! Ich weiĂ nicht, ob das wichtig ist. Als wir gestern bei dem Regenwetter nach Trier fuhren, folgte uns ein Mann auf einem Fahrrad. Leider konnte ich den Mann nicht erkennen!“
Ludolf wurde hellhörig.
„Dann werden wir den Gatsch scharf im Auge behalten, mein Kind!“, antwortet Ludolf gelassen und nahm Emma die ZĂŒgel wieder aus der Hand.
Emma hatte Recht, der Fremde hielt mit Absicht einen gehörigen Abstand hinter den Wittichs. Seinen zerkrempelten Hut hatte er sich tief ins Gesicht gezogen, damit man seinen lauernden Blick nicht sehen konnte. Nervös kaute er auf einem Grashalm herum. Hoffentlich schafft es Marcel rechtzeitig vor Ort, zu sein?
Raoul wusste zwar nicht genau, wer dieser Marcel Herzberger in Wahrheit war und was er vorhatte, doch konnte es sich eigentlich nur um die Kasse und Handelswaren der Wittichs handeln. Er hatte ihn vor Kurzem in Trier in einer Spelunke kennen gelernt, und von ihm das Angebot gemacht bekommen, auf die Schnelle viel Geld zu verdienen. Und da er ohnehin pleite war, kam ihm dieses Angebot gelegen. FĂŒr Wagen und Pferd hatte dieser Herzberger bereits vorher gesorgt.
Da fragte Vater Ludolf seine Tochter Emma: „Warum hĂ€ltst du den Gatsch hinter uns fĂŒr einen Strauchdieb?“
„Der Mann hat böse Augen, Papa und einen sehr unruhigen Blick. Als er mich gestern in Trier anblickte, erschaudert es mich, und es lief mir eiskalt den RĂŒcken herunter.
Als er dann behauptete, er wolle nach Frankreich, um dort auf den MĂ€rkten GeschĂ€fte zu machen, so glaubten Maria und ich ihm das nicht. Maria und ich sind ihm heimlich hinterher gegangen und haben gesehen, wie er sich mit einem anderen Mann traf. Leider konnten wir ihre Unterhaltung nicht verstehen, weil wir uns zu weit zurĂŒckhielten, da sie uns sonst gesehen hĂ€tten. Doch Maria erklĂ€rte mir, dass sie anhand der GebĂ€rden erraten habe, dass es dabei um uns gegangen sein muss. Hin und wieder deutete dieser Raoul mit seiner Hand in Richtung unserer Wagen und der andere Mann nickte darauf sehr heftig mit dem Kopf. Danach verschwanden sie zusammen in einer Kneipe!“
„Wir werden also aufpassen mĂŒssen, ob er etwas gegen uns im Schilde fĂŒhrt!“, antwortet Ludolf. „Und, wenn er etwas gegen uns im Schilde fĂŒhren sollte, hetze ich ihm unseren Balduin auf den Hals. Der Hund scheint den Kerl ohnehin nicht zu mögen. Im ĂŒbrigen sind dein Bruder Wilhelm und ich auch nicht von schlechten Eltern. Hinten im Wagen habe ich fĂŒr solche FĂ€lle einen Karabiner K 98 aus dem Ersten Weltkrieg versteckt. Also, keine Sorge liebe Emma, es sind genĂŒgend Augen, die aufpassen!“
Damit war ihre Unterhaltung beendet.
Nach vier Stunden erreichten sie die deutsch-französische Grenze. Bereits von Weitem sahen sie den Schlagbaum und das Schild Zoll – Douane. Die ZollformalitĂ€ten an der Grenze waren schnell erledigt, zumal die Zöllner die Sippe der Wittichs bereits von frĂŒheren Fahrten her kannten. Sie kontrollierten lediglich, ob zusĂ€tzlich fremde Personen auf dem Wagen waren. Nur bei Raoul durchsuchten sie dessen Wagen genauer, fanden jedoch nichts.
„Bon Route!“ Sagten die deutschen Zöllner und lieĂen den Wagentross die deutsche Seite passieren. Die gleichen FormalitĂ€ten erfolgten nochmals auf der französischen Seite und schon befand man sich auf der Route ĂŒber Sierck-les-Bains - Thionville – Metz – nach Nancy. Von dort wollte man durch die Vogesen, in Richtung Colmar weiterfahren.
Die Fahrt ĂŒber die vielen Dörfer ging nur schleppend und langsam voran. Nach achteinhalbstĂŒndiger Fahrt, unterwegs gab es keine besonderen Vorkommnisse, hatte man endlich Nancy erreicht.
Es begann bereits zu dunkeln, als man in Nancy ankam. Dennoch beabsichtigte Ludolf, die 35 Kilometer bis Lunéville weiterzufahren. Von seinem Schatten Raoul hatte er seit Langem nichts mehr gesehen. Mochte dieser Raoul nun bleiben, wo er wollte. Er hatte ihn bis ins Elsass mitgenommen, und das war sein einziges Versprechen.
So fuhr er dem Wegweiser folgend den langsam ansteigenden Weg in das Gebirge. Der Rest seiner Sippe schlief bereits im Wagen. Als es dann völlig zu dunkeln begann, zĂŒndete er die mitgefĂŒhrten Karbidlampen an, hĂ€ngte zwei nach vorne in die vorgesehene Halterung und befestigte eine hinten am Wagen. So folgte er bei dieser spĂ€rlichen Beleuchtung dem Waldweg, der sich vor ihm auftat. Vorsichtshalber hatte er bereits vorher den Karabiner aus dem Wagen geholt, den er nun geladen quer vor sich auf den Knien liegen hatte. Balduin lag vor ihm und beobachtete jede seiner Bewegungen.
„Ja, du bist ein braver Hund, Balduin!“, streichelte Ludolf seinen Hund. „Pass du immer schön auf dein Herrchen auf. Kannst wohl diesen Raoul auch nicht sehr leiden, stimmts?“
„Wuff, Wow Wau!“, machte Balduin und knurrte leicht zur BestĂ€tigung, als ob er sein Herrchen verstanden habe, und war danach wieder still.
Schon halb in Trance fĂ€hrt Ludolf weiter. Nach drei Stunden Fahrt durch das nĂ€chtliche Dunkel war er irgendwann in der NĂ€he von LunĂ©ville angekommen. Hier machte er am Rande eines WĂ€ldchens halt. Ohne sich weiter um seinen komischen Mitreisenden zu kĂŒmmern, trocknete er im Halbdunkel noch die Pferde ab, wickelt sich selbst in eine Wolldecke und schĂ€rfte dem Hund Balduin ein, ja gut aufzupassen. TodmĂŒde schlĂ€ft er auf dem Kutschbock ein.
Â
Obwohl es noch stockfinster war, wird Ludolf einige Stunden spÀter durch das holpern des Wagens wieder geweckt.
„Wie, was? Halt! Was soll das?“ Verstört blickt Ludolf Wittich sich um. Hatte er getrĂ€umt? Im Nu ist er hellwach, springt auf und erkennt zum GlĂŒck die Silhouette seines Sohnes Wilhelm neben sich auf dem Kutschbock sitzen.
„Guten Morgen Vater, es wird bald hell, wir mĂŒssen weiter, wenn wir noch vor heute abend in der NĂ€he der Stadt RibeauvillĂš ankommen wollen!“
„Ach du bist es. Ich dachte schon wir wĂ€ren ĂŒberfallen worden. Dann fahr du mal weiter mein Sohn, ich bin noch mĂŒde und mir ist kalt!“
Ludolf steigt nach hinten in den Wagen, legt sich auf eine der Pritschen, deckt sich warm zu und schlÀft sofort wieder ein. Er hatte die halbe Nacht auf dem Kutschbock zugebracht und war völlig durchgefroren.
Wilhelm lenkte das Fuhrwerk ebenso gut wie sein Vater. So fÀhrt er in der Dunkelheit immer tiefer in die Vogesen. Er folgt stur dem vor ihm schlÀngelnden und viele Kurven aufweisenden Waldweg an einem kleinen Fluss entlang.
Als der Tag sich allmÀhlich zu Lichten begann, erblickt Wilhelm weit hinter sich im Tal das Fuhrwerk dieses Fremden. Er hatte nÀmlich kurz angehalten, um die hintere Karbidlampe zu löschen und im Wagen zu verstauen. Dabei hatte er das Fuhrwerk entdeckt.
„Der hat wohl die letzte Nacht ganz in der NĂ€he von uns zugebracht“, dachte sich Wilhelm, „und folgte jetzt unseren Wagenspuren, die ich auf dem frischen Waldboden hinterlassen habe? Das muss ich nachher unbedingt Vater melden!“
Nach und nach wurde die gesamte Familie wach und GroĂmutter Notburga fragt: „Wollen wir nicht endlich bald anhalten und frĂŒhstĂŒcken, die Pferde und unsere Esel brauchen auch frisches Futter!“
„Sobald ich einen geeigneten Platz gefunden habe, GroĂmutter, halte ich an! Eine Frage: Ist Vater schon wach?“
„Lass den mal noch schlafen“, erwidert Hedewig, „der ist die halbe Nacht durchgefahren!“
„Ich bin schon wach!“, ertönt die Stimme Ludolfs aus dem Inneren. Was gibt es, mein Junge?“ Ludolf kam aus dem Wagen hervor und setzte sich neben seinen Sohn. Die knapp zwei Stunden Schlaf schienen ihm gut getan zu haben. „Was gibt es?“
„Vater, dieser Fremde ist wieder hinter uns!“
„Immer noch? Ich dachte, er wĂ€re bei Nancy geradeaus in Richtung Paris weitergefahren. Nun bin ich mir sicher, dass er uns verfolgt!“
„Was kann er denn von uns wollen, Vater?“
„Ich weiĂ es nicht. Ich denke, dass er bei uns Geld vermutet!“
„Aber was will er denn alleine gegen uns ausrichten?“
„Möglicherweise gehört er zu einer Bande von Strauchdieben, die uns hier in den WĂ€ldern auflauern sollen?“
„Dann mĂŒsste er ja schon in Trier einen VerbĂŒndeten gehabt haben!“
„Den hatte er auch. Emma erzĂ€hlte mir, dass Maria und sie ihm vom Viehmarkt aus nachgegangen sind und ihn mit einem anderen Mann gesehen haben. Was nun, wenn dieser uns bereits vorausgefahren ist, und eine Horde Vagabunden zusammentrommelt?“
„Aber dann mĂŒssten sie doch unsere Route kennen!“
„Auch die kennen sie vermutlich. Erinnere dich an das GesprĂ€ch mit diesem Gatsch, als er mich fragte, wohin wir fahren. Ich habe es ihm frei herausgesagt, da ich ihn fĂŒr einen Narren hielt. Ich könnte mich jetzt selber Ohrfeigen!“
„Ja, ganz entgegen deiner Philosophie, man solle seinen Weg verschweigen, damit einem die Gefahr nicht vorauseilen kann!“, antwortete Wilhelm.
Wilhelm legte seinem Vater zum Trost die Hand auf die Schulter. „Was hĂ€ltst du davon, wenn wir einfach die Route Ă€ndern?
„Das geht nicht Wilhelm, dann kĂ€men wir zu spĂ€t in RibeauvillĂš an!“
„Dann werden wir eben genau aufpassen und uns zur Wehr setzen. Wir sind immerhin sechs Personen, die mit dem Schuri umzugehen wissen. Opa kann mit dem Karabiner ebenfalls gut umgehen, und auf Balduin können wir uns ohnehin verlassen. Ich möchte denjenigen sehen, der sich mit unserem ungarischen Hirtenhund anlegen will!“
„Da hast Recht Wilhelm, wir werden aufpassen, und unseren Weg normal fortsetzen. Also los!“
Hier erkannte man mal wieder einmal, wie sehr fahrende Familien zusammenhielten, wenn ihnen Gefahr drohte. NatĂŒrlich erklĂ€rten sich auch die Frauen bereit, ihren ursprĂŒnglichen Weg beizubehalten. Notburga steckte sich auch gleich das KĂŒchenmesser in die SchĂŒrze und sagte:
„Sollen nur kommen, diese Gatsche!“
Mit gespannter Wachsamkeit fuhr man nun weiter.
Nach zwei Stunden deutet eine Holztafel am Wegesrand auf die nÀchste Ortschaft Azerailles hin.
„Wir kommen gleich in einem Ort an, dort werden wir die Pferde trĂ€nken und können FrĂŒhstĂŒcken, GroĂmutter!“, ruft Wilhelm nach hinten.
Â
Jede kleine bĂ€uerliche Ortschaft in den Vogesen besitzt einen Brunnen mit Steintrog, als Wasserstelle fĂŒr das Vieh.
In Azerailles angekommen, halten sie ihr Gespann an einem solchen Brunnen an und versorgten zunĂ€chst die Tiere mit Wasser und frischem Heu. Mutter Hedewig ging zum Brunnen und holte Wasser fĂŒr den Kaffee. Einzelne Bauern kamen herbei und grĂŒĂten höflich: „Bonjour Monsieurs et Madame!“
„Bonjour!“, grĂŒĂten die Wittichs höflich zurĂŒck.
Bewundernd betrachten sie das alte Fuhrwerk der Wittichs. „Voila une Grande Chambre du Voyage ! »
Inzwischen kam Raoul angefahren und hielt auf der anderen StraĂenseite, ohne vom Bock herabzusteigen.
„Komischer Heiliger, dieser Raoul“, flĂŒstert Wilhelm seiner Schwester Emma zu, die gerade PferdeĂ€pfel einsammelt, um sie spĂ€ter im Kanonenofen zu verfeuern.
„Solange er nicht zu uns herĂŒber kommt, kann er bleiben, wo der Pfeffer wĂ€chst!“, antwortet Emma ebenso leise. „Bin froh, wenn wir ihn endlich los sind!“
Nach zwanzig Minuten Aufenthalt ging die Fahrt weiter.
„Bon Route!“, rufen die Azerailles Bauern den Wittichs hinterher und winkten mit ihren TĂŒchern. Raoul folgen ihnen weiter im gewohnten Abstand.
„Solange der Kerl nur alleine hinter uns ist, haben wir nicht zu befĂŒrchten. Doch sollten wir von jetzt an den Weg vor uns besser im Auge behalten!“, meinte Wilhelm zu seinem Vater.
Ludolf ging wortlos nach hinten in den Wagen, holt den Karabiner K 98 hervor, lÀdt ihn durch und sagt zu seinem Sohn:
„Hier, nimm du das Ding und wenn sich uns jemand in den Weg stellt, schieĂt du! Ich fahre jetzt weiter!“
Damit setzte er sich neben Wilhelm auf den Kutschbock und nimmt ihm die ZĂŒgel aus der Hand. Wilhelm nahm den Karabiner und legt ihn schussbereit neben sich.
Nach einigen Kilometern musste Ludolf wieder anhalten, weil die Radnaben wieder trocken gelaufen waren.
Gleichzeitig hielt auch Raoul sein Gespann hinter eine Kurve an und wartete. Ein paar Minuten darauf taucht ein Mann aus dem GebĂŒsch auf und fragt: „Alles klar, Raoul?“
„Ja, es scheint alles nach Plan zu laufen!“, antwortet dieser.
Der zweite Mann steigt auf das Fuhrwerk und verschwand sofort im Kastenwagen. Von alledem bemerkten die vorausfahrenden Wittichs nichts. Da Rudolf vermutlich in KĂŒrze wieder anhalten wĂŒrde, um die Radnaben erneut zu schmieren, konnte Raoul das Gespann ruhig eine Weile halten lassen und sich mit seinem Kumpan besprechen. Die Wittichs wĂŒrde er leicht wieder einholen.
„Was willst du eigentlich von der Sippe da vorne?“, fragt Raoul nach hinten in den Wagen hinein.
„Diese Leute fĂŒhren ein Dokument mit sich herum, welches ich unbedingt in meinen Besitz bringen muss!“
„Um was fĂŒr ein Dokument handelt es sich denn?“
„Eine alte Urkunde, die mir gehört!“
„Eine Urkunde, worĂŒber?“
„Das, tut nichts zur Sache, fahre du diesen Leuten nur weiter wie gewohnt hinterher. Von meiner Anwesenheit dĂŒrfen sie nichts ahnen. Bei passender Gelegenheit werde ich ihren Wagen durchstöbern, das Dokument und das Geld an mich bringen. Du bekommst dafĂŒr alles Geld, dass diese Leute bei sich fĂŒhren!“
„Woher, kennst du die Familie Wittich?“, fragte Raoul. „Wer und was sind sie eigentlich, dass sie dir so wichtig sind?“
„Das habe ich dir doch schon gesagt!“, antwortet der Fremde mit verhaltener Stimme. „Doch will ich dir verraten, was ich ĂŒber diese Sippe in Erfahrung gebracht habe!
Das ganze Jahr reist diese Familie durch alle Lande, von Ort zu Ort, wobei ihre Reisen sie meist durch Deutschland, die Schweiz, Ăsterreich, Ungarn dem Böhmerland und Frankreich fĂŒhren. Dabei sind sie ĂŒberall als fahrende HĂ€ndler bekannt, die ihre Körbe, Töpfe, Pfannen an die Bevölkerung verkaufen!“
„Das tun doch fast alle fahrenden Leute!“
„Das schon, aber hör zu! Nebenbei ĂŒberbringen diese Leute Nachrichten, verstehst du, Nachrichten!“
„Meinst du damit, dass sie heimliche BotengĂ€nger und Spione sind?“
„Genau, oder kennst du eine bessere Tarnung?“
Raoul pfiff durch die ZĂ€hne. „Hui, das ist ja ein Ding. Dabei sehen diese Leute so harmlos aus, und in Wahrheit sind sie Geheimagenten?“
„Ob sie wirklich Geheimagenten sind, das weiĂ ich nicht wirklich, wĂ€re aber gut möglich! Ăberleg mal, die vielen Sprachen die sie sprechen, sogar das Rotwelsche sprechen und verstehen sie, dass allein macht sie schon verdĂ€chtig!“
Dass Marcel ihn mit seinen ErzĂ€hlungen nur fĂŒr seine Zwecke um den Finger wickeln wollte, bemerkte Raoul nicht. Dazu fehlte es ihm wirklich im OberstĂŒbchen.
„Was versteht man unter der rotwelschen Sprache?“, fragte Raoul vor Neugierde. Denn, dass es um die Familie Wittich einen Mythos gab, faszinierte ihn. Allein der Gedanke, in einen Spionagefall verwickelt zu sein, reizte ihn sehr. War er doch bei der Wehrmacht nur ein kleines Licht, oder wie man sagt: SchĂŒtze Arsch! .
„Das ist eine sehr geheimnisvolle Sprache, die nur ganz wenige verstehen!“, betonte sein Kumpan extra leise. „Die Sprache ist im Mittelalter entstanden, und bedeutete soviel wie; die Sprache einer Rot (Rotte) mit einem unverstĂ€ndlichem Kauder(welsch)!“
„Aha!“ lĂ€sst sich Raoul nun ebenso leise vernehmen, denn er war inzwischen dem Gespann der Wittichs viel zu nahe gekommen. Diese sollten jedoch nicht bemerken, dass er mit jemandem sprach.
„ErzĂ€hle leise weiter, sodass nur ich dich hören kann, oder warte, ich lasse mich ein paar PferdelĂ€ngen zurĂŒckfallen, die Wittichs sind
Kommentare
Kommentar schreiben
| UteSchuster viel GlĂŒck - GLG Ute |
| Ernst Re: Re: Die Ăberarbeitung ist gut geworden. - Zitat: (Original von Ernst am 05.07.2011 - 12:04 Uhr) Zitat: (Original von Louisa am 05.07.2011 - 11:22 Uhr) Nun hast du Gott sei Dank einen Verlag gefunden. GlĂŒckwunsch lieber Ernst....na das freut mich, dass Georgy im Buch mitspielt ( Balduin) Das spielt nicht in Ungarn aber könnte sein....ne echt. PS: schau mal seite 14 stoisch ( R) vergessen. Es wird ja noch Lektoriert, gell Bin so froh, endlich klappt es. Toll lieber Freund.... Danke, liebst Gabriela. Ich schau mal gleich auf Seite 14 nach.. Bussi Ernst Lacht! Ich hab da kein R vergessen. Das heiĂt "stoisch" und nicht storisch! *lEumele |
| Ernst Re: Die Ăberarbeitung ist gut geworden. - Zitat: (Original von Louisa am 05.07.2011 - 11:22 Uhr) Nun hast du Gott sei Dank einen Verlag gefunden. GlĂŒckwunsch lieber Ernst....na das freut mich, dass Georgy im Buch mitspielt ( Balduin) Das spielt nicht in Ungarn aber könnte sein....ne echt. PS: schau mal seite 14 stoisch ( R) vergessen. Es wird ja noch Lektoriert, gell Bin so froh, endlich klappt es. Toll lieber Freund.... Danke, liebst Gabriela. Ich schau mal gleich auf Seite 14 nach.. Bussi Ernst |
| Gabriella Die Ăberarbeitung ist gut geworden. - Nun hast du Gott sei Dank einen Verlag gefunden. GlĂŒckwunsch lieber Ernst....na das freut mich, dass Georgy im Buch mitspielt ( Balduin) Das spielt nicht in Ungarn aber könnte sein....ne echt. PS: schau mal seite 14 stoisch ( R) vergessen. Es wird ja noch Lektoriert, gell Bin so froh, endlich klappt es. Toll lieber Freund.... |