Romane & Erzählungen
Die Farben des Dschungels - Der Pferdefuss im Paradies
REGISTRIEREN
LOGIN
0
"Die Farben des Dschungels - Der Pferdefuss im Paradies"
Veröffentlicht am 09. Dezember 2007, 36 Seiten
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Bummler und Beobachter zwischen den Welten und Kulturen. Ewig Reisender.../// mystorys edition 2007
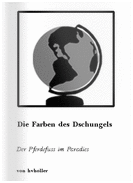
Die Farben des Dschungels - Der Pferdefuss im Paradies
Beschreibung
Abseits der bekannten Welt lebt ein Mensch nach eigenen Regeln und den Naturgesetzen
Die Farben des Dschungels
Hans Volker Holler
Wir warteten auf den Regen. Seit Tagen schon. Wäre ein Barometer zur Hand gewesen hätten wir feststellen können, daß es seit den frühen Morgenstunden rapide gefallen war. Wir fühlten uns wie von einem Vakuum umgeben, wie in einem luftleeren Raum.
Wir, das sind die drei Männer die am Ufer des Augarico standen und in die Wasser des Flusses starrten. Um uns herum der dichte Dschungel, wie überall hier im Nordosten Ekuadors, dem Oriente, wie das Land jenseits der Anden auch genannt wird.
Jose Rojas hielt seine Hand in die rotbraunen Fluten und zog sie dann langsam wieder heraus. Die warme Luft, einem Fön ähnlich trocknete sie in wenigen Augenblicken.
„Das kann böse werden“ sagte und wandte sich, die fünf Finger ausgestreckt haltend, an Jaime Pereira, den Eigentümer einer weiter flußabwärts liegenden Hazienda. Jaime betrachtete ohne großes Interesse die Hand seines Vorarbeiters. Eine dünne gelbe Schicht hatte sich, einem Handschuh gleich, bis hin zum Gelenk aufgelegt.
„Lehm“, meinte Pereira, „der kommt von ganz oben.“ Dabei wandte er seinen Kopf in westliche Richtung, wo sich in der Ferne das Massiv der Kordilleren erstreckte. Zwar konnten wir es trotz des unverhältnismäßig klaren Tages nicht sehen, so aber doch erahnen.
„Das sieht verdammtnochmal nach Hochwasser aus, Hans.“ Pereira sah mich dabei an.
„Mit dem Viehtrieb wird dann wohl in den nächsten Tagen nichts. Wir müssen abwarten, bis sich der Wasserspiegel senkt.“
Er macht eine kleine Pause und wandte den Blick von mir ab. Leise sagte er mehr zu sich selbst:
„Ich habe keine Lust durch übertriebene Eile Tiere zu verlieren. Selbst eins wäre mir noch zuviel.“
„Ich kann dich gut verstehen Pereira“, antwortete ich „aber wenn du die Rinder noch in diesem Jahr auf deine Weiden bringen willst, wird die Zeit verdammt knapp. Wenn es erst hier zu regnen beginnt dauert es mindestens vier Monate, bis du einen neuen Trieb machen kannst, wenn nicht gar sechs.“
Pereiras sehnig-schlanke Figur straffte sich. Er schien nachzudenken. Bevor er etwas sagen konnte, fiel ihm sein Vorarbeiter ins Wort.
„Wir könnten warten, bis das Wasser nicht mehr so reißend ist. Dann wäre es sicher zu schaffen. Aber im Moment ist diesbezüglich gar nichts zu machen. Warten wir doch ein paar Tage bis der Regen in den Bergen aufgehört hat, dann sehen wir weiter.“
„Jose hat recht“, meinte der wohl zu einem Entschluß gekommene Haziendabesitzer, „wir warten ab. Eine Woche. Oder gegebenenfalls etwas länger. Der Regen hat dann bei uns wohl noch nicht eingesetzt aber der Fluß hat sich etwas beruhigt, so daß keine Gefahr beim Übertrieb besteht. Die Breite spielt dabei ja keine Rolle, es geht uns ja in erster Linie um die Strömung.“
Rojas nickte beifällig, als er die Worte seines Bosses hörte.
Ich ergriff eine Zigarette, die mir der hagere Mann aus einer zerknitterten Packung anbot.
„Ja dann, Pereira, laß von Dir hören, wenn Du mich mit dem Boot brauchst. Ich werde dann zur Stelle sein.“
Das war alles, was ich zu dieser Angelegenheit noch sagen konnte. Leid hat es mir schon getan, weil ich das Geld zu diesem Zeitpunkt gut hätte brauchen können.
„Kommt mit“, lud ich die beiden ein, „ich hab noch ein Fläschchen Cristal da. Wir werden erst mal einen nehmen, jetzt, wo es doch nichts zu erledigen gibt.“
Die Männer lächelten und stiegen mit mir den Uferkamm hinauf. Zwanzig Meter weiter auf einer Lichtung bewohnte ich eine Bambushütte. Unter einem kleinen Dach aus Palmwedeln hatte ich mir neben der Hütte die Feuerstelle gebaut. Dort war auch ein Tisch mit vier selbst gezimmerten Bänken. Sie setzten sich. Ich verschwand kurz in meiner Hütte und kehrte mit der Flasche zu meinen Gästen zurück. Von einem ungehobelten Brett, das mir als Ablage diente, nahm ich drei leidlich saubere Gläser, die ich in einen mit Wasser gefüllten Eimer tauchte. Mit einem Schlenker des Handgelenks schüttelte ich die hängen gebliebenen Wassertropfen auf den Lehmboden. Daß vormals Senf oder Marmelade in den Gefäßen war, störte niemanden.
„Uups, das ist der Hochprozentige“, ließ Rojas vernehmen und drehte dabei die Flasche in der Hand. Wo hast du den denn her?“
„Schmuggelware. Der kommt von drüben.“ Dabei zeigte ich mit dem Kinn in nördliche Richtung. Beide wußten, daß ich damit Kolumbien meinte.
Einmal im Monat, manchmal auch zwei mal, kamen Männer und Frauen hier vorbei. Auf ihrem Weg ins grenznahe Lago Agrio schleppten sie Kisten und Säcke mit sich.
Es hatte sich so ergeben, daß sie eine Nacht unter dem Palmdach verbrachten, bevor sie am frühen Morgen in das ekuadorianische Kleinstädtchen aufbrachen. An den späten Nachmittagen oder frühen Abenden luden sie mich zu verschiedenen Drinks ein, brieten mitgebrachtes Fleisch oder die Frauen bereiteten Trockenfisch zu. Nach dem Essen tranken wir und immer spielte irgend jemand auf der Gitarre schwermütige Liebeslieder. Jedes mal hatten sie andere Waren dabei. Mal war es Whisky, mal Rum oder Wodka. Letzte Woche hatten sie diesen hochprozebtigen Schnaps aus kolumbianischer Produktion dabei.
Ich hütete mich zu fragen, was sie sonst noch in ihren Kisten und Säcken mit sich führten. Dieses Desinteresse und meine Bereitschaft, sie unter dem Palmdach schlafen zu lassen, honorierten sie regelmäßig mit einer Flasche aus ihren Beständen. Mir sollte es recht sein.
Nachdem ich unsere Gläser zwei Finger breit gefüllt hatte, prostete ich meinen Gästen zu. Wir berochen kurz das Getränk, bevor wir es in die Kehlen kippten. Nach einem kurzen Brennen das uns Tränen in die Augen trieb, machte sich wohlige Wärme im Innern breit.
Pereira schob das leere Glas in meine Richtung und sagte grinsend:
„Und jetzt noch einen darauf, daß es bald regnet.“
Zustimmend goß ich nochmals ein.
Ein Schreck durchzuckte mich, als plötzlich aus dem Nichts ein dunkler Schatten in unsere Runde schoß -direkt zwischen Pereiras Beine.
„Hallo Perro, wo kommst du denn her? Bist du etwa den ganzen Weg hierher gelaufen um bei deinem Herrchen zu sein? Du bist mir ja einer.“
Pereira streichelte den kleinen Hund der so unvermittelt aufgetaucht war und mir einen gehörigen Schrecken versetzt hatte. Mit hängender Zunge und hechelnd lag er nun unter dem Tisch zwischen Pereiras Füßen.
„Schlimmer als eine Frau, die Töle“, bemerkte er liebevoll, „ich kann einen Schritt machen, ohne daß er hinter mir her ist.
Er lachte rauh und streichelte das Tier. Es war nicht zu übersehen, daß der Hund das gern hatte. Auch Rojas redete nun spielerisch auf ihn ein. Perro schien die um ihn gemachte Aufregung zu genießen.
Hinter dem linken Ohrlappen des rasselosen Tieres bemerkte ich ein offenes, eiterndes Geschwür. Ich dachte daran, daß einer seiner Vorfahren wohl ein Cockerspaniel gewesen sein mußte.
Mittlerweile hatte Perro sich beruhigt und die großen Ohren lagen wie vergessene Paddel auf dem festgestampften Lehmboden.
„Trinken wir auf die Frauen“, schlug Jose vor und wollte sein Glas an den Mund führen. Pereira schien jedoch nicht ganz einverstanden.
„Auf unsere Hunde und deren Treue“, meinte der.
Wir lachten alle drei und kippten mit zusammen gekniffenen Augen den Drink.
Die Flasche war halb leer, als sich die beiden Männer von mir verabschiedeten. Als sie mit dem Hund über den schmalen Pfad unter den Bananenstauden verschwanden, sah ich ihnen hinterher und goß mir noch einen Drink ein.
Ich war wieder alleine.
Seit einem Jahr nun lebte ich schon hier inmitten des Dschungels und kultivierte die Pflanzen, die ich zum Leben brauchte. Mir machte dieses freie, unabhängige Dasein Spass. Keinerlei Verantwortung bedrückte mich, niemand machte mir Vorschriften.
Ich stand morgens auf, wann es mir paßte und legte mich in die Hängematte, wenn ich müde war. Hatte ich Lust, besoff ich mich und blieb den ganzen Tag über in meiner Schlafstelle. Ich laß Nietzsches „Zarathustra“ oder blätterte in einer alten, schon schimmeligen Ausgabe des Magazins „Playboy“.
Vor einem halben Jahr wurde es mir dann aber doch zu eintönig und ich kaufte von meinem letzten Bargeld einen Außenbordmotor, den ich an dem Aluminiumboot befestigte, das ich während der letzten Trockenzeit gefunden hatte. Es war eingegraben in einer Sandbank, nur ein Teil des Hecks ragte noch heraus. Wie lange es schon dort gelegen haben mag, weiß ich nicht. Mit einem Hammer und viel Teer brachte ich es wieder in Schuß. In den vier Monaten, in denen es vor meinen Hütten auf dem Fluß lag, reklamierte es niemand als sein Eigentum. Damit war es nun mein!
Mit dem motorisierten Gleiter zählte ich aber auch mit einem Schlage zu einem der begehrtesten Männer dieser Gegend.
Ich übernahm Fährdienste, die mir Bares einbrachten. Manchmal auch Naturalien wie ein Huhn, Trockenfleisch oder Ähnliches. Der Kontakt als Europäer zu diesen einfachen, liebenswerten Menschen der Region bereitete mir viel Freude.
Manchmal erhielt ich auch Aufträge wie diesen von Pereira.
Der hatte eine größere Zahl von Rindern in Shushufindi, einem Ort auf der anderen Flußseite, gekauft und mußte diese Tiere nun zu seinen Weideplätzen bringen. Bei den herkömmlichen Viehtrieben kam es oft vor, daß eines oder auch mehrere der Rinder ertranken. Kein geringer Verlust für einen Siedler, der meißt noch bei seiner Bank in Lago Agrio verschuldet ist.
Mit Pereira bin ich übereingekommen, das Boot einzusetzen.
Rechts und links von dem Aluminiumgleiter würden wir die Tiere paarweise an kurzen Stricken mit den Köpfen über Wasser halten. So würde keines verloren gehen. Für die sechzehn Rinder hatte mir der Mann fünfzig Dollar versprochen, in amerikanischer Währung. Dazu Frühstück und das Mittagessen. Ein guter Lohn, hier am Ende der Welt.
Doch das Wetter machte mir nun einen Strich durch die Rechnung.
Es regnete in den Anden. Aus den kleinen Rinnsalen in den Kordilleren werden reißende Bäche, die am Rande des Tieflandes in die größeren Ströme fließen. Aus den Bergen kommt lehmiges, gelbbraunes Wasser. Wenn sich das nun mit der dünnen Humusschicht unserer Gegend vermischt, wird es ganz einfach nur dreckig.
Aber hier bei uns im Tiefland hat es lange nicht geregnet. Nicht so, wie man es in den Tropen gewohnt ist. Aber in den Bergen schüttete es schon seit Tagen. In den frühen Morgenstunden kann man die Gewitterwolken sehen, die sich vor dem Andenmassiv aufgetürmt haben. Und dieser Regen ist für unsere Region schlimmer, als der schlimmste tropische Wolkenbruch.
Der Fluß ist breiter geworden und reißender. Die Erde, über die ich lief, gab unter meinen Füßen nach, war vollgesogen mit Feuchtigkeit. Die Geräusche unter meinen Sohlen erinnerten mich an Moor.
Um auf andere Gedanken zu kommen entschloß ich mich, zum angeln zu gehen. Nur fünfhundert Meter von meiner Hütte weg war eine Lagune. Ich mochte diesen kleinen See. Umrahmt von überhängendem Gebüsch hatte er etwas märchenhaftes. Doch wußten alle der hiesigen Siedler, daß im See Piranas waren. Doch war das nicht der Pirana, den ich aus Büchern kannte, nicht der fast runde, bunt schillernde Fisch mit den scharfen Zähnen. Hier war eine andere Art beheimatet: länglich wie ein Hering, oliv-schwarz, extrem offensiv. Um sie zu angeln, ist nur ein kleiner Köder nötig. Ein paar Tropfen Blut wittern sie noch über viele hundert Meter. Schon das Geräusch alleine, das man mit der Machete verursacht wenn man sie mit der Breitseite auf das Wasser aufschlägt, genügt um sie anzulocken.
Ich kam mit der Angelschnur aus der Hütte. Es war eine Plastikschnur von der Dicke einer Wäscheleine, aufgewickelt auf ein Stück Hartholz. Der Haken war aus Stahl und zur Verstärkung hatte ich durch die Öse noch sechs Zentimeter Stahldraht dreifach gezogen, bevor ich die durchsichtige Schnur eben an diesem Draht befestigte. Schon des öfteren hatten mir die scharfen Zähne dieser Piraniaart die Schnur durchbissen und meinen Haken auf nimmer Wiedersehen verschwinden lassen. Das sollte mir nicht wieder passieren. Auch wenn man diese Fische am Haken hat muß man aufpassen. Sie schnappen selbst noch, wenn sie an Land gebracht wurden und können auch dort noch bis zu vier Stunden überleben. Will man sie nach dem anlanden packen, schlagen sie plötzlich mit ihrem Körper als wäre es das Leder einer Peitsche. Sie sind in der Lage mit gezieltem Schnappen einen Finger oder einen Zeh abzutrennen; so sauber wie es ein Chirurg mit einem scharfen Skalpell nicht besser schafft.
Mit dem Boot konnte ich den See nicht erreichen. Er war umgeben von einem natürlichen Erdwall aus Holz, Laub, Schlamm und Erdreich. Etwas unterhalb floß das kleine Flüßchen, welches auch hinter meiner Hütte verlief und ein paar hundert Meter weiter in den Aguarico mündet. Nur während der Hauptregenzeit, die nie länger als drei Monate dauert, schwillt das Bächlein so an, daß es mir Mühe bereitet, es watend oder schwimmend zu überqueren.
Ich stand auf dem Wall der das stille Gewässer von dem Flüßchen trennte und genoß die Ruhe, die meine Umgebung ausstrahlte. Ich träumte von einem verwunschenen Teich und dachte dabei an die Prinzessin, die von dem Prinzen wachgeküsst wurde. Oder war ich im falschen Märchen?
Ich verscheuchte die sentimentalen Gedanken und nahm vorsichtig die Schnur mit dem spitzen Haken aus der Brusttasche meines Hemdes, darauf bedacht, mich nicht zu verletzen. In der Hosentasche hatte ich, eingeschlagen in ein grünes Blatt, drei fette Maden. Die hatte ich mit der Machete hinter einer Baumrinde herausgekratzt. Nachdem der Köder auf das Metall des Hakens aufgezogen war, stieg ich zum See hinunter. Mit dem Buschmesser schlug ich klatschend auf das ruhige Wasser und wartete. Als ich die dunklen Schatten der Fischleiber unter der Oberfläche sah, warf ich in hohem Bogen die Schnur aus. Gerade in dem Moment, als die Angelschnur auf die Wasseroberfläche pitschte, vernahm ich in der Ferne das dumpfe Donnern eines sich nahenden Unwetters. Dann ging ein Ruck durch die Schnur und das Nylon straffte sich. Gleichmäßig, mit sanftem Gegendruck, zog ich die Leine an mich heran; nicht zu langsam aber auch nicht zu schnell. Dann sah ich den oliv-schwarzen und auf der Unterseite silbrig glänzenden und sich windenden Fischleib.
„Ich hab dich. Du kommst in die Pfanne“, dachte ich, als ich den Piranha an Land zog. Mit der breitseite der Machete drückte ich den Fisch auf den Waldboden. Mit der freien Hand zog ich das schmale Finnmesser aus dem Bund der Jeans und mit einem tiefen Schnitt hinter dem Kopf des Fisches sicherte ich mir ein schmackhaftes Abendessen. Die beiden überflüssigen Köder warf ich ins Wasser. Beim Weggehen sah ich noch, wie viele Mäuler danach schnappten und wie sich die Wasserringe am Ufersaum brachen. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Von einem Busch schlug ich einen dünnen Zweig, befreite ihn von den Blättern und kleinem Geäst. Dieses Stöckchen zog ich durchs Maul des Fisches vorbei an drei Reihen messerscharfer Zähne, bis es durch die durchschnittene Stelle des Hinterkopfes wieder zum Vorschein kam. So trug ich meine Beute nach Hause.
Obwohl es noch nicht geregnet hatte spürte ich, wie sich die Dschungelerde langsam mit Wasser voll saugte. Die Luftfeuchtigkeit erhöhte sich von Stunde zu Stunde.
Jose Rojas schien recht zu behalten mit seiner Voraussage, daß es bös werden könne, wie er sich ausdrückte.
Über dem offenen Feuer unter dem Palmdach briet ich in der schnell zunehmenden Dunkelheit des frühen Abends den Piranha. Erst hatte ich ihn entschuppt und dann ausgenommen. Als Beilage genehmigte ich mir frittierte Platanos -das sind noch grüne Kochbananen, sowie eine in Salzwasser gekochte Manjokwurzel.
Zum Nachtisch schenkte ich mir noch drei Finger breit von dem Gebrannten ein, den die Schmuggler dagelassen hatten.
In der Hängematte stellte ich mir dann die allabendliche Frage: Hietzsche oder Hefner?
Ich entschied mich für das ramponierte Herrenmagazin das schon über drei Jahre alt war. Die Mädchen auf den speckigen Seiten waren aber noch genau so hübsch wie am Erscheinungstag, der melancholische Friedrich dagegen schon seit vielen Jahren tot!
Dicke Tropfen fielen aus graublauen Gewitterwolken. Sie kamen von Osten und hatten sich über der grünen Welt Amazoniens irgendwo formiert. Sie leiteten die Regenzeit im Oriente ein. Von Westen, dem Fuße der Anden her, drängten schwere, schlammige Wassermassen nach Osten, hin zu einem über viertausend Kilometer entfernten Ozean. Wie ein nimmersatter Schwamm saugte sich die Erde voll mit der lehmigen Feuchtigkeit.
Die Farbe des Dschungels veränderte sich mit dem ersten schweren Regenguß. Das blasse Grün der Pflanzenblätter wurde dunkel und satt. Vielfarbige Blüten öffneten sich an Büschen und Sträuchern, deren Namen ich nicht kenne und viele auch noch namenlos sind. Ein herrliches Kaleidoskop kam zum Vorschein, das nur ganz kurz zu Beginn einer jeden Regenzeit zu beobachten ist.
Während der täglichen Sonnenstunden ging ich vor meine Hütte, um mir die Veränderungen zu betrachten. Jedesmal bot sich mir ein neues, reizvolles Bild. Aber auch der Geruch des Dschungels hatte sich verändert. Die Erde schien zu atmen und auszudünsten. Dieser Atem roch modrig und faulig. Andererseits jedoch schien der Urwald neues Leben auszuhauchen. Aus den fetten, weisen Maden unter den Baumrinden wurden bunte Schmetterlinge, mache größer noch als kleine Vögel. Aus den Erdlöchern schlängelten sich die Vipern und Nattern, um sich vor dem drohenden Ertrinken zu retten. Andererseits aber wurden auch die Fliegen und Stechmücken zur Plage für Mensch und Tier.
In der Herdstelle entzündete ich ein kleines Feuer auf das ich feuchtes Holz legte um die Rauchentwicklung zu unterstützen, die mir die kleinen Quälgeister einigermaßen vom Leibe hielt. Des nachts spannte ich über der Hängematte das Moskitonetz aus, das ich während der Trockenzeit nicht benutzt hatte.
Während der Vormittage regnete es vier Stunden und am Nachmittag derer zwei. Nachts eigentlich ohne nennenswerte Unterbrechung. Die Fluten des Acuarico schwollen an, das Wasser jedoch wurde klarer mit jedem Tag. Ein Zeichen dafür, daß es in den Bergen aufgehört hatte zu regnen. Jetzt brauchten wir nur noch auf den Rückstau zu warten, dann konnten wir mit dem Übertrieb beginnen.
Der Rückstau ist ein Phänomen das sich einstellt, wenn die Wassermassen den Abfluß durch die Flußläufe nicht mehr schaffen. Dazu muß man sich vorstellen, daß die Wasser auf einer Länge von siebentausend Kilometern lediglich ein Gefälle von vierhundert Metern haben. Weiter im Osten, in den Ebenen Brasiliens, heißt es während dieser Zeit: Land unter! Die Wasser stauen sich zurück und die Strömungen verlieren ihre Schrecken, weil die Wassermassen sich nur noch träge dem Atlantik zu wälzen.
Eine Woche noch, so schätzte ich, dann würde sich der Fluß beruhigt haben. Dann würde er auf der mir gegenüber liegenden Seite über das Ufer treten und sich fast strömungslos und still verhalten. Nicht ganz unähnlich einem Raubtier, das auf seine Beute lauert.
Unter meinen Füßen spürte und hörte ich die Feuchtigkeit mehr denn je. An der Stelle wo meine Hütte stand, brauchte ich mir über Wasserschäden keine Gedanken zu machen. Das Stück Land, das ich bewohnte lag zwar zwischen dem kleinen, namenlosen Flüßchen - in der Trockenzeit eigentlich nur ein Rinnsal - und dem Acuarico, war aber etwas höher gelegen als das gegenüber liegende Ufer. Das Wasser würde sich dann dort verlaufen. Für den Moment blieb mir nichts anderes übrig, als zu warten, auf daß sich der Strom beruhigte. Das würde, wie schon gesagt, wohl noch eine Woche dauern.
Die Zeit zwischen den Güssen wollte ich mir mit angeln vertreiben. Es blieb jedoch nur bei einem Versuch. Das Wasser in der Lagune war gestiegen. Der Erdwall, der das Ufer säumte, war durchnäßt und selbst auf dem höchsten Punkt morastig. Bis zu den Knöcheln versank ich in dem nachgebenden Erdreich. Auf dem Kamm der Böschung hatte ich Mühe nicht auf dem schmierigen Grund auszurutschen und in den See zu schlittern. Bei dem Gedanken daran überzog es mich mit einer Gänsehaut. In diesem Moment hatte der See seinen märchenhaften Reiz für mich verloren. Er erschien mir nun wie eine vage, nicht zu bestimmende Bedrohung. War es die Ruhe, die über dem Wasser lag?
Nach mehrmaligen Versuchen, die gefräßigen Räuber anzulocken, gab ich auf. Wo mochten die Piranhas sein? Nach einem Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche stieg ich vorsichtig zurück auf den Wall. Fast wäre mir entgangen daß sich das klare Wasser des Sees durch die lockere Erde drängte und sich mit der dunklen Brühe des Flüßchens vermischte. Meiner Beobachtung maß ich zu diesem Zeitpunkt aber noch keinerlei Bedeutung bei. Als die ersten schweren Regentropfen zu fallen begannen beeilte ich mich, mein schützendes Palmdach zu erreichen.
Acht Tage nach unserem letzten Treffen erschien Jaime Pereira erneut mit seinem Vorarbeiter bei mir.
„Morgen Vormittag machen wir den Übertrieb“, bemerkte der Haziendabesitzer nach einer kurzen Begrüßung, „das Wasser hat sich beruhigt und der Fluß ist fast ohne Strömung.“
Er hatte recht. Der Rückstau der gewaltigen Wassermassen hatte bereits eingesetzt und dem Strom jegliche Gefahr genommen. An träge vorbei treibenden entwurzelten Bäumen konnte man die Geschwindigkeit der Strömung sehr gut abschätzen. Zwar war der Fluß nun wesentlich breiter als während der Trockenzeit aber beim Übersetzen der Rinder mit dem Motorboot hatten wir mit keinerlei Schwierigkeiten zu rechnen.
„Morgen früh dann“, sagte ich und holte die Flasche mit dem Rest des hochprozentigen „Cristal“ hervor. Ein Lächeln huschte über die Gesichter der beiden Männer als ich die Drinks eingoß. Jaimes Hund, der treue Mischling, beobachtete uns schwanzwedelnd. Das eitrige Geschwür an seinem Ohrlappen war verschwunden. Zurückgeblieben war lediglich eine oberflächliche Wunde die scheinbar schlecht verheilte und leicht schmierig blutete. Ab und zu kratzte das Tier mit der Pfote darüber um die Fliegen zu verscheuchen, die wohl einen unangenehmen Juckreiz verursachten.
Nach zwei schnell gekippten Schnäpsen verließen mich die beiden Männer wieder. Während sie über den Pfad durch die Bananenplantage schritten, tollte der Hund zwischen ihnen und animierte zum Spiel.
Wir wollten eine Furt benutzen, die sich auch schon bei vorausgegangenen Übertrieben als sicher erwiesen hatte. Dort war der Fluß nicht so breit. Immerhin waren es, bedingt durch das Hochwasser, doch noch etwa hundertzwanzig Meter. Jose kam mit zwei Hilfskräften von Pereiras Hazienda zu Fuß. Jaime selbst war zu Pferde, barfuß mit Stoffhose und hellblauem Hemd, das er über dem Bauchnabel zusammengeknotet hatte.Sie hatten die Rinder vier Stunden in strömendem Regen getrieben bis sie zu der Stelle gelangten, wo ich sie mit dem Boot erwartete. Der Himmel riß kurz auf und die tropische Sonne lachte an diesem frühen Mittag durch eine Schneise dunkler, schwerer Kumuluswolken.
Nach einer wohl verdienten Zigarettenpause stiegen die beiden Hilfskräfte zu mir in den Gleiter. Ihre Aufgabe war es, links und rechts vom Boot jeweils ein Rind an einem kurzen Seil mit dem Kopf über dem Wasser zu halten.
Normalerweise schwimmen die Tiere problemlos auch größere Strecken. Dabei treiben aber immer wieder einige der wertvollen Rinder ab und erzeugen Panik beim Rest der Herde. Ist einmal Wasser in die Lunge einer Kuh gedrungen öffnet sich automatisch auch der After des Tieres. Deshalb sagt man auch: Die ersaufen von vorne und von hinten!
Pereira wollte einen Verlust auf jeden Fall vermeiden.
Mit sanfter Gewalt schoben und zogen wir die ersten beiden verängstigten Rinder in die jeweilige Position links und rechts neben das Boot. Auf das Zeichen der beiden Gehilfen, daß sie die Stricke am Boot festgemacht hatten und auch sicher in Händen hielten, startete ich den Motor und fuhr langsam vom Ufer ab. Als die Tiere keinen Grund mehr unter ihren Hufen spürten, begannen sie automatisch mit kräftigen Schwimmbewegungen. Sie verloren die anfängliche Scheu und starrten mit weit aufgerissenen typischen Kuhaugen auf das andere Ufer. Einer der Arbeiter blieb bei den beiden übergesetzten Rindern und Rojas stieg nun zu uns. Wir drei setzten wir dann die restlichen vierzehn Tiere über. Alles verlief ohne Probleme.
Pereira, im Sattel auf seinem Braunen sitzend, hatte die ganze Aktion zufrieden beobachtet und konnte nun sehen, wie seine Tiere anfingen, auf der anderen Uferseite zu grasen oder von den dort wachsenden Büschen zu fressen. Sein Hund lag neben dem Pferd auf der Erde und beleckte ab und zu die kleine Wunde an seinem Schlappohr.
Wir beobachteten wie Jaime seinem Pferd einen Klaps gab und es so in den Fluß trieb. Unterdessen lief der Hund winselnd am Flußrand auf und ab. Pereira drehte sich in seinem Sattel um und rief ihm zu:
„Na komm, Perro! Komm, schwimm mir nach!“
Der Bastard schien unentschlossen, schnüffelte aufgeregt am Uferrand, blickte noch einmal seinem Herrchen nach und sprang dann doch endlich ins Wasser.
Vom gegenüber liegenden Ufer betrachteten wir ohne sonderliches Interesse das Geschehen.
Pereira hatte die Flußmitte erreicht. Der Hund war vielleicht zwanzig Meter hinter ihm als der urplötzlich in ein herzzerreißendes Jaueln ausbrach. Wir sahen den Kopf des Hundes noch als wieder ein hohes Schreien zu hören war, ähnlich dem Kreischen eines kleinen Kindes. Das Wasser um den kleinen Körper herum schien zu brodeln. Wir hatten unseren Blick noch nicht abgewandt als uns Pereiras Schrei am Ufer erreichte und sich in der Tiefe des Dschungels brach.
„Piranhas!“
Vögel, die bis dahin in den Wipfel der hohen Bäume saßen, flogen auf, als hätten sie das Wort verstanden und wollten sich in Sicherheit bringen.
Ihr aufgeregtes Kreischen übermalten die folgenden Szenen wie grausige Musik.
Noch einmal tönte es uns in den Ohren: „Hier sind Piranhas!“
Das Wasser um den Gaul kam in Bewegung. Neben dem Sieden und Brodeln kam nun noch ein anderes Geräusch. Es erinnerte mich an das hohe, unheilvolle Summen das man unter Hochspannungsleitungen vernimmt. Nur die gab es hier im Umkreis von vierhundert Kilometern nicht.
Umgeben von dem Kreischen der Vögel, von diesem Kochen und Zischen im Wasser und Pereiras Schreien, begann der Braune zu scheuen.
Der Haziendabesitzer hatte die Zügel losgelassen und hielt sich am Sattelhorn fest. Das Wasser machte das Pferd träge, so daß der Mann keine Angst haben mußte, aus dem Reitsitz katapultiert zu werden. Es fehlten vielleicht noch fünfzig Meter bis zum rettenden Ufer als das Pferd anfing anhaltend zu wiehern. Wie das Pfeifen einer alten Dampflok hörten sich die Todesschreie an, die uns das Blut in den Adern gefrieren ließen. Jetzt begann auch Pereira wieder zu uns herüber zu rufen. Zwar konnten wir die Worte nicht verstehen, doch sie weckten uns aus dem einem Schock ähnlichen Zustand auf.
„Das Boot“ schrie mich Jose an, „fahr ihm mit dem Boot entgegen. Hilf ihm!“ Unsanft drängte mich Rojas zu dem vor uns dümpelnden Gleiter.
Dann war Ruhe. Wenn man von diesem Summen absah. Das Pferd hatte zu schreien aufgehört.
Als ich die an einem Baumstumpf befestigte Leine des Bootes löste sah ich aus den Augenwinkeln, wie sich das tote Pferd auf die Seite legte. Pereira stellte sich mit beiden Beinen auf den Bauch des Tieres. Noch zwanzig Meter trennten uns. Rojas und ich sprangen in das Boot, stießen uns ab und ich startete den Motor.
„Scheiße“, hörten wir Pereira fluchen und sahen zu, wie er mit einem gewaltigen Satz vom Kadaver seines Braunen federte. Der Sprung brachte ihn drei Rettung verheißende Meter näher zum flachen Ufer. Klatschend kam er im Wasser auf, tauchte kurz unter um dann mit kräftigen Schwimmbewegungen zu beginnen. Wir hörten seinen gurgelnden, erstickten Schrei, kurz bevor sein Körper wieder unter der Wasseroberfläche verschwand um dann endlich gegen den Ufersaum zu stoßen. Rojas und ich hatten mit laufendem Motor einen kleinen Bogen auf dem Wasser beschrieben und fuhren nun im zickzack durch das aufgewühlte Wasser um mit der Schraube des Außenborders den Schwarm der gefräßigen Bestien von Pereira abzuhalten.
Mit dem Gesicht nach unten, die Füße noch im Wasser, lag der Mann am Ufer. Beide Hände hatten sich in das nasse Erdreich vergraben. So, als hätte er noch versucht, darin einen Halt zu finden. So zogen ihn die beiden Arbeiter einen Augenblick später an Land. Den Leblosen unter den Achseln packend, zogen sie ihn auf das feuchte Dschungelgras, das den Uferrandbewuchs bildete.
Zuckungen gingen durch den Körper des Mannes, als wir anlegten. Jose sprang aus dem Boot und stürzte auf seinen Boss zu. Er rüttelte an seiner Schulter und klopfte ihm mit der flachen Hand auf den Rücken, wie man es bei einem kleinen Kind tut, das sich verschluckt hat. Der Vorarbeiter drehte seinen Chef um und blickte in starre, angstgeweitete Augen.
Jaime Pereira war tot. Daran gab es keine Zweifel. Auch dann nicht, als sich sein Brustkorb unter dem halb offenen Hemd unregelmäßig hob und senkte.
Ich schaute genau in dem Moment in die Gesichter der Männer, als alles Blut aus ihren Gesichtern wich. Ich sah ihren Blick auf die Stelle von Pereiras Körper gerichtet, wo sich beim Menschen das solar plexus befindet. Dort, eine handbreit über dem Bauchnabel, genau zwischen den beiden Rippenknochen, sah man ein Loch.
Es blutete kaum, war fast kreisrund und von der Größe der Öffnung eines Wasserglases. Aus diesem Loch hörte man Geräusche!
Schmatzende, gefräßige Geräusche. Soweit es uns möglich war konnten wir erkennen, daß es sich im Innern des Thorax mindestens vier der nicht ganz heringgroßen Piranhas an den Eingeweiden Pereiras gütlich taten.
Diese ununterbrochenen Schmatzgeräusche ließen unsere Mägen rebellieren.
Als erster wandte sich einer der Arbeiter ab und übergab sich auf dem Gras.
Ein paar Augenblicke später kotzten wir alle.
Immer dann, wenn ich, als ob ich es nicht glauben könnte, zu dem Toten hinsah, überkam mich ein neues Übelkeitsgefühl. Den drei anderen schien es nicht besser zu ergehen.
„Im Fluß gibt es keine Piranhas! In diesem Fluß hat es noch nie Phiranhas gegeben“, sagte Jose leise und mehr zu sich selbst.
Die beiden Arbeiter schüttelten die Köpfe und einer meinte:
„In den Flüssen hier, so nahe bei den Bergen, hat es noch nie Piranhas gegeben. Dabei schüttelte er immer und immer wieder seinen Kopf und sah auf den Leichnam seines Bosses. Unvermittelt drehte er sich ab und übergab sich erneut.
Wir blickten alle vier auf den Strom, der gar nicht flußähnlich, sondern trügerisch ruhig vor uns lag. Das summende Geräusch war verschwunden. Auch der abtreibende Kadaver des Pferdes war nicht mehr in unserem Blickfeld. Von Osten schoben sich wieder schwarze Gewitterwolken vor die Sonne und es begann zu dunkeln, obwohl es noch früher Nachmittag war.
Mir war kalt.
„Bringen wir ihn zu seiner Frau“, meinte Jose weinend. Er machte sich daran, die immer noch schmatzenden Fische aus dem Körper herauszuholen.
Während die beiden Arbeiter sich daran machten die Rinder zusammenzutreiben, um sie über einen Dschungelpfad zu Pereiras Anwesen zu bringen, betteten Jose und ich den Toten im Boot und brachten ihn übers Wasser zu seinem Haus.
Vor ein paar Tagen badeten noch die Kinder im Fluß, die jungen Mädchen und Frauen wuschen die Wäsche darin. Dabei baumelten die Füße und Unterschenkel im Wasser. Die jungen Männer veranstalteten Wettkämpfe wer als erster das andere Ufer erreichte. Selbst meine allabendlichen Bäder fielen mir wieder ein.
„Nein“, sagte ich so leise, daß Jose es nicht hören konnte, „im Fluß hat es nie Piranhas gegeben.“
Hans Volker Holler
Wir warteten auf den Regen. Seit Tagen schon. Wäre ein Barometer zur Hand gewesen hätten wir feststellen können, daß es seit den frühen Morgenstunden rapide gefallen war. Wir fühlten uns wie von einem Vakuum umgeben, wie in einem luftleeren Raum.
Wir, das sind die drei Männer die am Ufer des Augarico standen und in die Wasser des Flusses starrten. Um uns herum der dichte Dschungel, wie überall hier im Nordosten Ekuadors, dem Oriente, wie das Land jenseits der Anden auch genannt wird.
Jose Rojas hielt seine Hand in die rotbraunen Fluten und zog sie dann langsam wieder heraus. Die warme Luft, einem Fön ähnlich trocknete sie in wenigen Augenblicken.
„Das kann böse werden“ sagte und wandte sich, die fünf Finger ausgestreckt haltend, an Jaime Pereira, den Eigentümer einer weiter flußabwärts liegenden Hazienda. Jaime betrachtete ohne großes Interesse die Hand seines Vorarbeiters. Eine dünne gelbe Schicht hatte sich, einem Handschuh gleich, bis hin zum Gelenk aufgelegt.
„Lehm“, meinte Pereira, „der kommt von ganz oben.“ Dabei wandte er seinen Kopf in westliche Richtung, wo sich in der Ferne das Massiv der Kordilleren erstreckte. Zwar konnten wir es trotz des unverhältnismäßig klaren Tages nicht sehen, so aber doch erahnen.
„Das sieht verdammtnochmal nach Hochwasser aus, Hans.“ Pereira sah mich dabei an.
„Mit dem Viehtrieb wird dann wohl in den nächsten Tagen nichts. Wir müssen abwarten, bis sich der Wasserspiegel senkt.“
Er macht eine kleine Pause und wandte den Blick von mir ab. Leise sagte er mehr zu sich selbst:
„Ich habe keine Lust durch übertriebene Eile Tiere zu verlieren. Selbst eins wäre mir noch zuviel.“
„Ich kann dich gut verstehen Pereira“, antwortete ich „aber wenn du die Rinder noch in diesem Jahr auf deine Weiden bringen willst, wird die Zeit verdammt knapp. Wenn es erst hier zu regnen beginnt dauert es mindestens vier Monate, bis du einen neuen Trieb machen kannst, wenn nicht gar sechs.“
Pereiras sehnig-schlanke Figur straffte sich. Er schien nachzudenken. Bevor er etwas sagen konnte, fiel ihm sein Vorarbeiter ins Wort.
„Wir könnten warten, bis das Wasser nicht mehr so reißend ist. Dann wäre es sicher zu schaffen. Aber im Moment ist diesbezüglich gar nichts zu machen. Warten wir doch ein paar Tage bis der Regen in den Bergen aufgehört hat, dann sehen wir weiter.“
„Jose hat recht“, meinte der wohl zu einem Entschluß gekommene Haziendabesitzer, „wir warten ab. Eine Woche. Oder gegebenenfalls etwas länger. Der Regen hat dann bei uns wohl noch nicht eingesetzt aber der Fluß hat sich etwas beruhigt, so daß keine Gefahr beim Übertrieb besteht. Die Breite spielt dabei ja keine Rolle, es geht uns ja in erster Linie um die Strömung.“
Rojas nickte beifällig, als er die Worte seines Bosses hörte.
Ich ergriff eine Zigarette, die mir der hagere Mann aus einer zerknitterten Packung anbot.
„Ja dann, Pereira, laß von Dir hören, wenn Du mich mit dem Boot brauchst. Ich werde dann zur Stelle sein.“
Das war alles, was ich zu dieser Angelegenheit noch sagen konnte. Leid hat es mir schon getan, weil ich das Geld zu diesem Zeitpunkt gut hätte brauchen können.
„Kommt mit“, lud ich die beiden ein, „ich hab noch ein Fläschchen Cristal da. Wir werden erst mal einen nehmen, jetzt, wo es doch nichts zu erledigen gibt.“
Die Männer lächelten und stiegen mit mir den Uferkamm hinauf. Zwanzig Meter weiter auf einer Lichtung bewohnte ich eine Bambushütte. Unter einem kleinen Dach aus Palmwedeln hatte ich mir neben der Hütte die Feuerstelle gebaut. Dort war auch ein Tisch mit vier selbst gezimmerten Bänken. Sie setzten sich. Ich verschwand kurz in meiner Hütte und kehrte mit der Flasche zu meinen Gästen zurück. Von einem ungehobelten Brett, das mir als Ablage diente, nahm ich drei leidlich saubere Gläser, die ich in einen mit Wasser gefüllten Eimer tauchte. Mit einem Schlenker des Handgelenks schüttelte ich die hängen gebliebenen Wassertropfen auf den Lehmboden. Daß vormals Senf oder Marmelade in den Gefäßen war, störte niemanden.
„Uups, das ist der Hochprozentige“, ließ Rojas vernehmen und drehte dabei die Flasche in der Hand. Wo hast du den denn her?“
„Schmuggelware. Der kommt von drüben.“ Dabei zeigte ich mit dem Kinn in nördliche Richtung. Beide wußten, daß ich damit Kolumbien meinte.
Einmal im Monat, manchmal auch zwei mal, kamen Männer und Frauen hier vorbei. Auf ihrem Weg ins grenznahe Lago Agrio schleppten sie Kisten und Säcke mit sich.
Es hatte sich so ergeben, daß sie eine Nacht unter dem Palmdach verbrachten, bevor sie am frühen Morgen in das ekuadorianische Kleinstädtchen aufbrachen. An den späten Nachmittagen oder frühen Abenden luden sie mich zu verschiedenen Drinks ein, brieten mitgebrachtes Fleisch oder die Frauen bereiteten Trockenfisch zu. Nach dem Essen tranken wir und immer spielte irgend jemand auf der Gitarre schwermütige Liebeslieder. Jedes mal hatten sie andere Waren dabei. Mal war es Whisky, mal Rum oder Wodka. Letzte Woche hatten sie diesen hochprozebtigen Schnaps aus kolumbianischer Produktion dabei.
Ich hütete mich zu fragen, was sie sonst noch in ihren Kisten und Säcken mit sich führten. Dieses Desinteresse und meine Bereitschaft, sie unter dem Palmdach schlafen zu lassen, honorierten sie regelmäßig mit einer Flasche aus ihren Beständen. Mir sollte es recht sein.
Nachdem ich unsere Gläser zwei Finger breit gefüllt hatte, prostete ich meinen Gästen zu. Wir berochen kurz das Getränk, bevor wir es in die Kehlen kippten. Nach einem kurzen Brennen das uns Tränen in die Augen trieb, machte sich wohlige Wärme im Innern breit.
Pereira schob das leere Glas in meine Richtung und sagte grinsend:
„Und jetzt noch einen darauf, daß es bald regnet.“
Zustimmend goß ich nochmals ein.
Ein Schreck durchzuckte mich, als plötzlich aus dem Nichts ein dunkler Schatten in unsere Runde schoß -direkt zwischen Pereiras Beine.
„Hallo Perro, wo kommst du denn her? Bist du etwa den ganzen Weg hierher gelaufen um bei deinem Herrchen zu sein? Du bist mir ja einer.“
Pereira streichelte den kleinen Hund der so unvermittelt aufgetaucht war und mir einen gehörigen Schrecken versetzt hatte. Mit hängender Zunge und hechelnd lag er nun unter dem Tisch zwischen Pereiras Füßen.
„Schlimmer als eine Frau, die Töle“, bemerkte er liebevoll, „ich kann einen Schritt machen, ohne daß er hinter mir her ist.
Er lachte rauh und streichelte das Tier. Es war nicht zu übersehen, daß der Hund das gern hatte. Auch Rojas redete nun spielerisch auf ihn ein. Perro schien die um ihn gemachte Aufregung zu genießen.
Hinter dem linken Ohrlappen des rasselosen Tieres bemerkte ich ein offenes, eiterndes Geschwür. Ich dachte daran, daß einer seiner Vorfahren wohl ein Cockerspaniel gewesen sein mußte.
Mittlerweile hatte Perro sich beruhigt und die großen Ohren lagen wie vergessene Paddel auf dem festgestampften Lehmboden.
„Trinken wir auf die Frauen“, schlug Jose vor und wollte sein Glas an den Mund führen. Pereira schien jedoch nicht ganz einverstanden.
„Auf unsere Hunde und deren Treue“, meinte der.
Wir lachten alle drei und kippten mit zusammen gekniffenen Augen den Drink.
Die Flasche war halb leer, als sich die beiden Männer von mir verabschiedeten. Als sie mit dem Hund über den schmalen Pfad unter den Bananenstauden verschwanden, sah ich ihnen hinterher und goß mir noch einen Drink ein.
Ich war wieder alleine.
Seit einem Jahr nun lebte ich schon hier inmitten des Dschungels und kultivierte die Pflanzen, die ich zum Leben brauchte. Mir machte dieses freie, unabhängige Dasein Spass. Keinerlei Verantwortung bedrückte mich, niemand machte mir Vorschriften.
Ich stand morgens auf, wann es mir paßte und legte mich in die Hängematte, wenn ich müde war. Hatte ich Lust, besoff ich mich und blieb den ganzen Tag über in meiner Schlafstelle. Ich laß Nietzsches „Zarathustra“ oder blätterte in einer alten, schon schimmeligen Ausgabe des Magazins „Playboy“.
Vor einem halben Jahr wurde es mir dann aber doch zu eintönig und ich kaufte von meinem letzten Bargeld einen Außenbordmotor, den ich an dem Aluminiumboot befestigte, das ich während der letzten Trockenzeit gefunden hatte. Es war eingegraben in einer Sandbank, nur ein Teil des Hecks ragte noch heraus. Wie lange es schon dort gelegen haben mag, weiß ich nicht. Mit einem Hammer und viel Teer brachte ich es wieder in Schuß. In den vier Monaten, in denen es vor meinen Hütten auf dem Fluß lag, reklamierte es niemand als sein Eigentum. Damit war es nun mein!
Mit dem motorisierten Gleiter zählte ich aber auch mit einem Schlage zu einem der begehrtesten Männer dieser Gegend.
Ich übernahm Fährdienste, die mir Bares einbrachten. Manchmal auch Naturalien wie ein Huhn, Trockenfleisch oder Ähnliches. Der Kontakt als Europäer zu diesen einfachen, liebenswerten Menschen der Region bereitete mir viel Freude.
Manchmal erhielt ich auch Aufträge wie diesen von Pereira.
Der hatte eine größere Zahl von Rindern in Shushufindi, einem Ort auf der anderen Flußseite, gekauft und mußte diese Tiere nun zu seinen Weideplätzen bringen. Bei den herkömmlichen Viehtrieben kam es oft vor, daß eines oder auch mehrere der Rinder ertranken. Kein geringer Verlust für einen Siedler, der meißt noch bei seiner Bank in Lago Agrio verschuldet ist.
Mit Pereira bin ich übereingekommen, das Boot einzusetzen.
Rechts und links von dem Aluminiumgleiter würden wir die Tiere paarweise an kurzen Stricken mit den Köpfen über Wasser halten. So würde keines verloren gehen. Für die sechzehn Rinder hatte mir der Mann fünfzig Dollar versprochen, in amerikanischer Währung. Dazu Frühstück und das Mittagessen. Ein guter Lohn, hier am Ende der Welt.
Doch das Wetter machte mir nun einen Strich durch die Rechnung.
Es regnete in den Anden. Aus den kleinen Rinnsalen in den Kordilleren werden reißende Bäche, die am Rande des Tieflandes in die größeren Ströme fließen. Aus den Bergen kommt lehmiges, gelbbraunes Wasser. Wenn sich das nun mit der dünnen Humusschicht unserer Gegend vermischt, wird es ganz einfach nur dreckig.
Aber hier bei uns im Tiefland hat es lange nicht geregnet. Nicht so, wie man es in den Tropen gewohnt ist. Aber in den Bergen schüttete es schon seit Tagen. In den frühen Morgenstunden kann man die Gewitterwolken sehen, die sich vor dem Andenmassiv aufgetürmt haben. Und dieser Regen ist für unsere Region schlimmer, als der schlimmste tropische Wolkenbruch.
Der Fluß ist breiter geworden und reißender. Die Erde, über die ich lief, gab unter meinen Füßen nach, war vollgesogen mit Feuchtigkeit. Die Geräusche unter meinen Sohlen erinnerten mich an Moor.
Um auf andere Gedanken zu kommen entschloß ich mich, zum angeln zu gehen. Nur fünfhundert Meter von meiner Hütte weg war eine Lagune. Ich mochte diesen kleinen See. Umrahmt von überhängendem Gebüsch hatte er etwas märchenhaftes. Doch wußten alle der hiesigen Siedler, daß im See Piranas waren. Doch war das nicht der Pirana, den ich aus Büchern kannte, nicht der fast runde, bunt schillernde Fisch mit den scharfen Zähnen. Hier war eine andere Art beheimatet: länglich wie ein Hering, oliv-schwarz, extrem offensiv. Um sie zu angeln, ist nur ein kleiner Köder nötig. Ein paar Tropfen Blut wittern sie noch über viele hundert Meter. Schon das Geräusch alleine, das man mit der Machete verursacht wenn man sie mit der Breitseite auf das Wasser aufschlägt, genügt um sie anzulocken.
Ich kam mit der Angelschnur aus der Hütte. Es war eine Plastikschnur von der Dicke einer Wäscheleine, aufgewickelt auf ein Stück Hartholz. Der Haken war aus Stahl und zur Verstärkung hatte ich durch die Öse noch sechs Zentimeter Stahldraht dreifach gezogen, bevor ich die durchsichtige Schnur eben an diesem Draht befestigte. Schon des öfteren hatten mir die scharfen Zähne dieser Piraniaart die Schnur durchbissen und meinen Haken auf nimmer Wiedersehen verschwinden lassen. Das sollte mir nicht wieder passieren. Auch wenn man diese Fische am Haken hat muß man aufpassen. Sie schnappen selbst noch, wenn sie an Land gebracht wurden und können auch dort noch bis zu vier Stunden überleben. Will man sie nach dem anlanden packen, schlagen sie plötzlich mit ihrem Körper als wäre es das Leder einer Peitsche. Sie sind in der Lage mit gezieltem Schnappen einen Finger oder einen Zeh abzutrennen; so sauber wie es ein Chirurg mit einem scharfen Skalpell nicht besser schafft.
Mit dem Boot konnte ich den See nicht erreichen. Er war umgeben von einem natürlichen Erdwall aus Holz, Laub, Schlamm und Erdreich. Etwas unterhalb floß das kleine Flüßchen, welches auch hinter meiner Hütte verlief und ein paar hundert Meter weiter in den Aguarico mündet. Nur während der Hauptregenzeit, die nie länger als drei Monate dauert, schwillt das Bächlein so an, daß es mir Mühe bereitet, es watend oder schwimmend zu überqueren.
Ich stand auf dem Wall der das stille Gewässer von dem Flüßchen trennte und genoß die Ruhe, die meine Umgebung ausstrahlte. Ich träumte von einem verwunschenen Teich und dachte dabei an die Prinzessin, die von dem Prinzen wachgeküsst wurde. Oder war ich im falschen Märchen?
Ich verscheuchte die sentimentalen Gedanken und nahm vorsichtig die Schnur mit dem spitzen Haken aus der Brusttasche meines Hemdes, darauf bedacht, mich nicht zu verletzen. In der Hosentasche hatte ich, eingeschlagen in ein grünes Blatt, drei fette Maden. Die hatte ich mit der Machete hinter einer Baumrinde herausgekratzt. Nachdem der Köder auf das Metall des Hakens aufgezogen war, stieg ich zum See hinunter. Mit dem Buschmesser schlug ich klatschend auf das ruhige Wasser und wartete. Als ich die dunklen Schatten der Fischleiber unter der Oberfläche sah, warf ich in hohem Bogen die Schnur aus. Gerade in dem Moment, als die Angelschnur auf die Wasseroberfläche pitschte, vernahm ich in der Ferne das dumpfe Donnern eines sich nahenden Unwetters. Dann ging ein Ruck durch die Schnur und das Nylon straffte sich. Gleichmäßig, mit sanftem Gegendruck, zog ich die Leine an mich heran; nicht zu langsam aber auch nicht zu schnell. Dann sah ich den oliv-schwarzen und auf der Unterseite silbrig glänzenden und sich windenden Fischleib.
„Ich hab dich. Du kommst in die Pfanne“, dachte ich, als ich den Piranha an Land zog. Mit der breitseite der Machete drückte ich den Fisch auf den Waldboden. Mit der freien Hand zog ich das schmale Finnmesser aus dem Bund der Jeans und mit einem tiefen Schnitt hinter dem Kopf des Fisches sicherte ich mir ein schmackhaftes Abendessen. Die beiden überflüssigen Köder warf ich ins Wasser. Beim Weggehen sah ich noch, wie viele Mäuler danach schnappten und wie sich die Wasserringe am Ufersaum brachen. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Von einem Busch schlug ich einen dünnen Zweig, befreite ihn von den Blättern und kleinem Geäst. Dieses Stöckchen zog ich durchs Maul des Fisches vorbei an drei Reihen messerscharfer Zähne, bis es durch die durchschnittene Stelle des Hinterkopfes wieder zum Vorschein kam. So trug ich meine Beute nach Hause.
Obwohl es noch nicht geregnet hatte spürte ich, wie sich die Dschungelerde langsam mit Wasser voll saugte. Die Luftfeuchtigkeit erhöhte sich von Stunde zu Stunde.
Jose Rojas schien recht zu behalten mit seiner Voraussage, daß es bös werden könne, wie er sich ausdrückte.
Über dem offenen Feuer unter dem Palmdach briet ich in der schnell zunehmenden Dunkelheit des frühen Abends den Piranha. Erst hatte ich ihn entschuppt und dann ausgenommen. Als Beilage genehmigte ich mir frittierte Platanos -das sind noch grüne Kochbananen, sowie eine in Salzwasser gekochte Manjokwurzel.
Zum Nachtisch schenkte ich mir noch drei Finger breit von dem Gebrannten ein, den die Schmuggler dagelassen hatten.
In der Hängematte stellte ich mir dann die allabendliche Frage: Hietzsche oder Hefner?
Ich entschied mich für das ramponierte Herrenmagazin das schon über drei Jahre alt war. Die Mädchen auf den speckigen Seiten waren aber noch genau so hübsch wie am Erscheinungstag, der melancholische Friedrich dagegen schon seit vielen Jahren tot!
Dicke Tropfen fielen aus graublauen Gewitterwolken. Sie kamen von Osten und hatten sich über der grünen Welt Amazoniens irgendwo formiert. Sie leiteten die Regenzeit im Oriente ein. Von Westen, dem Fuße der Anden her, drängten schwere, schlammige Wassermassen nach Osten, hin zu einem über viertausend Kilometer entfernten Ozean. Wie ein nimmersatter Schwamm saugte sich die Erde voll mit der lehmigen Feuchtigkeit.
Die Farbe des Dschungels veränderte sich mit dem ersten schweren Regenguß. Das blasse Grün der Pflanzenblätter wurde dunkel und satt. Vielfarbige Blüten öffneten sich an Büschen und Sträuchern, deren Namen ich nicht kenne und viele auch noch namenlos sind. Ein herrliches Kaleidoskop kam zum Vorschein, das nur ganz kurz zu Beginn einer jeden Regenzeit zu beobachten ist.
Während der täglichen Sonnenstunden ging ich vor meine Hütte, um mir die Veränderungen zu betrachten. Jedesmal bot sich mir ein neues, reizvolles Bild. Aber auch der Geruch des Dschungels hatte sich verändert. Die Erde schien zu atmen und auszudünsten. Dieser Atem roch modrig und faulig. Andererseits jedoch schien der Urwald neues Leben auszuhauchen. Aus den fetten, weisen Maden unter den Baumrinden wurden bunte Schmetterlinge, mache größer noch als kleine Vögel. Aus den Erdlöchern schlängelten sich die Vipern und Nattern, um sich vor dem drohenden Ertrinken zu retten. Andererseits aber wurden auch die Fliegen und Stechmücken zur Plage für Mensch und Tier.
In der Herdstelle entzündete ich ein kleines Feuer auf das ich feuchtes Holz legte um die Rauchentwicklung zu unterstützen, die mir die kleinen Quälgeister einigermaßen vom Leibe hielt. Des nachts spannte ich über der Hängematte das Moskitonetz aus, das ich während der Trockenzeit nicht benutzt hatte.
Während der Vormittage regnete es vier Stunden und am Nachmittag derer zwei. Nachts eigentlich ohne nennenswerte Unterbrechung. Die Fluten des Acuarico schwollen an, das Wasser jedoch wurde klarer mit jedem Tag. Ein Zeichen dafür, daß es in den Bergen aufgehört hatte zu regnen. Jetzt brauchten wir nur noch auf den Rückstau zu warten, dann konnten wir mit dem Übertrieb beginnen.
Der Rückstau ist ein Phänomen das sich einstellt, wenn die Wassermassen den Abfluß durch die Flußläufe nicht mehr schaffen. Dazu muß man sich vorstellen, daß die Wasser auf einer Länge von siebentausend Kilometern lediglich ein Gefälle von vierhundert Metern haben. Weiter im Osten, in den Ebenen Brasiliens, heißt es während dieser Zeit: Land unter! Die Wasser stauen sich zurück und die Strömungen verlieren ihre Schrecken, weil die Wassermassen sich nur noch träge dem Atlantik zu wälzen.
Eine Woche noch, so schätzte ich, dann würde sich der Fluß beruhigt haben. Dann würde er auf der mir gegenüber liegenden Seite über das Ufer treten und sich fast strömungslos und still verhalten. Nicht ganz unähnlich einem Raubtier, das auf seine Beute lauert.
Unter meinen Füßen spürte und hörte ich die Feuchtigkeit mehr denn je. An der Stelle wo meine Hütte stand, brauchte ich mir über Wasserschäden keine Gedanken zu machen. Das Stück Land, das ich bewohnte lag zwar zwischen dem kleinen, namenlosen Flüßchen - in der Trockenzeit eigentlich nur ein Rinnsal - und dem Acuarico, war aber etwas höher gelegen als das gegenüber liegende Ufer. Das Wasser würde sich dann dort verlaufen. Für den Moment blieb mir nichts anderes übrig, als zu warten, auf daß sich der Strom beruhigte. Das würde, wie schon gesagt, wohl noch eine Woche dauern.
Die Zeit zwischen den Güssen wollte ich mir mit angeln vertreiben. Es blieb jedoch nur bei einem Versuch. Das Wasser in der Lagune war gestiegen. Der Erdwall, der das Ufer säumte, war durchnäßt und selbst auf dem höchsten Punkt morastig. Bis zu den Knöcheln versank ich in dem nachgebenden Erdreich. Auf dem Kamm der Böschung hatte ich Mühe nicht auf dem schmierigen Grund auszurutschen und in den See zu schlittern. Bei dem Gedanken daran überzog es mich mit einer Gänsehaut. In diesem Moment hatte der See seinen märchenhaften Reiz für mich verloren. Er erschien mir nun wie eine vage, nicht zu bestimmende Bedrohung. War es die Ruhe, die über dem Wasser lag?
Nach mehrmaligen Versuchen, die gefräßigen Räuber anzulocken, gab ich auf. Wo mochten die Piranhas sein? Nach einem Blick über die spiegelglatte Wasseroberfläche stieg ich vorsichtig zurück auf den Wall. Fast wäre mir entgangen daß sich das klare Wasser des Sees durch die lockere Erde drängte und sich mit der dunklen Brühe des Flüßchens vermischte. Meiner Beobachtung maß ich zu diesem Zeitpunkt aber noch keinerlei Bedeutung bei. Als die ersten schweren Regentropfen zu fallen begannen beeilte ich mich, mein schützendes Palmdach zu erreichen.
Acht Tage nach unserem letzten Treffen erschien Jaime Pereira erneut mit seinem Vorarbeiter bei mir.
„Morgen Vormittag machen wir den Übertrieb“, bemerkte der Haziendabesitzer nach einer kurzen Begrüßung, „das Wasser hat sich beruhigt und der Fluß ist fast ohne Strömung.“
Er hatte recht. Der Rückstau der gewaltigen Wassermassen hatte bereits eingesetzt und dem Strom jegliche Gefahr genommen. An träge vorbei treibenden entwurzelten Bäumen konnte man die Geschwindigkeit der Strömung sehr gut abschätzen. Zwar war der Fluß nun wesentlich breiter als während der Trockenzeit aber beim Übersetzen der Rinder mit dem Motorboot hatten wir mit keinerlei Schwierigkeiten zu rechnen.
„Morgen früh dann“, sagte ich und holte die Flasche mit dem Rest des hochprozentigen „Cristal“ hervor. Ein Lächeln huschte über die Gesichter der beiden Männer als ich die Drinks eingoß. Jaimes Hund, der treue Mischling, beobachtete uns schwanzwedelnd. Das eitrige Geschwür an seinem Ohrlappen war verschwunden. Zurückgeblieben war lediglich eine oberflächliche Wunde die scheinbar schlecht verheilte und leicht schmierig blutete. Ab und zu kratzte das Tier mit der Pfote darüber um die Fliegen zu verscheuchen, die wohl einen unangenehmen Juckreiz verursachten.
Nach zwei schnell gekippten Schnäpsen verließen mich die beiden Männer wieder. Während sie über den Pfad durch die Bananenplantage schritten, tollte der Hund zwischen ihnen und animierte zum Spiel.
Wir wollten eine Furt benutzen, die sich auch schon bei vorausgegangenen Übertrieben als sicher erwiesen hatte. Dort war der Fluß nicht so breit. Immerhin waren es, bedingt durch das Hochwasser, doch noch etwa hundertzwanzig Meter. Jose kam mit zwei Hilfskräften von Pereiras Hazienda zu Fuß. Jaime selbst war zu Pferde, barfuß mit Stoffhose und hellblauem Hemd, das er über dem Bauchnabel zusammengeknotet hatte.Sie hatten die Rinder vier Stunden in strömendem Regen getrieben bis sie zu der Stelle gelangten, wo ich sie mit dem Boot erwartete. Der Himmel riß kurz auf und die tropische Sonne lachte an diesem frühen Mittag durch eine Schneise dunkler, schwerer Kumuluswolken.
Nach einer wohl verdienten Zigarettenpause stiegen die beiden Hilfskräfte zu mir in den Gleiter. Ihre Aufgabe war es, links und rechts vom Boot jeweils ein Rind an einem kurzen Seil mit dem Kopf über dem Wasser zu halten.
Normalerweise schwimmen die Tiere problemlos auch größere Strecken. Dabei treiben aber immer wieder einige der wertvollen Rinder ab und erzeugen Panik beim Rest der Herde. Ist einmal Wasser in die Lunge einer Kuh gedrungen öffnet sich automatisch auch der After des Tieres. Deshalb sagt man auch: Die ersaufen von vorne und von hinten!
Pereira wollte einen Verlust auf jeden Fall vermeiden.
Mit sanfter Gewalt schoben und zogen wir die ersten beiden verängstigten Rinder in die jeweilige Position links und rechts neben das Boot. Auf das Zeichen der beiden Gehilfen, daß sie die Stricke am Boot festgemacht hatten und auch sicher in Händen hielten, startete ich den Motor und fuhr langsam vom Ufer ab. Als die Tiere keinen Grund mehr unter ihren Hufen spürten, begannen sie automatisch mit kräftigen Schwimmbewegungen. Sie verloren die anfängliche Scheu und starrten mit weit aufgerissenen typischen Kuhaugen auf das andere Ufer. Einer der Arbeiter blieb bei den beiden übergesetzten Rindern und Rojas stieg nun zu uns. Wir drei setzten wir dann die restlichen vierzehn Tiere über. Alles verlief ohne Probleme.
Pereira, im Sattel auf seinem Braunen sitzend, hatte die ganze Aktion zufrieden beobachtet und konnte nun sehen, wie seine Tiere anfingen, auf der anderen Uferseite zu grasen oder von den dort wachsenden Büschen zu fressen. Sein Hund lag neben dem Pferd auf der Erde und beleckte ab und zu die kleine Wunde an seinem Schlappohr.
Wir beobachteten wie Jaime seinem Pferd einen Klaps gab und es so in den Fluß trieb. Unterdessen lief der Hund winselnd am Flußrand auf und ab. Pereira drehte sich in seinem Sattel um und rief ihm zu:
„Na komm, Perro! Komm, schwimm mir nach!“
Der Bastard schien unentschlossen, schnüffelte aufgeregt am Uferrand, blickte noch einmal seinem Herrchen nach und sprang dann doch endlich ins Wasser.
Vom gegenüber liegenden Ufer betrachteten wir ohne sonderliches Interesse das Geschehen.
Pereira hatte die Flußmitte erreicht. Der Hund war vielleicht zwanzig Meter hinter ihm als der urplötzlich in ein herzzerreißendes Jaueln ausbrach. Wir sahen den Kopf des Hundes noch als wieder ein hohes Schreien zu hören war, ähnlich dem Kreischen eines kleinen Kindes. Das Wasser um den kleinen Körper herum schien zu brodeln. Wir hatten unseren Blick noch nicht abgewandt als uns Pereiras Schrei am Ufer erreichte und sich in der Tiefe des Dschungels brach.
„Piranhas!“
Vögel, die bis dahin in den Wipfel der hohen Bäume saßen, flogen auf, als hätten sie das Wort verstanden und wollten sich in Sicherheit bringen.
Ihr aufgeregtes Kreischen übermalten die folgenden Szenen wie grausige Musik.
Noch einmal tönte es uns in den Ohren: „Hier sind Piranhas!“
Das Wasser um den Gaul kam in Bewegung. Neben dem Sieden und Brodeln kam nun noch ein anderes Geräusch. Es erinnerte mich an das hohe, unheilvolle Summen das man unter Hochspannungsleitungen vernimmt. Nur die gab es hier im Umkreis von vierhundert Kilometern nicht.
Umgeben von dem Kreischen der Vögel, von diesem Kochen und Zischen im Wasser und Pereiras Schreien, begann der Braune zu scheuen.
Der Haziendabesitzer hatte die Zügel losgelassen und hielt sich am Sattelhorn fest. Das Wasser machte das Pferd träge, so daß der Mann keine Angst haben mußte, aus dem Reitsitz katapultiert zu werden. Es fehlten vielleicht noch fünfzig Meter bis zum rettenden Ufer als das Pferd anfing anhaltend zu wiehern. Wie das Pfeifen einer alten Dampflok hörten sich die Todesschreie an, die uns das Blut in den Adern gefrieren ließen. Jetzt begann auch Pereira wieder zu uns herüber zu rufen. Zwar konnten wir die Worte nicht verstehen, doch sie weckten uns aus dem einem Schock ähnlichen Zustand auf.
„Das Boot“ schrie mich Jose an, „fahr ihm mit dem Boot entgegen. Hilf ihm!“ Unsanft drängte mich Rojas zu dem vor uns dümpelnden Gleiter.
Dann war Ruhe. Wenn man von diesem Summen absah. Das Pferd hatte zu schreien aufgehört.
Als ich die an einem Baumstumpf befestigte Leine des Bootes löste sah ich aus den Augenwinkeln, wie sich das tote Pferd auf die Seite legte. Pereira stellte sich mit beiden Beinen auf den Bauch des Tieres. Noch zwanzig Meter trennten uns. Rojas und ich sprangen in das Boot, stießen uns ab und ich startete den Motor.
„Scheiße“, hörten wir Pereira fluchen und sahen zu, wie er mit einem gewaltigen Satz vom Kadaver seines Braunen federte. Der Sprung brachte ihn drei Rettung verheißende Meter näher zum flachen Ufer. Klatschend kam er im Wasser auf, tauchte kurz unter um dann mit kräftigen Schwimmbewegungen zu beginnen. Wir hörten seinen gurgelnden, erstickten Schrei, kurz bevor sein Körper wieder unter der Wasseroberfläche verschwand um dann endlich gegen den Ufersaum zu stoßen. Rojas und ich hatten mit laufendem Motor einen kleinen Bogen auf dem Wasser beschrieben und fuhren nun im zickzack durch das aufgewühlte Wasser um mit der Schraube des Außenborders den Schwarm der gefräßigen Bestien von Pereira abzuhalten.
Mit dem Gesicht nach unten, die Füße noch im Wasser, lag der Mann am Ufer. Beide Hände hatten sich in das nasse Erdreich vergraben. So, als hätte er noch versucht, darin einen Halt zu finden. So zogen ihn die beiden Arbeiter einen Augenblick später an Land. Den Leblosen unter den Achseln packend, zogen sie ihn auf das feuchte Dschungelgras, das den Uferrandbewuchs bildete.
Zuckungen gingen durch den Körper des Mannes, als wir anlegten. Jose sprang aus dem Boot und stürzte auf seinen Boss zu. Er rüttelte an seiner Schulter und klopfte ihm mit der flachen Hand auf den Rücken, wie man es bei einem kleinen Kind tut, das sich verschluckt hat. Der Vorarbeiter drehte seinen Chef um und blickte in starre, angstgeweitete Augen.
Jaime Pereira war tot. Daran gab es keine Zweifel. Auch dann nicht, als sich sein Brustkorb unter dem halb offenen Hemd unregelmäßig hob und senkte.
Ich schaute genau in dem Moment in die Gesichter der Männer, als alles Blut aus ihren Gesichtern wich. Ich sah ihren Blick auf die Stelle von Pereiras Körper gerichtet, wo sich beim Menschen das solar plexus befindet. Dort, eine handbreit über dem Bauchnabel, genau zwischen den beiden Rippenknochen, sah man ein Loch.
Es blutete kaum, war fast kreisrund und von der Größe der Öffnung eines Wasserglases. Aus diesem Loch hörte man Geräusche!
Schmatzende, gefräßige Geräusche. Soweit es uns möglich war konnten wir erkennen, daß es sich im Innern des Thorax mindestens vier der nicht ganz heringgroßen Piranhas an den Eingeweiden Pereiras gütlich taten.
Diese ununterbrochenen Schmatzgeräusche ließen unsere Mägen rebellieren.
Als erster wandte sich einer der Arbeiter ab und übergab sich auf dem Gras.
Ein paar Augenblicke später kotzten wir alle.
Immer dann, wenn ich, als ob ich es nicht glauben könnte, zu dem Toten hinsah, überkam mich ein neues Übelkeitsgefühl. Den drei anderen schien es nicht besser zu ergehen.
„Im Fluß gibt es keine Piranhas! In diesem Fluß hat es noch nie Phiranhas gegeben“, sagte Jose leise und mehr zu sich selbst.
Die beiden Arbeiter schüttelten die Köpfe und einer meinte:
„In den Flüssen hier, so nahe bei den Bergen, hat es noch nie Piranhas gegeben. Dabei schüttelte er immer und immer wieder seinen Kopf und sah auf den Leichnam seines Bosses. Unvermittelt drehte er sich ab und übergab sich erneut.
Wir blickten alle vier auf den Strom, der gar nicht flußähnlich, sondern trügerisch ruhig vor uns lag. Das summende Geräusch war verschwunden. Auch der abtreibende Kadaver des Pferdes war nicht mehr in unserem Blickfeld. Von Osten schoben sich wieder schwarze Gewitterwolken vor die Sonne und es begann zu dunkeln, obwohl es noch früher Nachmittag war.
Mir war kalt.
„Bringen wir ihn zu seiner Frau“, meinte Jose weinend. Er machte sich daran, die immer noch schmatzenden Fische aus dem Körper herauszuholen.
Während die beiden Arbeiter sich daran machten die Rinder zusammenzutreiben, um sie über einen Dschungelpfad zu Pereiras Anwesen zu bringen, betteten Jose und ich den Toten im Boot und brachten ihn übers Wasser zu seinem Haus.
Vor ein paar Tagen badeten noch die Kinder im Fluß, die jungen Mädchen und Frauen wuschen die Wäsche darin. Dabei baumelten die Füße und Unterschenkel im Wasser. Die jungen Männer veranstalteten Wettkämpfe wer als erster das andere Ufer erreichte. Selbst meine allabendlichen Bäder fielen mir wieder ein.
„Nein“, sagte ich so leise, daß Jose es nicht hören konnte, „im Fluß hat es nie Piranhas gegeben.“
http://www.mscdn.de/ms/karten/beschreibung_4918-0.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/beschreibung_4918-1.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24910.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24911.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24912.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24913.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24914.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24915.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24916.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24917.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24918.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24919.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24920.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24921.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24922.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24923.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24924.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24925.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24926.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24927.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24928.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24929.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24930.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24931.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24932.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24933.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24934.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24935.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24936.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24937.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24938.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24939.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24940.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24941.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24942.png
http://www.mscdn.de/ms/karten/v_24943.png
0
Über den Autor
hvholler
Leser-Statistik
180
Leser
Quelle
Veröffentlicht am
Kommentare
Kommentar schreiben
Senden
Zeige mehr Kommentare
10
0
0
Senden
4918