Romane & Erzählungen
Die Heimkehr
Kategorie Romane & Erzählungen
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
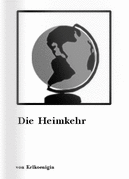
Die Heimkehr
Beschreibung
Eine ├Ągyptische Gothic Novel aus dem 19. Jahrhundert
Die Besucherin
6. Die Besucherin
Die Turmuhr schlug Mitternacht, doch Johann lag noch immer wach. Die Geisterstunde hat begonnen, durchfuhr es ihn.
Auch drei Wochen nach der Rückkehr des Vaters war er noch immer zu aufgewühlt, alsdass sein Verstand einfach abtauchen wollte. Seine Gedanken kreisten um die Kiste im Keller und er verspürte den Wunsch noch einmal das Mitbringsel aus Ägypten zu betrachten.
Er schl├╝pfte in seine Pantoffeln und versuchte beim Durchqueren des Raums nicht auf die knarrende Diele vor dem Schrank zu treten, um seinen Bruder nicht zu wecken, der im Nachbarraum schlief. Als er den Deckel der alten Truhe anhob, quietschen die Scharniere leise und Johann hielt einen Augenblick in der Bewegung inne. Dann b├╝ckte er sich nach dem Morgenmantel, der auf einem Sto├č von Abenteuerb├╝chern lag, denen Johann l├Ąngst entwachsen war, die er aber doch nicht einfach wegwerfen wollte.
Er streifte sich den Mantel ├╝ber und vermeinte im Dunkeln die farbige Blumen zu erkennen, die in den roten Font aus Seide eingewebt waren, da er sich schon so oft im hellen Licht des Tages betrachtet hatte, dass sie sich in sein Ged├Ąchtnis eingebrannt hatten. Durch das Fenster schien der Mond und Johann suchte sein Spiegelbild im Glas zu erkennen, doch er sah nur einen grauen Schemen.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á
Morgen will ich zeitig aufstehen, rief er sich ins Ged├Ąchtnis. Daher sollte ich endlich schlafen. Also schl├╝pft er wieder aus dem Morgenmantel. Er nahm sich einen Augenblick Zeit um ihn behutsam auf dem Bett zusammenzulegen und┬á in der Truhe zu verstauen. Vielleicht hatte Peter Recht und er sollte den Morgenmantel zu seinem an die Garderobe h├Ąngen, aber irgendetwas str├Ąubte sich in Johann dagegen dies zu tun.┬á
Er schlurfte zur├╝ck zum Bett, Iegte sich auf den R├╝cken, ├╝berkreuzte die Arme auf der Brust blickte hoch an die Decke. So liegen die Pharaonen in ihrer Gruft, dachte er und sah vor seinem inneren Auge die Mumie im Keller.
Still war es. Nur das Ticken des Holzwurms war zu h├Âren oder bildete er sich dies nur ein? Erinnerungen erschienen in seinem Geist und verblassten wieder. Durch das Fenster schien der Mond und tauchte den Raum in silbernes Licht, das viel zu hell war um zu schlafen.
Ungeduldig drehte Johann sich mit dem Gesicht gegen die Wand und dachte dabei an die Vorlesung ├╝ber mittelhochdeutsche Literatur, aber deren erm├╝dende Wirkung wollte sich nicht einstellen. Enerviert zwang er sich dazu, tief durchzuatmen, denn er wollte endlich schlafen. Er schloss die Lider und ein Nachbild aus grauen Flecken bildete sich vor seinen Augen. Langsam l├Âsten sich Johanns Gedanken auf, und er tauchte in eine angenehme, warme Dunkelheit ein. Die Finsternis nahm Kontur an und verdichtete sich zur Silhouette eines fliegenden Vogels.
Bevor das Dunkel ihn umh├╝llte, durchfuhr ihn eine dunkle Vorahnung. Er vermeinte geradezu k├Ârperlich zu versp├╝ren, dass er nicht allein im Raum war. Er riss er die Augen wieder auf und richtete sich halb auf in seinem Bett. Schwer atmend versuchte er in der Dunkelheit Einzelheiten zu erkennen, aber seine Sinne stellten sich nur ganz langsam auf die Finsternis ein.
Bewegte sich da etwas an der Zimmert├╝r? Johann sah einen grauen Fleck vor dem braun gestrichenen Holz und er sp├╝rte, wie sich seine Nackenhaare str├Ąubten. Was mochte das sein?, fragte er sich beklommen. Vielleicht gar nichts. Vielleicht spielten ihm seine ├╝berreizten Sinne einen Streich? Johann rieb sich die Augen, riss sie wieder auf und starrte in Richtung T├╝r, aber der Fleck noch immer ┬áda. Langsam l├Âste er sich von der T├╝r, doch Im tr├╝ben Licht war er nur umrisshaft zu erkennen.
Eine Welle der Panik stieg in Johann auf. Eisige K├Ąlte breitete sich auf seiner Haut aus. Am liebsten h├Ątte er sich im Bett verkrochen und sich die Decke ├╝ber den Kopf gezogen, aber das w├╝rde den Spuk nicht beenden. Johann starrte mit angehaltenem Atem in das Dunkel. Kalter Schwei├č lief ihm ├╝ber die Stirn, rann in seine Augen, aber er schaffte es nicht, eine Hand zu heben um sich ├╝ber das Gesicht zu wischen. Verzweifelt ├╝berlegte er, wie er sich in Sicherheit bringen k├Ânnte. Seine Gedanken ├╝berschlugen sich, doch er fand keinen Ausweg. ┬á
Das Phantom erreichte die Mitte des Zimmers. Nun konnte es Johann deutlich erkennen. Es ├Ąhnelte in Gr├Â├če und Gestalt einem Menschen, besa├č aber seltsam flie├čende Konturen. Wie in Nebel geh├╝llt sah er eine schlanke Person, die in ein graues Gewand trug. Lange, gl├Ąnzend schwarze Locken hingen unter dem durchsichtigen Tuch wie dunkle Schlangen wirr bis auf die Schultern. Gro├če, dunkle Augen versch├Ânten die unscheinbaren Z├╝ge eines geisterhaft bleichen Antlitzes, das fast blutleer schien. Um die blassen Lippen lag ein Zug resignierten Grames, in ihrem Blick eine unendliche Traurigkeit.
Im pl├Âtzlichen Erkennen begriff Johann, dass er den Eindringling schon einmal gesehen hatte. Sein Gesicht glich dem des Schattens, der ihn in der Unterwelt fast ber├╝hret h├Ątte.
Er schrie vor Schreck laut auf.
„Was um Gottes Willen suchst du hier!“, entfuhr es ihm. „Du bist doch tot!“
„Ich kann im Grab keine Ruhe finden, denn man hat mir die Mumie geraubt“, s├Ąuselte der Eindringling mit melodischer Stimme. „Ich bin auf Erden nicht zu meinem Recht gekommen. Ruhelos sind die Schatten der M├Ądchen, die vor ihrer Hochzeit aus dem Leben gerissen worden sind.“
Unf├Ąhig etwas zu erwidern starrte Johann das Phantom an. Es war als hielten ihn unsichtbare H├Ąnde davon ab, von dem schwankenden Bett zu fliehen. Er ahnte, dass der Schatten ihm nach dem Leben trachtete, doch etwas zog ihn geradezu magnetisch zu ihm hin.
„Dann sah ich dich vor mir!“, hauchte das M├Ądchen. Sie sprach immer leiser, bis es kaum mehr als ein Wispern war, doch noch immer ging von ihrer Stimme ein unwiderstehlicher Zauber aus. „Du erinnertest mich an meinen Geliebten, den ich nicht heiraten durfte!“
Als er ihre vom Kummer gezeichneten Z├╝ge sah versp├╝rte Johann einen Anflug vom Mitleid. Dann ├╝berwog das Grauen. Sein Puls raste, sein Herz klopfte so laut, dass es ihm in den Ohren dr├Âhnte. Kerzengerade sa├č er im Bett und umkrallte die verschwitzte Decke.
„Wie hei├čt du?“, fragte er in der verzweifelten Hoffnung, dass er - wie im M├Ąrchen Rumpelstilzchen - Macht ├╝ber das Phantom gewinnen k├Ânnte, wenn er nur seinen Namen kannte.
„Wir Schatten haben keinen Namen!“ Die Augen der Besucherin begannen im Dunkeln zu gl├╝hen. Sie gl├╝hten so rot wie die d├Ąmonischen Augen, die Johann aus der Kiste der Mumie angestarrt hatten. „Warum hat man die Ruhe meines Grabes gest├Ârt? Nur in meiner Mumie kann ich wohnen.“
Panisch suchte Johann nach einer Idee, wie er den Eindringling ablenken k├Ânnte, aber wieder versagte seine Phantasie aufs Kl├Ąglichste. Das Wesen flog ganz langsam auf das Bett zu. Johann ├Âffnete den Mund um zu schreien, doch kein Ton l├Âste sich aus seiner trockenen Kehle.
„Heute ist unsere Hochzeitsnacht“, fl├╝sterte die melodische Stimme.
Ganz langsam schwebte sie mit auf ihn zu. Schon war sie so nah, dass Johann ihren Atem sp├╝ren konnte. Eine eiskalte Hand ber├╝hrte seine Schulter und Johann zuckte zur├╝ck. Starr vor Entsetzen blickte er in das Gesicht seiner n├Ąchtlichen Besucherin. Ihre Wangen waren so wei├č und durchsichtig wie kalter pentelischer Marmor. Hell waren auch die leicht ge├Âffnete Lippen. Kalter Atem entwich ihrem Mund, der nach Moder roch. Dann schloss sie die Augen.
Sie will mich k├╝ssen, durchfuhr es Johann. Ein verzweifelter Lebenswillen stieg in ihm auf. Mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, zwang er sich, seine Gedanken zu ordnen. Der Morgenmantel!, durchfuhr es ihn.
„Liebste, bist du nicht neugierig auf mein Hochzeitsgeschenk?“, fragte er mit schwankender Stimme.
├ťber die verh├Ąrmten Z├╝ge des M├Ądchens huschte ein verkl├Ąrtes L├Ącheln.
„Du hast ein Geschenk f├╝r mich!“ Ihre Augen wanderten von Johanns Gesicht zu seinen H├Ąnden, die sich noch immer an der Decke festkrallten. „K├Ânntest du doch ermessen, wie sehr mich dies erfreut!“
Johann betete im Geist zu allen Heiligen, dass sie ihm beistehen m├Âgen und dieses schreckliche Wesen sich ablenken lie├č, damit er um Hilfe rufen konnte.
„Wo ist dein Geschenk?“
Noch immer war Johann wider seinen Willen fasziniert von dieser Stimme.
„Es ist in der Truhe neben der T├╝r“, stotterte er und war dankbar, dass sich das M├Âbel in der anderen Ecke des Zimmers befand. „Es ist ein Morgenmantel aus reiner Seide.“
Die Besucherin durchma├č den Raum mit erschreckender Geschwindigkeit, die ganz im Gegensatz zu der vorherigen Langsamkeit ihrer Bewegungen stand. Sie erreichte die Truhe und ├Âffnete ihren Deckel.
„Hilfe!“, rief Johann im gleichen Augenblick so laut er konnte. „Sie will mich umbringen. Rettet mich!“
Irgendetwas verursachte einen heftigen Schlag. Die Holzdielen des Bodens erbebten und pl├Âtzlich war es hell im Raum.
Das Phantom schrie vor Schmerz auf, es war ein gequ├Ąlter Aufschrei, wie Johann ihn noch niemals geh├Ârt hatte.
Geblendet vom grellen Licht und halb wahnsinnig vor Angst, bedeckte er die Augen mit beiden H├Ąnden. Er sp├╝rte eine leichte Ber├╝hrung an der Schulter und zuckte zur├╝ck, aber die Hand, die ihn packte war nicht kalt, sondern warm und lebendig. ┬á
„Was hast du?“, h├Ârte er die Stimme seines Bruders fragen.
Johann blinzelte und sah in Peters Gesicht, der im Nachthemd und mit einer ├ľllampe in der Hand neben seinem Bett stand. Argw├Âhnisch lie├č seinen Blick im Raum schweifen, aber das Phantom war verschwunden. Die eisige K├Ąlte in seinem Inneren lie├č nach, aber noch immer f├╝hlt er sich elend.
„Was ist los?“, fragte Peter nochmals.
Er r├╝ckte einen Schemel heran und setzte sich darauf.
Johann sch├╝ttelte den Kopf und legte ihn dann auf die Knie, denn er wollte niemanden sehen. Ein Zittern ging durch seinen ganzen K├Ârper. Schwer atmend war er einige Minuten lang unf├Ąhig zu sprechen.
Die Hand seines Bruders ber├╝hrte ihn am Arm und fuhr sofort wieder zur├╝ck.
„Du bist ja kalt wie Eis!“
Johann schaute hoch und er sah Peter, der die Hand bes├Ąnftigend mit der Innenfl├Ąche nach oben hob.
„Es ist alles wieder gut“, sch├Ąrfte er seinem Bruder ein.
Nichts ist gut“, entfuhr es Johann. „Der Geist einer ├ägypterin wollte mich umbringen. Sie hat behauptet, dass sie ohne ihre Mumie keine Ruhe findet.“
„Das war bestimmt nur wieder einer deiner ├╝blichen Alptr├Ąume“, sagte sein Bruder mit sorgenvollem Blick, als ob er bef├╝rchtete, Johann k├Ânnte den Verstand verloren haben.
„Beruhige dich doch! Wir stiften unsere Mumie einem Museum und denken nicht mehr an sie.“
„Aber es war alles so real!“, insistierte Johann, der nicht daran glaubte, dass es nur ein Traum gewesen war. ┬á
Wieder schaute er sich um, denn er frage sich, ob sich das M├Ądchen irgendwo im Raum versteckt haben konnte.
„Vielleicht hilft es dir, wenn du dar├╝ber redest?“, fragte Peter und schaute ihn eindringlich an. „Du musst dich vor mir nicht sch├Ąmen. Schlie├člich bin ich dein Bruder.“
„Ich m├Âchte aber nicht dar├╝ber reden“, erwiderte Johann heftiger als er beabsichtigt hatte.
“Was genau hast du gesehen?“, fragte Peter nochmals, diesmal in einem geradezu inquisitorischen Tonfall.
Johann kannte seinen Bruder gut genug, um zu wissen, dass er nicht locker lassen w├╝rde, also gab er nach.
„Es fing damit an, dass ich neulich getr├Ąumt habe, ich sei in die griechische Unterwelt abgestiegen.“
Peter schaute auf den Nachttisch, auf dem die Odyssee lag und er sch├╝ttelte missbilligend den Kopf.
„Im Hades wollte mich ein Schatten ber├╝hren …“ Johann suchte Blickkontakt mit seinem Bruder, aber dieser sagte nichts. „Vorhin habe ich diesen Schatten wiedergesehen, ein junges M├Ądchen, es ist einfach durch den Raum geschwebt … ┬áSie hat sich dar├╝ber beklagt, dass man seine Mumie gestohlen habe … ┬áDas M├Ądchen wollte mein Blut trinken, es wollte mich zu sich in den Hades hinabziehen …“
„Es war nur ein Traum. Er war schrecklich, aber nun ist alles wieder gut“, entgegnete Peter ganz leise und wieder hatte Johann den Eindruck, dass sein Bruder mit ihm wie mit einem Wahnsinnigen sprach. „Ich h├Ątte dieses … Gespenst anderenfalls gesehen als ich die T├╝r ge├Âffnet habe!“
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Johann dachte ├╝ber die Worte seines Bruders nach, aber alles in ihm str├Ąubte sich gegen diese banale Erkl├Ąrung.
„Nein, das stimmt nicht!“, protestierte er schlie├člich. „Ich habe nicht getr├Ąumt, ich war hellwach!“┬á┬á
„Es war nur ein Alptraum“, wiederholte Peter und schaute Johann ernst an.
„Wir gehen jetzt in die K├╝che und trinken zusammen ein Glas des Marillenlik├Ârs, den Tante Henriette vorbeigeschickt hat“, schlug er vor. „Dann sieht die Welt schon gleich ganz anders aus.“ ┬á
„Von mir aus“, antwortete Johann ohne gro├če Begeisterung und, obwohl er noch immer etwas weiche Knie hatte, rappelte er sich auf und stellte die F├╝├če auf den Boden. „Wenn ich das tats├Ąchlich getr├Ąumt habe, dann nur, weil du mir auf dem Weg zum Arzt von diesen herumfliegenden Seelen …“
Ganz pl├Âtzlich kam ihn ein beunruhigender Gedanke: Es gab ein probates Mittel um herauszufinden, ob der Schatten ihn tats├Ąchlich besucht hatte oder ob dies nur ein Traum war, wie sein Bruder behauptete.
„Gleich wirst Du sehen, dass ich mich nicht irre!“ verk├╝ndete Johann mit triumphaler Stimme, obwohl er eigentlich das Gegenteil hoffte, „Ich habe die Besucherin abgelenkt, indem ich behauptet habe, mein orientalischer Morgenmantel sei ein Hochzeitsgeschenk f├╝r sie.“
„Du hast einer toten ├ägypterin den pr├Ąchtigen Mantel geschenkt, den Vater dir mitgebracht hat?“, fragte Peter v├Âllig entgeistert. „Du gibst das einfach so das Einzige weg, das dir noch von ihm geblieben ist?“
Johann fragte sich, ob sein Bruder wirklich begriff, in welcher t├Âdlichen Gefahr er sich befunden hatte.
„Sie hat ihn sich aus der Truhe geholt.“
Johann zeigte anklagend auf das M├Âbel.
„Das glaube ich nicht!“
Johann schl├╝pfte in seine Pantoffeln und stand. Obwohl ihn seine Beine kaum trugen durchquerte er den Raum bis zur Truhe. Sein Herz klopfte fast schmerzhaft gegen seine Rippen als er mit beiden H├Ąnden den Deckel anhob.
Als er hineinschaute, lie├č der Schock ihn fast in Ohnmacht fallen. Der Mantel war verschwunden!
„In der Truhe sind ja nur alte B├╝cher und das da!“, entfuhr es Peter, der hinter ihm stand.
Er holte einen roten Fes mit schwarzer Bommel heraus und setzte ihn sich auf den Kopf. „Schade, dass Vater nur einen davon mitgebracht hat …. Bist du ganz sicher …“
„Ja ich bin ganz sicher!“, br├╝llte Johann seinen Bruder an. „Der Mantel lag auf den B├╝chern. Der Fes war daneben“
Peter legte den Zeigefinger auf die Lippen.
„Nicht so laut, sonst weckst du die anderen!“
„Sie hat ihn tats├Ąchlich mitgenommen …“ stammelte Johann. „Sie h├Ątte mich sonst get├Âtet … Vaters Morgenmantel hat mir das Leben gerettet!“
Peter starrte seinen Bruder mit weit aufgerissenen Augen an. Erstmals hatte Johann den Eindruck, dass er ihn ernst nahm. Einige Augenblicke lang schauten beide wortlos auf die zerfledderten Schm├Âker in der Truhe.
 
Dann brach Peter das Schweigen: „Ich glaube, jetzt brauche ich auch einen Lik├Âr.“
So leise sie konnten stiegen die Br├╝der auf Zehenspitzen die Treppe hinab, Peter noch immer mit dem Fes auf dem Kopf. Er betrat die K├╝che, ├Âffnete eine Schrankt├╝r und suchte nach geeigneten Gl├Ąsern, aber er sah nur normale Wassergl├Ąser. Die werden gen├╝gen, sagte er sich und stellte zwei davon auf den K├╝chentisch.
„Was wird Mutter dazu sagen?“, fragte Johann bange, als sein Bruder eine der Flasche entkorkte, die der Apotheker vorbeigebracht hatte.
„Sie hat mir eine Flasche geschenkt, weil ich f├╝r sie einen Brief zur Post gebracht habe.“
Sorgf├Ąltig, als handle es sich um eine liturgische Handlung f├╝llte Peter die zwei Gl├Ąser randvoll mit der klaren Fl├╝ssigkeit, die die Flasche enthielt. Johann sah ihm skeptisch zu, als bef├╝rchtete er vergiftet zu werden.
Peter lie├č sich Johann gegen├╝ber nieder, der mit bleichem Gesicht zusammengesunken auf einem K├╝chenstuhl sa├č. Seine Brust hob und senkte sich noch immer viel zu schnell.
„Trink!“ forderte er seinen Bruder auf.
Johann griff mit zitternden Fingern nach dem Glas, schnupperte an dem Lik├Âr und verzog dann das Gesicht.
„Woher hat Tante Henriette diesen seltsamen Lik├Âr?“, wollte er wissen.
„Keine Ahnung! Wahrscheinlich hat der Onkel ihn selbst destilliert, aber ist eigentlich egal.“ Peter machte┬á eine einladende Geste. „Augen zu und runter damit!“
Noch immer z├Âgerte der Bruder und Peter sagte sich, dass er mit gutem Beispiel vorangehen m├╝sse. Er kippte den Inhalt des Glases hinunter und endlich tat Johann es ihm gleich. Die Fl├╝ssigkeit brannte so h├Âllisch im Rachen, dass Peter die Tr├Ąnen in die Augen schossen. Eine Welle der ├ťbelkeit schlug ├╝ber ihn zusammen. Das Blut pulsierte wie Feuer in seine Adern. Seine Kehle war rau und schmerzte und er wurde von einem Hustenanfall gesch├╝ttelt. Als er wieder zu Atem kam, bemerkte er, dass auch Johann ger├Âtete Augen hatte.
„Was war das f├╝r ein Teufelszeug?“, fuhr ihn der Bruder mit bebenden Lippen an. „Sag mal, willst du mich vergiften?“
Peter griff nach der Flasche auf dem Tisch, doch dieser schwankte bedenklich. Erst im zweiten Anlauf bekam er die Lik├Ârflasche zu fassen. Auf dem Bauch des durchsichtigen Glases klebte ein handbeschriftetes Etikett.
„Ma, Ma, rillenschnaps“, las er m├╝hsam vor und wurde vor Schreck wieder fast n├╝chtern. „Wieso das? Ich denke, in den Flaschen soll Lik├Âr sein?“
„Konntest du das nicht vorher ├╝berpr├╝fen?“, beschwerte sich Johann.
Peter verstand immer noch nicht, warum in der Flasche Schnaps war. Hatte die Mutter nicht etwas von Marillenlik├Âr gesagt? Obwohl ihm schrecklich schwindlig war, erhob er sich und wankte zur Anrichte, wo die anderen Flaschen standen. Die meisten von ihnen bestanden seltsamerweise aus get├Ântem Glas. Sich auf die Anrichte aufst├╝tzend, betrachtete Peter das Etikett einer der Flaschen und er las: „Marillenlik├Âr“.
„Verdammt!“, fluchte er laut, als er realisierte, dass er schlicht die falsche Flasche erwischt hatte.┬á
Frustriert lie├č er sich wieder auf seinen Stuhl fallen. Noch immer brannte sein Magen und der Boden unter im bebte, als bef├Ąnde er sich auf einem Schiff.
„Meinst du, dass der Schatten zur├╝ck kommt?“, fragte Johann unvermittelt.
Er sah Peter mit glasigen Augen an, den Kopf auf die H├Ąnde gest├╝tzt.
„Nein, er f├╝rchtet sich vor dem┬á┬á ….┬á Licht“, behauptete Peter, der einen Augenblick lang erwog, dass tats├Ąchlich ein ruheloser Schatten seinen Bruder verfolgte.
Alles in Peter str├Ąubte sich gegen diese Vorstellung, aber das Verschwinden des Morgenmantels gefiel ihm gar nicht.
„Ich meine nicht nur heute!“┬á
Johann hob abwehrend die Hand und seine Lippen bebten.
„Wir bringen die Mumie nach ├ägypten zur├╝ck“, h├Ârte Peter sich selbst sagen und seine Stimme wurde immer lauter. Er hielt sich die Ohren zu, da er das dr├Âhnende Echo im Kopf nicht ertrug. „Dann ist sie wieder …┬á friedlich.┬á ….Au├čerdem hat Doktor …. Doktor ….. Sommer dir empfohlen zu verreisen ┬á….┬á┬á┬á Dann k├Ânnen Moritz und seine, seine, seine … Kumpanen┬á … die┬á Mumie nicht auswickeln … “
„Das klingt┬á ….. vern├╝nftig. Vielleicht l├Ąsst sie mich dann wirklich in Ruhe …“ Peter fragte sich, ob ihm seine vom Alkohol benebelten Sinne einen Streich spielten. Hatte sein Bruder ihm tats├Ąchlich zugestimmt? Er hatte mit mehr Widerstand gerechnet. Offenbar hatte der Obstbrand Johanns Lebensgeister wieder etwas geweckt, denn Peter glaubte einen Anflug von Hoffnung in den vom Alkohol ger├Âteten Z├╝gen seines Bruders zu bemerken „Aber wo sollen wir hin? ├ägypten ist sehr┬á┬á ….┬á gro├č.“
„Nach Alexandria zu … Priester Menas“, erwiderte Peter, sich dabei an der Tischkante festhaltend, weil er bef├╝rchtete vom schaukelnden Stuhl zu kippen. Aber ganz pl├Âtzlich konnte er wieder einigerma├čen artikulieren. „Ihn hat Vater in seinen Briefen erw├Ąhnt, jedenfalls so lange er noch geschrieben hat …“
„Du hast die Fahrt schon geplant?“, unterbrach Johann, auch er vor Schreck schlagartig ern├╝chtert. “Du hast dir den seltsamen Namen wohl nicht zuf├Ąllig gemerkt!“
Peter nickte bed├Ąchtig und er f├╝hlte sich, als ob sein Hirn im Sch├Ądel herumschwappte.
„Ich habe sogar schon die P├Ąsse besorgt.“┬á
„Aber, was wird Mutter dazu sagen?“, frage Johann und auch Peter sah im gleichen Augenblick ihr vorwurfsvolles Gesicht vor sich. Sie w├╝rde alles in ihrer Macht stehende tun, um die Reise der S├Âhne zu sabotieren. Also w├╝rde ihnen nichts anderes ├╝brig bleiben als heimlich zu verschwinden.
„Wir sind beide gro├čj├Ąhrig! Sie kann es uns nicht verbieten!“, erkl├Ąrte er mit gr├Â├čerem Optimismus als er empfand. „Also kommst du mit?“
Sein Gegen├╝ber nickte.
„Von mir aus“, antwortete er matt. „So geht es jedenfalls nicht weiter.“
Einen Augenblick lang fehlten Peter die Worte. „Ich hatte schon bef├╝rchtet, dieser Traum k├Ânnte …“ Peter stockte. Der Traum k├Ânnte was? Johann den Rest gegeben haben? Endg├╝ltig gezeigt haben, dass er nicht richtig tickte?
„Er hat mir einen Ausweg gezeigt“, erg├Ąnzte Johann, „Der Schatten l├Ąsst mich nur in Frieden, wenn ich seinen Wunsch erf├╝lle.“┬á
Peter hoffte, dass Johann seine Meinung nicht revidieren m├Âge, wenn er wieder n├╝chtern war.
 
Der Marillenlik├Âr
5. Der Marillenlik├Âr
Vor dem Haus der Berggruens hielt eine Kutsche, auf deren T├╝ren als Emblem ein wei├čer Schwan gemalt war und ein Schwarm Kr├Ąhen flog vom L├Ąrm der quietschenden Bremsen verschreckt auf. Wenige Sekunden sp├Ąter wurde die Haust├╝r ge├Âffnet und die Hausherrin selbst schritt durch den Vorgarten, um den Besuch zu empfangen.
„Du bist sp├Ąt dran, August“, sagte sie zu dem korpulenten Fahrgast, der sich scherf├Ąllig durch die T├╝r der Kabine schob.
„Tut mir leid, aber mir ist etwas dazwischen gekommen“, brummte der so angesprochene und betupfte sich die verschwitze Stirn mit einem gro├čen, schmuddeligen Taschentuch.
Charlotte vermutete eher, dass der Schwager nicht auf seinen Mittagsschlaf verzichten wollte. Vielleicht glaubte er auch, seinen Auftritt eindrucksvoller zu gestalten, wenn er auf sich warten lie├č.
Dazu wollte aber seine Aufmachung nicht recht passen: Der schwarzer Gehrock war schon abgetragen und verblichen und der Hut war l├Ąngst au├čer Mode. War die Apotheke weniger ertr├Ąglich war als die Schwester behauptete oder war der Schwager schlicht geizig? Charlotte sagte sich, dass sie dem Apotheker gegen├╝ber nicht voreingenommen sein durfte, nur weil die Schwester mit ihm angab.┬á┬á
„Die Mumie ist im Keller“, erkl├Ąrte sie ohne weitere Umschweife, da ihr nach der enervierenden Warterei die Lust auf small talk vergangen war.
W├Ąre der Schwager nur eine halbe Stunde fr├╝her gekommen, so h├Ątte sie ihm einen Cognac angeboten, aber nun war es daf├╝r zu sp├Ąt, denn die Arbeit musste erledigt sein, bevor die S├Âhne von der Universit├Ąt zur├╝ckehrten.
„Ich habe Fritz mitgebracht, meinen Lehrling“, erkl├Ąrte August, als ein schlaksiger Junge von etwa f├╝nfzehn Jahren aus der Kutsche stieg, den Charlotte zuvor nicht bemerkt hatte. Seine viel zu weite Kleidung hatte ihm sicher die Mutter mit dem Argument verpasst, dass er in sie noch hineinwachsen w├╝rde.┬á
„Guten Tag, Frau Berggruen“, gr├╝├čte er, „das hat mir die Apothekerin f├╝r Sie mitgegeben.“
Er hob einen Korb, der mit Flaschen gef├╝llt war auf den B├╝rgersteig. „einige Flaschen mit Marillenlik├Âr.“
Charlotte fragte sich, ob der Schwager sich sein Sal├Ąr mit Schwarzbrennerei aufbesserte, aber vielleicht war dies auch bei einem Apotheker v├Âllig legal. Sie wollte den Korb anheben, doch sie bekam ihn nicht von der Stelle, so schwer war er.
„Das mache ich schon!“ Wie selbstverst├Ąndlich hatte der magere Lehrling sich des Korbes angenommen, w├Ąhrend der korpulente Apotheker zum Haus voranschritt. Charlotte warf noch einen pr├╝fenden Blick die Stra├če hinunter und eilte hinterher.
„Stell bitte die Flaschen auf die Anrichte in der K├╝che“, erkl├Ąrte sie und dirigierte den Jungen durch den Flur.
Als sie die T├╝r aufriss, fuhren zwei Frauen vor Schreck zusammen. Es waren Elise und die neue Gouvernante, die Charlotte f├╝r Sophie engagiert hatte. Sie sa├čen am Tisch, tranken Kaffee und schwatzten.
„Bist du schon mit dem Pl├Ątten fertig?“, wollte Charlotte wissen, die sich fragte, was der Schwager von einem Haushalt denken sollte, in dem die Dienstboten am hellerlichten Tag in der K├╝che faulenzten.┬á
Mit einer genuschelten Entschuldigung huschte Elise durch die T├╝r, w├Ąhrend Miss MacIntosh vorgab, kein Deutsch zu verstehen. Dabei hatte sie sich doch eben noch gl├Ąnzend mit dem Hausm├Ądchen verstanden.
Ohne die Schottin eines Kommentars zu w├╝rdigen verlie├č Charlotte die K├╝che, gefolgt von Fritz und dem Schwager. Sie holte eine ├ľllampe, z├╝ndete sie an und schloss die Kellert├╝r auf, die zu ├Âffnen sie einige M├╝he kostete.
„Vorsichtig, die Decke ist sehr niedrig“, warnte sie die beiden anderen, nachdem es ihr endlich gelungen war.
Dann stieg sie langsam die Treppe hinab, wobei sie sich bemühte, den Saum ihres Kleides nicht über die schmutzigen Stufen schleifen zu lassen. Sonnenstrahlen fielen von der Kellertür herab und durchdrangen die staubige Luft. Es roch nach Vermodertem und kaltem Rauch, aber die Luft fühlte sich angenehm kühl an auf Charlottes verschwitzter Stirn. 
Unten angelangt schaute sie sich - mit der Lampe in alle vier Richtungen leuchtend - um, denn es war schon eine Weile her, dass sie das letzte Mal im Keller gewesen war. Damals standen hier nur ein Paar Weinkisten, w├Ąhrend nun ein zum Stauraum unfunktionierter Gang zur Linken voller Regalbretter war, die mit Baumwollt├╝chern abgedeckt waren. Auch die Wand zur Rechten verschwand hinter Regalen, die mit Schachteln und Kisten beladen waren. Charlotte wollte lieber gar nicht wissen, was Peter hier alles deponierte hatte. Offenbar hatte er den Keller in eine ├Ągyptische Gruft verwandelt. Charlotte schauderte es. Dann rief sie sich ins Ged├Ąchtnis, dass sie hier nicht l├Ąnger als n├Âtig verweilen sollte, denn die Mumie musste schleunigst aus dem Haus gebracht werden.
„Da drin ist sie!“. Charlotte deutete auf einen sperrigen Gegenstand, direkt neben dem Treppenabsatz. „Lasst die Versandkiste stehen, dann bemerken die Jungs es vielleicht nicht gleich …. und auch die bemalte Kiste, vermutlich ist sie ziemlich wertvoll, aber die Mumie k├Ânnt ihr haben.“
Die grob gezimmerte Versandkiste aus Fichtenholz war vollkommen unscheinbar, eigentlich wie jede beliebige andere Kiste. Es k├Ânnte Porzellan darin gelagert sein oder auch ├äpfel. Was hatte nur Johann in der Kiste gesehen, dass es ihn halb zu Tode erschreckt hatte?
„Sehen wir mal!“, erkl├Ąrte der Schwager, als er mit angespanntem Gesichtsausdruck den Deckel der Kiste anhob.
Charlotte stand hinter ihm und leuchtete hinein. Im flackernden Schein der Lampe sah sie eine menschengestaltige, buntbemalte Kiste. Die Bilder, mit denen sie verziert war, hatten sicher irgendetwas mit der Mumie zu tun.
„Mein Gott, ist das schaurig“, murmelte der Lehrling und Charlotte Berggruen wurde ganz pl├Âtzlich von einem Schwindel ergriffen.
Sie musste sich mit einer Hand an der Wand abst├╝tzen, da ihr der Boden unter den F├╝├čen schwankte. Das war sicher nur die staubige Luft im Keller, dachte sie und tadelte sich selbst daf├╝r, dass es auch sie einen Augenblick lang gegraut hatte. Schlie├člich war sie eine Mutter von drei Kindern und kein unreifer Junge, der zu viele Schauerromane konsumiert hatte!┬á┬á
Die Kellert├╝r ├Âffnete sich mit einem lauten, knarrenden Ger├Ąusch und Charlotte fuhr vor Schreck zusammen.
„Frau Berggruen!“, rief eine leicht hysterische, weibliche Stimme durch den Schacht des Treppenhauses.
Charlotte drehte sich um und sah das Hausm├Ądchen mit sorgenvollem Gesicht vor der obersten Stufe stehende.
„Ja Elise?“, rief Charlotte unwirsch zur├╝ck, „was um Gottes Willen ist los? Musstest du mich so erschrecken?“
┬á„Peter, ├Ąh … der ├Ąltere Herr Berggruen kommt gerade auf das Haus zu!“
Fast h├Ątte Charlotte laut geflucht. An diesem Tag ging aber auch alles daneben!
„Bitte r├╝hrt euch nicht, bis ich Bescheid gebe“, instruierte sie die beiden M├Ąnner und erschrak dar├╝ber, wie schrill ihre eigene Stimme klang.┬á
Sie ├Ąrgerte sich ├╝ber sich selbst, dass sie Peter nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellte. Schlie├člich war sie seine Mutter. Aber es war ihr uns├Ąglich peinlich, sich vor dem Schwager mit ihrem Sohn herumzustreiten.
„Aber, meine Liebe!“, protestierte der beh├Ąbige Apotheker, „Das halte ich aber f├╝r etwas ├╝bertrieben. Du meinst doch nicht ernsthaft, dass wir hier unten warten sollen?“
„Es muss sein“, insistierte die Hausherrin und stieg so schnell es ihr schweres, langes Kleid zulie├č die Kellertreppe hinauf.
Es gelang ihr gerade noch, die T├╝r hinter sich zu schlie├čen und die Laterne zu l├Âschen, bevor Peter seinen Schl├╝ssel im Schloss herumdrehte und die Wohnungst├╝r ├Âffnete.
Sie schritt ihm entgegen und versperrte ihm dabei den Weg zur oberen Etage, denn sie musste ihn schnellstm├Âglich dazu bewegen, das Haus wieder zu verlassen.
„Du bist schon zur├╝ck?“, fragte sie und versuchte dabei zu l├Ącheln.
„Meine Vorlesung ist ausgefallen“, erkl├Ąrte Peter seiner Mutter, die w├Ąhrenddessen mit gr├Â├čtm├Âglicher Beil├Ąufigkeit einen Brief von der Ablage neben der T├╝r aufhob.
Peter nahm seinen Ranzen ab und warf ihn in die Ecke. Seine Mutter sp├╝rte, dass ihn etwas bek├╝mmerte, aber momentan hatte sie keine Zeit, um sich dar├╝ber Gedanken zu machen.
„Wieso steht eigentlich die Kutsche der Schwanenapotheke vor der T├╝r? Hat Onkel August in der Gegend Gesch├Ąfte?“, fragte Peter und seine Mutter erschrak.
Die Kutsche mit dem Emblem der Schwanen-Apotheke, die hatte sie v├Âllig vergessen. Wieder verfluchte sie die Unp├╝nktlichkeit des Schwagers.
„Ja, er liefert in der Nachbarschaft ein Medikament aus“, log sie mit einem etwas angestrengtem L├Ącheln, „und da hat meine Schwester ihn gebeten, uns etwas von ihrem Marillenlik├Âr mitzubringen.“
Peter versuchte an seiner Mutter vorbeizugehen, aber sie fiel ihm in den Arm.
„Du kommst wie gerufen!“,┬á erkl├Ąrte sie mit viel zu viel Pathos.
Aus dem Keller drang dumpfes Gepolter und Charlotte Berggruen hoffte, dass ihr Sohn es nicht geh├Ârt hatte. Sie ├╝berreichte ihm den Brief, den sie in der Hand hielt.
„Ich habe versprochen, auf den Onkel zu warten, aber dieser Brief muss ganz dringend zur Post gebracht werden. K├Ânntest du dies nicht f├╝r mich erledigen?“
„Selbstverst├Ąndlich“, erwiderte Peter und seine Mutter dr├╝ckte ihm ein paar M├╝nzen in die Hand.
Leider hatte sie keine Ahnung, was eine Briefmarke kostete, denn normalerweise erledigte dergleichen das Hausm├Ądchen, aber sie hoffte, dass es f├╝r einen Brief ausreichend war.
„Einen Augenblick noch“, sagte Peter und ging in Richtung K├╝che.
Als er die Kellert├╝r passierte, blieb er einen Moment stehen und seiner Mutter stockte der Atem. Hatte der L├Ąrm im Keller von vorhin den Argwohn ihres Sohns geweckt? Mit angespanntem Gesichtsausdruck lauschte Peter, aber gl├╝cklicherweise war von unten nichts zu h├Âren.
Dann betrat er die K├╝che und sein Blick glitt suchend durch den Raum glitt. Seine Mutter bekam ein mulmiges Gef├╝hl im Magen und wieder fragte sich, ob er etwas ahnte. Doch dann schnappte Peter sich einen Apfel und wandte sich endlich zum Gehen.
„Du kannst dir nachher auch zur Belohung eine Flasche Lik├Âr nehmen!“, rief seine Mutter ihm mit zuckers├╝├čer Stimme nach und beobachtete erleichtert, wie Peter das Haus verlie├č. Die T├╝r fiel leise hinter ihm zu.
Charlotte Berggruen schlich zum Fenster und stellte sich einen Schritt hinter den Vorhang, sodass man sie von drau├čen nicht erkennen konnte. Mit angehaltenem Atem beobachtete sie ihren Sohn, der herzhaft in den Apfel biss und dabei die Kutsche des Apothekers be├Ąugte. Dann machte er sich endlich auf den Weg. Seine Mutter wartete, bis er um die Ecke gebogen war. Erst dann ging sie zur Kellert├╝r uns riss sie auf.
„Was ist denn da unten los“, rief sie ins Dunkel.
„Was soll schon los sein?“, antwortet der Apotheker mit h├Ârbarer Emp├Ârung. „Du hast uns im Finstern warten lassen und da bin ich mit dem Ellbogen gegen ein Regalbrett gesto├čen.“
Mit einem leisen Seufzer stieg Charlotte wieder in den Keller hinab. Der Schwager hielt seinen Hut in seinen fleischigen H├Ąnden und sein Lehrling war etwas blass um die Nase.
„Wogegen bist du gesto├čen?“, fragte Charlotte und versuchte, nicht ungehalten zu klingen.
Der Apotheker machte eine vage Kopfbewegung nach links und rieb sich dann anklagend seine schmerzende Stelle am Ellbogen.
Die Hausherrin schaute sich um, ob die beiden irgendeinen Schaden angerichtet hatten, aber sie konnte keine Ver├Ąnderung zu vorher feststellen, was aber nichts hei├čen mochte, bei dem Chaos, das hier unten herrschte.┬á
„Jetzt beeilt euch!“, ermahnte sie die M├Ąnner. „In zehn Minuten m├╝sst ihr wieder verschwunden sein. Dann kommt mein Sohn schon wieder zur├╝ck, denn die Post ist gerade um die Ecke!“
Der Schwager murmelte etwas von „heutiger Jungend“ und von „vers├Ąumter Erziehung“ und machte sich mit seinem Lehrling an die Arbeit.
 
W├Ąhrend Peter auf dem Weg zur Post rein mechanisch einen Fu├č vor den anderen setzte f├╝hlte er geradezu k├Ârperlich, dass zu Hause etwas nicht stimmte. Warum war die Mutter so nerv├Âs gewesen? Es war ganz un├╝bersehbar gewesen, dass er sie bei irgendetwas gest├Ârt hatte. Einen Augenblick lang ├╝berlegte er, ob sie ein Verh├Ąltnis mit Onkel August haben k├Ânnte. Dann musste er ├╝ber seine eigene Idee innerlich lachen, so absurd war sie: die elegante Mutter und der dicke Apotheker! Aber warum stand seine Kutsche dann am hellerlichten Tag vor dem Haus?┬á
Noch immer vor sich hingr├╝belnd stieg er die Freitreppe hoch, die zum Eingang des Postgeb├Ąudes f├╝hrte. Er ├Âffnete die T├╝r und stellte sich am Schalter an. Peter lie├č seinen Blick durch die ├╝berf├╝llte Schalterhalle schweifen. Seltsam, dass um die Mittagszeit hier so viel los war! Offenbar hatte heute die ganze Stadt dringende Briefe verfasst.
Wieder dachte er an ├ägypten. Der ├Ąrztliche Ratschlag hatte in ihm eine Saite zum Erklingen gebracht, die nicht sofort wieder verstummen wollte. Als er dem Bruder spontan vorgeschlagen hatte, mit ihm ins Land der Pharaonen zu reisen, hatte er sich ├╝ber seine eigenen Worte gewundert. Zwar f├╝hlte er sich seit der R├╝ckkehr seines Vaters von der Kultur des alten ├ägyptens angezogen, aber diese Zuneigung war bisher rein platonischer Art gewesen.
Doch, warum sollte er eigentlich nicht nach ├ägypten fahren? Je l├Ąnger er dar├╝ber nachdachte, desto besser gefiel ihm diese Vorstellung. Und, wenn der ├Ąngstliche Bruder zuhause bleiben wollte?
Dann musste er eben ohne Johann reisen. Schlie├člich hatte er selbst ihm diesen Vorschlag gemacht. Peter hatte mittlerweile alles gr├╝ndlich satt: die wankelm├╝tige Anneliese, die ihm noch vor einem Monat ewige Treue geschworen hatte, der Bruder, der nicht erwachsen werden wollte, die vorwurfsvolle Miene der Mutter, die sich zu einer eifrigen Kirchg├Ąngerin entwickelt hatte, die scheinheilige kleine Schwester und auch das sauert├Âpfische Gesicht von deren neuer Gouvernante aus Schottland lie├č nichts Gutes erhoffen.
Als Peter dann auch noch an seine Begegnung mit Moritz dacht, war ihm endg├╝ltig die Stimmung verdorben: Nach dem Arztbesuch hatte Peter erwogen, doch noch der Mensa einen Besuch abzustatten, als er die kr├Ąftige Figur seines Freundes Moritz gesehen hatte, der mit den Armen in der Luft herumrudernd auf ihn zugekommen war, auf dem Kopf eine Studentenm├╝tze und ├╝ber der Jacke die Sch├Ąrpe der Burschenschaft Germania.
„Wo warst Du?“, hatte dieser ihm schon aus der Ferne zugerufen. „Wir haben dich in der Mensa vermisst!“
„Ich habe die Pause mit meinem Bruder verbracht“, hatte er absichtlich etwas vage geantwortet.
„Mit dem, der …“
„Ich habe nur einen Bruder“, hatte Peter Moritz unterbrochen, da er es nicht leiden konnte, wenn andere schlecht ├╝ber Johann sprachen.
„Ehe ich es vergesse“, hatte Moritz, in einen sachlichen Ton verfallend bemerkte. „Die Vorlesung des alten Sedlmaier f├Ąllt aus. Angeblich ist er krank. Aber ich habe da aber meine Zweifel, nur eine Woche vor den Semesterferien.“
Peter hatte sofort nach Hause gehen wollen, aber Moritz hatte erkl├Ąrt, dass er unbedingt mit ihm reden wollte: „Ich habe den Kameraden von der Mumie berichtet …“ Peter hatte gehofft, dass er Moritz nicht zuviel erz├Ąhlen hatte, aber mit irgendwem musste er schlie├člich reden. Dazu waren Freunde doch da. „Theodor hat daraufhin berichtet, dass man in England neuerdings Mumien-Partys feiert. Sie werden auch Auswickel-Partys genannt. …“
„Meine Mumie wird nicht ausgewickelt!“, hatte Peter seinen Freund angefahren und sich im gleichen Augenblick gefragt, warum er „meine“ Mumie gesagt hatte. Sie geh├Ârte doch sozusagen der ganzen Familie. Trotzdem hatte Peter sie innerlich vereinnahmt, wie die anderen Altert├╝mer, die sein Vater auch ├ägypten mitgebracht hatte.┬á
„Sei doch kein Spielverderber!“, hatte Moritz ihn mit einen geradezu nachsichtigem L├Ącheln getadelt. „So eine Mumien-Party ist bestimmt sehr aufregend. Du wei├čt doch selbst, dass oft wertvolle Beigaben, wie Schmuckst├╝cke und Skarab├Ąen in die Leinent├╝cher eingewickelt sind. Theodor sagt, dass sich die Teilnehmer Schauergeschichten erz├Ąhlen um die Spannung zu erh├Âhen.“
„Per Express oder Normal?“, fragte eine barsche Stimme und unterbrach damit Peters┬á┬á Erinnerungen.
Der Brief wurde ihm f├Ârmlich aus der Hand gerissen. Peter schrak zusammen, sein Kopf fuhr hoch und er sah in das strenge Gesicht eines ├Ąlteren Postbeamten.
„Express“, stotterte er, denn schlie├člich hatte die Mutter gesagt, dass der Brief dringend sei. Zur Best├Ątigung dieser Theorie warf er einen Blick auf die Adresse, aber er konnte sie nicht entziffern. Dazu h├Ątte er unterwegs hinreichend Gelegenheit gehabt!
Der Postbeamte nannte ihm den Preis der Marke, Peter wollte bezahlen, aber die M├╝nzen, die die Mutter ihm gegeben hatte reichten nicht aus. Mit gerunzelter Stirn musterte ihn der Postbeamte, aber Peter f├Ârderte schlie├člich aus seiner Hosentasche den fehlenden Kreuzer heraus.
Dann verlie├č er das Postgeb├Ąude und eilte auf schnellsten Weg zur├╝ck, denn mittlerweile f├╝hlte er sich schon ganz schwach vor Hunger. Der Apfel war nicht mehr als ein Tropfen auf den hei├čen Stein gewesen und auf die alten Stullen war ihm der Appetit vergangen, da sie ihn an den unerfreulichen Arztbesuch erinnerten.
Als Peter endlich das elterliche Haus erreichte, war zu seiner Entt├Ąuschung die Kutsche des Onkels verschwunden. Nun w├╝rde er wohl niemals erfahren, was sich zu Hause in seiner Abwesenheit ereignet hatte.
Ohne zu klingeln schloss er die T├╝r auf und Elise verschwand bei seinem Anblick kichernd in der K├╝che.
„Ich habe einen schrecklichen Hunger!“, rief er der Mutter zu, die im gleichen Augenblick aus dem Salon geschossen kam.
Sie sah auf die Standuhr, die anzeigte, dass es bereits halb drei war.
„Ach, du Armer hast ja noch immer nichts gegessen“, sagte sie dann und t├Ątschelte ihrem Sohn die Wange. „Elise wird dir etwas warm machen!“┬á
Sie warf dem Hausm├Ądchen, das neugierig aus der halbge├Âffneten K├╝chent├╝r herausschaute einen aufmunternden Blick zu.
„M├Âchten Sie Pichelsteiner Eintopf oder Roulade mit Rotkraut?“
„Roulade!“, antwortete Peter, ohne nachzudenken.
Seine Mutter musterte ihn und die Falten, die sich auf ihrer Stirn zu bilden begannen wurden tiefer. So sah sie Peter immer an, wenn er irgendetwas ausgefressen hatte, aber diesmal f├╝hlte er sich keinerlei Schuld bewusst. Er fand, dass die Mutter, trotz ihrer angespannten Haltung, f├╝r ihr Alter noch recht attraktiv war. Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihnen den n├Ąchsten Stiefvater pr├Ąsentieren w├╝rde. Peter schauderte es bei dem Gedanken, dass auch die Sache mit Wilhelm noch nicht ausgestanden war. Er w├╝rde es sich bestimmt nicht nehmen lassen, nach Ablauf des Trauerjahrs aus K├Ânigsberg zur├╝ckzukehren.
„Warum hast du eigentlich Moritz nicht zum Essen mitgebracht?“, fragte die Mutter unvermittelt. Das erste wirkliche L├Ącheln huschte ├╝ber ihr Gesicht. „Du wei├č, er ist in unserem Haus immer willkommen!“
Verbittert presste Peter die Lippen aufeinander
„Seit er in diese komische Burschenschaft eingetreten ist, hat er sich ver├Ąndert.“
Aus der K├╝che drang das Klappern von T├Âpfen und die Stimme des Hausm├Ądchens, das bei der Arbeit vor sich hinsummte.
„Ja so ist das im Leben“, r├Ąsonierte die Mutter, „man verliert alte Freunde und gewinnt neue hinzu.“
Warum musste Erwachsene immer derartige Gemeinpl├Ątze von sich geben, wenn sie nicht wussten, was sie sagen sollten?
Ägypten!, murmelte Peter innerlich vor sich hin, bevor er sich auf dem Weg in die Küche machte.
 
Der Spaziergang
4. Der Spaziergang
Johann verlie├č als letzter die Aula, da er sich erst einem Ruck geben musste um sich von seinem Klappstuhl zu erheben, so ersch├Âpft war er. Seine Glieder schmerzten, die Augen brannten und schon nach wenigen Schritten wurde ihm schwindlig.
Im Korridor blieb er einen Augenblick stehen, da ihn die Sonne blendete, die ihm durch das Fenster direkt in die Augen schien. Am Wochenende war endlich der Sommer eingezogen, aber Johann war dies von ganzem Herzen gleichg├╝ltig.
Im Gegenteil, die ausgelassene Stimmung der Kommilitonen, ja selbst die singenden V├Âgel auf den B├Ąumen provozierte ihn geradezu.
Er bedauerte, dass sich das Semester seinem Ende n├Ąherte, denn er war momentan f├╝r jede Ablenkung dankbar, selbst wenn es nur die in jeder Beziehung ersch├Âpfende Vorlesung ├╝ber mittelhochdeutsche Literatur war.
„Da bist du ja endlich!“
Es war Peter, der gesprochen hatte und Johann schaute sich erstaunt nach seinem Bruder um, da dieser gew├Âhnlich die Pausen mit seinem Freund Moritz verbrachte. Er fand Peter neben der Eingangst├╝r der Aula, mit dem R├╝cken an der Wand lehnend, den Ranzen l├Ąssig ├╝ber die Schulter geworfen.
„Du siehst ja schrecklich aus!“, entfuhr es ihm, als er Johann aus der N├Ąhe sah. „Hast du schon wieder einen Alptraum gehabt?“
„Nein“, beteuerte Johann und dies entsprach auch der Wahrheit. Doch war er wohl nur deshalb von schlechten Tr├Ąumen verschont gewesen, weil er fast gar nicht geschlafen hatte.
Pl├Âtzlich realisierte er, dass es Montag war.
„Aber was ist mit dir?“, fragte er zur├╝ck, „bist du nicht montags an die Tafel des Professors von Gaimersdorf geladen?“
Peter schnitt ein ver├Ąrgertes Gesicht.
„Keine Lust, dann m├╝sste ich mit seiner Tochter Anneliese sch├Ântun.“
Einen Augenblick lang fragte sich Johann, ob er sich verh├Ârt hatte.
„Aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie dir gut gef├Ąllt?“, fragte er dann vorsichtig nach, da er es nicht wagte, die Formulierung „dass du in sie verliebt bist“ laut auszusprechen.
Ein Schatten huschte ├╝ber das Gesicht seines Bruders.
„Ach, du hast es noch nicht geh├Ârt?“
„Was soll ich geh├Ârt haben?“
„Professor Friedrich von Gaimerdorf hat am Sonntag offiziell die Verlobung seiner Tochter Anneliese mit dem Rittmeister Ottmar von Semmering bekannt gegeben!“
„Was, mit dem eingebildeten Schn├Âsel? Nur, weil er eine farbige Uniform tr├Ągt!“, entfuhr es Johann und er sah vor seinem inneren Auge den blasierten, etwas d├╝mmlichen Mann, der unglaublich stolz auf seine adlige Herkunft war. „Das tut mir aber leid!“
Peter machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Nicht so schlimm“, behauptete er, aber sein ungl├╝cklicher Gesichtsausdruck strafte seine Worte L├╝gen. „Es war mir sowieso nie richtig ernst mit ihr.“
Johann lie├č die Sache auf sich bewenden, da ihm Peter mit seiner mal wieder recht abweisenden Art unmissverst├Ąndlich signalisierte, dass er nicht ├╝ber Anneliese sprechen wollte. Aber warum traf Peter sich diesen Mittag nicht mit seinem besten Freund Moritz?┬á
„Ist Moritz krank?“, fragte er vorsichtig nach. „Du isst doch sonst mit ihm in der Mensa? “
Peter warf ihm einen undefinierbaren Blick zu und wieder hatte Johann den Eindruck, etwas Falsches gesagt zu haben.
„Er hatte heute etwas anderes vor.“
Johann fragte sich noch immer, was Peter von ihm wollte, denn er sp├╝rte genau, dass es nicht die Einsamkeit war, die ihn dazu veranlasst hatte ihn vor der Aula zu erwarten.
„Ich bin ziemlich hungrig“, bemerkte er schlie├člich, eher um irgendetwas zu sagen.
„Dagegen habe ich ein probates Heilmittel. Ich habe n├Ąmlich einen Stapel Stullen dabei. In der Mensa gibt es sowieso st├Ąndig diese schrecklichen Krautwickel.“ Peter deutete auf seinen Ranzen. Dann blickte er aus dem Fenster. „Lass uns etwas die Beine vertreten. Endlich scheint die Sonne und wer wei├č wie lange noch. Ich glaube, hinter den Bergen braut sich wieder etwas zusammen.“
„Wie du willst“, erwiderte Johann fatalistisch, obwohl ihm k├Ârperliche Anstrengungen momentan geradezu zuwider waren.
Sie stiegen die Treppe hinunter, durchschritten einen langen Korridor und als sie endlich ins Freie gelangen, hatte der Wind schwarze Wolkengebirge herbeigetrieben, aber wenigstens regnete es nicht schon wieder.
„Das w├Ąre auch zu sch├Ân gewesen! Ich habe gehofft, dass das sonnige Wetter etwas l├Ąnger vorh├Ąlt“, maulte Peter und schlug den Kragen seiner Jacke hoch, um sich vor dem Wind zu sch├╝tzen.
„Gib es zu: Das war eine schwachsinnige Idee von dir, ausgerechnet heute Mittag einen Spaziergang zu machen!“, protestierte er nach ein paar Schritten, zumal er sich noch immer fragte, was sein Bruder im Schilde f├╝hrte.
„Ich konnte schlie├člich nicht ahnen, dass die Sonne so schnell wieder verschwindet“, bemerkte dieser in einem beil├Ąufigen Tonfall.
„Dann lass und doch wieder umkehren!“
„Der Spaziergang wird dir trotzdem gut tun. Du solltest nicht tagelang nur ├╝ber deinen alten B├╝chern br├╝ten. Bei diesem ungesundem Lebenswandel bek├Ąme wahrscheinlich jeder Alptr├Ąume!“
Johann ├Ąrgerte sich, dass sein Bruder das Lieblingsargument ihrer Mutter aufgriff, nur dass diese ihm immer – nicht ganz uneigenn├╝tzig – Gartenarbeit vorschlug um auf andere Gedanken zu kommen.
„Willst du damit andeuten, dass ich nicht gesund bin?“, fuhr er seinen Bruder an, hatte aber im selben Augenblick den Eindruck sich im Ton vergriffen zu haben. Schlie├člich war es Peter, der mit ihm sprach und nicht der verhasste Doktor Eisenbach.┬á
„Das habe ich nicht gesagt, aber so geht das nicht weiter mit dir!“, erwiderte Peter, der sich offenbar M├╝he gab, geduldig zu klingen. „Aber wenn du weiterhin st├Ąndig Alptr├Ąume hast, bist du bald ein einziges Nervenwrack.“
Johann verkniff sich m├╝hsam die Bemerkung, dass er nicht aus Vergn├╝gen vom Hades tr├Ąumte, denn er wusste, dass diese Argumentation zu nichts f├╝hrte. Also trottete er weiterhin die Stra├če entlang, die von H├Ąuser ges├Ąumt wurde, deren Fassaden S├Ąulen und Dreiecksgiebel vorgestellt waren.
Hier wohnen keine armen Leute, dachte er. Seltsam, dass er sich noch niemals zuvor in diese Stra├če verirrt hatte, obwohl sie sich so nah am Campus befand.
Johann bemerkte einen Balkon, der von Karyatiden getragen wurde, die unterhalb der H├╝fte mit den Pfeilern verschmolzen. Sie erinnerten Johann an Mumien. Ihm fiel ein, dass die zahlreichen B├╝cher ├╝ber ├ägypten, die Peter in der Universit├Ątsbibliothek ausgeliehen hatte, vermuten lie├čen, dass sich sein Bruder mittlerweile in der ├Ągyptischen Mythologie auskannte.
„Sag mal, du hast doch eine Menge ├╝ber ├ägypten gelesen?“, begann er vorsichtig.
„Ja, warum?“
Peters Stimme klang alarmiert, auch wenn er zu verbergen suchte, dass ihn die Frage beunruhigte.
„Da gibt es etwas, was ich mich die ganze Zeit besch├Ąftigt: Warum genau haben sich die alten ├ägypter eigentlich mumifizieren lassen? Ich wei├č, sie glaubten an eine Art Leben nach dem Tod, aber irgendwie ist das alles seltsam. …“
„Es ist nicht nur seltsam, sondern auch ziemlich kompliziert“, erkl├Ąrte Peter und die Sorge um seinen Bruder war h├Ârbarem Stolz gewichen.
„Es f├Ąngt schon damit an, die ├ägypter glaubten drei verschiedene Seelen zu haben …“
„Das h├Ârt sich f├╝r mich nach Schizophrenie an“, entfuhr es Johann.
Peter zuckte mit dem Schultern.
„Ja, ich wei├č auch nicht, ob ich alles richtig verstanden habe, vielleicht sind es auch nur verschiedene Aspekte der Seele, keine Ahnung … jedenfalls eine von ihnen - wenn ich mich richtig erinnere wird sie Ba genannt - hat die Gestalt eins Vogels. Sie braucht die Mumie┬á … als Wohnung sozusagen.“
Das war alles noch viel befremdlicher als Johann vermutet hatte.
„Was f├╝r ein Vogel?“, fragte er erstaunt nach. „Ein Rebhuhn? Eine Eule?“,
Peter sch├╝ttelte lachend den Kopf.
„Also du stellst mir Fragen! Ich bin schlie├člich kein Ornithologe. Ich wei├č nur, dass das Ba als Vogel mit Menschenkopf dargestellt wird…“
Johann kam dies vage bekannt vor.
„Dieses Bar ist also eine Art Sirene, wie die, deren Gesang Odysseus bet├Ârt hat?“
Peter verdrehte die Augen in vorget├Ąuschter Verzweiflung und warf dann seinem Bruder einen Seitenblick zu.
„Lies doch mal etwas anderes!“┬á┬á┬á┬á
„Besser als deine juristischen Schwarten!“
Peter verlangsamte seine Schritte.
„Au├čerdem hei├čt der Seelenvogel Ba und nicht Bar.“
Die Br├╝der erreichten das Ende der Stra├če und Peter bog ohne zu Z├Âgern um die Ecke und sie erreichten einen kleinen Park, wo sie auf einer Bank Platz nahmen, obwohl diese von Regen noch ziemlich feucht war.
„Ich w├╝rde gern ungest├Ârt mit dir reden“, erkl├Ąrte Peter. Er sah Johann nachdenklich von der Seite an. „Was h├Ąltst du davon, wenn wir beide nach ├ägypten fahren?“
Johann schnaubte leise.
„Also, wenn dies ein Scherz sein soll, so geht mir dein Sinn f├╝r Humor ab!“
„Keinesfalls“, erkl├Ąrte Peter und er wirkte pl├Âtzlich ganz aufgeregt. „Bald beginnen die Semesterferien und ich f├╝r meinen Fall habe genug von diesem gr├Ąsslichen Wetter.“
Johann erschrak ├╝ber den Tatendurst seines Bruders.
„Aber gleich nach ├ägypten, das ist doch bestimmt sehr teuer?“, wandte er ein, weil ihm spontan kein besseres Argument einfiel.
Peter sch├╝ttelte nachsichtig den Kopf.
„Wir k├Ânnen uns das ohne weiteres leisten.“
Noch immer war Johann alles andere als begeistert
„Aber das ist gef├Ąhrlich, denk nur an Vater!“
„Jetzt ├╝bertreibst du aber! Die Kaufleute, mit denen er gereist ist sind schlie├člich wohlbehalten zur├╝ckgekehrt.“ Wieder musterte Peter seinen Bruder von der Seite. „Au├čerdem komme ich schlie├člich mit, um dich zu besch├╝tzten.“
Johann musste lachen. Gerade sein leichtsinniger Bruder w├╝rde diese Reise nicht ungef├Ąhrlicher machen.
„Also was h├Ąltst du davon?“
„Ich werde dar├╝ber nachdenken“, erwiderte Johann mechanisch.
Aber, was sagte er da? Eigentlich musste er ├╝berhaupt nicht ├╝ber diesen absurden Vorschlag nachdenken. Was sollte er in der W├╝ste unter wilden Beduinen?
„Willst du nicht ohne mich fahren?“, fragte er ihn daher.
„Red nicht so einen Bl├Âdsinn“, erwiderte sein Bruder unwirsch. „Du bist es, der eine Luftver├Ąnderung braucht.“
Die Frau des Apothekers
3. Die Frau des Apothekers
Als Charlotte Berggruen in das leicht hochn├Ąsige Gesicht Henriettes blickte, die ihr die T├╝r ├Âffnete fragte sie sich, ob es wirkliche eine gute Idee gewesen war, der Einladung ihrer Schwester Folge geleistet zu haben. Ihr Verstand sagte ihr, dass sie wieder unter Menschen gehen sollte, aber es fiel ihr noch immer sehr schwer an ihr vorheriges Leben anzukn├╝pfen, als ob nichts geschehen w├Ąre.
„Schwarz steht dir gut, meine Liebe, aber was bist du mager geworden!“, tadelte sie die Schwester, nachdem sie sich gegenseitig begr├╝├čt und begutachtet hatten. „Du solltest wirklich mehr auf dich achten!“
Diesen prosaischen Kommentar h├Ątte sie noch nicht einmal ihrer Schwester zugetraut, die schon immer die praktischere von ihnen beiden gewesen war. Aber das Schlimmste war, dass Charlotte tief in ihrem Inneren wusste, dass Henriette nicht ganz Unrecht hatte. Sie durfte sich nicht gehen lassen, denn nun trug sie die ganze Verantwortung f├╝r die Familie.
„Wei├čt du, ich hatte in letzter Zeit andere Probleme als mich um meine ├Ąu├čere Erscheinung zu k├╝mmern“, stammelte sie, w├Ąhrend sie ihre Tochter Sophie vor sich herschiebend ihrer Schwester in den Salon folgte. Aus dem Garten h├Ârte sie das Jauchzen ihrer beiden Nichten, die sich auf der Schaukel vergn├╝gten.
„H├Ąnde aus den Taschen!“, ermahnte sie Sophie, die sich err├Âtend nach ihr umdrehte. Aber sie durfte sich ob solcher Manieren nicht wundern, hatte sie sich doch allzu lang die Erziehung ihrer Tochter vernachl├Ąssigt.┬á
Im Salon war bereits der Tisch gedeckt und das k├Âstliche Aroma von frisch aufgebr├╝htem Kaffee stieg Charlotte in die Nase. Auch der Kuchen, der auf Porzellanplatten aufgebaut war stellte alles in den Schatten, was Elise jemals fabrizierte hatte.
Hier war ├╝berhaupt alles gediegen: Die Einrichtung, der Vorhang, die Stofftapeten und der Konzertfl├╝gel in der Ecke. An dem Boden lag ein echter Orientteppich und an W├Ąnden hingen moderne Gem├Ąlde. Sie zeigten italienische Landschaften und Portr├Ąts der Familie des Hausherrn.┬á┬á
Charlotte dirigierte ihre Tochter auf einen Stuhl mit dem R├╝cken zur Wand und nahm selbst an der gegen├╝berliegenden Seite des Tisches Platz. Das Dienstm├Ądchen schenkte den beiden Schwestern Kaffee ein, verschwand dann kurz in der K├╝che und kam mit einer gro├čen Tasse Kakao f├╝r Sophie zur├╝ck.
Charlotte griff nach der Tortenschaufel und platzierte auf den Teller ihrer Tochter - echtes Mei├čener Porzellan, wie sie nicht ohne Neid feststellte - ein St├╝ck der Erdbeertorte, der diese bereits begehrliche Blicke zugeworfen hatte. Dann hievte sie h├Âflichkeitshalber mit der Kuchengabel ein St├╝ck Schwarzw├Ąlder Kirschtorte auf den eigenen Teller, obwohl sie eigentlich gar keinen Appetit hatte. Sie schob sich einen Bissen in den Mund und war angenehm ├╝berrascht. Die Torte schmeckte noch besser als sie aussah, sie war s├╝├č, aber nicht zu zuckrig und so locker, dass sie auf der Zunge verging.
„Ach, du Arme, wie geht es dir denn?“, fragte die Schwester mit einer leicht ├╝bertriebenen Freundlichkeit.┬á
Charlotte machte kauende Mundbewegungen, um nicht augenblicklich antworten zu m├╝ssen, denn noch immer stiegen die Tr├Ąnen in ihr hoch, wenn sie von Bernhard sprach.
„Es geht so“, behauptete sie schlie├člich. „Irgendwie geht das Leben weiter. Au├čerdem habe ja noch die Kinder, um die ich mich k├╝mmern muss.“
Ihr Blick streifte die mampfende Sophie. Dann zeigte sie auf die angeschnittene Torte, die vor ihr stand. 
„Meinst du deine K├Âchin kann mir das Rezept daf├╝r aufschreiben?“, frage sie, um dem Gespr├Ąch eine andere Wendung zu geben.
„Das meinst du doch nicht ernst? Eine erstklassische K├Âchin verr├Ąt niemals ihre Rezepte!“, entfuhr es der Schwester und sie warf Charlotte einen missbilligendem Blick zu.
„Ja, um deine K├Âchin bist du wirklich zu beneiden“, gab Charlotte zu.
„Eine solche K├Âchin k├Ânntest auch du heute haben, wenn du nur den richtigen Mann geheiratet h├Ąttest. Ich habe dich von Anfang an vor diesem Bernhard Berggruen gewarnt und wie du siehst, habe ich Recht behalten.“┬á
Charlotte versp├╝rte den spontanen Drang Bernhard zu verteidigen, aber dies war leichter gesagt als getan.
„Er war kein schlechter Ehemann …“ Noch immer fiel es ihr schwer von ihm in der Vergangenheitsform zu sprechen. Das hatte sie in all den langen Jahren niemals getan, noch nicht einmal, nachdem sie Wilhelms Heiratsantrag angenommen hatte. „Ich meine, bevor er nach ├ägypten abgereist ist.“
Die Schwester sch├╝ttelte missbilligend den Kopf und warf ihr dann einen „was soll aus der Armen nur werden?“-Blick zu.
„Er war ein Rumtreiber“, stellte sie sachlich fest. „Mein August hingegen, der hat Verantwortungsgef├╝hl. Seine Apotheke ist die beste und eintr├Ąglichste der ganzen Stadt.“
Das war exakt, was auch Charlotte ihrem Mann immer vorgeworfen hatte, aber aus dem Munde der Schwester h├Ârten sich diese Worte pl├Âtzlich ganz anders an.
„Du kanntest ihn eben nicht so wie ich!“, entfuhr es ihr. „Tag und Nacht qu├Ąlt mich nun die Frage, warum er erst so sp├Ąt …“
Charlotte beendete den Satz nicht, denn sie wollte nicht vor den Augen ihrer Tochter weinen. Mittlerweile bereute sie, diese mitgenommen zu haben, aber Wilhelm war noch immer mit dem Packen seiner Habseligkeiten besch├Ąftigt und Charlotte wollte nicht, dass die Kleine zwischen die Fronten geriet. Sophie war immer seine Lieblingssch├╝lerin gewesen und dabei hatte Charlotte den Hauslehrer doch nur engagiert, weil sie mit Peter nicht mehr fertig geworden war. Aber dies hatte aber nichts daran ge├Ąndert, dass der Junge von Tag zu Tag rebellischer geworden war. Peter hatte von Anfang an gegen Wilhelm aufgegehrt und nach ihrer Verlobung keinen Hehl daraus gemacht, dass er ihn als Stiefvater nicht akzeptieren w├╝rde.
„Ich lerne jetzt Franz├Âsisch“, kr├Ąhte Sophie, die bemerkt hatte, dass die Mutter sie ansah, „das kann nicht einmal der Johann.“┬á
Ihre Schwester geizte nicht mit Komplimenten, aber Charlotte erkannte, dass in Anwesenheit Sophies keine ungest├Ârte Unterhaltung mit Henriette m├Âglich war.
„Willst du nicht mit deinen Cousinen spielen?“, forderte ihre Tochter daher auf. „Sie sind schon im Garten.“┬á
„Du hast Recht, bei diesem sch├Ânen Wetter sollte Sophie ihnen Gesellschaft leisten“, stimmt die Schwester zu. „Dieser Lenz war doch arg verregnet.“
Sophie widersprach nicht, im Gegensatz zu Peter gab sie eigentlich niemals Widerrede, aber sie zog ein Gesicht, als ob sie jeden Augenblick losheulen w├╝rde. Sie warf einen steinerweichenden Blick auf den Kuchen und die Tante versprach ihr etwas davon aufzuheben.
Erst als sich die Zimmert├╝r endlich von au├čen geschlossen hatte begann Charlotte zu sprechen, aber alles, was sie herausbrachte war eine banale Alltagsfeststellung.
„Ich werde mich wohl demn├Ąchst nach einem neuen Hausarzt umsehen.“
„Warum?“
„Vielleicht h├Ątte ein anderer Arzt Bernhard retten k├Ânnen.“
Die Schwester sch├╝ttelte mit einer geradezu nachsichtigen Miene den Kopf.
„Wahrscheinlich h├Ątte ihn auch der Leibarzt des Kaisers nicht kurieren k├Ânnen.“ Charlotte sah ihr an, dass sie Bernhards Tod f├╝r keinen besonders schweren Verlust f├╝r die Menschheit hielt. „August hat jedenfalls vollstes Vertrauen in Doktor Winter, du wei├čt, wieviel er von Medizin versteht.“
Ohnm├Ąchtige Wut stieg in Charlotte auf, aber sie versuchte sie zu bek├Ąmpfen, denn sie hatte noch immer nicht ├╝ber das fatale Mitbringsel ihres Mannes gesprochen. Nicht nur, dass der gro├če Kasten im Keller ihren j├╝ngeren Sohn noch immer beunruhigte, sondern Charlotte konnte nicht an die Mumie denken, ohne dass das Bild ihres Mannes in ihr aufstieg, der fiebernd auf seinem Bett lag. Leichtsinnigerweise hatte sie Peter erlaubt, den Inhalt der anderen Kisten zu behalten, aber die Mumie musste verschwinden und zwar so schnell wie m├Âglich.
„Ich verstehe dich wirklich nicht mehr.“ Die Schwester musterte Charlotte missbilligend. „Auf dem Friedhof habe ich meinen Augen nicht getraut, als ich dich verschleiert und wild schluchzend gesehen habe. Wolltest du nicht noch letzten Monat erneut in den Ehestand eintreten? Warum nimmst du dir dann den Tod deines treulosen Mannes so zu Herzen? Du hattest ihn doch schon vor langem verloren. Er war doch l├Ąngst ein Fremder f├╝r dich und f├╝r deine armen Kinder.“┬á┬á
Die Schwester warf Sophie durch die Terrassent├╝r einen mitleidigen Blick zu, w├Ąhrend sie lachend und unbeschwert mit den Cousinen im Garten spielte.
„Ach das verstehst du ja doch nicht!“, entfuhr es Charlotte.
Besa├č Henriette wirklich nicht genug Phantasie um sich vorstellen zu k├Ânnen, dass sie Bernhard geliebt hatte? Dass sie all die Jahre gehofft hatte er k├Ânnte doch noch zur├╝ckkehren?
„Was machen eigentlich deine beiden S├Âhne?“, wollte die Schwester unvermittelt wissen und Charlotte war einen Augenblick lang verbl├╝fft ├╝ber den abrupten Themenwechsel.
„Soweit geht es Ihnen ganz gut, …glaube ich jedenfalls.“ Charlotte musste sich eingestehen, dass sie schon lange nicht mehr wusste, was in ihnen vorging. Au├čerdem ging es die Schwester nichts an, dass Johann noch immer v├Âllig am Boden zerst├Ârt war. „Peter ist neuerdings ganz fasziniert von ├ägypten. Er hat darauf bestanden den gesamten ├Ągyptischen Plunder, den Bernhard mitgebracht hat auf sein Zimmer zu schaffen. Der Raum ist jetzt voller staubiger Regale, angeh├Ąuft mit Gef├Ą├čen, mit G├Âtzenbildern und Fig├╝rchen von schrecklichen Tieren, nur die Mumie …“
„Und Johann?“, unterbrach die Schwester.
Charlotte seufzte laut h├Ârbar, nicht nur weil sie sich Sorgen um Johann machte, sondern auch, weil sie die Schwester nur besucht hatte um ├╝ber die Mumie zu reden und nun lie├č Henriette sie nicht zu Worte kommen.
„Johann ist noch immer schrecklich blass und schmal. Und stell’ dir vor, er findet seine Vorlesungen langweilig! Wo er doch unbedingt Germanistik studieren wollte!“, erg├Ąnzte sie mit ihrerseits einen Blick auf die Terrasse werfend, denn ihre Tochter hatte ihr diese Neuigkeit kolportiert.
Sie tat dies mit ambivalenten Gef├╝hlen, denn einerseits war sie froh, dass sie aus dem Munde┬á ihre Tochter erfuhr, was ihre S├Âhne trieben, aber andererseits konnte sich des Verdachtes nicht erw├Ąhren, dass Sophie diesen im Gegenzug alles kurz und klein berichtete, was sie ├╝ber sie selbst in Erfahrung gebracht hatte. Dieses neugierige Kind erinnerte sie fatal an ihre eigene Mutter, Gott hab sie selig.
„Ja, Ja, deine S├Âhne sind ganz nach deinem Mann geraten“, kommentierte die Schwester sarkastisch, „aber die kleine Sophie ist ein richtiges Goldst├╝ck.“
Sie beugte sich vor und winkte ihrer Nichte zu.
Charlotte sagte sich, dass sie endlich zur Sache kommen musste, denn sie war ver├Ąrgert ├╝ber die st├Ąndigen Sticheleien der Schwester.┬á
„Leider haben wir auch noch immer diese grauenhafte Mumie im Keller“, erkl├Ąrte sie daher ohne Umschweife. „Kennst du vielleicht jemanden, der sie in einem Museum schenken oder eine Wunderkammer bringen kann?“
„Wo denkst hin?“, meinte die Schwester und stopfte ein halbes St├╝ck Kuchen auf einmal in sich hinein. „Da wei├č ich etwas Besseren. ├ťberlass sie doch meinem Mann f├╝r seine Apotheke. Er macht dir bestimmt einen guten Preis. Zwar ist Mumia als Heilmittel etwas aus der Mode gekommen, aber, wenn nichts anderes hilft dann….“
„Warum hat mir das niemand gesagt?“ Charlotte Berggruen f├╝hlte sich ganz pl├Âtzlich elend. „Vielleicht h├Ątte dies Bernhard retten k├Ânnen!“
Ihre Schwester verdrehte die Augen.
„Also, Charlotte, ich muss mich doch sehr wundern. Du willst doch nicht allen Ernstes sagen, dass du an so einen Hokuspokus glaubst?“
„Wie du schon sagtest“, murmelte sie, „wenn es die einzige Hoffnung ist die noch bleibt, dann h├Ątte ich auch ihm auch Mumia verabreicht …“
Charlotte wandte sich ab und schaute aus dem Fenster, damit ihre Schwester nicht sah, dass ihre Augen in Tr├Ąnen schwammen.
„Willst du noch eine Tasse Kaffee?“, fragte diese nach einigen Augenblicken des Schweigens.
Charlotte drehte sich wieder um und sah, dass ihre Schwester bereits die Kanne in der Hand hielt. Wortlos sch├╝ttelte sie den Kopf, denn sie bef├╝rchtete, dass ihre Stimme bebte.
„Kopf hoch, das Leben geht weiter! Zuerst verkaufst du August deine Mumie und dann solltest du endlich dein Leben ordnen.“
Charlotte schreckte auf.
„Verkaufen? Ich will gar kein Geld f├╝r dieses schreckliche …. Ding.“ Wieder k├Ąmpfte sie mit den Tr├Ąnen, aber diesmal gelang es ihr schneller sie zu bek├Ąmpfen.┬á┬á
„August wird sich freuen!“, verk├╝ndete die Schwester und musterte sie dann von der Seite.
„Und was wird aus dir und Wilhelm?“, fragte sie vorsichtig.
„Ehrlich, Henriette, ich wei├č es nicht. Das wird nur die Zeit weisen“, gab Charlotte mit einem tief empfundenen Seufzer zu und strich sich dann gedankenverloren eine st├Ârrische Haarstr├Ąhne aus dem Gesicht. „Nachdem ich Bernhard wiedergesehen habe …“
„Also, das geht mich zwar nichts an“, meinte die Schwester etwas spitz, „aber etwas Besseres als den findest du alle Tage.“┬á
Charlotte erhob sich langsam und bed├Ąchtig, fast wie eine alte Frau.
„Du hast v├Âllig Recht, das geht dich wirklich nichts an“, erkl├Ąrte sie etwas gedehnt und mit f├╝r sie selbst ├╝berraschend fester Stimme, „ich glaube, ich habe deine Zeit schon lang genug in Anspruch genommen.“┬á
Die Schwester ging zu ihr, packte sie am Ärmel ihres schwarzen Kleides, das für das sommerliche Wetter viel zu warm war und zog sie ganz sanft wieder zurück auf den Stuhl.
„Aber, aber, wer wird denn gleich so empfindlich sein! Man wird doch mal seine Meinung sagen k├Ânnen, wenn du vor ├╝ber zwanzig Jahren nur auf mich geh├Ârt h├Ąttest …“
„Nicht schon wieder!“, fuhr Charlotte gereizt die Schwester an.
Henriette blickte sie sorgenvoll an und Charlotte bemerkte, wie gut das helle Kleid mit dem Blumenmuster, das nach neuester Pariser Mode geschnitten war, mit den grauen Augen der Schwester harmonierte. 
„Ich will doch nur dein Bestes! Auch wenn du partout keine wohlgemeinten Ratschl├Ąge annehmen willst, so musst du doch nicht so abrupt aus meinem Haus st├╝rmen! Du hast ja noch nicht einmal dein St├╝ck Schwarzw├Ąlder Kirschtorte gegessen.“ Das helle Lachen der drei M├Ądchen war aus dem Garten zu h├Âren. „Au├čerdem habe ich Sophie versprochen etwas Kuchen f├╝r sie ├╝brigzulassen.“
Mit Schrecken realisierte Charlotte, dass sie vor Kummer die schiere Existenz ihrer Tochter v├Âllig vergessen hatte.┬á
„Sag, mal sie spielt gerade so sch├Ân mit deinen T├Âchtern, die Jungs sind ja viel ├Ąlter als sie und …“, begann sie zaghaft, denn sie wagte es kaum, ihren Wunsch zu ├Ąu├čern.
„Sophie kann gern ein paar Tage bei mir bleiben“, bot die Schwester an und Charlotte bekam ein schlechtes Gewissen, dass sie eben so ungehalten gewesen war.
Sie versuchte, sich ihre Erleichterung nicht anmerken zu lassen. Die Schwester brauchte nicht zu erfahren, dass sie Sophie aus dem Haus haben wollte, damit sie nicht Zeuge ihrer Auseinandersetzungen mit Wilhelm wurde. Wenn sie ihn ├╝berhaupt heiraten w├╝rde, dann allenfalls nach Ablauf des traditionellen Trauerjahrs. Momentan f├╝hlte sie sich nicht imstande, eine neue Bindung einzugehen. Daher hatte sie Wilhelm geraten, die ihm angebotene Stelle in K├Ânigsberg anzunehmen, aber dieser Vorschlag war auf wenig Gegenliebe gesto├čen.┬á┬á
„Das ist wirklich sehr nett von dir, ich muss mich momentan um so Vieles k├╝mmern“, erkl├Ąrte sie der Schwester, aber der Versuch sie dabei anzul├Ącheln misslang aufs Gr├╝ndlichste.
„Ich will mich nur schnell von Sophie verabschieden! Dann muss ich aber wirklich endlich aufbrechen.“
Die Schwester machte eine einladende Geste in Richtung Garten.
„Und mach dir keine Gedanken wegen der Mumie. August holt sie vormittags ab, w├Ąhrend deine S├Âhne auf der Universit├Ąt sind. Dann k├Ânnen sie nicht dagegen protestieren.“
 
Der Abtstieg in die Unterwelt
1. Abstieg in die Unterwelt
Das Schiff passierte die unwirtlichste K├╝ste, die Johann jemals gesehen hatte. Im nebelverh├╝llten Zwielicht zogen schneebedeckte Berge vorbei. Alles schien sich┬á aufzul├Âsen, es gab weder Land, noch Meer, noch Dunst, sondern alles zugleich und nichts davon. Vor dem Ufer schaukelte eine wei├če Fl├Ąche im Halbdunkel wie ein Floss. Mit Schrecken registrierte Johann, dass es sich nur um Packeis handeln konnte, ein Ph├Ąnomen, dass er als Bewohner s├╝dlicher Gefilde nur vom H├Ârensagen kannte. Das Meer war tats├Ąchlich streckenweise zugefroren und so konnte das Schiff nur langsam im tr├╝ben Halbdunkel zwischen den Eisschollen navigieren, die wie Geisterschiffe auf dem kalten Wasser trieben.
„Wo bin ich?“, entfuhr Johann, der sich nicht erkl├Ąren konnte, wie es ihn in diese trostlose Gegend verschlagen konnte.
„Dies ist das Reich, wo die Kimmerer in ewiger D├Ąmmerung lebten! Wir haben endlich den Rand des Okeanos erreicht, erwiderte ein alter Seemann - wohl der Kapit├Ąn des Schiffes - der Johann vage bekannt vorkam, obwohl er sich beim besten Willen nicht an seinen Namen erinnern konnte.
Johann traute seinen Ohren nicht: War dies tats├Ąchlich der Okeanos, das Weltmeer aus der Odyssee? Dann lag vor ihm der Hain der Persephone, aber Johann konnte keine Einzelheitern erkennen, denn ein feuchter Nebel verh├╝llte das Ufer.
Durch das Schiff ging ganz pl├Âtzlich ein heftiger Ruck. Johann verlor das Gleichgewicht, stolperte, fiel auf seine Knie und fluchte beim Aufstehen leise vor sich hin. Die unsanfte Landung lie├č darauf schlie├čen, dass der Steuermann das Festland zu sp├Ąt wahrgenommen hatte.
Seeleute hievten ein altert├╝mliches Ruderboot ins Wasser und ausgerechnet Johanns ├Ąlterer Bruder Peter kletterte als erster hinein. In der Hand hielt er zwei brennende Fackeln. Er nahm auf der Ruderbank Platz, schaute dann zum Schiff hoch und seine Augen suchten die seines Bruders. Als er sie gefunden hatte, machte er eine einladende Geste in Richtung des Bootes.
„Worauf wartest du noch?“, h├Ârte Johann ihn rufen.
Obwohl sich alles in ihm dagegen str├Ąubte, gehorchte Johann nach kurzem Z├Âgern, denn er f├╝rchtete sich, ohne Peter an Bord dieses seltsamen Schiffes zur├╝ckzubleiben.
„Das wurde aber auch Zeit!“, begr├╝├čte ihn sein Bruder und dr├╝ckte ihm eine Fackel in die Hand.
Es folgten der Kapit├Ąn und zwei Seeleute, die widerstrebenden Hammel hinter sich herschleiften. ┬á
Als sie ebenfalls an Bord des kleinen Bootes geklettert waren begannen die Seeleute zu rudern. Die Hammel bl├Âken anklagend in das Halbdunkel. Opfertiere, durchfuhr es Johann und ein namenloses Grauen ├╝ber kam ihn. Wie konnte sein Bruder im┬á fortschrittlichen 19. Jahrhundert auf die Idee kommen, derart barbarische Praktiken wiederbeleben zu wollen?
├ťber ihm w├Âlbte sich der schwarze Himmel dieser trostlosen Landschaft, in die nie das Licht der Sonne eindrang. Nur mit M├╝he konnte er die Bl├Ątter der Pappeln erkennen, die am Ufer standen. Sie waren dunkel auf einer Seite, hell auf der anderen. Dies symbolisierte die Grenze zwischen den beiden Welten, der Welt der Lebenden und jener der der Toten.┬á┬á
Das Boot lief auf Sand und die M├Ąnner stiegen aus. Eine Brise wehte Johann die Kapuze vom Kopf und er fluchte wieder, diesmal deutlich vernehmbar. Er zog sich seinen Mantel fester um die Schultern, der viel zu d├╝nn f├╝r dieses Wetter war. Seine Ohren brannten, die Nase triefte und die H├Ąnde waren schon ganz klamm vor K├Ąlte.
„Wir m├╝ssen einen Graben um diesen Altar ausheben“, verk├╝ndete Peter und deutete dabei auf einen gro├čen Stein, der am Ufer herumlag.┬á
Johann bearbeitete den halbgefrorenen Boden mit der Schaufel und stellte fest, dass diese k├Ârperliche Anstrengung wenigstens den Vorteil hatte, dass ihm geh├Ârig warum wurde und die K├Ąlte nicht mehr ganz so unertr├Ąglich war.
Als der Graben tief genug war, goss Peter Honig, Wasser, Milch und Wein als Trankopfer f├╝r die Unterweltsg├Âtter hinein. Ein langes Messer blitzte in seiner Hand und er schnitt mit einer schnellen Bewegung einem der Hammel die Kehle durch. Das Blut wie eine Font├Ąne spritzte heraus, ergoss sich ├╝ber den Stein und f├╝llte den Graben. Johann wandte sich angewidert ab. Was war nur in seinen Bruder gefahren, der normalerweise keiner Fliege etwas zuleide tun konnte?┬á
„Komm herbei, Geist des Teiresias!“ rief Peter mit weithin t├Ânender Stimme. „Nimm unsere Gabe an! Wir haben Blut f├╝r dich, Blut, die Nahrung der Toten!“
Peter beschwor den Geist des Teiresias? Johann erinnerte sich ganz langsam: Er kannte diesen Namen aus der Odyssee! Es war der Schatten des Sehers Teiresias, der Odysseus den R├╝ckweg nach Ithaka beschrieben hatte.
Vorsichtig hob Johann seine Augen, obwohl er nicht sicher war, ob er wirklich sehen wollte, was geschehen war, w├Ąhrend er sich abgewandt hatte. Seine Bef├╝rchtungen best├Ątigten sich, sein Bruder hatte mittlerweile auch den zweiten Widder get├Âtet. Noch mehr Blut str├Âmte in den Graben. Johann bek├Ąmpfte nur mit gro├čer M├╝he einen Brechreiz.
Schreckliches St├Âhnen durchschnitt ganz pl├Âtzlich die finster Stille. Dies waren wahrscheinlich die Schatten, die das Blut rochen. Johann lief ein Schauder ├╝ber den R├╝cken.
Peter hingegen lie├č sich nicht beirren. Mit der Routine eines Metzgers h├Ąutete er die geopferten Tiere, schnitt Fleisch und Fett von ihren Schenkeln und schichtete die Opfergaben auf dem Altar auf. Dann entfachte er ein Feuer, ohne dass Johann nachvollziehen konnte wie er dies bewerkstelligte. Bald brutzelte das Fett in den Flammen und es roch nach verbranntem Fleisch. Die Flammen erloschen und Peter betete laut zu Hades und Persephone.
„Herr der Unterwelt, Herrin des Schweigens, f├╝hrt den Schatten des Teiresias zu uns!“
Inzwischen hatte der Geruch des warmen Blutes Scharen von Geistern angelockt. Sie erschienen als vage Schemen aus dem Nebel.
„Wir m├╝ssen sie mit dem Schwert davon abhalten zu trinken!“, rief Peter ihm zu. „Nur Teiresias darf sich uns n├Ąhern!“
Johann m├╝hte sich damit ab, sein schweres Schwert zu bewegen, aber es wollte ihm nicht recht gelingen, denn es drohte ihm aus seinen verschwitzten H├Ąnden zu rutschen.
„Ich bin kein Soldat“, entfuhr es ihm, „ich kann mit dem Ding nicht umgehen. Woher hast du nur diese uralte Waffe und was soll das alles?“
„Du musst nur etwas damit herumfuchteln, um die Schatten zu vertreiben!“ erwiderte Peter, ohne ihn anzusehen. „Hab keine Angst! Diese Schatten sind ein menschengestaltiges Nichts. Sie besitzen keinen K├Ârper und k├Ânnen uns daher nicht schaden.“
Johann schlug mit dem Schwert verzweifelt um sich. In der gestaltlosen Masse der Schemen tauchten von Zeit zu Zeit gespenstische Gesichter auf. Es waren die traurigen Gesichter junger Menschen, die zu fr├╝h aus dem Leben gerissen worden waren, M├╝tter mit S├Ąugling im Arm, unverheiratete M├Ądchen, die sich noch nicht mit ihrer k├Ârperlosen Existenz abgefunden hatten, Kinder mit geisterhaftem Spielzeug in den H├Ąnden. Der Raum war erf├╝llt vom Klang ihrer Klagen.
Johann starrte auf den immer schneller werdenden Reigen. Obwohl die Schemen nah an ihm vorbeiflogen, gab es keinen Wind.
Zwischen den Scharen tat sich eine L├╝cke auf. Die ├ľffnung drehte sich auf ihn zu und eine gr├╝nliche Hand streckte sich nach ihm aus. Die Schatten wollten ihn in den Geistertanz einbeziehen. Johann wich zur├╝ck und drohte mit dem Schwert. Die L├╝cke schloss sich wieder und erneut wirbelten die Phantome so schnell um Johann, dass es ihm schwindlig wurde.
Ein Geist l├Âste sich aus der wilden Jagd und flog auf Johann zu. Es war der Schatten eines M├Ądchens. Ihre durchsichtige Hand mit den goldenen Armreifen am schmalen Handgelenk kam Johann so nah, dass die Finger fast seinen Arm ber├╝hrten. Johann wurde vom blanken Entsetzten ergriffen. Sein Magen verkrampfte sich, seine H├Ąnde wurden kalt und er w├Ąre am liebsten weggelaufen, egal wohin. Trotz der K├Ąlte brach ihm der Schwei├č aus. Der Schreck l├Ąhmte ihn derart, dass er nicht einmal imstande war, auszuweichen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er aufgeh├Ârt hatte, die Schatten mit der Waffe zu vertreiben.
Johann raffte sich auf, sch├╝ttelte, die L├Ąhmung von sich und drohte dem Schatten des M├Ądchens mit dem Schwert. Dabei umklammerte er den Knauf so fest, dass seine Fingerspitzen taub wurden.
„Du kannst mich nicht umbringen“, rief der Schatten mit hohler Stimme, „denn ich bin bereits tot.“
Gl├╝cklicherweise nahm der Spuk im gleichen Augenblick ein abruptes Ende. Als ob sie einen, f├╝r die Lebenden unh├Ârbaren Befehl erhalten h├Ątten, zogen sich die Phantome ganz pl├Âtzlich zur├╝ck.
Die Szenerie ├Ąnderte sich. Aus der Ferne drang das Klirren von Metall auf Metall, als ob dort eine Schlacht tobte. Vage Gestalten eilten herbei, b├Ąrtige M├Ąnner mit ├äxten, Schwertern und Lanzen. Ihnen ritt ein hochrangiger Krieger voran, seiner R├╝stung nach zu schlie├čen ein Troianer. Ihm folgten, in nicht endenwollender Reihe die ger├╝steten Schatten von Kriegern, darunter eine Schar von Amazonen, angef├╝hrt von ihrer K├Ânigin.
„Wir Schatten dulden die Lebenden nicht!“, fl├╝sterte und wisperte die graue Schar. Das Echo des schaurigen Chors verhallte nur langsam.
Johann wurde ganz pl├Âtzlich schwindlig. Er f├╝hlte sich, als ob er von einem rei├čenden Strom erfasst w├╝rde. Die Schatten wurden immer blasser und Johann sp├╝rte, wie ein Ruck durch seinen K├Ârper ging.
 
Er ├Âffnete die Augen und schaute sich erstaunt um. Einen Augenblick lang konnte er nicht fassen, was er sah, beziehungsweise, was er nicht sah: Die griechische Unterwelt und das altmodische Schiff waren verschwunden. Er lag schwer atmend im zuhause auf seinem Bett. Die Kirchturmuhr schlug und Johann sp├╝rte das weiche Kissen unter seinem Kopf. Das ganze war nur ein Alptraum gewesen, realisierte er.
Im Licht des Vollmonds, der durch das Fenster seines Zimmers schien sah er die Vossche ├ťbersetzung der Odyssee auf seinem Nachttisch liegen. Ein Lesezeichen markierte den 11. Gesang, der vom Abstieg des Irrfahrers in die Unterwelt handelte.
G├╝tiger Gott, wie konnte dieser klassische Stoff bewirken, dass er vom Hades getr├Ąumt hatte? Vielleicht tr├Ąumte er das n├Ąchste Mal von der sch├Ânen Nymphe Kalypso, dachte Johann halb im Scherz, w├Ąhrend er sich zur Wand drehte, denn der Mond schien allzu hell ins Zimmer herein.
Sein Herz pochte, sein Puls raste und er zitterte noch immer am ganzen Leib. Also gab Johann nach einer Weile den Versuch auf, wieder einzuschlafen. V├Âllig ersch├Âpft und zugleich hellwach starrte er eine Weile die Wand an, deren helle Tapete in der Dunkelheit grau war, aber die Erinnerung an den gerade durchlittenen Alptraum lie├č sich einfach nicht einfach absch├╝tteln.
Johann z├╝ndete die Kerze auf seinem Nachttisch an. Dann las er noch ein Kapitel in der Odyssee, denn schlie├člich wurde deren Kenntnis in einem der Seminare vorausgesetzt, die er im folgenden Semester zu belegen gedachte.
Die Mumie
2. Die Mumie
Auf den mit Kies bestreuten Wegen und des Innenhofes der Universit├Ąt hatten sich flache Pf├╝tzen gebildet. Studenten hielten sich am Rand der Gr├╝nfl├Ąche, anstatt sie wie sonst zu ├╝berqueren, denn keiner von ihnen wollte mit schmutzigen Schuhen in der Alma Mater erwischt werden. Seit Tagen regnete es und nur ab und zu kl├Ąrte sich der Himmel f├╝r kurze Zeit auf, aber bevor die Pf├╝tzen getrocknet waren, trieb der Westwind schon wieder neue Regenwolken vor sich her. Zwar mochte dies den Nebeneffekt haben, dass sich die - von Tausenden von F├╝├čen niedergetrampelten Grasnarben - wieder etwas erholen konnten, aber Peter h├Ątte vorgezogen,┬á trockenen Fu├čes in die Mensa zu gelangen.
An der Scheibe des Fensters, auf dessen Bank er sich aufst├╝tzte rannen unabl├Ąssig schwere Tropfen herab, ein sich st├Ąndig ver├Ąnderndes Streifenmuster hinterlassend. Hoffentlich gab es wenigstens etwas Gutes in der Mensa, dachte er, als sein Blick die Universit├Ątskantine streifte, aber er hatte wenig Hoffnung, dass sein Wunsch in Erf├╝llung gehen k├Ânnte. Dies verstie├č gegen alle Regeln der Wahrscheinlichkeit.
Irgendwie spiegelte die Witterung seine eigene Gem├╝tsverfassung wieder, die sich auch┬á auf einem Tiefpunkt befand. Dabei hatte er sich so auf das Studium der Jurisprudenz gefreut, nicht zuletzt, weil es ihm einen guten Vorwand bot Anneliese von Gaimersdorf regelm├Ą├čig zu sehen, die Tochter einer seiner Professoren, die er letztes Jahr auf dem Kirchweihfest kennengelernt hatte.
Doch die Ereignisse der vergangenen Woche hatten selbst ihm zugesetzt, obwohl er dies gegen├╝ber seinem Bruder niemals zugegeben h├Ątte. Seit er denken konnte war er der st├Ąrkere Bruder gewesen, der Johann vor der meist grundlosen Schelte der Mutter und den H├Ąnseleien der Nachbarskinder in Schutz genommen hatte. Annelieses liebliche Gestalt verschwand schlagartig vor seinem inneren Auge, und damit auch sein f├╝r einen Au├čenstehenden sicher etwas unmotiviertes L├Ącheln, als er eine Hand auf seiner Schulter sp├╝rte. Er schrak zusammen, drehte sich abrupt um und sah in das strahlende Gesicht seines Kommilitonen und besten Freundes Moritz.
„Peter!“ Seine Stimme klang freudig ├╝berrascht. „Warum hast du die ganze letzte Woche gefehlt? Du warst doch hoffentlich nicht krank?“┬á┬á┬á
Automatisch sch├╝ttelte Peter den Kopf. Gedankenverloren fuhr er sich mit der Hand durchs dunkle Haar und kratzte sich am Hinterkopf.
„Nein, das nicht …“, begann er, aber er beendete den Satz nicht, weil er noch immer zu aufgew├╝hlt war, um die schrecklichen Geschehnisse der letzten Tage in Worte zu fassen.
„Aber?“, erg├Ąnzte Moritz.
Als er die Anteilnahme im Gesicht seines Freundes sah gab Peter sich einen Ruck.
„Ich habe dir doch erz├Ąhlt, dass mein Vater verschollenen ist?“
Der Freund nickte. „Ja... ├ägypten, nicht wahr?“
Peter nickte seinerseits und blickte wieder aus dem Fenster. Zwischen den noch immer herunterrinnenden Tropfen konnte er seine eigene Reflexion im Glas wahrnehmen, die einer Marmorstatue glich, so bleich war er.
„Letzte Woche ist er unerwartet wieder ...“ Gegen seinen Willen sp├╝rte er einen Schwall Tr├Ąnen in sich aufsteigen, schloss aber die Augen und k├Ąmpfte sie nieder, indem er krampfhaft an Anneliese dachte. Wenn sie ihn in diesen desolaten Zustand sehen k├Ânnte, w├╝rde er vor Scham im Erdboden versinken! „aufgetaucht. Einfach so, ohne sich vorher anzuk├╝ndigen.“
Moritz lie├č seinen Mund vor ├ťberraschung offenstehen.
„Vier Tage sp├Ąter ist er gestorben.... und niemand wei├č...“
„D... Das tut mir wirklich sehr leid.“, stammelte sein Freund leise.
Peter, der m├╝hsam wieder seine Fassung erlangt hatte, winkte ab. „Ist nicht so schlimm.“ Er w├╝nschte, der k├Ânnte sich selbst vom Wahrheitsgehalt seiner Worte ├╝berzeugen. Vergeblich versuchte er zu l├Ącheln und verzog doch dabei nur das Gesicht. „Er war praktisch ein Fremder f├╝r mich.“
„Das ist trotzdem schrecklich!“, entfuhr es seinem Gegen├╝ber. „Du musst mir das aber noch etwas ausf├╝hrlicher berichten. Schlie├člich bin ich doch dein Freund!“
Peter blickte ihn ungl├╝ckliche an, sp├╝rte aber keinen Drang, ├╝ber die tragischen Ereignisse in seinem Hause zu sprechen, obwohl er sonst mit seinem besten Freund alles teilte.
„Ich lade dich auch ins Gasthaus „zur alten M├╝hle“ ein“, f├╝gte Moritz hinzu als Peter nicht reagierte, „Heute gibt es wieder diese ungenie├čbaren Kohlrouladen in der Mensa.“
Bei der blo├čen Vorstellung wurde Peter ├╝bel, denn er verabscheute – ganz im Gegensatz zum Koch der Mensa – alles, was nur entfernt etwas mit Kohl zu tun hatte.
„Von mir aus“, murmelte er daher und fragte sich einen Augenblick lang ob Moritz Gedanken lesen konnte. Er wusste, dass er ├╝ber kurz oder lang nicht umhin kommen w├╝rde seinem Freund alles zu berichten. Also war es vielleicht das Beste die Sache so schnell wie m├Âglich hinter sich zu bringen. „Aber lass uns in den 'Fasan' gehen. Ich habe keine Lust, dem alten Sedelmaier ├╝ber den Weg zu laufen.“
Moritz verdrehte dazu die Augen. „Dem m├Âchte ich auch lieber nicht begegnen. Der bringt es noch fertig, uns eine Hausarbeit aufzubrummen, nur weil wir angeblich zuviel Zeit haben. Das ist n├Ąmlich neulich dem Ferdinand passiert als er ihn unten am Fluss begegnete.“
Schweigend durchquerte Peter den Innenhof und ging, ohne auf den immer st├Ąrker werdenden Regen zu achten, durch verwinkelte Gassen bis er endlich das Gasthaus erreichte. Erst jetzt gewahrte er Moritz, der schweigend hinter ihm hergetrottet war.
Die Fenster des 'Fasan' waren beschlagen und daher sah Peter erst als er bereits die T├╝r ge├Âffnet hatte, wie voll das Gasthaus war. Offenbar waren sie nicht die einzigen Studenten, die sich vor der Kohlroulade hierher gefl├╝chtet hatten. Junge M├Ąnner mit feuchten Haaren und klammen Fingern machten sich gierig ├╝ber ihre Gerichte her, w├Ąhrend die Tochter des Wirts etwas ├╝berfordert war, all die Bestellungen aufzunehmen, die Speisen auszutragen, abzurechnen und die leeren Teller wieder abzur├Ąumen. Der Raum war erf├╝llt vom Klappern der Teller und vom Geplauder der Kommilitonen. Peter f├╝hlte sich deplaziert unter all diesen fr├Âhlichen jungen M├Ąnnern.
Gl├╝cklicherweise sah er in der Menge kein bekanntes Gesicht, aber er machte sich keinerlei Illusionen: Bald w├╝rde die halbe Universit├Ąt ├╝ber seine Familie tratschen. Hoffentlich verbreiteten sich die sensationellen Neuigkeiten erst in den Semesterferien, denn dann w├Ąre die gr├Â├čte Sensationsgier zu Beginn es neuen Semesters bereits befriedigt.
Mit etwas Gl├╝ck fand Peter einen Platz in der hinteren Ecke der Stube, da ein ├Ąltlicher Angestellter – der sich in dieser Umgebung ausmachte wie der Oberlehrer eines Internats - sich gerade zum Gehen erhob. Moritz bestellte zweimal das Tagesgericht: Spickbraten mit Kl├Â├čen und w├Ąhrend die Freunde aufs Essen warteten, begann Peter zu erz├Ąhlen. Er sprach mit gesenkter Stimme, aber er h├Ątte den „Fasan“ nicht ins Spiel gebracht, wenn er gewusst h├Ątte, welcher Beliebtheit er sich an diesem Tag erfreute.
„Vor ├╝ber zehn Jahren hat sich mein Vater einer Handelsmission von Kaufleuten angeschlossen, die nach ├ägypten aufgebrochen ist. Das Ziel meines Vaters war aber das Tal der K├Ânige. Als begeisterter Hobby-Arch├Ąologe wollte unbedingt der erste sein, der ein Pharaonen-Grab auftun, das nicht schon in der Antike ausgeraubt worden ist. Mutter war nat├╝rlich dagegen, denn sie meinte, dass sich ein Familienvater nicht einfach so vor seiner Verantwortung dr├╝cken d├╝rfe und schon gar nicht so kurz nach der Geburt seines dritten Kindes. Sie versuchte Vater umzustimmen, aber es half nichts. Er sagte immer nur „Ich komme doch in wenigen Monaten schon wieder zur├╝ck“. Schlie├člich musste sie ihn doch trotz aller Proteste ziehen lassen, aber sie hat fast acht Jahre auf ihn gewartet.“
„Ich wei├č. Sie hat doch jetzt einen Neuen, euren alten Hauslehrer?“, fragte Moritz.
„Das macht die Sache ja so kompliziert“, entfuhr es Peter, heftiger als er beabsichtigt hatte.
„Erst muss ich noch etwas trinken. Mein Hals ist v├Âllig ausgetrocknet!“
Peter bestellte ein Glas Rotwein, das die sonst so langsame Wirtstochter ihm augenblicklich kredenzte. Er genehmigte sich einen gro├čen Schluck und genoss das Gef├╝hl, wie eine wohlige W├Ąrme in ihm aufstieg.
Dann begann er endlich zu erz├Ąhlen: „In den ersten Monaten trafen regelm├Ą├čig Briefen ein, in denen Vater seine baldige R├╝ckkehr versprochen hat. Dann schrieb er immer seltener, bis die Briefe schlie├člich v├Âllig ausblieben. Auch das Konsulat in Kairo konnte - oder wollte - nicht helfen. Selbst an den K├Ânig haben wir geschrieben. Von seinem Amt haben wir ein Schreiben zur├╝ckbekommen. Es war in schlechtem Englisch verfasst, jedoch mit einem bombastischen Siegel verschlossen, enthielt aber auch nicht viel mehr als gro├čes Bedauern seiner Exzellenz. Mein Vater habe sich angeblich in Alexandria mit einem koptischen Priester namens Menas zusammengetan, die beiden sollen sich dann den Beduinen anschlossen haben. So war keine Information zu bekommen. Die Jahre vergingen, zwischenzeitlich hat meine Mutter den Antrag gestellt, meinen Vater f├╝r tot erkl├Ąren zu lassen, damit sie sich neuverm├Ąhlen k├Ânne ...“
.... „Warte“, unterbrach Moritz, du sagtest doch, er sei mit einer Gruppe von Frankfurter Kaufleuten gefahren, habt ihr die gekannt? Sind die wenigstens zur├╝ckgekehrt?“
„Wir kannten keinen von ihnen. Sp├Ąter hat Mutter nat├╝rlich mit ihnen Kontakt aufgenommen. Die meisten sind auch wirklich nur wenigen Monate in Kairo geblieben. Von Vater wussten sie auch nur zu berichten, dass er nach Alexandria weitergereist ist. Niemand wei├č, was geschehen ist. Vater ist einfach verschwunden.“
„Jeder h├Ątte vermutet, dass er tot ist“, seufzte Moritz.
„So ging es auch mir, aber wir haben uns alle geirrt“, fuhr Peter fort. „Vorletzten Sonntag war einer dieser grauenhaft verregneten Tage, an denen es eigentlich gar nicht lohnt das Bett zu verlassen.“
„Das kann man wohl sagen“, stimmte Moritz ihm zu. „So einen gr├Ąsslichen Fr├╝hling hatten wir schon lange nicht mehr.“
Peters Gedanken wanderten zur├╝ck zu diesem schrecklichen Sonntag.
….
Ein grollender Donner weckte Peter gegen acht auf. Er warf einen Blick durch das Fenster auf die schwarzen Wolken, die ├╝ber den Himmel zogen. Dann drehte er sich nochmals im Bett um und schlief weiter, bis er zwei Stunden sp├Ąter wieder aufwachte und ihn sein knurrender Magen aus den Federn trieb. Er warf sich einen Morgenmantel ├╝ber das Nachtgewand und schlurfte in Pantoffeln die Treppe hinab.
Die anderen hatten bereits gefr├╝hst├╝ckt, sein Teller stand jedoch noch da. Peter holte eine Scheibe Brot aus dem Brotkasten, bestrich sie mit Butter und h├Ąufte anschlie├čend mit dem Messer mindestens zwei Zentimeter Erdbeermarmelade darauf.
Elise, das Hausm├Ądchen, scho├č herein und machte sich sogleich daran, ein K├Ąnnchen Kaffee frisch zubereiten. Peter setzte sich und genoss sein Marmeladenbrot.
Mit vollem Mund murmelte er „Danke“ als Elise den wunderbar duftenden Kaffee auf den Tisch stellte und das Hausm├Ądchen verschwand mit einem angedeuteten Knicks.
Peter erwog, sich eine zweite Scheibe zu schmieren, aber er verzichtete darauf, da das Mittagsmahl war schon nah war. Er brachte sein Gedeck auf die Anrichte und verlie├č die K├╝che Richtung Treppe um sich endlich umzuziehen.
Seine Mutter stand hinter dem Vorhang und blickte starr auf die Stra├če hinaus. Peter bemerkte sofort eine gewisse Anspannung an ihr und seine Neugier war geweckt. Was mochte da drau├čen Ungew├Âhnliches vor sich gehen? Auch er ging zum Fenster, der Kopf seiner Mutter fuhr herum, und im Augenblick des Widererkennens mischte sich etwas Abweisendes in ihren Blick, wie als w├Ąre es ihr nicht recht, dass er sie beobachtet.
„Sieh nur“, fl├╝sterte sie, „aber geh nicht zu nah ans Fenster“
Peter trat einen Schritt zur├╝ck und lugte hinaus.
Sonntagmorgens ruht gew├Âhnlich der Verkehr in der Seitenstra├če vor dem Haus. Daher staunte er ├╝ber eine Droschke, die vor dem Gartentor stand. Der Kutscher sa├č unschl├╝ssig auf dem Bock und blickte abwechselnd zur Kabine hinunter und zum Haus hinauf.
„Erwarten wir Besuch?“, fragte Peter seine Mutter, die noch immer auf die Stra├če starrte.
Sie sch├╝ttelte den Kopf.
„Nein, und schon gar keinen, der in einer Mietdroschke vorf├Ąhrt“, murmelte sie alarmiert.┬á „Ich hab ein ganz seltsames Gef├╝hl.“
„Wie lang steht er schon da?“
„Einige Minuten.“
„Wer kann das nur sein?“
Hinter dem Glas des Kabinenfensters regte sich ein Schemen, jemand schien  herauszublicken. Es war jedoch nichts Genaues zu erkennen.
„Steigt da jemand aus?“, fragte Peter und blickte zu seiner Mutter.
Sie fuhr sich nerv├Âs mit der Hand durch┬á das Haar.
Die T├╝re des Wagens ├Âffnete sich. Ein Mann mit ungew├Âhnlich gebr├Ąunter Gesichtshaut stieg mit etwas steifen Bewegungen heraus und sagte ein paar Worte zu dem Kutscher. Er trug b├╝rgerliche, schwarze Kleidung und einen Hut. F├╝r einen Moment stemmte er die Linke Hand in den R├╝cken und betrachtete das Haus als ├╝berlegte er, ob es das richtige sei.
Der Fremde machte sich am Gartentor zu schaffen und ├Âffnete es. Die Mutter trat mit erschrockenem Gesichtsausdruck einen Schritt zur├╝ck und hob die Hand an den Mund.
Verwirrt blickte Peter zu ihr hin├╝ber und sah, wie sie erblasste.
„Was hat dies zu bedeuten?“, fragte er. „Ein Einbrecher am hellerlichten Tag?“
„Mein Mann!“, entfuhr es der Mutter. Ihre Lippen bebten. „Dein Vater!“, wiederholte sie etwas leiser.“
„Vater?“, fragte Peter zur├╝ck, aber alles erschien ihm so unwirklich.
Die Erinnerung an seinen Vater war beinahe v├Âllig verblasst, obwohl er schon alt genug gewesen war, um den Schmerz seiner Mutter um seinen Weggang zu verstehen. Peter dachte an den jungen Mann auf der schwarz gerahmten Miniatur im Schlafzimmer, der eher ihm selbst ├Ąhnelte als dem unheimlichen Mann im Vorgarten.
Unf├Ąhig irgendetwas zu sagen starrte er weiterhin aus dem Fenster.
Peter wartete auf das schrille Ger├Ąusch der Glocke, aber es blieb auch. Der fremde Mann, der angeblich sein Vater war, versuchte stattdessen die Wohnungst├╝r aufzuschlie├čen.
„Peter!“
Er erwachte aus seiner Starre und blickte zur├╝ck zur Mutter, die er noch niemals so aufgew├╝hlte erlebt hatte.
„Du musst sofort Wilhelm suchen...“
Es l├Ąutete. Die Messingglocke der Haust├╝r durchschnitt die Stille. Die Mutter zuckte zusammen, fasste sich aber wieder. „Wilhelm darf nichts ├╝ber die geplante Hochzeit sagen, ja nicht einmal dar├╝ber, dass wir beide ein Paar sind. Das d├╝rfen wir deinem Vater nicht sofort auftischen! Sonst gibt es eine Katastrophe! Wilhelm ist euer Hauslehrer und mein Sekret├Ąr, mehr nicht! Sag es auch Johann und Sophie.“ Der Blick der Mutter glitt tadelnd am Morgenmantel ihres ├ältesten hinab. „Und zieh dir endlich etwas Anst├Ąndiges an!“
Die Klingel ging ein zweites Mal. Elise kam in den Flur geschossen, den Staubwedel in der rechten Hand. Seit wann putzte sie am heiligen Sonntag? Bestimmt hatte das M├Ądchen gelauscht.
Doch die Mutter rief sie zur├╝ck. W├Ąhrend Peter aus dem Zimmer eilte, h├Ârte er, dass ┬áauch das Hausm├Ądchen instruiert wurde.
Mit rasend klopfendem Herzen eilte er zum Bibliothekszimmers, in dem sein angeblicher Hauslehrer die Vormittage verbrachte und durch die Zimmert├╝r h├Ârte er seine Mutter, die den Vater begr├╝├čte. Es kam ihm vor als h├Ątte er all dies bereits einmal erlebt, aber das war nat├╝rlich unm├Âglich.
Wilhelm - ein hagerer, angespannter Mann, dem Peter normalerweise m├Âglichst aus dem Weg zu gehen suchte - stand auf der Leiter und studierte mit zusammengekniffenen Augen die R├╝cken der B├╝cher des obersten Regalbretts, in dem sich die englische Literatur, ├╝berwiegend Schauerromane befanden. Fast w├Ąre er heruntergefallen, als Peter die T├╝re mit Wucht aufriss.
Wilhelm schob seine Brille auf der Nase zur├╝ck und blickte strafend auf Peter herab, doch bevor er eine R├╝ge aussprechen konnte, fing Peter schon an: „Herr Doktor Eisenbach...“
Diese Anrede war Peter herausgerutscht, obwohl er Wilhelm sonst nur so ansprach, wenn er ihn ├Ąrgern wollte, Wilhelm verzog das Gesicht und ├Âffnete den Mund zum Protest, aber Peter schnitt ihm das Wort ab.
„Mutter hat mich beauftrag, ihnen mitzuteilen, dass der Vater aus der Fremde zur├╝ckgekehrt ist. Sie bittet Sie, Stillschweigen ├╝ber ihre Beziehung zu ihr zu wahren, um unangenehmen Szenen vorerst aus dem Weg zu gehen, bevor... “
„Verdammt!“, entfuhr es dem Doktor der Altphilologie, der sonst versuchte, seinen Stiefs├Âhnen in spe mit gutem Beispiel voranzugehen,. Bevor er sich fassen konnte, polterte ein Buch zu Boden. Peter sah, dass es sich um „Malmoth the Wanderer“ von Maturin handelte. „Das doch nicht...“
„Wie gesagt, Herr Doktor Eisenbach, verursache Sie bitte keinen Skandal, das m├Âchte Mutter um jeden Preis vermeiden!“, wiederholte Peter und fragte sich, warum ausgerechnet er mit dieser undankbaren Aufgabe betraut worden war.
Da war es wieder, dieses d├ęj├á vu-Gef├╝hl und diesmal wusste Peter warum, die Situation erinnerte ihn an die R├╝ckkehr des Agamemnon, wie sie in der Odyssee geschildert wurde, die sein Bruder wieder und wieder las wie der Pfarrer sein Brevier: Agamemnon kehrte vom Krieg zur├╝ck, aber seine Frau war bereits sein neue Bindung eingegangen. Wie wollte es Mutter vor Vater verheimlichen, dass Wilhelm und sie bereits das Aufgebot bestellt hatten? Peter versp├╝rte den starken Wunsch, durch den Hinterausgang des Hauses zu verschwinden, einfach zu verschwinden wie sein Vater es vor zehn Jahren getan hatte und alle Probleme hinter mir in diesem Haus zur├╝ckzulassen.
„Einen Moment mal“, stammelte Wilhelm und seine Stimme lie├č erkennen, dass ihn diese Neuigkeit genauso schockierte wie die Mutter, „du willst mich doch hoffentlich nicht zum Besten halten? Mit solchen Dingen macht man keine Scherze!“
Doch Peter hatte bereits die T├╝re aufgerissen und h├Ątte sie fast mit Elan hinter sich zugeschmissen, aber er beherrschte sich, da er noch mit seinen Geschwistern sprechen musste, bevor er die Aufmerksamkeit seines Vaters erregen durfte.
W├Ąhrend er sich die Treppe hinaufstahl, konnte er die Mutter in der Diele sprechen h├Âren. Er blieb einen Augenblick stehen um zu lauschen und vernahm, dass der Vater den Kutscher anwies, sein Gep├Ąck ins Haus zu schaffen. Offenbar beabsichtige er zu bleiben.
So hatte Bernhard Berggruen sich seine R├╝ckkehr in den Kreis seiner Familie nicht vorgestellt. Freudentr├Ąnen und Jubelschreie hatte er erhofft, aber an der Mittagstafel herrschte eine geradezu unertr├Ąglich angespannte Atmosph├Ąre.
Niemand freute sich: Johann k├Ąmpfte mit den Tr├Ąnen. Seine Mutter war erstarrt wie ein mechanisches Spielzeug. Doktor Wilhelm Eisenbach litt unter Appetitlosigkeit, w├Ąhrend Peter gedankenlos alles in sich hineinschaufelte und Elise, die das Mahl auftrug den Eindruck erweckte, als k├Ânnte sie jeden Augenblick loskichern. Nur die kleine Sophie betrachtete ihn mit unverhohlener Neugier.
Seine Frau hatte ihm zu Beginn des Mahls einige Fragen gestellt, deren Beantwortung sie aber nicht weiter zu interessieren schien. Ganz unvermittelt hatte dieser Doktor Eisenbach sie unterbrochen und von einer Anstellung berichtet, die ihm von der Bibliothek eines Gymnasiums in K├Ânigsberg angeboten worden war und Charlotte war daraufhin noch blasser geworden, falls dies ├╝berhaupt noch m├Âglich war.
Nachdem er selbst zum zweiten Mal festgestellt hatte, dass seine Kinder gro├č geworden waren, war das Gespr├Ąch schlie├člich v├Âllig verebbt. Die einzigen Ger├Ąusche, die nun das bleischwere Schweigen durchbrachen waren das Schaben der Messer auf den Tellern, leises Schl├╝rfen und das Zur├╝ckstellen von Gl├Ąsern auf die Tischplatte aus Mahagoni.
Bernhard Berggruen f├╝hlte sich ziemlich verloren und sein Blick wanderte von einem Gesicht zum anderen. ┬áWar dies nicht seine Familie, zu der er endlich zur├╝ckgekehrt war? War dies nicht sein Haus, das sein eigener Vater hatte erbauen lassen? War dies nicht sein Tisch, unter den die Anwesenden ihre F├╝├če streckten? Sein Verstand sagte ihm, dass all dies zutraf, aber sein Gef├╝hl sprach eine andere Sprache.
An den S├Âhnen, die ihm mittlerweile beide ├╝ber den Kopf gewachsen waren konnte er die inzwischen verstrichene Zeit ermessen und auch die Tochter war dem Kleinkindalter entwachsen. Wie alt mochten sie sein? Bernhard Berggruen durchforstete m├╝hsam seine halb versch├╝tteten Erinnerungen: Peter war ein Jahr nach seiner Eheschlie├čung geboren. Eine schemenhafte Erinnerung des Gl├╝cks, das er damals empfunden hatte stieg in ihm auf, aber sie war unendlich weit entfernt wie die Vergangenheit eines anderen. An den Fingern z├Ąhlte er ab, dass sein ├ältester nun bereits zwanzig Lenze z├Ąhlen musste. Der ein Jahr j├╝ngere Johann war also neunzehn und seine Tochter, die er nur als S├Ąugling kannte immerhin elf Jahre alt.
Zu feschen Burschen hatten die S├Âhne sich entwickelt, vor allem Johann mit seinen kastanienbraunen Locken und den melancholischen braunen Augen. Der dunkelhaarige Peter hingegen, der ihn aus den Augenwinkeln musterte, wenn er sich unbeobachtet f├╝hlte, wirkte f├╝r sein jugendliches Alter recht verschlossen, was aber nichts war im Vergleich mit diesem verbissenen Doktor Eisenbach.
Wieso sa├č an der Tafel ein Hauslehrer? Waren die Jungs nicht l├Ąngst dem Schulalter entwachsen und seit wann engagierte man Literaturwissenschaftler zur Beaufsichtigung seiner T├Âchter und keine Gouvernanten? Aber warum wunderte er sich? Er h├Ątte seine Frau nicht so lange allein lassen sollen! Bernhard Berggruen schob diesen unangenehmen Gedanken beiseite, denn er glaubte noch immer an eine gemeinsame Zukunft.
Monomanisch wiederholte er im Geiste: Es hatte sich nichts ge├Ąndert: die Stadt, das Haus, die M├Âbel, seine Frau, alles war so, wie er es in Erinnerung hatte! Tief in seinem Inneren wusste er jedoch, dass sich alles ge├Ąndert hatte, vor allem er selbst war nicht mehr derselbe.
In einem hilflosen Versuch, die abgerissene Verbindung zu seiner Frau wiederzubeleben, f├Ârderte er die pr├Ąchtige Kette aus seiner Jackentasche zutage, die er kurz nach seiner Ankunft┬á in ├ägypten auf dem Basar von Kairo erworben hatte. All die Jahre hatte er sie seiner Frau mit der Post zukommen lassen wollen, aber er hatte es immer wieder verschoben.
So schnell, dass sie nicht zur├╝ckweichen konnte trat er hinter seine Frau und h├Ąngte ihr das Geschmeide um den Hals. Betreten schielte sie nach hinten, wo sich erstmals ihre Blicke trafen. Bernhard Berggruen l├Ąchelte, obwohl er sich unendlich m├╝de f├╝hlte. Was hatte seine Frau? Warum zuckte sie zusammen? St├Ârte sie der Bart, den er sich hatte sprie├čen lassen, um die Narben in seinem Gesicht zu verbergen? Sein Herz klopfte so laut, dass sie es h├Âren musste.
„Danke, Bernhard... Das war nicht n├Âtig… Vielen Dank, es ist wundersch├Ân aber... viel zu wertvoll...“, stammelte sie, sprang von ihrem Platz auf und wandte sich nochmals zu ihrem Mann um. F├╝r einen Moment stand sie wie angewurzelt da und Bernhard Berggruen bek├Ąmpfte den Impuls sie zu umarmen, denn Charlotte blickte nun wie vom schlechten Gewissen geplagt zu Boden. Dann st├╝rmte sie aus dem Speisezimmer. Die T├╝re des Salons schlug zu, und ein leises Schluchzen war zu h├Âren.
Johann sprang auf, doch Peter packte ihn bei der Schulter.
„Lass sie“, wisperte er seinem Bruder zu und warf im gleichen Augenblick seiner Schwester einen flehentlichen Blick zu. „Ich glaube, sie will allein sein.“
Mit sorgenvoller Mine verlie├č der Vater die so abrupt aufgehobene Tafel, aber er versuchte nicht die Mutter zu tr├Âsten, sondern inspizierte sein Gep├Ąck. Neben zahlreichen Koffern und Taschen, stapelten sich auch einige Holzkisten unterschiedlicher Gr├Â├če in der Diele, darunter eine ganz besonders gro├če, die etwa f├╝nf Fu├č lang war.
Peter, der dem Vater zusammen mit seinen beiden Geschwistern gefolgt war sah zur├╝ckschauend durch die ge├Âffnete Esszimmert├╝r, dass Wilhelm noch immer allein am Ende des Tisches sa├č. Erstmals versp├╝rte er fast so etwas wie Mitleid f├╝r seinen ehemaligen Hauslehrer, aber dieses Gef├╝hl hielt nicht lange an, da er sich an die endlosen Grammatik├╝bungen erinnerte, die er ihm vorzugsweise an milden Fr├╝hjahrstagen aufgebrummt hatte.
Der Vater ├Âffnete einen alten, abgewetzten Koffer, auf dessen Deckel so viele farbige Aufkleber von Hotels platziert waren, dass das Leder nur noch an wenigen Stellen freilag.
„Das ist f├╝r euch!“, sagte er fast beil├Ąufig und schenkte seinen Kindern je einen morgenl├Ąndischen Hausmantel aus farbiggewirkter Seide.
Johann schl├╝pfte hinein und t├Ąnzelte durch die Diele, um sich im Spiegel zu betrachten und Peter nannte ihn einen Maharaja. Der Bruder grinste zur├╝ck. Pl├Âtzlich hellte sich auch das b├Ąrtige Gesicht des Vaters auf und Peter fragte sich wie er ihn vorhin noch so unheimlich finden konnte. Endlich schloss der Vater seine S├Âhne in die Arme, ohne, dass diese sich dagegen wehrten und auch Sophie kam ihm treuherzig entgegen. Der Vater strich ihr ├╝ber das blonde Haar und gab ihr einen angedeuteten Kuss auf die Wange.┬á ┬á
„Wollt ihr nicht nachschauen, was ich noch alles mitgebracht habe?“, fragte er nach einer Weile und es gelang ihm nur mit M├╝he seine R├╝hrung zu verbergen.
Peters Neugier war geweckt. Er zerschnitt die Schn├╝re, mit denen die erste Kiste umwickelt war und zog mit der Zange die N├Ągel aus dem Holzdeckeln. Er wurde f├╝r seine M├╝he belohnt, als er die in der Kiste verstauten Kunstsch├Ątze auspackte: Orientteppiche, alt├Ągyptischen Gef├Ą├če aus durchscheinendem Alabaster, Statuetten von Fremden G├Âttern und von wilden Tieren, Dosen, Papyrusrollen und Gruppen von kleinen Figuren, die in puppenhausartigen Mauern den verschiedensten Verrichtungen des t├Ąglichen Lebens nachgingen.
Johann schaute Peter mit vor Aufregung ger├Âteten Wangen ├╝ber die Schulter. Auch Wilhelm zeigte sich fasziniert, vor allem von den Schriftrollen und Peter dachte, dass er ein grauenhafter Angeber war, der nur so tat als k├Ânne er die Hieroglyphen entziffern. Nur Sophie war ins Esszimmer zur├╝ckgekehrt und schaute mit traurigem Gesicht aus dem Fenster.
Elise brachte schnell das Geschirr und das damastene Tischtuch in Sicherheit und bald war der Esstisch von historischen Sch├Ątzen ├╝bers├Ąt. Alles sah so makellos aus, als sei es erst gestern gefertigt, perfekt konserviert von der trockenen hei├čen Luft ├ägypten. Vor allem die Artefakte aus Gold hatten eine geradezu erschreckende Pr├Ąsenz und der Vater erkl├Ąrte, dass die ├ägypter Gold f├╝r das Fleisch der G├Âtter hielten
 
Die gro├če Kiste lag noch immer auf dem Kelim-Teppich in der Diele. Offenbar wollte sie der Vater bis zum Schluss aufbewahren. Johann fragte sich warum er ein so riesiges Geheimnis um sie machte. Als er um die Kiste herumging bemerke er pl├Âtzlich, dass sich Wilhelm mittlerweile dezent zur├╝ckgezogen hatte, wohl um sich mit der Mutter zu besprechen und er fragte sich, wie das alles noch enden sollte.┬á
Johann trat einen Schritt zur├╝ck um die Kiste aus einer gr├Â├čeren Distanz zu betrachten. Sie sah aus wie die anderen Kisten, nur etwas gr├Â├čer. Trotzdem f├╝hlte Johann sich von dieser speziellen Kiste zugleich angezogen und abgesto├čen. Vorsichtig beugte er sich vor und fuhr mit den Fingerspitzen ├╝ber ihren Deckel. Er blickte zu seinem Vater auf, der l├Ąchelnd hinter ihm stand und eine einladende Geste in Richtung der Kiste machte.
Johann fasste sich ein Herz und nahm das Stemmeisen um den Deckel mit kr├Ąftigen St├Â├čen abzuhebeln. Als der Deckel aufsprang, schlug Johann eine ├╝belrichende Staubwolke ins Gesicht. Er schrak zur├╝ck und schaute hoch zu seinem Vater, aber dieser nickte ihm nur l├Ąchelnd zu. Hatte er nichts bemerkt?
Johann hingegen graute es. Er hatte einen Hauch auf seinen Wangen versp├╝rt als ob sich aus der mysteri├Âsen Kiste etwas Lebendes entwichen w├Ąre, wie ein Geist aus einer verkorkten Flasche.
„Worauf wartest du noch? Mach es doch nicht so spannend!“, h├Ârte er seinen Bruder sagen, der aus dem Esszimmer geschlendert kam, wo er die mittlerweile vor sich hinquengelnde Schwester getadelt hatte, die es nicht gewohnt war, dass keiner von ihr Notiz nahm.
„Wenn es ihm Spa├č macht“, erwiderte der Vater, doch seine Stimme schein von weit her zukommen.┬á ┬á
Als Johann nicht reagierte stie├č Peter selbst den Deckel zur├╝ck. Johann schaute hinein und sah ein farbig bemaltes Holzobjekt. Es war eine Art gro├če Schachtel. Sie hatte dieselben l├Ąnglichen Ausma├če wie die Transportkiste, aber der obere Teil war schmaler, abgerundet und bemalte mit exotisch stilisierten, weiblichen Gesichtz├╝gen. Auch die restliche Oberfl├Ąche war mit feinen Gold- und Steineinlagen reich verziert und lackiert. Peter erkannte erschauernd Bilder von tierk├Âpfigen alt├Ągyptischen Gottheiten, darunter der mumiengestaltige Osiris.
Wieder fuhr er mit den Fingern ├╝ber die Oberfl├Ąche, die glatt und k├╝hl war, aber pl├Âtzlich war ihm, als ob die Schachtel vor ihm zur├╝ckgezuckt w├Ąre. Wie durch einen Nebel h├Ârte er Peter lachen. Johann schaute sich um und erschrak ├╝ber das feixende Gesicht seines Bruders.
Peter stumpte ihn zur Seite und hob den Deckel an. Der Sand der Sahara rieselte aus der Kiste und dann sah Johann eine Art Wolke, in der er eine menschliche Gestalt zu erkennen vermeinte. Er schrie vor Angst laut auf. Sein Bruder lie├č den Deckel fahren, der krachend zur├╝ckfiel und Johann st├╝rzte durch einen, dunklen Brunnenschacht, der nicht enden wollte. Dort, wo die Schw├Ąrze am tiefsten war, starrte er in zwei gl├╝hende Augen. Sie fixierten ihn, ohne auch nur einmal zu blinzeln und verschwanden wieder in der dunklen Nacht. Schrille Ger├Ąusche durchschnitten das Dunkel, die nichts Menschliches an sich hatten. Sue schwollen rhythmisch an und verebbten, nur um erneut zu ert├Ânen. Dann herrschte ganz pl├Âtzlich Stille und Licht.
Sophie begann laut zu weinen als Johann ganz langsam zu Boden sank. Die T├╝re des Salons flog auf, und die Mutter st├╝rmte heraus, mit verheulten Augen und aufgel├Âsten Haaren. Peter holte ein Glas Wasser um seinem Bruder die Stirn zu benetzen. Zu seiner gro├čen Erleichterung ├Âffnete dieser sogleich die Augen.
„Was ist geschehen?“, fragte er best├╝rzt, doch Johann brachte kein Wort heraus. Er zitterte am ganzen Leib und schwitzte zugleich. Seine Kleidung klebte ihm feucht am K├Ârper.
Hinter ihm heulte noch immer die kleine Schwester und die Eltern beschuldigten sich gegenseitig dieses Ungl├╝ck verursacht zu haben.
„Johann! Was hast du?,
Peter schloss den noch immer zitternden Bruder in die Arme und endlich sp├╝rte er, wie sich das Beben in seines Bruders K├Ârper nachlie├č. Elise war mittlerweile auch herangeeilt, ebenso wie Wilhelm, der versuchte, sich demonstrativ hinter die Mutter zu stellen, aber da er kaum gr├Â├čer als sie war wirkte es eher als ob er sich hinter ihr versteckte.
„Was zum Teufel ist da drin?“, fragte die Mutter in einem inquisitorischen Tonfall auf die Kiste deutend.
„Die Mumie eines M├Ądchens...“
Die Mutter straffte sich umgehend. „So etwas bringst du mir ins Haus? Sieh nur, was du damit angerichtet hast!“
Sie deutete anklagend mit dem Finger auf Johann.
„Aber wie konnte ich es ahnen, dass er so darauf reagieren w├╝rde!“, wehrte der Vater ab.
„Was wunderst du dich? Eine Mumie ist schlie├člich kein Kunstwerk!“, beschwerte sich die Mutter. „Ich weigere mich, einen Leichnam im Haus aufzubewahren!“
Mit einem halbunterdr├╝cktem Seufzer half sie ihrem j├╝ngeren Sohn, der sich der Mutter gegen├╝ber sichtbar an der Leine riss wieder auf die Beine.
Sein zielloser Blick richtete sich und er kam wieder zu Atem.
„Du hast uns ja einen Schrecken eingejagt“, meinte Peter. „Was in aller Welt war mit dir los?“
„Es war nur ein Schw├Ącheanfall“, beteuerte Johann.
„Das ist nichts f├╝r die Kleine“, n├Ârgelte Wilhelm im Hintergrund. „Au├čerdem kommt das nur von deiner Lekt├╝re. Die 'Odyssee' in deutscher Sprache, wenn ich das nur h├Âre!“
„Wir sind jetzt Studenten. Du hast uns gar nichts mehr zu befehlen!“, protestierte Peter und empfing daf├╝r ver├Ąrgerten Seitenblick von der Mutter.
Wilhelm wandte sich wortlos zum Gehen. Die noch immer quengelnde Sophie vor sich hertreibend verschwand er hinter der zufallenden T├╝r.
„Da hat dir deine Phantasie aber einen ziemlichen Streich gespielt“, meinte Peter, der sich freute, dass Johann wieder etwas Farbe im Gesicht hatte.
„Vielleicht sollte ich mir von Wilhelm eine lateinische Grammatik leihen“, erwiderte dieser mit einem matten L├Ącheln.“ Dann werde ich vielleicht genauso prosaisch wie er.“
Peter lachte.
Drau├čen heulte der Sturm und aus dem Salon dr├Âhnten wieder lautstarke Stimmen, Peter spitzte die Ohren, denn der Streit t├Ânte durch die halb offenstehende T├╝r. Er vernahm Begriffe wie „Verantwortungslosigkeit“ und „deine Erziehung“, aber pl├Âtzlich verstummte der Zank.
Auf Zehenspitzen n├Ąherte sich Peter der T├╝r und er sah seine Eltern in der Mitte des Raumes stehen. Die Mutter hob die Hand als wolle sie den Vater schlagen, der Vater fasste sie sanft am Handgelenk und beugte sich zu ihr herunter. „Bernhard...“, fl├╝sterte die Mutter als der Vater sie an sich zog und sie k├╝sste. Einen Augenblick lang versuchte sie ihn zur├╝ckzusto├čen, dann gab sie den Widerstand auf.
Jetzt hat es sich endlich ausgeeisenbacht, dachte Peter befriedigt, bevor er sich ganz langsam zur├╝ckzog und ganz leise die Salont├╝r schloss.
Aber es kam ganz anders. Am folgenden Morgen hatte der Vater starkes Fieber bekommen.
 
„Das ist ja entsetzlich“, fl├╝sterte Moritz, tief bewegt. „Er hat sich sicher in ├ägypten irgendetwas eingefangen.“
Peter nickte. „Er ist in einen... katakombischen“
„Katatonisch.“, verbesserte Moritz.
„Ja, richtig... er ist in einen katatonischen Zustand verfallen.“
W├Ąhrend er sich des Anblickes seines Vaters erinnerte, f├╝hlte Peter eine Welle des Elends in ihm aufsteigen.
„Nicht mehr ansprechbar war er. Unser Hausarzt kannte nicht einmal den Namen seiner Krankheit. Seine S├Ąfte, seine Pillen, sie haben nicht geholfen. Im Gegenteil: Vater ist immer schw├Ącher geworden und hat nur ab und zu noch im Delirium seltsamen Dingen vor sich hingemurmelt. Er sprach von einer Oase, von einer Frau mit ihrer Tochter und von einem Tempel, aber alles war so wirr, dass ich mir keinen Vers daraus machen konnte. Drei Tage lag er auf dem Bett und k├Ąmpfte gegen den Tod. W├Ąhrende der ganzen Zeit hat Mutter an seinem Bett gesessen, aber sie wirkte seltsam weggetreten, wie eine Schlafwandlerin, aber Vater ist einfach so dahingesiecht, und am Abend des dritten Tages hat er die Augen f├╝r immer geschlossen.“
„Das tut mir schrecklich leid f├╝r Dich und Johann“, fl├╝sterte Moritz.
Peter nickte
„Johann geht es noch immer sehr schlecht. Keine Nacht, in der er ruhig schl├Ąft.“
„Ja, und Deine Mutter, ich meine... will sie noch immer den Doktor Sowieso heiraten?“
„Sie wei├č selbst nicht, was sie will. Eigentlich wollte sie immer nur unseren Vater zur├╝ck, glaube ich... Der Eisenbach war nur eine Vernunftl├Âsung, ein Ersatz.“
„Jetzt habt ihr eine echte...“, begann Moritz, und seine Augen leuchteten auf einmal. „Sag, darf ich die Mumie mal sehen?“
Peter sch├╝ttelte den Kopf. „Nein, das geht nicht. Wir haben sie vorerst in den Keller geschafft, aber Mutter will sie so schnell wie m├Âglich loswerden.“
„Bitte! Ausnahmsweise.“, flehte Moritz. „Ich bin schlie├člich dein Freund, du selbst hast sie dir inzwischen bestimmt auch angesehen?“
„Nein, dass habe ich nicht“, beteuerte Peter und fragte sich, seit wann sein Freund ein so gef├╝hlloser Klotz war.
Verstimmt packte er seinen Ranzen und mit einem „Danke f├╝r die Einladung“ lie├č er Moritz mit seinem halbvollen Weinglas im „Fasan“ sitzen.
Das Wasser des Osiris
14. Das Wasser des Osiris
Als Peter kurz nach Sonnenaufgang unsanft von einem laut gebr├╝llten Kommando geweckt wurde, brauchte er einen Augenblick lang um zu bereifen, warum Takait als Junge verkleidet neben seinem Lager stand. Sie sah aus, als habe sie nicht geschlafen und abgenommen hatte sie auch.
Dann besann er sich, dass die Karawane ziemlich ├╝berst├╝rzt und mehrere Tage fr├╝her als geplant von der ersten Oase aufgebrochen war. Eine Stunde nachdem der Sphinx zu einem Sandhaufen zusammengest├╝rzt war, hatte sich ein aufgebrachter Mob vor der Karawanserei zusammengerottet, der die Fremden zum S├╝ndenbock f├╝r die schrecklichen Ereignisse machen wollte. Nur indem sie geflohen waren, hatten sie sich vor den lynchw├╝tigen Oasenbewohnern retten k├Ânnen. Wenn die Beduinen diese nicht mit ihren Gewehren in Schach gehalten h├Ątten, h├Ątten sie die erste Oase wohl nicht lebend verlassen. Es war eine seltsame Welt, in der man heidnische G├Âtter anbetete, aber Schusswaffen kannte. Wenn die aufgebrachte Menge die t├Âdliche Wirkung der Gewehre nicht gekannt h├Ątte, w├Ąre sie nicht augenblicklich gefl├╝chtet. Wahrscheinlich war es schon in der Vergangenheit zu Zusammenst├Â├čen zwischen den bewaffneten Karawanenf├╝hrern und den Einheimischen gekommen.
Peters erster klarer Gedanke galt der wertvollen Zwiebel und er schaute sich m├Âglichst unauff├Ąllig um. Keiner der Kaufleute blickte in seine Richtung. Trotzdem drehte Peter ihnen vorsichtshalber den R├╝cken zu, damit sein K├Ârper ihnen den Blick verstellte. Dann kramte er nach der Zwiebel in einem ledernen Beutel, den er am G├╝rtel trug. Er hatte sie in ein feuchtes Taschentuch eingeschlagen, das aber inzwischen knochentrocken war. W├╝stenstaub fiel heraus, als er das Tuch auffaltete und der darin geborgene Oasenkrokus bot einen traurigen Anblick. Seine rote Bl├╝te und die Bl├Ątter hatten keinen einzigen Tag in der sengenden Hitze ├╝berstanden. Dies war eigentlich zu erwarten gewesen, denn es war ein wahnsinniges Vorhaben, eine bl├╝hende Pflanze durch die W├╝ste zu transportieren. Sie konnten sich gl├╝cklich preisen, falls es ihnen gel├Ąnge, wenigstens die Zwiebel heil in die n├Ąchste Oase zu schaffen, wo sie gut beraten waren, die Medizin daraus zu bereiten.
„Nur gut, dass der Oasenkrokus eine verdickte Wurzel besitzt“, sagte Takait und Peter fuhr zusammen, denn er hatte sie nicht herannahen geh├Ârt. „Sonst h├Ąttet ihr den langen, beschwerlichen Weg durch die W├╝ste v├Âllig umsonst gemacht.“
Peter w├╝rdigte Takait keines Blickes, denn er hasste es, wenn sich jemand von hinten an ihn anschlich und ihn erschreckte. Mit gro├čer Sorgfalt wickelte er die Zwiebel wieder in das Tuch und verstaute dieses in seinem Beutel.┬á
Als er sich den anderen wieder zuwandte war Takait mit der Zubereitung des Fr├╝hst├╝cks besch├Ąftigt und der Bruder hockte unt├Ątig neben ihr auf dem Boden, wobei seine Knie fast seine Ohren ber├╝hrten. Das M├Ądchen trug wieder ihr eigenes, kurz geschnittenes Haar. So konnte sie - zumindest f├╝r einen unaufmerksamen Betrachter wie Johann - als Junge durchgehen, aber Peter fragte sich, ob es sich nicht inzwischen unter den H├Ąndlern herumgesprochen hatte, dass sie es war, die vor dem Sphinx getanzt hatte. Was f├╝r ein Jammer, dass Takait keine Tempelt├Ąnzerin mehr sein wollte, dachte Peter, denn er hatte noch nie einen so beeindruckenden Tanz gesehen. Daher wunderte er sich auch noch immer dar├╝ber, dass Takait sich ihnen bei ihrer Flucht angeschlossen hatte. War sie denn nicht zur ersten Sobek-Oase gereist, um Hathor-Priesterin zu werden?
Peter steckte die K├Ąlte der Nacht noch immer in den Knochen und er sog gierig die warme Luft ein, die der Wind ihm ins Gesicht blies, aber er war noch immer von den schrecklichen Ereignissen des Vortags ganz aufgew├╝hlt. Zeit seines Lebens hatte er sich geweigert an ├ťbernat├╝rliches, Spuk und anderen Hokuspokus zu glauben, weshalb er auch Johanns Bericht vom Besuch des m├Ârderischen Schattens mit gro├čer Skepsis aufgenommen hatte. Nun hatte er mit eigenen Augen gesehen, wie ein steinerner Sphinx zum Leben erwacht und kurze Zeit sp├Ąter durch den Tanz einer jungen Frau zu Sand verwandelt worden war.
Als Peter Takait am Lagerfeuer herumwerkeln sah, fragte er sich, ob er es tats├Ąchlich einer Tempelt├Ąnzerin zumuten konnte, weiterhin seine Dienerin zu sein. Au├čerdem hatte sie ihnen nicht nur geholfen, den Oasenkrokus zu stehlen, sondern sie hatte ihnen schlie├člich das Leben gerettet. Doch die Frage, ob Takait die Br├╝der f├╝r die zur├╝ckliegenden Ereignisse verantwortlich machte, lag noch immer unausgesprochen zwischen ihnen.
„Einen Vorteil hat diese schreckliche Sache: Wenigstens begleitest du uns jetzt noch bis zur n├Ąchsten Etappe“, sagte Peter nach einer Weile zu Takait, die in einer Pfanne r├╝hrte und dabei leise eine traurige Melodie vor sich hinsummte. Peter fand den Geruch des Breis, den sie darin briet nicht sehr appetitanregend und er wollte lieber gar nicht wissen, worum es sich handelte.
Takait schaute von ihrer Arbeit hoch. Schmerz und Ersch├Âpfung schienen ihr in den Augen.
„Dabei wollte ich wirklich gern auf der ersten Oase bleiben.“
Peter wurde bewusst, dass seine Bemerkung nicht sehr diplomatisch gewesen war. 
„Ja, das war eine kurze Laufbahn als Priestersch├╝lerin“, sagte er daher schlie├člich in einem entschuldigenden Tonfall zu ihr, und fragte sich im n├Ąchsten Augenblick, wof├╝r er sich eigentlich entschuldigte.
„Das ist nicht so schlimm. In diesem Tempel hat es mir sowieso nicht gefallen“, erwiderte Takait mit einer fahrigen Handbewegung, bei der ihr fast der R├╝hrl├Âffel in die Pfanne gefallen w├Ąre. Es war un├╝bersehbar, dass sie versuchte, ihre Nervosit├Ąt zu verbergen, aber es gelang ihr nicht.
„Ich verstehe dich nicht! Zuerst l├Ąufst du von zu Hause weg, um Priestersch├╝lerin zu werden und dann macht es dir pl├Âtzlich nichts aus, alles wieder aufzugeben?“, mischte sich Johann ein, Takait skeptisch von der Seite musternd.
Takait wandte sich ab, so dass die Br├╝der ihr Gesicht nicht sehen konnten. Einen Augenblick lang schaute sie mit der Pfanne in der Hand wortlos in die W├╝ste.
„Ich bin nicht als Sch├╝lerin angenommen worden“, sagte sie dann, sich wieder umdrehend mit leiser, tonloser Stimme. „Die oberste Hathore hat gesagt, dass sie nur Neulinge annimmt und keine ausgebildete T├Ąnzerinnen anderer Kulte. In Wahrheit war sie nur neidisch, weil ich j├╝nger bin als sie. Ich war gut genug, sie bis zum n├Ąchsten Feiertag zu vertreten - denn die Hohepriesterin besucht gerade ihre Verwandten auf der zweiten Oase – aber dann sollte ich wieder gehen. Nur deshalb habe ich euch geholfen, den Oasenkrokus zu stehlen, weil ich mich so ├╝ber die Hohepriesterin ge├Ąrgert habe.“
Jetzt schaute Johann betreten auf den Boden, denn diese Antwort hatte er sicherlich nicht erwartet. Peter f├╝hlte sich verpflichtet, irgendetwas zu sagen, um das peinliche Schweigen zu beenden.
„Willst du dich nicht im Tempel der zweiten Oase bewerben?“
„Dass wei├č ich noch nicht“, brummte Takait ihn an und Peter fragte sich, was eigentlich dagegen sprach.
„Bestimmt gibt es auch auf der dritten Oase einen Tempel?“, fragte Johann, sicher nicht ganz uneigenn├╝tzig.
„Mehrere, zum Beispiel der Neith-Tempel.“
„Der Neid-Tempel?“, entfuhr es beide Br├╝der zugleich.
Takait schaute sie tadelnd an und Peter fragte sich, warum sie so schlecht gelaunt war.
„In dem gr├Â├čten Tempel der dritten Oase wird die G├Âttin Neith verehrt.“ Takait sprach das Wort sehr deutlich aus, sodass Peter und Johann verstanden, dass es offenbar mit einem T endete.┬á „Ihr Name bedeutet die Schreckliche“, f├╝gte sie in einem Tonfall hinzu, in dem Peter heute ist ein sch├Âner Tag gesagt h├Ątte. „Sie ist eine der vier Schutzgottheiten der Toten. Auf dem Geb├Ąlk ihres Tempels steht die Inschrift: Ich bin alles, was war, alles, was ist und alles, was sein wird. Keinem Sterblichen ist es jemals gelungen meinen Schleier abzustreifen.“
„Hat sie den Kopf eines Tieres?“, fragte Johann mit gerunzelter Stirn.“
„Nein, sie wird in menschlicher Gestalt dargestellt und ist h├Ąufig mit┬á Pfeil und Bogen ausgestattet. Da sie im Nildelta ihren Hauptwohnsitz hat, tr├Ągt sie die rote Krone Unter├Ągyptens.“
Nach dieser Erkl├Ąrung, von der Peter nicht recht wusste, wie er sie einordnen sollte, herrschte wieder bedr├╝ckende Stille.
„Nur gut, dass wir bewaffnete Karawanenf├╝hrer haben“, bemerkte Peter auf die in lange Umh├Ąnge geh├╝llten Gestalten deutend. Er kam sich ziemlich einf├Ąltig vor, aber er f├╝hlte sich ┬áverpflichtete, irgendetwas zu sagen.
„Sie tun nur so, als ob sie sich nicht f├╝rchten. Der Einsturz des Labyrinths und der w├╝tende Sphinx werden sie genauso erschreckt haben wie euch“, erwiderte Takait, offensichtlich froh das Thema wechseln zu k├Ânnen.
„Warum sagst du das in einem derart vorwurfsvollen Tonfall“, protestierte Johann, „wir sind weder f├╝r das Erdbeben verantwortlich, noch ist es unsere Schuld, dass R├Ąuber ins das Labyrinth eingebrochen sind!“
„Aber immerhin seid ihr in die Grabkammer eingedrungen, die der Sphinx bewacht hat“, erkl├Ąrte Takait mit finsterem Gesicht.
„Aber die anderen haben die T├╝r ge├Âffnet. Wir sind nur zuf├Ąllig da drinnen gelandet! Wenn du mitgekommen w├Ąrst, wie es eigentlich deine Aufgabe als Dolmetscherin gewesen w├Ąre, w├Ąren wir nicht vom Weg abgekommen! Das ist alles nur deine Schuld!“
Peter wunderte sich, warum der Bruder Takait gegen├╝ber immer gleich so feindselig war.
„M├Âglicherweise hat aber auch das Herausrei├čen der Blume durch profane H├Ąnde den Sphinx geweckt!“, vermutete Takait, den Vorwurf ignorierend.
„Warum hast du das dann nicht ┬áf├╝r uns getan, wo deine H├Ąnde doch offenbar nicht profan sind?“, fuhr Johann die Tempelt├Ąnzerin an.
Ich habe einen heiligen Eid schw├Âren m├╝ssen, dass ich keinen Oasenkrokus ausgraben darf.“┬á
„Bestimmt willst du als n├Ąchstes meinem Bruder weismachen, dass er es war, der den Sphinx auf den Plan gebracht hat, weil er im Sandsturm eine streunende Katze getreten hat“, konterte Johann boshaft und Peter kannte den Bruder gut genug, um zu wissen, dass er selbst dies f├╝r eine absurde Idee hielt.
„Dann h├Ątte der Sphinx sich fr├╝her geregt!“, erkl├Ąrte Takait sachlich, die den Kommentar offenbar ernst genommen hatte.
„Eigentlich ist es doch ziemlich gleichg├╝ltig, was den Sphinx ge├Ąrgert hat“, erkl├Ąrte Peter, in einem Versuch Frieden zwischen den Streithammeln zu stiften, „Hauptsache, wir sind ihm entkommen.“
„Aber ….“
Takait stie├č das Wort mit einem emp├Ârten Gesichtsaudruck aus, wandte aber dann abrupt ihre Aufmerksamkeit wieder der Pfanne zu, die sie w├Ąhrend des Gespr├Ąches kurzzeitig vom Feuer genommen hatte. Peters Blick, der ihr folgte streifte die Nomaden, die ein Kaninchen am Feuer r├Âsteten, das einer von Ihnen gejagt hatte. K├Âstlicher Bratenduft drang bald durch das Lager, aber die Beduinen machten keinerlei Anstalten, ihre Beute mit den anderen zu teilen.
„Mehr haben die geizigen Kaufleute nicht herausger├╝ckt.“ Takait zeigte sie mit einer einladenden Bewegung auf die nach Fett riechenden grauen Fladen, die sie zubereitet hatte. „Sie behaupten, dass sie ihre Gesch├Ąfte auf der Oase noch nicht abgeschlossen hatten, aber ich finde, sie h├Ątten uns trotzdem wenigstens ein paar Oliven abgeben k├Ânnen.“
Angewidert betrachte Peter den Inhalt der Pfanne. Dabei dachte er mit Mordgel├╝sten an den Wirt, der den Kontakt zu den Beduinen hergestellt hatte. Ihm hatten sie Geld f├╝r ihre Verpflegung bezahlt und nun behaupteten die H├Ąndler, davon nichts zu wissen. Vielleicht waren es aber auch die Kaufleute, die ihn betrogen, aber Peter konnte es ihnen nicht nachweisen, denn schlie├člich besa├č er keine Quittung. Lustlos biss er in einen Fladen, der noch fader schmeckte als er aussah und Peter hatte nur Wasser, um ihn herunterzusp├╝len. Ein Becher Kaffee w├Ąre eigentlich das Mindeste, was man nach einer Nacht in der W├╝ste erwarten konnte! Wehm├╝tig dachte Peter an das Gasthaus zum Fasan in seiner Heimatstadt.
Auch Takait hatte offenbar keinen Appetit, denn sie legte ihre Portion schon nach wenigen Bissen mit einem leisen Seufzer in die Pfanne zur├╝ck. Nur Johann stopfte unverdrossen den Fladen in sich hinein.
„Geht es dir gut?“ fragte Peter, w├Ąhrend er Takait von der Seite zu mustern suchte, aber sie wich seinen Blicken aus.
„Ja, es geht mir gut. Ich bin nur m├╝de“, murmelte sie, aber sie klang nicht sehr ├╝berzeugend.
„Dich bek├╝mmert doch etwas?“, fragte Peter daher in einem dr├Ąngenden Tonfall nach. „Wenn wir mit diesen zwielichtigen Kaufleuten reisen, sollten wir wenigstens voreinander keine Geheimnisse haben!“
Johann, der neben ihm sa├č musste ├╝ber diese Worte lachen und verschluckte sich an dem Bissen in seinem Mund. Er wurde von Hustenanf├Ąllen gesch├╝ttelt. Takait hingegen seufzte erneut, diesmal deutlich vernehmbar. Dann schaute sie mit ernstem Gesichtsausdruck in Richtung der Beduinen, stand auf und schritt auf die Karawanef├╝hrer zu.
„Ich glaube, es ist besser, wenn du mir die Zwiebel gibst“, sagte Johann leise, „Takait hat vorhin zugesehen, wie du sie weggepackt hast. Ich traue ihr nicht zehn Zentimeter ├╝ber den Weg.“
Wortlos dr├╝ckte Peter dem Bruder den Beutel in die Hand, da er zu ersch├Âpft war um sich herumzustreiten. Johann griff sich leise bedankend nach der Zwiebel und verstaute sie in seinem B├╝ndel und Peter hatte das ungute Gef├╝hl, einen Fehler begangen zu haben, aber er konnte kaum dem Bruder die Zwiebel gleich wieder wegnehmen. Aber es war ja nur f├╝r einen Tag. In der n├Ąchsten Karawanserei w├╝rde Peter ihn zu Medizin verarbeiten und diese dann in seinem Gep├Ąck verstauen.
Peter rieb sich die brennenden Augen, die vom hei├čen Wind gereizt waren. Dann dr├╝ckte er den R├╝cken durch und lie├č seinen Blick ├╝ber das Lager schweifen, mehr aus Langeweile, als, dass er erwartete, etwas Ungew├Âhnliches zu bemerken. Pl├Âtzlich schreckte er aus seinem d├Ąmmrigen Zustand auf, denn er hatte den Eindruck, dass die Karawane geschrumpft war. Dies war ihm am Vortag in der Hektik des Aufbruchs entgangen. Er z├Ąhlte die K├Âpfe der vermummten Kaufleute und es waren tats├Ąchlich nur dreizehn. Wo mochten die fehlenden beiden H├Ąndler stecken? Waren sie auf der Oase umgekommen? Hatte man sie vergessen oder waren sie freiwillig zur├╝ckgeblieben? Peter gr├╝belte einen Augenblick dar├╝ber nach, dann fiel es ihm ganz pl├Âtzlich wie Schuppen von den Augen.
„Jetzt wei├č ich, warum mir die beiden dicken Grabr├Ąuber unten im Labyrinth bekannt vorgekommen sind!“, entfuhr es ihm spontan und er war froh, dass keiner der anderen Deutsch verstand, „Es waren zwei der H├Ąndler!“
Und was war mit den anderen?, durchfuhr es Peter bang? Geh├Ârten sie zur gleichen R├Ąuberbande? Peter weigerte sich innerlich, dasselbe von Takait zu vermuten.
„Wie, um Gotteswillen kommst du denn auf diese Idee?“
Johann blickte den Bruder wie vom Donner ger├╝hrt an.
„Ganz einfach: Auf dem Hinweg waren es f├╝nfzehn Kaufm├Ąnner und jetzt sind es nur noch dreizehn“, erkl├Ąrte Peter.
Johann z├Ąhlte mit ausgestrecktem Zeigefinger die Kaufleute ab, die mittlerweile aufgebracht gestikulierend in einer Gruppe beisammen standen, wohl weil die Nomaden ihnen nichts von ihrem Braten abgaben. Takait verlie├č die Streitenden und schlenderte zu den Br├╝dern zur├╝ck.
„Es sind wirklich zwei weniger, aber vielleicht sind einfach zwei Kaufleute in der Oase geblieben“, wandte er ein. „Bist du sicher, dass du die R├Ąuber wiedererkannt hast? Unter ihren Umh├Ąngen sehen sie doch alle gleich aus.“
„Nein, ich habe ihre Gesichter aus der N├Ąhe gesehen…“
„Aber es waren doch drei R├Ąuber“, unterbrach Johann, „und nur zwei Kaufleute fehlen!“┬á┬á
Peter dachte einen Augenblick r├╝ber diesen Einwand nach.
„Du hast nat├╝rlich Recht, aber der d├╝nne ├ägypter kannte sich sehr gut aus. Er war wahrscheinlich ein Priester des Labyrinthes.“
„Ein Priester w├╝rde niemals ein Grab berauben!“, rief Takait emp├Ârt aus, die bisher schweigend, doch aufmerksam den Wortwechsel verfolgt hatte.
Peter bezweifelte dies. Schlie├člich wussten die Priester am besten, welche Sch├Ątze in den unterirdischen Gew├Âlben lagen, Sch├Ątze, mit denen die Lebenden mehr anfangen konnten als die Toten und er bedauerte noch immer, dass er aus der Grabkammer nichts mitnehmen konnte.
Der ├Ąltere der beiden Nomaden gab das Zeichen zum Aufbruch. Die Kaufleute beendeten ihre Auseinandersetzung, zumal das Kaninchen mittlerweile verspeist war und ein jeder bestieg sein Kamel.
In den n├Ąchsten Stunden durchquerte die Karawane einen besonders monotonen Kiesw├╝stenabschnitt. Dann wurden die Gesteinsbrocken immer kleiner bis nur noch grober Sand ├╝brig war. Riesige gelbe D├╝nen t├╝rmten sich in der Ferne vor dem azurblauen Himmel auf. Die hei├če Luft flirrte den Reisenden vor den brennenden Augen. Aus dem warmen Morgen war mittlerweile ein – selbst f├╝r hiesige Verh├Ąltnisse –ungew├Âhnlich hei├čer Mittag geworden.
Johann g├Ąhnte herzhaft, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. Er litt unter chronischem Schlafmangel und jetzt, wo die Karawane geschrumpft war, w├╝rde er noch h├Ąufiger zu Nachtwachen herangezogen werden. Missmutig schaute er sich nach den anderen um. Auch Peter sa├č apathisch auf seinem Kamel. Hinter ihm ritt Takait. Sie schaute immer wieder zur├╝ck, warum war Johann unklar, denn hinter ihr befand sich ein ├Ąltlicher, harmlos aussehender Kaufmann. F├╝rchtete sie sich davor, dass die Priester der ersten Oase ihnen folgten? Oder die aufgebrachte Volksmenge, aber das konnte nicht sein, denn sie besa├čen sicher nicht alle Kamele?┬á
Als die Karawane eine schattenspendene Felswand passierte, hoffte Johann auf eine kurze Pause, aber die Nomaden machten keinerlei Anstalten dazu und leider beschwerte sich auch keiner der Kaufleute.
Der monotone Schritt des Kamels versetzte Johann in einen angenehmen D├Ąmmerzustand, in dem sich die Hitze leichter ertragen lie├č. Immer wieder sank sein Kinn langsam auf die Brust und er musste seine gesamte Willenskraft sammeln um den Kopf wieder hochzuheben.┬á
Johann schrak zusammen, als ein schrilles Ger├Ąusch die Stille durchschnitt. Schon wieder die D├Ąmonen, dachte Johann, aber es war Takait, die einen spitzen Schrei ausgesto├čen hatte, der offensichtlich nicht nur Johann durch Mark und Bein gegangen war, denn alle drehen sich nach Takait um, so auch Johann.
Er h├Ątte nicht zu sagen vermocht, was er am Horizont zu sehen erwartete, aber der Anblick, der sich seinen Augen nun bot war es bestimmt nicht. Hinter der Karawane erhob sich zum Greifen nahe das Hochplateau, in dessen Schlucht sich die Nordoase befand. Wie konnte das sein, wo sie doch schon so lange durch die W├╝ste ritten? Hatten die Karawanenf├╝hrer sie im Kreis herumgef├╝hrt? Waren sie, nach all der Plackerei wieder zu dem verfluchten Ort zur├╝ckgekehrt, von dem sie am Vortag aufgebrochen waren? Hatten die Oasenbewohner sie daf├╝r bezahlt? Vor seinem inneren Auge sah Johann den lebendig gewordenen Sphinx und das eingest├╝rzte Labyrinth.
„Nein!“, schrie Takait, noch immer au├čer sich vor Angst. „Ich bin deine Tempelt├Ąnzerin! Hathor verschone mich! Du bist doch die Besch├╝tzerin der Fremden!“
Johann fragte sich, ob sie den Verstand verloren hatte. Warum f├╝rchtete sie sich pl├Âtzlich vor der G├Âttin Hathor, deren Priesterin sie werden wollte? Oder sah Takait etwas, was Johann verborgen war? Warum versuchte der Bruder nicht sie zu beruhigen? Johann schaute Peter an, aber auch dieser machte einen ratlosen Eindruck, sicherlich nicht nur wegen der hysterischen Takait, sondern auch, weil sie unerwarteterweise zur Oase zur├╝ckgekehrt waren.
„Nein!“, schrie Takait erneut. „Hathor, habe Erbarmen!“
Alle Augen waren nun auf die junge Frau in M├Ąnnerkleidern gerichtet, deren hohe Stimme sie mit t├Âdlicher Gewissheit zu verraten drohte. Erst jetzt realisierte Johann, dass Takait auf Deutsch geschrieen hatte. Was mochte dies nur bedeuten? Johann konnte kaum glauben, dass dies dieselbe furchtlose junge Frau war, die f├╝r den Sphinx getanzt hatte.┬á
„Nicht so laut“, sagte Peter, der endlich zu Takait geritten war. Er ber├╝hrte sie an der Schulter, zog aber seine Hand sofort zur├╝ck. „Willst du, dass alle merken, dass du ein M├Ądchen bist? Dann bekommst du bestimmt ├ärger oder die Kaufm├Ąnner bel├Ąstigen dich.“
Der ├Ąltere der Beduinen richtete einige unfreundliche Worte an Takait. Das M├Ądchen widersprach, aber der Nomade brachte sie mit einer Geste zum Schweigen. Takait starrte ihn mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen an. Der Mann machte einen weiteren barschen Kommentar und drehte sich abrupt um. Takait rief ihm etwas nach. Ihre Stimme ├╝berschlug sich dabei vor Emp├Ârung.
„Was hat er gesagt?“, fragte Peter, der dieser Szene mit gerunzelter Stirn beigewohnt hatte.
Takait atmete schwer. Ihr Gesicht war blass, aber sie hatte sich wieder etwas gefangen.
„Er behauptet, dass er nicht vom Weg abgekommen sei und, dass die Berge nur eine Fatamorgana sind. Wir sagen in den Oasen Wasser des Osiris dazu. Das, was wir sehen ist angeblich nicht real. Die W├╝stend├Ąmonen gaukeln uns nur vor, dass dies die erste Oase sei.“
„Schon wieder die D├Ąmonen! Eine absurdere Erkl├Ąrung habe ich noch nie geh├Ârt!“, entfuhr es Johann, der grenzenlos dar├╝ber erleichtert, dass es nur eine Fatamorgana war, die sie get├Ąuscht hatte. Auf diese Idee h├Ątte er eigentlich selbst kommen m├╝ssen, aber es war eben etwas anderes in B├╝chern von dergleichen zu lesen oder sie mit eigenen Augen zu sehen.
„Er sagt, er kennt die W├╝ste wie seinen Wasserschlauch“, erwiderte Takait mit matter Stimme und Johann realisierte, dass sie seinen Kommentar falsch verstanden hatte. ┬á
Wieder fuhr der Beduine Takait an. Zorn flackerte in seinen Augen auf, der aber nichts war gegen den finsteren Gesichtsausdruck des Anf├╝hrers der Kaufleute, der Takait in einem scharfen Tonfall aufforderte, still zu sein.
„Hathor, Hathor, Hathor“, murmelte Takait monomanisch vor sich hin. „Verwandle dich nicht in Sackmet, werde nicht zur blutd├╝rstigen L├Âwin!“
„Lass uns weiterreiten“, sagte Peter zu ihr, „Wenn du das Felsplateau nicht mehr siehst, wirst du dich besser f├╝hlen.“
Takait sah Peter an, als ob sie ihn noch nie gesehen h├Ątte, aber ganz pl├Âtzlich huschte ein L├Ącheln des Wiedererkennens ├╝ber ihr blasses Gesicht.
„Als Sackmet geht Hathor in die W├╝ste und schlachtet wahllos Menschen ab. Sie watet in ihrem Blut und m├Âchte die Menschen ausrotten!“
„Aber bestimmt nicht heute, das wei├č ich ganz genau“, meinte Peter und Johann fragte sich, wie er dazu kam dies zu sagen.
Was f├╝r eine seltsame Religion, dachte er, aber wenigstens atmete Takait nicht mehr so schnell. Sie war noch etwas k├Ąsig im Gesicht, aber sie hatte sich wieder etwas beruhigt. Mit einem leisen Seufzer spornte sie ihr Dromedar an und die Karawane setzte ihren Weg fort. Bald war hinter ihnen das Bild des Hochplateaus verblasst. Die Kaufleute sa├čen wieder entspannt auf ihren Kamelen, nur Peter wirkte weiterhin bek├╝mmert und auch Takait gelang es nur m├╝hsam die Fassung wiederzuerlangen.
Trotzdem verlief der verbleibende Ritt zur zweiten Oase ruhig und ohne weitere Zwischenf├Ąlle. Sie durchquerten eine felsige Region und manchmal polterte ein von den F├╝├čen der Kamele losgerissener Gesteinsbrocken die H├Ąnge hinunter und verfing sich schlie├člich im verdorrten Gestr├╝pp. Geier flogen vom Aas einer jungen Gazelle auf und schwangen sich kr├Ąchzend in die L├╝fte, hektisch kreisend warteten sie darauf, wieder unter sich zu sein, um sich um das Aas streiten zu k├Ânnen.┬á┬á
Ab und zu heulten auch die D├Ąmonen, aber nach der Begegnung mit dem Sphinx hatten sie f├╝r Johann viel von ihrem Schrecken verloren. Am Abend n├Ąherte sich der j├Ąmmerliche Zug bereits der zweiten Oase. In einem Stall wieherte laut ein Esel, als wolle er seinen Artgenossen die Ankunft der Karawane ank├╝ndigen.
Wenn man sie hier als Priesterin annimmt, werden wir Takait endlich los, dachte Johann als er sah, dass das Ortsbild wieder von einem Tempel beherrschte wurde. Hoffentlich ├╝berredete Peter Takait nicht sie weiterhin zu begleiten! Johann schluckte, denn tief in seinem Inneren wusste er, dass dies leider unumg├Ąnglich sein w├╝rde, da sie Takait als Dolmetscherin brauchen w├╝rden. Aber sp├Ątestens in Alexandria w├╝rde Johann sie wegschicken! Und wenn sie sich weigerte zu gehen? Johann sagte sich, dass er momentan andere Sorgen hatte, denn Alexandria war noch fern.
Die Karawanserei war eine ├Ąrmliche Anlage, deren wei├če Wandfarbe an vielen Stellen von den regelm├Ą├čig wiederkehrenden Sandst├╝rmen abgeschmirgelt worden war, sodass die gelben Ziegel des Mauerwerkes blo├člagen. Als die Reisenden ihr Ziel endlich erreicht hatten, war Johann so ersch├Âpft, dass er nur hastig ein paar Bissen herunter schlang und sich dann auf sein Lager warf. Er schlief sofort ein und tr├Ąumte von Sand, Sand unter den F├╝ssen, Sand in den Augen, Sand in den Gew├Ąndern, Sand, der durch die Finger rieselt.┬á
Gegen sechs Uhr schreckte er aus dem Schlaf auf und hatte das Gef├╝hl, dass etwas Gr├Ąssliches vorgefallen war. Er streckte und r├Ąkelte sich. Die Nacht war viel zu kurz gewesen, seine Glieder waren steif und die Kleidungst├╝cke klebten auf der Haut. Er rieb sich den Schlaf aus den Augen und sah sich im Raum um. Auf den ersten Blick war nichts Ungew├Âhnliches zu erkennen. Au├čer ihm schliefen alle. Das Schnarchen eines Kaufmannes erf├╝llte den Raum, sonst war es still.
Johann bemerkte, dass das ├╝bern├Ąchste Lager verwaist war. „Takait!“, Durchfuhr es ihn. Ihre Abwesenheit verhie├č nichts Gutes.
Im selben Augenblick wusste Johann intuitiv, was vorgefallen war. Mit zitternden H├Ąnden durchw├╝hlte er sein B├╝ndel. Achtlos warf er alle Dinge heraus, die sich darin befanden. Dann war er den Beutel leert, aber die Zwiebel befand sich nicht darin. Trotz der Hitze lief Johann ein Schauer ├╝ber den R├╝cken. Jemand - und es gab f├╝r ihn keinen Zweifel daran, wer dieser jemand war – hatte die Zwiebel gestohlen!
Einen Moment lang sah Johann fassungslos in den leeren Beutel in seiner Hand. Dann schleuderte er ihn w├╝tend auf den Boden. Es fehlte nicht viel und er h├Ątte laut geflucht, aber es machte den Diebstahl auch nicht ungeschehen, wenn er alle weckte.
 
Der Kaufmann
15. Der Kaufmann
Johann kroch zum Nachbarlager und sch├╝ttelte Peter an der Schulter. Mit einem leisen Fluch wachte dieser auf und als er den Bruder erkannte, verzog er das Gesicht zu einer missmutigen Grimasse.
„Was um Gotteswillen ist denn in dich gefahren, mich nach diesem anstrengenden Ritt so fr├╝h zu wecken?“
„Takait ist mit dem Oasenkrokus durchgebrannt!“, sagte Johann mit ged├Ąmpfter Stimme, denn ihm viel keine Formulierung ein, die dies besch├Ânigt h├Ątte.┬á
„Das glaube ich nicht!“, protestierte Peter spontan. „Du musst dich irren. Such noch mal gr├╝ndlich in deiner Tasche nach der Zwiebel!“
Wortlos zeigte Johann auf das leere Lager.
„Sie kommt bestimmt bald wieder“, erkl├Ąrte Peter, doch er klang mittlerweile ziemlich beunruhigt.
„Lass uns drau├čen reden“, schlug Johann vor. “Das geht schlie├člich niemandem an.“
„Von mir aus!“
Peter klang nicht sehr begeistert, aber er rappelte sich endlich von seinem Lager auf. Der Sand, der durch die Fenster hereingeweht war, knirschte unter ihren F├╝├čen als die┬á Br├╝der versuchten leise zwischen den Lagern der Schlafenden hindurchzuschreiten.
Sie schoben das Tor auf und traten in das glei├čende Sonnenlicht hinaus. Trotz der fr├╝hen Stunde herrscht auf den Gassen bereits erstaunlich viel Betrieb. Es waren wahrscheinlich ganz normale ├ägypter, die die k├╝hleren Morgenstunden ausnutzten, um noch vor der mitt├Ąglichen Hitze ihre gesamten Besorgungen zu erledigen. Trotzdem konnte Johann sich des Verdachts nicht erwehren, dass s├Ąmtlicher Bewohner dieser Oase Diebe, Schmuggler, Grabr├Ąuber oder Hehler waren, denn wie sonst sollten sie hier drau├čen fernab der Zivilisation ihren Lebensunterhalt verdienen?
„Also, was ist passiert?“, wollte Peter vor dem Tor der Karawanserei wissen.
„Der Oasenkrokus ist aus meinem Beutel verschwunden und von Takait fehlt jede Spur!“, stellte Johann so sachlich wie m├Âglich fest, obwohl er immer noch innerlich vor Wut kochte. Gleich macht Peter mir schreckliche Vorw├╝rfe, dachte er bang.
„Vielleicht ist er dir unterwegs raus der Tasche gefallen?“, wandte Peter mit gerunzelter Stirn ein, offenbar bestrebt Takait zu verteidigen.
„Nein, das┬á ist er nicht!“ Peter sah ihn skeptisch an als ob er vermutete, dass Johann dies nur so behauptete. „Erstens lag die Zwiebel ganz unten in meinerTasche, wo sie nicht zuf├Ąllig herrausfallen konnte und zweitens war sie Gestern Abend noch da. Das habe ich n├Ąmlich noch als letztes vor dem Einschlafen kontrolliert! Da auch Takait verschwunden ist, d├╝rfte wohl klar sein, wer die Zwiebel gestohlen hat.“
Peter schwieg einige Sekunden lang, als ob er ├╝ber ein schwieriges Problem gr├╝beln w├╝rde. Eine hei├če Brise kam auf, die Sand und verd├Ârrte Bl├Ątter die Gasse entlang trieb und Johann leckte sich nerv├Âs ├╝ber die trockenen Lippen, denn es war nur eine Frage der Zeit, dass der Bruder ihn beschimpfen w├╝rde. Mittlerweile standen einige halbnackte Jungs im Halbkreis um die Fremden und starrten sie mit unverholender Neugier an, als ob sie einen sportlichen Wettkampf oder eine Theaterauff├╝hrung beiwohnen w├╝rden. Was mochten diese Oasenkinder wohl ├╝ber sie denken?
„Vielleicht hat sie ihn nur ausgeliehen“, meinte Peter in einem letzten halbherzigen Versuch, Takait in Schutz zu nehmen. Dann fand er sich langsam mit der unangenehmen Wahrheit ab, denn er konnte sich nicht gegen die logische Schlussfolgerung verschlie├čen, dass es kein Zufall sein konnte, dass auch Takait und nicht nur der Oasenkrokus ├╝ber Nacht verschwunden war.
Ein etwa sechsj├Ąhriges Kind zeigte auf die Fremden. Die Mutter, die daneben stand und mit einer Nachbarin klatschte, tadelte es und die beiden steckten ihre K├Âpfe zusammen und tuschelten. Das Kind lachte. Demonstrativ kehrte Johann ihnen den R├╝cken zu. Aus dem Inneren der Karawanserei drangen lebhafte Stimmen. Offenbar schlief an diesem Morgen niemand lang.
„Wir m├╝ssen mit dem Verwalter der Karawanserei reden“, sagte Peter schlie├člich mit einem resignierten Gesichtsausdruck. „Vielleicht kann er uns bei der Suche nach Takait behilflich sein.“┬á┬á
„Aber, wir haben keinen Dolmetscher mehr! Wir k├Ânnen mit niemandem reden!“
„Verdammt!“
Johann staunte, denn Peter fluchte fast nie.
„Sie hatte es doch von Anfang an nur auf den Oasenkrokus abgesehen!“, stellte Johann, dem diese Idee zuvor nicht gekommen war, w├╝tend fest. In diesem Augenblick h├Ątte er Takait mit blo├čen H├Ąnden erw├╝rgen k├Ânnen, „sie ist bestimmt nur mitgekommen, weil du so vertrauensselig warst ihr zu erz├Ąhlen, dass wir einen dieser komischen Krokusse brauchen!“
„Das glaube ich nicht. Bestimmt hat sie die Zwiebel spontan entwendet. Man hat sie nicht als Tempelsch├╝lerin angenommen und sie war dar├╝ber verzweifelt“, murmelte Peter. Er fuhr sich mit der Hand durch das dunkle Haar. ┬á„Au├čerdem ist das Bl├Âdsinn, was du da sagst. Sie war allein im Tempel und h├Ątte alle Krokusse f├╝r sich selbst stehlen k├Ânnen, wenn dies ihr Ziel gewesen w├Ąre.“
Johann verkniff sich m├╝hsam jeglichen Kommentar, da er dankbar war, dass ihm der Bruder bisher keine Vorw├╝rfe gemacht hatte und er deshalb lieber keinen Streit mit Peter anfangen wollte. Aber hatte der Bruder tats├Ąchlich vergessen, dass Takait durch einen Eid gebunden war, der ihr das Ausgraben der Zwiebeln verbot?
„Und was machen wir jetzt?“, fragte Johann vorsichtig, „wir k├Ânnen schlie├člich nicht den ganzen Tag hier drau├čen in der gl├╝henden Sonne herumstehen und uns von den Kindern angaffen lassen.“
„Einer von uns schaut sich nach dem Grab um, aus dem die Mumie stammt und der andere sucht Takait“, antwortete der Bruder nach einer Weile und er wirkte ma├člos entt├Ąuscht.
„Ich m├Âchte so wenig wie m├Âglich mit der Mumie zu tun haben!“, stellte Johann mit Nachdruck fest.
„Also wirst du Takait suchen. Am besten, du beginnst sofort damit. Wir d├╝rfen keine Zeit verschwenden. Sonst vergr├Â├čert sich ihr Vorsprung noch mehr.“
„Das sagst du so einfach, aber wie, um Gotteswillen soll ich Takait finden?“, fragte Johann ver├Ąrgert zur├╝ck. „Sie kann sich in jeder H├╝tte versteckt haben. Wir sind nicht die Polizei und haben daher keinen Durchsuchungsbefehlt! Au├čerdem kann ich nicht einmal mit den Einheimischen reden!“
„Das vergesse ich immer wieder! Wir h├Ątten zu Hause Arabisch lernen sollen“, brummte Peter, „versuch es im Zweifelsfall mit Englisch. Lass dir irgendetwas einfallen! Schlie├člich hast du uns diese Geschichte eingebrockt!“
Also doch, dachte Johann und versuchte sich nicht zu ├Ąrgern, aber es gelang ihm nicht. Es war ein Fehler gewesen, die Zwiebel vom Bruder erbeten zu haben. Anderenfalls h├Ątte Takait sie Peter gestohlen und er k├Ânnte ihn jetzt in die W├╝ste schicken, um die Diebin und ihre Beute aufzusp├╝ren.
„Du warst es, der Takait angeheuert hat!“, giftete er nach einer Schrecksekunde zur├╝ck, „ich habe ihr von Anfang an nicht ├╝ber den Weg getraut, schon als ich dachte, sie w├Ąre ein Junge!“
Die Stimmen, die aus der Karawanserei drangen wurden immer lauter. Ob dies mit dem Verschwinden Takaits zusammenhing? 
„Wer h├Ątte gedacht, dass sie so etwas tun k├Ânnte? Sie sah wie ein harmloses junges M├Ądchen aus. Ich wusste nicht einmal, dass sie Tempelt├Ąnzerin ist“, lenkte Peter ein. Dann warf er dem Bruder einen finsteren Blick zu, „aber warum stehst du noch herum? Geh endlich und bring sie wieder zur├╝ck!“
„Wie du meinst“, erwiderte Johann gedehnt, denn mit dem Bruder war offenbar momentan nicht vern├╝nftig zu reden.
Er beschloss, sich nach dem ├Ągyptischen ├äquivalent einer Gastwirtschaft umzuschauen. Wenn es dergleichen nicht gab oder Takait sich dort nicht zuf├Ąllig aufhielt, war seine Mission bereits gescheitert.
„Einen Augenblick noch“, rief Peter Johann nach, als er erst drei Schritte gegangen war, „du tr├Ągst doch deine Uhr noch bei dir?“
„Falls Takait sie nicht geklaut hat“, erwiderte Johann schlecht gelaunt und fingerte in der Innentasche seiner Jacke herum. Er fand die goldene Taschenuhr, die er zum achtzehnten Geburtstag von Gro├čvater geschenkt bekommen hatte, aber sie war von einer feinen Staubschicht bedeckt und tickte nicht mehr.
„Geht deine Uhr noch?“, fragte er Peter und hielt ihm seinen stehengebliebenen Chronometer vor die Nase.
„Selbstverst├Ąndlich“, erwiderte der Bruder leicht herablassend und fischte seine Uhr aus der Tasche, „ich habe sie n├Ąmlich jeden Abend aufgezogen. Wir haben gerade halb sieben ├Ągyptischer Zeit …“
„Da siehst du, wie lange wir uns sinnlos herumgezankt haben“, unterbrach Johann den rechthaberischen Bruder und zog das feine R├Ądchen an der Schmalseite der Uhr heraus, um die Zeit einzustellen.
„Um zw├Âlf Uhr treffen wir uns wieder vor diesem Tor!“, erkl├Ąrte Peter unvermittelt und st├╝rmte in die Karawanserei zur├╝ck.
Das klingt, wie bei Philippi sehen wir uns wieder dachte Johann, w├Ąhrend er die erstbeste Gasse einschlug. Er sp├╝rte geradezu k├Ârperlich, wie die Augen der Kinder ihm folgten und bek├Ąmpfte nur m├╝hsam den Impuls, sich umzudrehen und ihnen die Zunge rauszustrecken.
 
Peter betrat den Innenhof, um den die Geb├Ąude angeordnet waren, durch eine gewaltige h├Âlzerne T├╝r mit Griffen aus Messing. Sein Ziel war der Lagerraum, denn er wollte ├╝berpr├╝fen, ob die Mumie noch an ihrem Platz war. Zwar konnte er sich nicht vorstellen, dass Takait diese gestohlen haben konnte, aber er wollte sich davon lieber mit eigenen Augen ├╝berzeugen.
Er hatte den Bruder einfach drau├čen stehen lassen, weil er kurz davor war, zu explodieren. Es war typisch f├╝r Johann. dass er sich den Oasenkrokus hatte stehlen lassen und noch dazu so kurz vor dem Ziel. Peter hatte vorgehabt, in der Karawanserei daraus eine Medizin f├╝r den Bruder und sich selbst zu bereiten und den restlichen Sud in einer Flasche nach Hause zu transportieren. Nun bereute er bitterlich, dass er dem Bruder die Zwiebel anvertraut hatte. Wenn Johann eine Aufgabe ├╝bernahm, so konnte man sich darauf verlassen, dass er sie vermasselte.
Zwar war er unglaublich w├╝tend auf Johann, aber noch mehr ├Ąrgerte sich Peter ├╝ber sich selbst. Er musste zugeben, dass der Vorwurf, den Johann ihm gemacht hatte, nur allzu gerechtfertigt war: Er war viel zu vertrauensselig gewesen, was Takait betraf, denn sie┬á hatte ihm auf den ersten Blick gefallen. Seit sie Alexandria verlassen hatten, hatte er nur ein einziges Mal an die treulose Anneliese gedacht, n├Ąmlich als der Bruder beim Anblick der ersten Oase den befremdlichen Wunsch ge├Ąu├čert hatte, bald wieder nach Hause zu fahren.
Peter hatte inzwischen den Lagerraum erreicht, aber er betrat ihn nicht, sondern blieb verbl├╝fft in der T├╝r├Âffnung stehen, denn drinnen war der Teufel los. Die meisten Kaufleute standen in der Mitte des Raums und zankten sich so lautstark, dass es die Kamele im angrenzenden Stall nerv├Âs machen musste. Peter versuchte, die Streithammel m├Âglicht unauff├Ąllig zu passieren, aber die Blicke aller folgten ihm. Wenn er jetzt zu seiner Transportkiste ging, so machte er m├Âglicherweise die zwielichtigen Reisegef├Ąhrten erst auf die Mumie neugierig. Also gab er vor, sich in der T├╝r geirrt zu haben und verlie├č mit einer leise gemurmelten Entschuldigung, die sowieso niemand verstehen konnte den Raum.
Missmutig stapfte er in Richtung des gro├čen Tempels, der die elenden H├Ąuser der Bewohner ├╝berragte, da er vermutete, dass sich dort Grabanlagen befanden. Der Geb├Ąudekomplex ├Ąhnelte dem Tempel der ersten Oase so stark, dass er vom selben Architekten entworfen sein musste. Aber Peter interessierte sich momentan nicht besonders f├╝r alt├Ągyptische Sakralbauten, denn ihm kam sein Vorhaben hoffnungslos vor: Ohne die Vermittlung Takaits konnte er sich noch nicht einmal danach erkundigen, ob hier im letzten Jahr ein Mumie abhanden gekommen war.┬á
Vor dem Tempel lungerte ein auff├Ąllig gekleideter Mann mit rotem Turban, goldenen Ohrringen und gepflegtem Bart herum und spielte mit seinem Gebetskettchen. Er war nicht nur der erste nach Landessitte gekleidete ├ägypter, den Peter auf einer dieser Sobek-Oasen gesehen hatte, sondern er war einer dieser Bilderbuchorientale, wie er sie bisher nur von Gem├Ąldereproduktionen kannte. Im Vorbeigehen nickte er dem Fremden zum Gru├č zu und war schon im Begriff den Bau zu betreten, als er zu seinem Erstaunen auf Englisch angesprochen wurde.
„Warum so eilig, junger Effendi?“
Peter blieb abrupt stehen und seine Augen suchten nach dem Sprecher, doch er sah nur den Orientalen, ├╝ber dessen Gesicht ein ironisches L├Ącheln huschte. Erst in diesem Augenblick erkannte er ihn: Es war der H├Ąndler, der w├Ąhrend der Reise f├╝r die anderen gesprochen hatte. Offenbar trug er zur Feier des Tages seinen Sonntagsstaat und Peter bemerkte, dass er j├╝nger war als er ihn bisher eingesch├Ątzt hatte. Er konnte nicht ├Ąlter als Ende Zwanzig sein.
„Junger Effendi! Wir sollten endlich einmal miteinander reden“, sagte der Kaufmann mit einer so unterw├╝rfigen Verbeugung, dass sie nur ironisch gemeint sein konnte und Peter starrt ihn einen Augenblick lang sprachlos an, geschockt dar├╝ber, dass der Kaufmann bisher nicht hatte zu erkennen gegeben hatte, dass er Englisch sprach.
„Und wor├╝ber?“, fragte er unwirsch zur├╝ck, denn er versp├╝rte wenig Neigung, sich mit diesem heimt├╝ckischen Menschen zu unterhalten.
„├ťber ihren reizenden Reisegef├Ąhrten vielleicht“, schlug er mit einem schiefen L├Ącheln vor, „oder ├╝ber die Mumie in ihrem Gep├Ąck.“
„Wie viel?“, wollte Peter wissen, denn er war nicht in der Stimmung um herumzufeilschen.
„Wie viel was?“, fragte der Kaufmann am├╝siert zur├╝ck.
„Wie viel Geld verlangen Sie f├╝r die Informationen, die Sie mir geben wollen?“
Der Kaufmann sch├╝ttelte bed├Ąchtig den Kopf und schaute Peter mit der herablassenden Nachsicht an, mit der man mit einem Kind spricht.
„Es macht keinen Spa├č, mit Europ├Ąern Gesch├Ąfte zu machen! Die meisten von euch sind unh├Âflich, unkultiviert und stillos. Bei uns trinkt man zuerst einen Tee zusammen und spricht ├╝ber die Familie. Dann raucht man eine Pfeife. Erst dann spricht man ├╝ber das Gesch├Ąft.“
„Aber ich habe es eilig“, erwiderte Peter, der sich fragte, ob der Kaufmann sich ├╝ber ihn lustig machte, „ich w├Ąre Ihnen also sehr verbunden, wenn Sie mir ohne weitere Umschweife mitteilen k├Ânnten, was Sie wissen. Sie werden mich bestimmt nicht undankbar finden.“
„Das ist schon besser!“, erwiderte der ├ägypter und streckte seine rechte Hand ohne das geringste Zeichen von Verlegenheit aus.
Peter gab ihm eine Silberm├╝nze und er dachte an den Bruder, der den Zollbeamten bestochen hatte. Vielleicht besa├č Johann in diesen Dingen ein gr├Â├čeres diplomatisches Geschick.
„Wissen Sie wo Takait steckt?“, wollte er dann wissen.
„Das nicht, aber es wird sie vielleicht interessieren, dass die Karawanenf├╝hrer heute Morgen au├čer sich dar├╝ber, dass man ihren ein Dromedar gestohlen hat. Als sie dann bemerkten, dass auch Takait verschwunden war, haben sie eins und eins zusammengez├Ąhlt.“
Peters Magen zog sich zusammen und augenblicklich war aller Zorn auf Takait verflogen, denn er traute den grimmigen Beduinen zu, ihr etwas anzutun. War sie am Ende so leichtsinnige gewesen, von der Oase zu fliehen? Vor seinem inneren Auge sah Peter Takait sich halb verdurstet durch Sandd├╝nen schleppen.
„Sie wird doch nicht allein in die W├╝ste geritten sein?“, rief er daher erschrocken aus.
„Sie brauchen sich nicht um Takait zu sorgen!“ Der Kaufmann machte eine wegwerfende Handbewegung und begann dann wieder die elfenbeinernen Perlen, seines rosenkranz├Ąhnlichen Kettchens um das Handgelenkt zu drehen. „Es ist nur ein Katzensprung bis zur dritten Oase, sie ist kaum zwei Tagesm├Ąrsche weit. Und au├čerdem befindet sich eine weitere, wenn auch ganz kleine Oase auf dem Weg. Ich habe diese Strecke schon so oft zur├╝ckgelegt, dass auch ich allein dahin reiten k├Ânnte. Dies d├╝rfte also ein Kinderspiel f├╝r jemanden sein, der hier geboren und aufgewachsen ist.“
Peter wunderte sich, dass pl├Âtzlich von einer weiteren Oase die Rede war.
„Dann gibt es also insgesamt vier Sobek-Oasen?“, stellte er automatisch fest, obwohl er eigentlich momentan andere Sorgen hatte.
„Die kleine Oase wird nicht mitgez├Ąhlt. Sie besteht nur aus einem Brunnen, circa zehn Palmen und f├╝nf H├Ąusern, darunter eine Schenke.“
„Eine Schenke?“, fragte Peter verbl├╝fft nach, da er glaubte, dass der Kaufmann, der ansonsten erstaunlich gut Englisch sprach, eine falsche Vokabel verwendet hatte. „Sie meinten doch sicher eine Karawanserei?“
„Selbstverst├Ąndlich gibt es dort auch G├Ąstebetten und einen Mietstall, aber das Haus ist vor allem eine Schenke. Dort treffen sich die jungen Leute der zweiten und der dritten Sobek-Oase, denn es ist nicht gut, in der Nachbarschaft zu heiraten, wo alle miteinander versippt und verschw├Ągert sind. Au├čerdem k├Ânnen sich in dieser Wirtschaft die Vertreter der verfeindeten ersten und dritten Oase auf neutralem Boden treffen. Sie ist sozusagen das Wasserloch in der W├╝ste, an dem Frieden zwischen L├Âwen und Gazellen herrscht.“┬á
Peter schwirrte der Kopf und er fragte nicht nach, warum die Bewohner der zweiten Oase offenbar mit denen der dritten befreundet und mit denen der ersten zumindest nicht verfeindet waren, w├Ąhrend die der ersten und der dritten nicht miteinander verkehrten. Was diese Schenke betraf, so h├Ârte sich die Beschreibung f├╝r Peters Geschmack nach einem Schmugglertreff an, wo Takait ihre Beute zu verschachern versuchen w├╝rde.
„Offiziell gibt es nat├╝rlich keine einzige Sobek-Oase“, f├╝gte der Kaufmann mit einem komplizenhaften L├Ącheln hinzu, „denn diese Oasen sind auf keiner modernen Karte notiert.“
„Was bedeut eigentlich Sobek?“, wollte Peter wissen, der diese Frage schon mehrfach┬á Takait stellen wollte, aber dies immer wieder vergessen hatte.
Der Kaufmann verzog das Gesicht, als ob er ├╝ber einen peinlichen Verwandten sprechen sollte.
„Sobek ist der Name eines schrecklichen Krokodils, das die Heiden anbeten. Auf der dritten Oase hat man einen Tempel zu seinen Ehren errichtet.“
Peter vermutete, dass der W├╝stensohn eine krokodilk├Âpfige ├Ągyptische Gottheit meinte und er musste an Johanns Vermutung denken, dass man m├Âglicherweise in den Dorft├╝mpeln Krokodile hielt. Peters Begeisterung f├╝r das alte ├ägypten war mittlerweile auf dem Nullpunkt angelangt. Je schneller sie diese seltsamen Oasen verlie├čen, desto besser! Aber vorher w├╝rden sie nicht umhinkommen, die dritten dieser Krokodilsoasen aufsuchen. Fast h├Ątte Peter spontan nachgefragt, ob der Kaufmann augenblicklich mit ihm aufbrechen k├Ânnte - denn er verstand seine Bemerkung von vorhin als Angebot, sich als F├╝hrer anheuern zu lassen -┬á als ihm schmerzlich einfiel, dass er noch nach dem Grab suchen musste.
„K├Ânnten Sie vielleicht so freundlich sein, mich – selbstverst├Ąndlich gegen gute Bezahlung - in diesen Tempel zu begleiten?“, fragte er daher den Kaufmann so h├Âflich wie er es in seiner derzeitigen Verfassung nur zustande brachte und deutete dabei auf den Bau, vor dem sie die ganze Zeit herumdiskutierten, „ich m├Âchte die Priester etwas fragen und habe bekanntlich leider keinen Dolmetscher mehr.“
„Leider spreche ich auch kein ├ägyptisch“, erwiderte der Kaufmann bedauernd, „aber vielleicht kann ich auch so behilflich sein.“
Peter dachte, dass dies nicht gerade sein Gl├╝ckstag war. Zu allem ├ťberfluss machte ihn das kontinuierliche Klappern der Perlen zunehmend nerv├Âs.
„Mich interessiert, ob hier Pharaonen begraben sind“, erkl├Ąrte er absichtlich vage und hoffte, dass man ihn nicht schon wieder f├╝r einen Grabr├Ąuber hielt.
„Das halte ich f├╝r v├Âllig ausgeschlossen“, antwortete der Kaufmann ohne nachzudenken und kratzte sich dann am Bart. „Schlie├člich ist die ganze Anlage ist nur wenige hundert Jahre alt.“
Diesen Verdacht hatte Peter auch schon gehabt, aber momentan war ihm diese Best├Ątigung seiner Kennerschaft herzlich egal. Er r├Ąusperte sich. Dann gab er sich einen inneren Ruck, denn er wusste, dass er ohne den Kaufmann niemals das Grab finden w├╝rde, aus dem die Mumie stammte.┬á
„Da Sie offenbar schon wissen, dass wir eine Mumie …“
„Nicht nur ich!“, unterbrach ihn der Kaufmann mit einem am├╝sierten Gesichtsausdruck, „die ganze Karawane redet dar├╝ber, dass sie eine Mumie durch die W├╝ste transportieren!“
Ein gr├Ąsslicher Verdacht stieg in Peter auf und er schwor sich, nie wieder einer Frau zu vertrauen.
„Hat Takait das herumerz├Ąhlt?“┬á┬á
„Ich wei├č nicht, von wem die Informationen stammten, aber jedenfalls wussten es alle: Wir Kaufleute, die Karawanenf├╝hrer, die Stallknechte und die Oasenbewohner, aber Takait hat Sie als einziger in Schutz genommen.“
„Was hei├čt hier in Schutz genommen?“, entfuhr es Peter. Die Sache wurde immer dubiose, „Was um Gottes Willen vermuten die anderen, was wir mit der Mumie vorhaben?“
Der Kaufmann strich sich bed├Ąchtig durch den Bart.
„Einige sagen, Sie wollen L├Âsegeld von den Nachfahren der Verstorbenen fordern. Andere meinen, Sie h├Ątten vor, mittels heidnischer Magie die Mumie wieder zum Leben zu erwecken. Bei einem Giaur kann man nie wissen …“
„Einem was?“, unterbrach Peter, der gar nicht fassen konnte, was er soeben erfahren hatte.
„Einem Ungl├Ąubigen!“
Peter schloss die Augen und z├Ąhlte innerlich bis drei, um nicht laut loszulachen. Wenn das die Mutter geh├Ârt h├Ątte!
„Und was hat Takait gesagt?“, entfuhr es ihm dann bang, obwohl er nicht sicher war, ob er die Antwort wirklich h├Âren wollte.
„Die Theorie Takaits war die seltsamste von allem. E r “, der Kaufmann sprach das Wort sehr gedehnt aus, „hat gesagt, sie h├Ątten vor, die Mumie in ihr Grab zur├╝ckzubringen. Ich habe es ihm geglaubt, denn so etwas Verr├╝cktes erfindet niemand. Das muss wohl die Wahrheit sein.“
„Wo Sie so auffallend gut informiert sind“, begann Peter vorsichtig, das anz├╝gliche Grinsen des Kaufmanns ignorierend, „wissen Sie vielleicht zuf├Ąllig auch, woher unsere Mumie stammen k├Ânnte, wenn nicht von hier? Man hat uns n├Ąmlich gesagt, sie w├Ąre auf dieser Oase gefunden worden.“
Der Mann blickte ihn leicht gelangweilt an, immer noch mit den Holzperlen herumspielend und Peter vermutete, dass er auf das n├Ąchste Bakschisch wartete.
„Von den drei Oasen der Sobek-Gruppe besitzt nur eine einzige alte Grabanlagen, n├Ąmlich die dritte“, erkl├Ąrte er, nachdem eine weitere Silberm├╝nze ihren Besitzer gewechselt hatte. Die meisten Finger der Hand, die nach dem Geld gegriffen hatten, waren mit Juwelenringen bedeckt.
Kein Wunder, bei den ├╝ppigen Einnahmen, dachte Peter, der wider seinen Willen von dem Kaufmann beeindruckt war. Aber konnte er dem ihm vertrauen oder geh├Ârte er zu der Bande von Grabr├Ąubern und Meuchelm├Ârdern, die er im Labyrinth bei ihrem sch├Ąndlichen Treiben beobachtet hatte?
„Mich hat gewundert, dass zwei Kaufleute fehlen“, begann er vorsichtig, „was ist mit ihnen geschehen?“
„Ja, das ist auch mir nicht entgangen“, erwiderte der ├ägypter nachdenklich, „aber ich wei├č leider nicht, was dahinter steckt. Sie haben sich erstmals unserem Zug angeschlossen. Auch die Karawanenf├╝hrer waren neu im Gesch├Ąft. Alle anderen Teilnehmer kannte ich.“┬á Peter blickte ratlos auf den Boden, denn im Grunde genommen half ihm diese Antwort auch nicht weiter, da er nicht beurteilen konnte, ob der Kaufmann log. „Angeblich haben die Beduinen ├╝berall nach ihnen gesucht, aber sonst hat sie niemand vermisst.“
Dieser Kommentar gab den Ausschlag. Peter beschloss spontan, dass er wohl keinen vertrauensw├╝rdigen F├╝hrer unter all den Schmugglern finden w├╝rde, als diesen raffgierigen Kaufmann, der wenigstens nicht wie ein M├Ârder aussah.
„Ich w├╝rde gern so bald wie m├Âglich zur dritten Oase aufbrechen“, erkl├Ąrte er daher, „Ich vermute, Sie k├Ânnen das f├╝r mich organisieren?“
„Mir Vergn├╝gen, junger Effendi“, erwiderte der Kaufmann zufrieden, „aber Sie sprechen nur von sich selbst. Was ist mit Ihrem verehrten Bruder? Gedenken Sie ihn hier, auf der zweiten Oase zur├╝cklassen?“
Dies war sicherlich nur ein schlechter Scherz, aber Peter versp├╝rte f├╝r einen Augenblick die Versuchung, genau dies zu tun. Dann erschrak er ├╝ber sich selbst.
„Selbstverst├Ąndlich, kommt auch mein Bruder mit. Wir brauchen also drei Kamele, zwei f├╝r uns und eins f├╝r das Gep├Ąck. Vielleicht k├Ânnen Sie unsere bisherigen Reittiere von den Beduinen leihen? Schlie├člich reisen wir auf dem Karawanenpfad und werden uns daher wahrscheinlich in der n├Ąchsten Oase wieder der restlichen Karawane anschlie├čen.“
Peter musste dreimal schlucken, als der Kaufmann die Summe nannte, die er als Gegenwert f├╝r seine Dienste f├╝r angemessen hielt.
„Sie sch├Ąmen sich wohl gar nicht, uns so auszunehmen?“, fragte er ihn dann emp├Ârt, „die Strecke ist doch angeblich ganz kurz und au├čerdem haben wir doch gewisserma├čen bereits daf├╝r bezahlte!“
„Die Entscheidung liegt selbstverst├Ąndlich bei Ihnen, Sie k├Ânnen auch gern eine Woche lang warten, bis wir Kaufleute unsere Gesch├Ąfte get├Ątigt haben. Aber wer wei├č, wer ihre W├╝stenblume bis dahin gepfl├╝ckt hat.“┬á┬á
„Wie nennt sich eigentlich ihr eigenes Gesch├Ąft? Erpressung?“
Dies war Peter nur so herausgerutscht, aber er bereute seine Worte nicht.
„Organisation. Der Engl├Ąnder w├╝rde sagen Management.“
Peter kommentierte diese unversch├Ąmte Bemerkung nicht, sondern er unternahm einen halbherzigen Versuch zu feilschen, auf den der Kaufmann mit sichtlichem Vergn├╝gen einging. Schlie├člich einigten sie sich auf einen Betrag, der deutlich unter der zuerst genannten Summe lag.
„Woher k├Ânnen Sie eigentlich so gut Englisch?“, fragte Peter, der sich eingestehen musste, dass der Kaufmann ihm darin haushoch ├╝berlegen war.
„Ich habe in Oxford studiert!“
Peter fragte sich, ob es dort einen Master-Studiengang in Schmuggel und Erpressung gab und noch immer ver├╝belter er seinem Gegen├╝ber seine Heimlichtuerei.
„Und warum haben Sie nie zuerkennen gegeben, dass Sie Englisch sprechen?“
„Sie haben mich nicht danach gefragt!“, stellte der Kaufmann mit einem undefinierbaren L├Ącheln fest und Peter f├╝hlte wahre Mordgel├╝ste in sich aufsteigen. Nur gut, dass sie untereinander Deutsch gesprochen hatte.
„Wann k├Ânnen wir aufbrechen?“, fragte er dann, denn es gab wohl nichts mehr zu besprechen.
„Ich werde sehen, was ich machen kann, junger Effendi! Um zw├Âlf Uhr vor der Karawanserei erwarte ich Sie“, erkl├Ąrte der Kaufmann und verbeugte sich erstaunlich tief f├╝r einen Mann so gut gekleideten Herrn.
Woher wei├č der das?, durchfuhr es Peter oder konnte es ein Zufall sein, dass der Kaufmann ihm diesen Treffpunkt vorgeschlagen hatte?
Pl├Âtzlich wurde ihm bewusst, dass sie sich noch nicht einmal vorgestellt hatten.
„Ich hei├če ├╝brigens Peter Berggruen“, erkl├Ąrte er, sich aus Gewohnheit mit dem Finger dahin tippen, wo sich normalerweise seine Hutkrempe bef├Ąnde, „und wie lautet Ihr werter Name?“
Mein Gott, jetzt spreche ich schon so blumig wie er, dachte Peter im gleichen Augenblick.
„Nennt mich Saladin“, erwiderte der Kaufmann, aber Peter war davon ├╝berzeugt, dass dieser genauso wenig Saladin hie├č wie er selbst Barbarossa.
Mit einer landestypischen Gru├čgeb├Ąrde verlie├č ihn Saladin recht unvermittelt und Peter stand noch einige Minuten lang wie vor dem Kopf geschlagen vor dem Tempel, denn er kam sich vor wie ein kompletter Idiot. Was hatte er eben erfahren m├╝ssen? Alle wussten, dass sie eine Mumie mit sich herumschleppten! Und unterwegs hatten sie die abwegigsten Theorien entwickelten, was sie damit bezweckten. Der Gipfel war, dass ihn die Kaufleute offenbar f├╝r eine Art Frankenstein hielten, der Tote zum Leben zu erwecken suchte. All das war so haneb├╝chen, dass es schon wieder komisch war.
Als Peter sich wieder etwas beruhigt hatte, beschloss er, Johann zu suchen, der bestimmt noch immer von Haus zu Haus irrte, auf der vergeblichen Suche nach Takait. Schwer konnte nicht sein den Bruder aufzusp├╝ren, da es auf der Oase – au├čer dem Tempel und der Karawanserei - nur wenige Bruchbuden und Gassen gab.
Nachdem er vergeblich jede einzelte dieser Gassen abgeschritten hatte, fand er Johann schlie├člich in einer Plantage unter einer Palme auf dem Boden sitzen. Auf seiner Stirn stand Schwei├č und er machte einen so ersch├Âpften Eindruck, dass Peter der Vorwurf im Halse stecken blieb, der ihm schon auf der Zunge lag. Zikaden zirpten im sp├Ąrlichen Gras, sonst war kein Ger├Ąusch zu h├Âren.
„Wie ist es gelaufen“, fragte Johann als er den Bruder sah, „sind wir endlich die Mumie los?“
Peter lie├č sich neben dem Bruder auf den Boden sinken und berichtete, was er erfahren hatte, aber er schwieg sich ├╝ber seine Informationsquelle aus. Sonst w├╝rde ihm Johann wieder vorwerfen, dass er zu vertrauensselig sei.
„Vielleicht holen wir Takait ja tats├Ąchlich ein“, meinte Johann als Peter geendet hatte, „ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben.“┬á
Es gab aber noch etwas, das Peter nicht verstand.
„Wieso gibt es angeblich keine alten Gr├Ąber auf der zweiten Oase?“, sagte er eher zu sich selbst, „Laut Priester Menas steht in Vaters Aufzeichnungen, dass er die Mumie hier gefunden hat.“┬á┬á
„Das muss nichts bedeuten“, erwiderte der Bruder ohne Nachzudenken, „der Priester hat sich bitterlich ├╝ber Vaters schlechtes Koptisch und seine unlesbare Handschrift beschwert. Entweder hat er den Text falsch entziffert oder Vater hat bei der ├ťbersetzung einen Fehler gemacht.“ Johann machte eine Pause. Dann sah er den Bruder bedeutsam an. „Aber du hast mich gar nicht gefragt, wie es mir sonst so ergangen ist. Ich muss dir etwas ganz Wichtiges erz├Ąhlen.“
„Du wei├čt wo Takait steckt?“, fragte Peter und sein Herz setzte einen Augenblick lang aus. Dann sah er einen Schatten ├╝ber das Gesicht des Bruders huschen und er wusste, dass es etwas anderes war und Peter f├╝hlte eine grenzenlose Entt├Ąuschung in sich aufsteigen.
„Nein es viel wichtiger“, antwortete der Bruder, aber sein Enthusiasmus war etwas verflogen, „ich habe vorhin zuf├Ąllig einen der Kaufleute getroffen …“
„War er orientalisch gekleidet und hat dich mit junger Effendi angeredet?“, unterbrach Peter.┬á
Johann nickte.
„Und er nannte sich Saladin?“
„Woher wei├čt du das?“
„Es war kein Zufall, dass du ihn getroffen hast, aber spann mich nicht auf die Folter, was hat er zu dir gesagt?“
Der Bruder sah ihn bedeutungsvoll an und Peter bef├╝rchtete, dass der schlitzohrige Kaufmann Johann die gleichen Informationen f├╝r teures Geld verkauft hatte wie ihm selbst.
„Er hat mir erz├Ąhlt, dass er fr├╝her oft auf der dritten Oase einen ├Ąlteren Effendi gesehen hat, der mir ├Ąhnlich sieht.“
Peter war es in diesem Augenblick v├Âllig gleichg├╝ltig, wie viel Johann f├╝r diese Information bezahlt hatte, Hauptsache sie entpuppte sich nicht als Irrtum oder als L├╝ge.
 
Die Beduinen
16. Die Beduinen
Takait erschrak, als sie hinter sich Schritte h├Ârte. Sie schaute sich um, aber sie sah nur einen betrunkenen Bauer, der in Richtung Gastwirtschaft torkelte. Er konnte l├Ąstig werden, aber er war nicht gef├Ąhrlich. Die D├Ąmmerung k├╝ndigte sich bereits an. Dies war kein guter Zeitpunkt f├╝r eine Frau, um allein einen derartig verrufenen Ort zu besuchen, aber wo sollte Takait sonst hingehen, nun, da sie sich endlich auf diese winzige Oase gerettet hatte? Je fr├╝her sie von hier wieder wegkam desto besser, aber vorher musste sie etwas trinken, denn sonst verdurstete sie!
Seit sie Hals ├╝ber Kopf aus der Karawanserei gefl├╝chtet war, hatte Takait keine ruhige Minute mehr gehabt. Noch immer graute es ihr bei der Vorstellung, die G├Âttin Hathor k├Ânnte sie zur Rechenschaft ziehen. Takait bereute es bitterlich, den Fremden beim Diebstahl des Oasenkrokus geholfen zu haben. Die schlechte Behandlung seitens der obersten Hathore des Tempels hatte ihr nicht das Recht gegeben, dieses Sakrileg zu begehen.
Fast z├Ąrtlich betastete Takait ihre Tasche aus Palmstroh, in der sie ihre Habseligkeiten verstaut hatte. Wenigstens befand sich die wertvolle Zwiebel nun in ihrem Besitz. Die Fremden konnten sie nicht mehr au├čer Landes bringen.┬á
Takait hoffte inst├Ąndig, dass diese m├Âglichst lange auf der zweiten Oase festsa├čen, denn an diesem Tag war alles schief gegangen. Zuerst hatte sie einen schmerzhaften Wadenkrampf bekommen und als sie abgesessen war, um sich etwas die F├╝├če zu vertreten, war ihr Kamel weggelaufen. Es war einfach in Richtung zweite Oase weggerannt, und Takait musste den Rest der Strecke zu Fu├č zur├╝cklegen. So war ihr Vorsprung dahingeschrumpft.
Takait z├Ąhlte an den Fingern ab, wer sie mittlerweile verfolgte: Ihr Stiefvater, die beiden Br├╝der, die Priester des Hathor-Tempels – sofern sie den Diebstahl des Oasenkrokus bemerkt haben sollten - und, wenn sie Pech hatte sogar Hathor pers├Ânlich. Als sie an Peter dachte, sch├Ąmte sich Takait ein wenig, denn er hatte sie immer sehr h├Âflich behandelt Wenn nur sein misstrauischer Bruder nicht w├Ąre! Takait stie├č einen tief empfundenen Seufzer aus. Wenn sie die Vergangenheit h├Ątte ungeschehen machen k├Ânnen, dann w├╝rde sie…, aber sie konnte dies nicht! Takait zwang sich, an die Zukunft zu denken, zumal sie fast das sch├Ąbige Geb├Ąude erreicht hatte, in dem sie endlich Hilfe zu finden hoffte.
Sosehr es ihr widerstrebte, musste sie doch hier einkehren, denn ihre F├╝├če brannten vom Marsch durch die W├╝ste, ihr flimmerte es vor den Augen und vor allem hatte sie seit Stunden nichts getrunken, denn ihren Wasserschlauch hatte das entflohene Dromedar mit sich davongetragen. Sie hoffte, dass der Wirt auch Wasser ausschenkte und mit etwas Gl├╝ck w├╝rde sie einen Bewohner der dritten Oase treffen, der sie gegen Bezahlung auf seinem Kamel reiten lie├č.
Takait schaute an sich herab. Ihr Gewand sa├č tadellos. Es war das einfache, wei├če Gewand, mit dem sie von zu Hause ausgerissen war, denn es erschien ihr f├╝r den Anlass angemessen. Sie hatte kurz vor der kleinen Oase ohne Namen den Beduinenumhang abgelegt und die Zeremonialgew├Ąnder, die man ihr im Tempel gegeben hatte, lagen sorgf├Ąltig zusammengelegt in ihrem B├╝ndel. Trotzdem sah bestimmt jeder, wie m├╝de und abgek├Ąmpft sie war.
Laute Stimmen drangen durch die ge├Âffneten Fenster der Schenke, deren Besitzer die Anlaufstelle f├╝r Schmuggler und Diebe war. Takait zupfte ihre Per├╝cke so zurecht, dass diese ihre abstehenden Ohren bedeckte. Seit fr├╝hester Kindheit hasste sie diesen Sch├Ânheitsfehler, ├╝ber den sich die anderen Kindern der dritten Oase mit vorliebe lustig gemacht hatten.┬á Peter hatte keine Vorstellung davon, was f├╝r eine Zumutung es f├╝r sie gewesen war, w├Ąhrend der Reise auf ihre Per├╝cke zu verzichten!┬á
Mit einiger ├ťberwindung ├Âffnete Takait die T├╝r, denn sie war zwar auf der Nachbaroase aufgewachsen, doch niemals zuvor hatte sie am Abend einen Fu├č ├╝ber die Schwelle dieses verrufenen Lokals gesetzt, wo sich der Abschaum zweier Oasen traf. Gesch├Ąfte, deren sich selbst die ├╝belsten Halsabschneider zu Hause sch├Ąmten, wurden hier abgewickelt und au├čerdem gab es in dieser Spelunke mehr Prostituierte als in allen drei Sobek-Oasen zusammen. Hoffentlich verschlug es Peter und Johann nicht zuf├Ąllig hierher! Takait w├╝rde sich ihrer Heimat sch├Ąmen.
Im Schankraum ging es erwartungsgem├Ą├č hoch her. Zu dieser fortgeschrittenen Stunde hatten die G├Ąste – die meisten von ihnen waren aus der dritten Oase hierher geritten -┬á schon reichlich dem Starkbier und dem roten Wein zugesprochen. Beim Anblick der Betrunkenen w├╝nschte Takait sich erstmals, sie w├Ąre in Alexandria geblieben, wo der Konsum von Alkohol verp├Ânt war. Dabei w├Ąre das Lokal mit einer kultivierteren Kundschaft durchaus gem├╝tlich gewesen: Entlang der W├Ąnde liefen Sitzb├Ąnke aus Palmenholz, vor denen elegant gedrechselte Tische und St├╝hle mit geflochtener Sitzfl├Ąche standen. In vier Fu├č H├Âhe waren farbenfrohe Nillandschaften auf den wei├čen Putz gemalt. Die Deckenbemalung hingegen erzeugt t├Ąuschend echt den Eindruck einer Laube und von deren Mitte hing ein Strau├čenei herab.
Ein Rebab-Spieler zupfte sein Instrument, in der Ecke sangen einige junge M├Ąnner, offensichtlich jeder ein anderes Lied und selbst der Wirt hatte glasige Augen.
„Endlich l├Ąsst du dich mal wieder blicken!“, rief er ihr durch den Raum entgegen. „Dein Stiefvater hat schon mehrmals hier vorbeigeschaut, um nachzufragen, ob ich wei├č wo du steckst und heute hat sich auch noch ein Gast nach dir erkundigt.“
Peter! Oder vielleicht Johann?“ durchfuhr es Takait und sie glaubte einen Augenblick lang, sie w├╝rde in Ohnmacht fallen. Dann begann sie trotz der sommerlichen Hitze am ganzen K├Ârper zu zittern.
„Ein Fremder?“, fragte sie und versuchte, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. Wie konnte es sein, dass die Br├╝der sie ├╝berholt hatten? Sie hatte unterwegs nur zwei Beduinen gesehen, die mit so gro├čer Geschwindigkeit an ihr vorbei geritten waren, dass Takait sie noch nicht einmal um Hilfe bitten konnte.
„Wo denkst du hin?“ Der Wirt lachte und enth├╝llte dabei eine h├Ąssliche Zahnl├╝cke, die er sich wohl bei einer Schl├Ągerei zugezogen hatte. „Er ist ein sehr guter Freund von mir.“
Der Wirt winkte einem Mann zu, der Takait bisher den R├╝cken zugewandt hatte. Dieser drehte sich um und Takait erkannte ihn augenblicklich, obwohl er sich die Kapuze tief in das Gesicht gezogen hatte. Es war der ├Ąltere der beiden finsteren Karawanenf├╝hrer, denen sie immer aus dem Weg gegangen war, wo es nur ging. Was um Isis Willen machte er jetzt hier? Hatte sich das Verschwinden der Oasenkrokus-Zwiebel herumgesprochen? Unwahrscheinlich, denn Peter und Johann konnten sich ohne ihre Hilfe nicht bei den Einheimischen beschweren. Takait konnte nur hoffen, dass der Beduine sie in Frauenkleidern nicht erkannte hatte, aber wieso hatte er sich dann nach ihr erkundigt? Hatte er den Namen Takait genannt oder nach der Frau gefragt, die f├╝r den Sphinx getanzt hatte?
Der Nomade musterte Takait mit wachen, intelligenten Augen.
„Dein Tanz war eindrucksvoll. Du solltest dein Talent nicht als Priesterin verschwenden, sondern im Tempel tanzen.“ Er l├Ąchelte verschlagen. „Wenn ich mich richtig erinnere, besteht der Gottesdienst im Tempel der dritten Oase vorwiegend darin, dass Priesterinnen vor dem Bildnis der Neith tanzen?“
Takaits war einen Augenblick lang perplex. Wieso erw├Ąhnte der Nomade die G├Âttin Neith? Und was wollte er mit dem Hinweis auf den Tanz sagen? Was wusste dieser grauenhafte Mensch? Takait zwang sich, bed├Ąchtig zu reagieren, denn vielleicht wusste er gar nichts. Was er gesagt hatte, war eine allgemein bekannte Tatsache. Wahrscheinlich wusste er nicht einmal, dass die T├Ąnzerin, die er gesehen hatte mit dem Jungen identisch war, der die Fremden als Diener begleitet hatte. Vielleicht sollte sie sich ├╝ber die vertrauliche Anrede beschweren? Nein, es war wohl besser, keinen Streit anzufangen.
„Ja, so ist es. Vielleicht werde ich irgendwann wieder tanzen, aber momentan habe ich etwas anderes vor. Es ist mein sehnlichster Wunsch, eine Priesterin zu werden“, sagte sie daher so beil├Ąufig wie m├Âglich, „aber momentan brauche ich etwas zu trinken, denn sonst verdurste ich.“
Takait legte zur Motivierung des Wirtes eine M├╝nze auf den Tisch, den dieser mit professioneller Beh├Ąndigkeit eins├Ąckelte.
„Wasser bitte“, f├╝gte Takait hinzu, da sie bef├╝rchtete anderenfalls Starkbier vorgesetzt zu bekommen, „wenn es geht einen ganzen Schlauch.“
„Wenn du wirklich willst“, meinte der Wirt mit einem dreckigen Grinsen und holte das Gew├╝nschte von unter der Theke hervor.
Takait setzte den Schlauch an die Lippen und schluckte das Wasser gierig herunter bis ihr der Magen schmerzte. Als sie den Wasserschlauch wieder absetzte, packte der Nomade sie unvermittelt am Arm.
„Was soll denn das?“ rief Takait aus und versuchte vergeblich die Hand des Beduinen abzusch├╝tteln.
Die anderen G├Ąste lachten. Jemand machte eine frauenfeindliche Bemerkung. Takait versuchte immer noch sich zu befreien, aber, obwohl sie recht kr├Ąftig war, musste sie feststellen, dass der Beduine ihr k├Ârperlich haushoch ├╝berlegen war.
„Wo ist das Kamel, den du mir gestohlen hast?“
Einen Augenblick lang war Takait verbl├╝fft. Das Dromedar hatte sie v├Âllig vergessen. War es m├Âglich, dass der Nomade sie trotz ihrer Verkleidung erkannt hatte?
„Welches Kamel?“, stotterte sie. „Ich wei├č gar nicht, wovon du redest?“
Sie schlug die Augen auf und versuchte einen unschuldigen Eindruck zu erwecken.
„Tu nicht so scheinheilig! Du hast du dich in aller Fr├╝he aus der Karawanserei davongestohlen, aber einer der Stallknechte hat dich fliehen sehen, und zwar mit einem meiner Kamele!“
Takait blickte hilfesuchend den Wirt an, aber dieser schaute unger├╝hrt zu, als der Nomade sie auf die Gasse schleifte. Das Gr├Âlen der Betrunkenen und weitere h├Ąmische Bemerkungen der G├Ąste folgten Takait und ihrem Entf├╝hrer. Dann schlug die T├╝r hinter ihr zu und sie stand auf der sandigen Freifl├Ąche zwischen den wenigen H├Ąusern.┬á
„Hast du wirklich gedacht, dass du mir entwischen kannst? Hierher zu fl├╝chten war eine ziemlich einf├Ąltige Idee!“
Dies fand Takait mittlerweile auch, denn als sie vor den Br├╝dern geflohen war, hatte sie keinen Gedanken an Karawanenf├╝hrer und das Dromedar verschwendet, das sie ausgeliehen hatte.
Der Nomade musterte Takait von Kopf bis Fu├č. In seinem sonnengegerbten Gesicht mischten sich ├ärger und Belustigung. Takait, die ihn erstmals bewusst ansah stellt fest, dass er sicherlich in seiner Jungend ein gutaussehender Mann gewesen war, aber diese lag mittlerweile mindestens zwanzig Jahre zur├╝ck, in denen die Sonne tiefe Furchen in seine Haut gegraben hatte.
Takait unternahm, einen letzten Versuch, sich dumm zu stellen.
„Da muss eine Verwechslung vorliegen. Ich habe kein Kamel gestohlen.“
„Zu Fu├č h├Ąttest du kaum so schnell hierhergelangen k├Ânnen.“
„Schau dich doch um!“, erkl├Ąrte Takait mit einer weit ausholenden Geb├Ąrde. „Hier ist weit und breit kein Kamel zu sehen.“
„Weil ich meine Tiere gelehrt habe, zur Herde zur├╝ckzukehren, aber ich nehme den Versuch f├╝r die Tat.“┬á
Ein drohender Unterton lag in der Stimme des Mannes. Takait sp├╝rte Panik in sich aufsteigen.
„Wenn du mir etwas tust, bekommst du ├ärger mit den beiden Fremden!“┬á
Das Gesicht des Nomaden verzog sich zu einem h├Ąmischen Grinsen.
„Mit dem Dunkelhaarige vielleicht. Der Rothaarige wird keinen Finger r├╝hren, so feindselig, wie er dich unterwegs die ganze Zeit angestarrt hat, aber eigentlich wirken sie beide nicht besonders gef├Ąhrlich!“ Der Beduine lie├č Takait weiterhin keinen Moment aus den Augen. Es waren kalte, harte Augen. „Aber ich habe gar nicht vor, mich an dir zu vergreifen. Dazu bist du viel zu wertvoll. Du wirst im Neith-Tempel der dritten Oase f├╝r uns spionieren!“
Diese Wendung hatte Takait nicht vorhergesehen. Sie frage sich noch, wer die zweite H├Ąlfte des „uns“ sein mochte, als sie den zweiten, j├╝ngeren Karawanef├╝hrer sah. Dann realisierte sie die volle Tragweite der Worte und ein Schauer lief ihr ├╝ber den ganzen Leib.
„Ihr geh├Ârt zu den Grabr├Ąubern!“
Beide M├Ąnner grinsten.
„Was meinst du, wie die Kaufleute ihre Beute ohne unsere Hilfe h├Ątten wegtransportieren sollen?“
Taikait starrte den ├Ąlteren Beduinen entsetzt an. Der andere hielt sich weiterhin im Hintergrund, was Takait bedauerte, denn er wirkte weniger gef├Ąhrlich, was aber vielleicht nur daran lag, dass sein Gesicht noch nicht von tiefen Furchen durchgraben war. Unterwegs hatte sich Takait mehrfach von ihm beobachtet gef├╝hlt, aber jedes Mal wenn sie ihn zur Rede stellen wollte, hatte er in eine andere Richtung geschaut und sie hatte beschlossen, dass sie sich geirrt haben musste.
„Jetzt spiel nicht auch noch die Unschuldige!“, erkl├Ąrte der ├Ąltere Beduine im Tonfall eines Richters, der im Begriff ist, einen Verbrecher zum Tod zu verurteilen, „Du hast alle betrogen: die Kaufleute, die Priester des Hathor-Tempels und sogar die beiden Fremden, deren Dolmetscherin du angeblich warst.“
Takait erschauerte innerlich. Es war, als ob ihre innere Stimme, ihr eigenes schlechtes Gewissen zu ihr spr├Ąche.
„Aber man hat mich dazu gezwungen, den R├Ąubern zu helfen!“, beteuerte sie, „einer der beiden Grabr├Ąuber hat mich wieder erkannt und er hat mir damit gedroht, mich meinem Stiefvater auszuliefern, wenn ich nicht f├╝r ihn spioniere!“
Takait fragte sich, warum sie sich eigentlich vor diesen schlechten Menschen entschuldigte. Sie kam sich vor wie in einem Alptraum, aber so sehr sie sich dies auch wünschte, sie erwachte nicht daraus. 
„Und ich zeige dich beim Dorfschulzen wegen Diebstahls an, wenn du nicht f├╝r uns arbeitest.“
Takait schwirrte der Kopf. Sie hatte sich geschworen, nie wieder R├Ąubern zuzuarbeiten, auch wenn man sie ihrer Familie deshalb auslieferte.┬á Trotzdem war es sicher unklug, den Beduinen zu widersprechen. Wer wei├č, wozu sie dann alles f├Ąhig waren. Vor ihrem inneren Auge sah Takait ganz pl├Âtzlich einst├╝rzende Bauten. Ob sie vielleicht gar die Schuld daran trug, dass der Sphinx zum Leben erwacht war?
„Habt Ihr denn gar nichts aus den Geschehnissen auf der ersten Oase gelernt? Habt ihr keine Angst vor dem Zorn der G├Âtter?“, entfuhr es ihr daher.
Der Nomaden wirkte so, als ob er sich nicht im Geringsten f├╝rchtete.
„Ein Erdbeben hat die Grabkammer zum Einsturz gebracht. Das war Pech f├╝r die Grabr├Ąuber, aber eure G├Âtzen hatten damit nichts zu tun.“
„Und der Sphinx?“
Der Nomade zuckte mit den Schultern.
„Wurde ebenfalls vom Erdbeben zerst├Ârt.“
Die Augen des ├Ąlteren Nomaden verengten sich zu Schlitzen. Takait bekam eine G├Ąnsehaut, als er sie misstrauisch anstarrte.
„Was ich mich schon unterwegs gefragt habe: Was hatten die beiden Fremden eigentlich auf der ersten Oase zu suchen? Sie haben - au├čer der Mumie, die sie bestimmt nicht in ├ägypten verkaufen wollten - keine Waren mit sich gef├╝hrt. Und trotzdem haben sie klaglos das Doppelte des ├╝blichen Preises gezahlt.“┬á
„Das haben sie mir nicht gesagt“, log Takait, „aber es hat mich auch nicht weiter interessiert. Alles, was f├╝r mich z├Ąhlte war, dass sie f├╝r meine Passage aufgekommen sind.“
Ein weiterer finsterer Blick war die Antwort.
„Aber du sprichst doch ihre Sprache. Hast du unterwegs nicht mitbekommen, wor├╝ber sie geredet haben?“
„Sie haben sehr wenig geredet, denn die Hitze ist ihnen nicht bekommen und wenn sie gesprochen haben, dann meist ├╝ber ihren Vater, der irgendwo in ├ägypten verschollen ist.“
Takait hoffte inst├Ąndig, dass der Nomade nicht doch irgendwann das Wort Oasenkrokus aufgeschnappt hatte, zumal sein Gesichtsausdruck keinen Zweifel daran lie├č, dass er ihr nicht glaubte. Dann fiel ihr zu ihrer Erleichterung ein, dass sie mit den Br├╝dern stets Deutsch gesprochen hatte.
„Meinst du, du kannst mich f├╝r dumm verkaufen? Sie haben in der unterirdischen Grabanlage des Labyrinths herumgeschn├╝ffelt und sie werden wohl kaum dort unten nach ihrem Vater gesucht haben.“
„Das sind genau die Dinge, mit denen ich nichts zu tun haben will!“, behauptete Takait, „sie haben mich daf├╝r bezahlt, dass ich f├╝r sie ├╝bersetzt habe. Alles andere wollte ich lieber gar nicht wissen.“
Die beiden Nomaden sahen sich wortlos an.
„Hast du Ihnen gesagt, wo sich die Sch├Ątze befinden?“
Takait sch├╝ttelte matt den Kopf. Die Sache wurde immer absurder.
„Aber den Kaufleuten hast du es gesagt!“
„Nein, woher um Isis Willen h├Ątte ich das wissen sollen?“, fragte sie v├Âllig wahrheitsgem├Ą├č, „nur der Priester, der mit den R├Ąubern versch├╝ttet worden ist kannte die Anlage. Meine Aufgabe war herauszufinden, wer f├╝r die Verwaltung der Grabanlage zust├Ąndig ist.“
„Haben die beiden Fremden auch mit diesem Priester gesprochen?“
„Sie sprechen nicht die Sprache unseres Landes!“┬á
Die beiden Nomaden steckten die K├Âpfe zusammen und besprachen sich.
„Wir haben genug Zeit mit Reden verschwendet“, erkl├Ąrte der ├ältere dann, „h├Âchste Zeit zur dritten Oase aufzubrechen.“
„Aber ihr k├Ânnt doch die Karawane nicht im Stich lassen!“, protestierte Takait, die wieder an die Br├╝der denken musste.
„Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun“, erkl├Ąrte der ├Ąltere Beduine, w├Ąhrend der j├╝ngere sie festhielt, damit sein Spie├čgeselle ihr die H├Ąnde auf dem R├╝cken festbinden konnte, „aber, wenn es dich beruhigt: Ich werde einen meiner Verwandten auf die zweite Oase schicken, damit er sich etwas Geld verdienen kann.
„Aber bald ist es dunkel!“, wandte Takait ein, in der Hoffnung, die Beduinen noch etwas hinzuhalten zu k├Ânnen. Vielleicht hatte sie Gl├╝ck und jemand suchte sie hier und wenn es nur ihr Stiefvater war, der sie unbedingt mit seinem Gesch├Ąftspartner verheiraten wollte.
„Wir werden drau├čen ├╝bernachten.“
Die Stimme des Beduinen duldete keinen Widerspruch. Sie schleiften die sich verzweifelt nach Hilfe umschauende Takait zu ihren Kamelen und machten sich auf den Weg.
*
Als am n├Ąchsten Morgen sich die D├Ąmmerung ank├╝ndigte, betete Takait zu allen G├Âttern ├ägyptens, dass die Oasenkrokus-Zwiebel nicht vertrocknet war, aber sie konnte dies nicht ├╝berpr├╝fen, da die beiden Nomaden nie zu schlafen schienen. Sie hielten angeblich abwechselnd Wache, aber Takait h├Ątte nicht zu sagen vermocht wer von ihnen wachte und wer in einem leichten Halbschlaf vor sich hind├Ąmmerte.┬á┬á
Noch immer f├╝hlte Takait die K├Ąlte der Nacht in ihren Knochen, doch am Horizont graute bereits der Morgen. Die ganze Zeit hatte Takait an die Br├╝der gedacht, die sie die Zwiebel hatte ausgraben lassen um sie ihnen dann wieder zu stehlen.
Dann brachen die drei Reisenden wieder auf. Das Gehen war f├╝r Takait m├╝hsam geworden in den zwei Tagen, in denen sie nun schon unterwegs waren, und je l├Ąnger Takait ging, desto anstrengender wurde es. Man lie├č sie laufen, w├Ąhrend die beiden M├Ąnner auf ihren Kamelen ritten. Sie hatten gesagt, dies sollte ihr eine Lehre sein, nie wieder ein Kamel zu stehlen. Zuerst war Takait w├╝tend gewesen, aber mittlerweile setzte sie nur noch apathisch einen Fu├č vor den anderen.
Sie legte den Kopf in den Nacken und betrachtete den Flug eines Vogels. Warum konnte er sie nicht auf seinen Schwingen davontragen? Ganz pl├Âtzlich sah Takait schwarze Flecken, die ihr vor den Augen tanzten. Sie schloss die Lider und legte sch├╝tzend eine Hand dar├╝ber. Trotzdem flackerten weiterhin purpurrote Punkte vor ihren geschlossenen Augen. Alles drehe sich um sie. In ihren Ohren rauschte es. Dann umfing sie die Dunkelheit.
„Steh auf!“, h├Ârte sie eine m├Ąnnliche Stimme aus der Ferne sagen und Takait f├╝hlte sich, wie in Watte verpackt.
Trotzt der r├╝den Worte war der Ton der Stimme nicht unfreundlich. Ganz langsam hob Takait, die noch v├Âllig benommen war, die Lider. Sie sah dem j├╝ngeren der beiden Beduinen ins Gesicht und schlagartig war sie wieder wach, aber am liebsten h├Ątte sie die Augen gleich wieder geschlossen. Vielleicht lie├č man sie dann schlafen. Takait hatte nur noch einen Wunsch, sie wollte ruhen. ┬á
Lange schwarze Str├Ąhnen hingen dem Beduinen ins sonnenverbrannte Gesicht. In seinem G├╝rtel steckte ein langes Messer, das er jederzeit gegen Takait einsetzen konnte und auf seinem R├╝cken baumelte sein Geweht. Wortlos half der Mann ihr auf die Beine. Dann lie├č er sie auf seinem Kamel aufsitzen. Er warf dem anderen Nomaden einen beschwichtigenden Blick zu.
Takait zwang sich zu einem dankbaren L├Ącheln und nahm die Z├╝gel in die Hand. Noch immer ganz benommen, griff sie in ihren Umhang. Ihre Finger suchten ein kleines Gef├Ą├č, in dem sich eine belebende Essenz befand, aber sie vermisste pl├Âtzlich ihre Tasche und schlagartig war sie wieder hellwach.
„Wo ist meine Tasche?“, rief sie den M├Ąnnern zu, bestrebt ihre Stimme nicht schrill werden zu lassen.
Der unfreundliche Nomade warf ihr die aus Palmbl├Ąttern geflochtene Tasche zu. Fast w├Ąre sie zu Boden gefallen, aber Takait bekam im letzen Augenblick einen Riemen zu fassen. Sie ├Âffnete die Lasche und schaute hinein. Die Tasche war leer! Ein eisiger Schauer durchfuhr Takait. Man hatte ihr nicht nur ihre Kleider weggenommen, die zusammengefaltet in der Tasche lagen, sondern auch die Oasenkrokus-Zwiebel.┬á┬á
„Eine kleine Anzahlung f├╝r das Kamel, den du uns gestohlen hast“, sagte der j├╝ngere Nomade fast entschuldigend.
„Aber das Kamel ist doch zur├╝ckgelaufen!“
„Strafe muss sein“, erwiderte der ├Ąltere Nomade.
Takait ├Âffnete ihren Mund, um nach dem Oasenkrokus zu fragen, aber sie besann sich im letzen Augenblick eines Besseren. Die Nomaden durften nicht erfahren, wie wertvoll die Blume war. Also durfte sich Takait nicht wegen einer unscheinbaren Zwiebel aufregen.
„Was willst du mit meinen Zeremonialgew├Ąndern anfangen?“, fragte sie daher mit m├╝hsam unterdr├╝cktem Zorn.
„Verkaufen, wenn du es nicht bei der Arbeit im Tempel tragen willst.“
„Das ist Diebstahl!“
Takait kam sich im gleichen Augenblick uns├Ąglich albern vor. Sie ahnte die Antwort, bevor sie ausgesprochen wurde.
„Und was war mit dem Kamel?“, Der j├╝ngere Nomade hatte gesprochen. „Ich hei├če ├╝brigens Abdul und wenn du etwas nett zu mir bist, gebe ich dir deine Kleider zur├╝ck.“
Pl├Âtzlich realisierte Takait, dass die Nomaden ihr noch etwas sehr Wertvolles weggenommen hatten.
„Gebt mir meine Statuette des Gottes Amun zur├╝ck!“, rief sie aus. „Sie ist meine pers├Ânliche Besch├╝tzerin!“
„Das ist nicht zuviel verlangt“, erwiderte Abdul und lie├č dabei seinen Blick in einer Art und Weise ├╝ber Takait gleiten, dass es ihr peinlich war, dass er ihren Tanz beobachtet hatte. „Die Statuette ist aus Terrakotta. Sie hat nur einen geringen materiellen Wert.“┬á
„Aber sie ist ein G├Âtzenbild!“
„Takait soll f├╝r uns tanzen. Also darfst du dich nicht an ihrem Glauben st├Âren.“
Mit einem ver├Ąchtlichen Blick warf der ├Ąltere Beduine ihr die Statuette zu und Takait beschloss, alles auf eine Karte zu setzen.
„In meiner Tasche befand sich auch eine Zwiebel. Wenn ich sie bei mir trage, hilft sie gegen die D├Ąmonen der Nacht.“
„Was ist das schon wieder f├╝r ein gottloses Geschw├Ątz?“
„So sind sie eben die Giaur“, erkl├Ąrte Abdul mit einem mitleidigen L├Ącheln. Ich hatte einmal einen Engl├Ąnder in meiner Karawane, der mir von Flederm├Ąusen in der Familiengruft erz├Ąhlt hat, die er mit Zwiebeln vertreibt.“
Mit einem ver├Ąchtlichen Schnauben kramte der Beduine die Zwiebel aus seiner Tasche und warf sie vor Takait┬á in den Sand.
„Jetzt ist aber Schluss! Meine Geduld ist endg├╝ltig ersch├Âpft!“
Nach diesem, von einem zornigen Blick begleiteten Machtwort des unfreundlichen Nomaden herrschte eine Zeitlang Schweigen. Takait wich seinem Blick aus. Seine stechenden Augen ├Ąngstigten sie mehr als alle D├Ąmonen der Nacht oder der W├╝ste. Sie waren kalt, ohne eine Spur von Gef├╝hl. Takait w├╝nschte sich mittlerweile nichts sehnlicher als ein ruhiges Fleckchen, in das sie sich zur├╝ckziehen konnte, und sei es der kleinste Tempel eines unbedeutenden Gottes.
Takait dachte an den Sphinx, den sie mit ihrem Tanz besiegt hatte und sie ├Ąrgerte sich ├╝ber ihre eigene Verzagtheit. War sie denn nicht sie eine T├Ąnzerin des Amun? Sie sollte sich zu helfen wissen, aber sie wusste momentan beim besten Willen nicht, wie.
Die Schankwirtschaft
17. Die Schankwirtschaft
Johann erkannte das Kamel, das der Mann, den sie Saladin nennen sollten ihm lieh auf den ersten Blick wieder: Es war dasselbe Tier, das schon vom ersten Tag ihrer Bekanntschaft an hochm├╝tig ├╝ber ihn weggesehen hatte und obwohl er es am Hals t├Ątschelte, lie├č es sich nicht herab ihn anzublicken. Vielleicht war es an der Zeit, sich miteinander zu arrangieren?
„Hat es eigentlich einen Namen?“ fragte er daher den neuen Karawanenf├╝hrer, der wieder seine aus weiten, den ganzen K├Ârper verh├╝llenden, br├Ąunlichen Gew├Ąndern bestehende Reisekleidung trug.
„Selbstverst├Ąndlich!“, erkl├Ąrte Saladin, „aber ich f├╝rchte, Sie k├Ânnten ihn nicht aussprechen. Ins Englische ├╝bersetzt hei├čt der Name des Kamels┬á so etwas ├ähnliches wie W├╝stenwind!“┬á
Johann wusste nicht recht, was er von dieser Neuigkeit halten sollte. Priester Menas hatte ihm erz├Ąhlt, dass alle Dromedare sehr schnell laufen konnten, aber von diesem Talent hatten sie bisher keine Kostprobe gegeben.
Sie brachen gegen Mittag auf, als die Sonne ihren h├Âchsten Stand erreicht hatte und Johann fragte sich zum wiederholtsten Mal, warum sie nichts nachts reisten. Aber diesmal war es vielleicht besser so, denn der Kaufmann, der sie begleitete war sicherlich kein so erfahrener Pfadf├╝hrer wie die beiden Beduinen, von denen seltsamerweise bei ihrer R├╝ckkehr in der Karawanserei jede Spur gefehlt hatte. Dies schien auch die anderen Kaufleute, die wild diskutierend in der Lagerhalle gestanden hatten, derart in Rage gebracht zu haben, dass sie den Aufbruch Saladins offenbar nicht zur Kenntnis genommen hatten, obwohl dieser unterwegs bei verschiedenen Anl├Ąssen als ihr Sprecher fungierte hatte.┬á
Auf diesen war Johann mittlerweile ├╝berhaupt nicht gut zu sprechen, denn zuerst hatte er eine vage Andeutung gemacht, dass er etwas ├╝ber den Vater w├╝sste und als Johann ihm Geld f├╝r diese Information gegeben hatte, hatte er zugegeben, nie mit dem Vater gesprochen zu haben. Stattdessen hatte er ihn damit vertr├Âstet, dass die Bewohner der dritten Oase ihm angeblich weiterhelfen konnten. Mittlerweile hatte Johann den finstere Verdacht, dass der Kaufmann all dies nur aus Geldgier erfunden hatte.
Johann fragte sich sogar ernsthaft, ob er seinen Bruder und ihn in die W├╝ste gelockt hatte, um ihnen fernab jeder menschlichen Ansiedlung die Mumie und ihre anderen Habseligkeiten zu rauben. Wenigstens waren sie in der ├ťberzahl, aber es war Vorsicht geboten.
Daher f├╝hlte sich Johann erst etwas wohler, als sich endlich die kleine Oase ohne Namen am Horizont abzuzeichnen begann. Zwar hatte der Kaufmann ihnen unterwegs keinen Anlass gegeben, sich ├╝ber ihn zu beklagen, aber Johann traute ihm noch weniger ├╝ber den Weg als Takait und dies wollte wirklich etwas hei├čen.
Beim Anblick der wenigen H├Ąuser, die inmitten eines Palmenhains standen, wunderte sich Johann, dass es hier eine Schnke gab. Offenbar kamen wirklich die Menschen aus der ganzen Umgebung hierher um sich zu treffen, um sich zu betrinken, um zu feiern und zu intrigieren. Vielleicht gab es auf dieser Oase sogar jemanden, der ihnen Ausk├╝nfte ├╝ber ihren Vater geben konnte. Ehe er eine Bemerkung dar├╝ber verlieren konnte, durchfuhr Johann ganz pl├Âtzlich die Erkenntnis, dass es einen logischen Sprung in den ├äu├čerungen ihres Pfadfinders gab.
„Eigentlich m├╝sste man sich doch auch auf der ersten und zweiten Oase an unseren Vater erinnern. Warum habe Sie und das nicht dort schon gesagt?“, fuhr er Saladin schlacht gelaunt an.
„Weil er immer nur die dritte Oase besucht hat, junger Effendi“, erwiderte Saladin mit einem nachsichtigen L├Ącheln, das Johann geradezu provozierte.
„Ich denke, die Karawanen klappern immer alle drei Oasen nacheinander ab?“, mischte sich nun auch Peter ein.
Der Kaufmann nickte bed├Ąchtig.
„Das ist auch so, aber es gibt auch Karawanen, die dies in umgekehrter Reihenfolge tun. Ihr Vater hat offenbar diese Route bevorzugt und ist dann immer in der dritten Oase gebleiben.“
Johann fand dies noch immer widersinnig.
„Und warum haben wir nicht auch die andere Route genommen?“, entfuhr es ich. „Ich h├Ątte auf den Besuch der ersten und der zweiten Oase gut verzichten k├Ânnen!“
„Sie hatten vor, die Strecke m├Âglichst schnell hinter sich zu bringen. Deshalb blieb Ihnen nichts anderes ├╝brig als alle drei Oasen zu besuchen. In welcher Reihenfolge sie das tun, ist f├╝r sie daher eigentlich unerheblich. Ihr Vater hingegen hat bei seinen Aufenthalten jeweils wochenlang gewartet, bis die n├Ąchste Karawane vorbeikam, die zur├╝ck nach Alexandria gezogen ist. Deshalb musste er nicht die Drei-Oasen-Tour machen.“
„Trotzdem k├Ânnten Sie in dieser Schenke nach unserem Vater fragen!“, meinte Johann, „und gegen eine Mahlzeit habe ich auch nichts einzuwenden.“
Der Kaufmann warf Peter einen fragenden Blick zu und dieser nickte. Johann ├Ąrgerte sich dar├╝ber, dass Saladin offenbar meinte vorher die Erlaubnis seines Bruders einholen zu m├╝ssen, bevor er seine Zustimmung gab.
„Aber ich muss Sie warnen“, bemerkte dieser dann, „dieses Lokal ist eine ├╝ble Spelunke. Es ist eine Schande f├╝r die gesamte Oasengruppe und eigentlich nicht der passende Aufenthaltsort f├╝r zwei junge Herren wie Sie.“
„Das h├Ątten Sie vorher sagen k├Ânnen!“, protestierte Peter, „jetzt wo wir in Sichtweite der Schenke sind, m├Âchte ich auch hineingehen.“
Der Kaufmann zuckte mit den Schultern.
„Auch ich habe selbstverst├Ąndlich nichts gegen eine warme Mahlzeit einzuwenden, aber ich wei├č nicht, ob ich ansonsten dort viel f├╝r Sie ausrichten kann. Die Schenke wird nur von ├ägypter frequentiert und diese halten nicht besonders viel von Antiquit├Ątenh├Ąndlern, wie mir.“
Das ist sicher ein Euphemismus f├╝r Grabr├Ąuber, durchfuhr es Johann.
„So nennt man das also heutzutage!“, erwiderte Peter lachend, der offenbar dieselbe Assoziation gehabt hatte.
„Man tut, was man kann“, entgegnete Saladin diplomatisch, „aber Sie tun mir in einem Punkt Unrecht: Ich handle mit Antiquit├Ąten, ich besorge sie nicht!“┬á┬á
Es war schon auf den ersten Blick zu sehen, welches der wei├čgekalkten, kubischen Geb├Ąude die Schankwirtschaft war, denn die kleineren Bauten waren vom Lachen und dem Geschrei von Kindern erf├╝llt. Die drei Reisenden brachten ihre Kamele im Mietstall unter, der in einem an die Schenke angrenzenden Schuppen untergebracht war und umrundeten den stattlichen Bau um zu der gro├čen h├Âlzernen T├╝r zu gelangen: Peter schritt mit wichtiger Miene eine Nasenl├Ąnge vor seinem Bruder voran, w├Ąhrend der Kaufmann mit einigem Abstand folgte.
Zwei junge Burschen mit wei├čen, gef├Ąltelten Schurzen und kahl rasierten Sch├Ądeln bogen um die Ecke und erreichten vor den Br├╝dern das Portal. Sie traten ein und schlugen Peter die T├╝r vor der Nase zu. Er blieb eine Schrecksekunde lang verbl├╝fft und ver├Ąrgert vor der mit Reliefs verzierten Holzt├╝r stehen.
Dann zog Saladin statt seiner die T├╝r wieder auf, deren Angeln ein h├Ąssliches Quietschen produzierten. Das ist Seltsam, dachte Johann: bei den beiden R├╝peln war die T├╝r lautlos aufgegangen. Sie traten ein und Johann war ├╝ber den Innenraum der Schenke ziemlich verbl├╝fft. Mein Gott, dass es so etwas tats├Ąchlich gibt, dachte er beim Anblick der Wandmalereien, der blauen Kacheln und des riesigen Vogeleis, das von der Decke hing. Das sieht ja aus wie ein B├╝hnenbild┬á der Zauberfl├Âte oder wie eines dieser orientalisierenden Gem├Ąlde, die in Frankreich zurzeit en vogue waren. Und der Wirt mit seinem Galgenvogelgesicht h├Ątte ein Schurke aus einem Boulevard-Theaterst├╝ck sein k├Ânnen.
Die meisten G├Ąste trugen eine ├Ąhnliche Tracht wie die Bewohner der ersten beiden Oasen: Nach alt├Ągyptischer Sitte gef├Ąltelte Schurze, weite plissierte Gew├Ąnder und sorgf├Ąltig gelockte Per├╝cken. Es roch nach R├Ąucherst├Ąbchen, Tabakraum und fettigen Speisen.┬á┬á
Als die Fremden eintraten, verstummten alle Gespr├Ąche und die Zecher begafften sie mit unverhohlener Feindseligkeit. Johann wunderte sich, was die die anderen G├Ąste eigentlich gegen sie hatten, zumal sie sich in ihren langen Umh├Ąngen und sonnenverbrannten Gesichtern kaum von Beduinen unterschieden. Also konnten sich die Animosit├Ąten der Einheimischen wohl nur gegen Nomaden richten, die sie wahrscheinlich┬á - nicht ganz zu Unrecht - f├╝r Diebe und Betr├╝ger hielten. Und Saladin hatte sie eben vorgewarnt, dass man ihn hier nicht sch├Ątzte.┬á
Als die drei Reisenden den Schankraum mit seinen quadratischen Tischen, die von Zechern umlagert waren, durchquerten, folgten ihnen die Blicke s├Ąmtlicher Menschen im Lokal. Es war ein regelrechtes Spie├črutenlaufen, sich zum Tresen vorzuk├Ąmpfen. Peter baute sich schlie├člich vor der Theke auf und r├Ąusperte sich, um die Aufmerksamkeit des dicken Wirts zu wecken, der mit einem schielenden Beduinen Karten spielte. Der Mann hinter dem Tresen blickte von seinem Blatt auf und bedachte den Neuank├Âmmling mit missbilligenden Blicken.
„K├Ânnten Sie sich bitte nach Takait erkundigen“, sagte Peter zu dem neben ihm stehenden Saladin und Johann ├Ąrgerte sich, dass der Bruder nicht wenigstens anstandshalber zuerst nach ihrem Vater gefragt hatte.
Mit einer - anbetracht dieser feindlichen Umgebung - bewundernswert h├Âflicher Miene ├╝bermittelte der Kaufmann das Anliegen der Br├╝der. Der Wirt sah ihn h├Ąmisch an und grunzte dann etwas auf ├ägyptisch, worauf Saladin etwas entgegnete, was die Br├╝der ebenfalls nicht verstanden, weil er offenbar Arabisch sprach. Der Wirt zog eine h├Ąssliche Grimasse und wiederholte dann widerwillig seinen Kommentar, der in der kehligen arabischen Sprache noch barscher klang.
„Er sagt, dass er Getr├Ąnke verkauft und keine Informationen!“, ├╝bersetzte Saladin in einem entschuldigenden Tonfall.
Johann schaute sich um, was man hier so trank. Die rote Fl├╝ssigkeit in den gl├Ąsernen Kelchen mochte Wein sein, ├╝ber die gelbe in den irdenen Bechern wollte er sich lieber keine Gedanken machen.
„Ein Glas Wein!“, sagte er daher und Peter nickte: „F├╝r mich dasselbe!“
Wieder ├╝bersetzte der Karawanenf├╝hrer und der Wirt knallte alsbald drei Keramikbecher nacheinander so vehement auf den Tresen, dass diese ├╝berschwappten und Johann einen Augenblick lang bef├╝rchtete, sie k├Ânnten in St├╝cke gehen.
„Warum bringt man uns nicht wie den Einheimischen Gl├Ąser?“, protestierte er dann, aber weder der Bruder noch Saladin gingen auf seine Beschwerde ein.
Johann nippte ohne gro├če Erwartungen am Becher und fand alsbald seine schlimmsten Bef├╝rchtungen best├Ątig. Er hatte zwar schon schlechtere Weine getrunken, aber nur bei den weniger betuchten Kommilitonen. Offensichtlich standen die Einheimischen hier auf zuckers├╝├čem Rebensaft und erstaunlich stark war er auch. H├Âchste Zeit, um etwas Nahrhaftes als Grundlage in den Magen zu bekommen!
„Wollen Sie uns nicht etwas zu essen bestellen?“, fragte er daher Saladin und bem├╝hte sich, nicht unh├Âflich zu werden, „und dies w├Ąre auch ein sehr guter Anlass, um endlich nach unserem Vater zu fragen!“
Er sah, dass der Kaufmann nach einer Ausflucht suchte, aber Johann lie├č ihn nicht zu Worte kommen.┬á
„Es ist ja wohl nicht auszuschlie├čen, dass er sich mal hierher verlaufen hat: Schlie├člich ist die dritte Oase ganz nah“, f├╝gte er schnell hinzu.
Der Kaufmann trank einen gro├čen Schluck Wein und machte dabei ein verdrie├čliches Gesicht. Erst in diesem Augenblick realisierte Johann, dass dieser ein alkoholisches Getr├Ąnk konsumierte.┬á┬á
„Ich dachte, der Prophet hat etwas dagegen“, sagte er, lachend auf den Becher deutend.
„Aus medizinischen Gr├╝nden ist es uns erlaubt und momentan handelt es sich um einen dringenden Notfall“, entgegnete Saladin mit einem schwer zu deutenden Gesichtsausdruck.
Der Wirt bedachte sie mit einer unfreundlichen Bemerkung und man musste kein ├ägyptisch k├Ânnen, um zu verstehen, dass er ihnen seine Speisen aufn├Âtigen wollte.
„Also bestellen Sie bitte endlich etwas zu Essen f├╝r uns drei“, sagte nun auch Peter, „und erkundigen Sie sich noch mal nach unserem Vater und nach Takait.“
Mit sichtbarer ├ťberwindung richtete der Kaufmann die Fragen aus, aber wieder war der Wirt recht kurz angebunden. Dann schnippte er mit den Fingern und ein M├Ądchen, das nach der Familien├Ąhnlichkeit zu schlie├čen seine Tochter sein musste, verschwand in der K├╝che. Sie war wie manche Frauen, die Johann in Alexandria gesehen hatte im t├╝rkischen Stil gekleidet, mit Kopftuch, enger Samtwest und gestreiftem Rock.
„Er bestreitet, Ihren Vater jemals gesehen zu haben. Angeblich sind Sie die ersten Effendis, die den Fu├č ├╝ber seine Schwelle gesetzt haben“, ├╝bersetzte Saladin, aber┬á der verschlagene Gesichtsausdruck des Wirtes strafte seine Wort L├╝gen. „Takait kennt er, aber er hat sie lang nicht mehr gesehen.“
Johann zuckte beim Wort sie zusammen, denn es bewies, dass Saladin wusste, dass Takait ein M├Ądchen war. Oder hatte er nur die Worte des Wirtes ├╝bersetzt? Auch wenn dem so sein sollte, dann wusste er nun endg├╝ltig Bescheid.
„Dann soll er die anderen G├Ąste fragen!“, entfuhr es Peter, dem es nur m├╝hsam gelang, sich zu beherrschen.
Der Kaufmann machte eine vage, ziemlich raumausgreifende Geste und Johann wusste sofort, was er meinte: Noch immer belauschten s├Ąmtliche Zecher, h├Ąmisch feixend die erb├Ąrmlichen Kommunikationsversuche der Fremden.
„Mich wundert, wie viele Worte Sie ├╝bersetzt haben, obwohl dieser maulfaule Wirt kaum drei Silben herausbekommen hat!“, bemerkte Johann mit einem Seitenblick auf den Kaufmann.
„Englisch ist eine sehr umst├Ąndliche Sprache“, erwiderte Saladin mit einem feinen L├Ącheln und im gleichen Augenblick kam die Wirtstochter mit drei Tellern aus der K├╝che, auf denen sich getrocknetes Hammelfleisch, sowie etwas verkochtes Gem├╝se befand und platzierte sie wesentlich feinf├╝hliger vor die Fremden als es ihr Vater mit den Bechern getan hatte. Zwar fand Johann es unkomfortabel, stehend am Tresen zu speisen, aber es gab keinen freien Tisch mehr und die im Schankraum versammelten Gestalten erweckten nicht den Eindruck, als ob sie die Fremden im ihrer Mitte willkommen hei├čen w├╝rden.┬á
Trotz dieser Unbequemlichkeit schlang Johann seine Portion gierig herunter, denn als ihm der Gem├╝segeruch in die Nase drang, bemerkte er erst wie hungrig er war. Das Mahl schmeckte besser als es aussah, was jedoch nicht viel hei├čen wollte, aber es war recht fettig.
Die Tochter des Wirts schenkte ungebeten nach und Johann st├╝rzte den Inhalt des Bechers dem Essen hinterher, obwohl Saladin ihm zufl├╝sterte: „Ich w├╝rde das lieber lassen!“
Eine angenehme W├Ąrme machte sich in ihm breit. Ein weiterer Schluck und Johann wurde die Augen schwer. Offensichtlich war dieser Wein noch st├Ąrker als der, den der Wirt vor dem Essen ausgeschenkt hatte. H├Âchste Zeit, diesen Ort zu verlassen, aber vorher musste er noch warten, bis der Bruder und Saladin ihr Mahl beendet hatten, denen dieses offenbar weit weniger mundete als ihm selbst.
Johann wischte sich den Mund am ├ärmel ab und schaute sich unauff├Ąllig im Schankraum um: Wenigstens starrte sie momentan niemand an. Dies lag nicht zuletzt daran, dass in der Zwischenzeit zwei leichte M├Ądchen das Lokal betreten hatten. Vor Peter stand noch der erste Becher Wein und auch der Kaufmann hatte seinen erst zur H├Ąlfte geleert.
Der Wirt sammelte den abgegessenen Teller ein, der vor Johann stand, reichte ihn seiner Tochter und sagte etwas zu Saladin mit einem h├Ąmischen Grinsen, das eine Zahnl├╝cke entbl├Â├čte.
„Wir wollen Informationen und keinen zuckers├╝├čen Nachtisch“, fuhr Peter schlecht gelaunt den Kaufmann an. „Ich habe langsam genug von diesem Beutelabschneider!“
Der Wirt streckte wortlos seine Hand aus. Saladin nannte einen Betrag, den er f├╝r angemessen hielt und Johann wunderte sich dar├╝ber, woher dieser die g├Ąngigen Preise kannte. Obgleich in gewisser Weise die Zeit hier stehen geblieben war, hatten die Einheimischen nicht nur keine Vorurteile gegen die moderne ├Ągyptische W├Ąhrung, sondern schienen auch ├╝ber die Preisentwicklung gut informiert zu sein.
Peter z├Ąhlte dem ihn h├Ąmisch anstarrenden Wirt die M├╝nzen in die Hand. Der Wirt lie├č die M├╝nzen auf dem Tresen klimpern und Johann fragte sich, ob er damit deren Echtheit ├╝berpr├╝fen wollte.
Dann deutete er ganz unvermittelt und ohne ein weiteres Wort zu verlieren auf die offen stehende T├╝r. Die umstehenden G├Ąste stimmten ihm laut gr├Âlend zu. Die angenehme Stimmung, in die der Wein Johann versetzt hatte, war schlagartig verflogen.
„Ich habe Sie vorher gewarnt, dass man hier etwas gegen Antiquit├Ątenh├Ąndler hat. Allein die Tatsache, dass ich Sie begleite hat schon den Wirt und seine Kunden gegen Sie aufgebracht“, erkl├Ąrte Saladin unger├╝hrt. „Ohne Sie h├Ątten mich keine zehn Pferde dazu gebracht, diese Spelunke zu betreten.“
Au├čer sich vor Wut, st├╝rmte Johann durch das ├╝berf├╝llte Lokal. Der starke Wein, den er getrunken hatte, lie├č den Boden unter seinen F├╝├čen schwanken und der Tabakrauch, der die Luft verpestet, hatte ihm Tr├Ąnen in die Augen getrieben. Halb blind stie├č sich daher den Kopf an dem - f├╝r einen Europ├Ąer viel zu niedrigen - T├╝rrahmen und h├Ârte hinter sich die Lachsalven der besoffenen G├Ąste. Er nahm einen neuen Anlauf und stolperte ins Freie.
Die Sonne blendete ihn und der Wind trieb im hei├čen Sand ins Gesicht, aber die missliche Situation, in der er sich befand, bewirkte dass Johann schnell wieder n├╝chtern wurde. Gleich w├╝rden ihm die anderen beiden nachfolgen und ihm vorwerfen, dass er sich wie ein Idiot benommen hatte.
Peter legte ihm die Hand von hinten auf die Schulter. Johann erschrak, denn er hatte ihn nicht kommen h├Âren.
„Jetzt reg dich doch nicht so auf!“, sagte er, „Saladin hatte Recht: Es war ein Fehler, die Wirtschaft zu betreten, aber denk immer dran, dass uns hier keiner kennt. Das muss uns alles nicht peinlich sein!“
Johann drehte sich um und grinste den Bruder an.
„Ich w├╝rde diese Gelichter jedenfalls nicht zu Mutters Damenkr├Ąnzchen einladen“, bemerkte er dann.
„Du hast offenbar einen ├╝ber den Durst getrunken“, stellte Peter stirnrunzelnd fest, „ich wei├č schon, warum ich es habe mit einem Glas dieses Ges├Âffs bewenden lassen.“
„Das ist nicht meine Schuld! Der Wein, den diese ├Ągyptische Maid mir nachgeschenkt hat, war nicht nur abscheulich, sondern auch sehr stark“, protestierte Johann.
„Da sollten Sie erst einmal das ├Ągyptische Bier versuchen“, mischte sich der Kaufmann ein, „das ist so hochprozentig, dass es den st├Ąrksten W├╝stenkrieger von Kamel haut.“
Eine hohe, weibliche Stimme sagte etwas und es klang so, als ob ihre Worte an die Fremden gerichtet w├Ąren.
Peter, Johann und┬á der Kaufmann drehten sich zugleich um. Die Frau, der die Stimme geh├Ârte war noch jung, soweit sich dies unter den dicken Schichten der Schminke beurteilen lie├č, die sie auf ihr Gesicht aufgetragen hatte. Ihre Augen waren mit schwarzen Linien umrahmt und die Lippen kirschrot bemalt.
„Was will sie von uns?“, fragte Peter unwirsch und seine Augen suchten Saladin.
Johann vermutete, dass es die junge Frau - die wahrscheinlich in der Schenke f├╝r das Am├╝sement der G├Ąste sorgte - auf ihr Geld abgesehen hatte, was auch immer sie als Gegenleistung anzubieten hatte.
„Sie hat Takait gesehen“, ├╝bersetzte der Kaufmann.
„Wirklich?“, entfuhr es Peter, „Und was will Sie daf├╝r?“
„Wollen Sie sich nicht erst miteinander bekannt machen?“, schlug Saladin mit einem leicht sardonischen L├Ącheln von. „Wir sollten doch wenigstens die allerwichtigsten H├Âflichkeitsformen wahren.“
Peter nickt mit einem enervierten Gesichtsausdruck und Saladin tauschte einige Worte mit der jungen Frau.
„Ihr Name ist Nefer“, erkl├Ąrte er dann. „Das hei├čt die Sch├Âne. Ihre Schwester haben Sie bereits vorhin kennen gelernt.“
Eine weitere Tochter des Wirtes! Johann h├Ątte sich dies eigentlich denken k├Ânnen, denn sie besa├č eine fl├╝chtige ├ähnlichkeit mit dem Schankm├Ądchen. Ein gn├Ądiges Geschick hatte hingegen bewirkt, dass sie ihrem fetten Vater nicht im Mindesten glich.
„Die Information ist ganz preiswert“, erkl├Ąrte der Kaufmann und Peter zahlte stoisch die Summe, die er ihm nannte.
Die junge Frau l├Ąchelte. Bei n├Ąherer Betrachtung war sie eigentlich so h├╝bsch wie ihr Name suggerierte. Johann erinnerte sich an die Aufmachung, in der Takait aus dem Tempel gekommen war: Offensichtlich schminkten sich in diesem Land nicht nur die leichten M├Ądchen, aber dies war trotzdem kein Beweis daf├╝r, dass Nefer nicht doch eine Animierdame war
Die junge Frau erz├Ąhlte etwas und der Kaufmann ├╝bersetzte: „Takait war gestern am sp├Ąten Abend hier. ┬áKaum war sie angekommen, haben zwei Beduinen sie beschuldigt, ein Kamel gestohlen zu haben und sie hat es noch nicht einmal abgestritten. Die drei sind dann ins Freie gegangen und haben sich vor der T├╝r herumgestritten, aber sie haben derart herumgebr├╝llt, dass Nefer gar nicht umhingekommen ist, das Gespr├Ąch mitanzuh├Âren. Anschlie├čend sind die Beduinen und Takait zur dritte Oase aufgebrochen, Takait wohl nicht ganz freiwillig.“┬á
Das ist die gerechte Strafe daf├╝r, dass sie meine Zwiebel gestohlen hat, war Johanns erster spontaner Gedanke. Und was war das mit dem Kamel? Vielleicht war Takait sogar eine professionelle Diebin? Aber dann h├Ątte sie wahrscheinlich auch ihre Brieftaschen und goldenen Uhren entwendet.
Als er in das sorgenvolle Gesicht seines Bruders sah, bereute Johann, was er soeben gedacht hatte. Diese Beduinen, die Takait verschleppt hatten, waren zweifelsohne die Karawanenf├╝hrer, diese brutalen Gesellen, die auf der ersten Oase die Bauern mit dem Gewehr bedroht hatten. Sein Bruder und er konnten es als zivilisierte Menschen eigentlich nicht verantworten, Takait in deren Gewalt zu lassen.
„Der Besuch dieser Spelunke war also doch kein v├Âlliger Fehlschlag“, sagte der Kaufmann und unterbrach damit Johanns Gedanken.
„Das stimmt“, erwiderte Peter, „aber nun sollten wir wirklich so schnell wie m├Âglich von hier verschwinden. Sonst holen wir die Beduinen niemals ein.“┬á
Johann sah sich nach Nefer um, da er sie fragen wollte, ob sie sich auch an den Vater erinnerte, aber diese war offenbar in die Wirtschaft zur├╝ckgeeilt. Wahrscheinlich durfte ihr Vater nicht wissen, auf welche Art und Weise sie sich ein Zubrot verdiente. Vielleicht war dies aber auch ein abgekartetes Spiel und es war der Wirt, der sie zu ihnen gesandt hatte? Johann beschloss, dass dies eigentlich v├Âllig gleichg├╝ltig war und er trottete noch immer vor sich hingr├╝belnd den beiden Reisegef├Ąhrten nach, die sich bereits auf den Weg zum Mietstall gemacht hatten.
 
Die dritte Oase
18. Die dritte Oase
Endlich erreichten die Br├╝der nach einem anstrengendem Ritt die dritte Oase und Peter verstand sofort, warum der Vater dieser vor den anderen den Vorzug gegeben hatte, so fasziniert wie er vom alten ├ägypten war: die Oase war die weitaus bev├Âlkerungsreichste der Sobek-Gruppe. Die Ansiedlung war von einer Mauer umgeben. Dahinter lag un├╝bersichtliche Ansammlung von verschachtelten H├Ąusern. Der alles ├╝berragende Tempel lie├č keinen Zweifel daran, wer hier die Macht aus├╝bte. Dies war sicherlich der Neith-Tempel, den Takait erw├Ąhnt hatte
Die drei Reisegef├Ąhrten machten Halt in der gr├Â├čten Karawanserei, die die Br├╝der bisher gesehen hatten.┬á Ein scharfer Gestank schlug ihnen entgegen, als sie den dazugeh├Ârigen Stall betraten, aber trotzdem schienen hier nicht mehr Reittiere abgestellt zu sein, als in den wesentlich kleineren Karawansereien der anderen Oasen. Peter z├Ąhlte nur ein gutes Dutzend Kamele und ein paar Pferde und Esel waren auch dabei.
Er fragte Saladin, woran es liegen mochte, das hier sowenig los war, aber der Kaufmann zuckte nur gedankenverloren mit den Schultern, sodass Peter bezweifelte, dass Saladin seine Frage ├╝berhaupt zur Kenntnis genommen hatte. Die Z├╝ge des Kaufmanns verh├Ąrteten sich und er verhielt den Schritt so pl├Âtzlich, dass Peter ein St├╝ck weiterging, bevor er ebenfalls stehen blieb.
Irgendetwas schien Saladin hochgradig zu beunruhigen, denn er stand einen Augenblick lang einfach so im Raum herum und starrte durch das Fenster zum Innenhof. Peter folgte seinem Blick und bemerkte drau├čen einen Mann, den er nicht hier anzutreffen vermutet hatte, n├Ąmlich den angeblich wenig reiselustigen Priester Menas aus Alexandria.
Peter stie├č Johann, der ebenfalls zuerst an Saladin vorbeigeschossen und dann wieder zur├╝ckgekehrt war, mit dem Ellbogen an und deutete in den Hof.
„Schau nur, wer dort drau├čen unter der Palme steht!“
„Menas!“, entfuhr es Johann. „Was zum Teufel treibt der denn hier?“
„Kennen Sie diesen Mann?“, fragte Saladin mit einer undefinierbaren Miene, aber der Blick, den er dann durch das Fenster warf war so finster wie eine Neumondnacht in der W├╝ste.
Einen Augenblick lang erwog Peter zu verneinen, um herauszufinden, was Saladin ├╝ber den Priester wusste, aber er war zu ersch├Âpft f├╝r ein derartiges Katz und Maus-Spiel.
„Ja, er war ein Freund meines Vaters“, h├Ârte er sich sch├Ąrfer sagen, als er beabsichtigt hatte, denn noch immer haderte er mit seinem Schicksal, dass der Vater in nicht nach ├ägypten mitgenommen hatte.
Der Kaufmann starrte einen Augenblick lang schweigend auf eines der im Stall angebundenen Kamele, an dem Peter nichts Ungew├Âhnliches entdecken konnte. Es roch genauso streng wie alle anderen Dromedare und war keines der Tiere, auf denen sie in die dritte Oase geritten waren.
„Tats├Ąchlich?“, fragte Saladin dann h├Ârbar konsterniert, aber seine Z├╝ge entspannten sich und er l├Ąchelte den Br├╝dern zu, wobei er seine wei├čen Z├Ąhne entbl├Â├čte. „Es erstaunt mich dies zu h├Âren, denn dieser alte Effendi war zwar fr├╝her ein h├Ąufiger Gast auf dieser Oase, aber das war vor der Zeit, als Ihr Vater nach ├ägypten gekommen ist.“
„Wie gut kennen Sie Priester Menas?“, wollte Johann wissen. „Wir wissen leider fast gar nichts ├╝ber ihn.“
„Ich kenne ihn nur vom Sehen“, beteuerte der Kaufmann mit einer etwas vorschnellen abwehrenden Geste, denn keiner der Br├╝der hatte vor, zu widersprechen, „aber das ist mehr als genug. Da Sie nun meine Dienste nicht mehr ben├Âtigen, kann ich mich guten Gewissens zur├╝ckziehen. Nat├╝rlich gew├Ąhrte ich Ihnen einen Preisnachlass, da ich Sie nun fr├╝her verlasse als vereinbart.“
Fast h├Ątte Peter ├╝ber diesen pl├Âtzlichen R├╝ckzieher gelacht, denn der eben noch so souver├Ąne Kaufmann machte einen geradezu panischen Eindruck, aber im gleichen Augenblick fragte Peter sich band, ob der Priester vielleicht gef├Ąhrlicher war als er aussah.
Andererseits hatte sich Saladin als nicht besonders zuverl├Ąssige Informationsquelle erwiese. So hatte er offenbar ma├člos ├╝bertrieben, als er behauptet hatte, dass er den Vater kannte. Vielleicht verhielt es sich mit dem Priester ebenso und Saladin kannte ihn wirklich nur vom H├Ârensagen. Peter wollte lieber gar nicht wissen, was der Kaufmann und seine Kumpanen von ihm dachten, denn offenbar waren diese Orientalen mit einer ├╝berbordenden Phantasie gesegnet, wie sich daran gezeigt hatte, dass sie ihnen zugetraut hatten, die Mumie wiederbeleben zu wollten.┬á
Peter versuchte sich selbst davon zu ├╝berzeugen, dass ihnen Menas auf dieser Oase wahrscheinlich bessere Dienste erweisen konnte als Saladin, aber noch immer nagte der Zweifel an der Integrit├Ąt des Priesters an ihm.
„Ich finde, wir sollten das Angebot annehmen“, sagte Johann auf Deutsch und Peter kramte seine B├Ârse aus seinem B├╝ndel heraus, wenn auch noch immer mit einem unguten Gef├╝hl.┬á
Um gen├╝gend Spielraum f├╝r das landes├╝bliche Feilschen zu behalten, ├╝berreichte Peter – ohne etwas zu sagen - dem Kaufmann nur wenig mehr als die H├Ąlfte der vereinbarten Summe.
Saladin griff – ohne Nachzuz├Ąhlen - nach dem Geld in Peters ausgestreckter Hand und lie├č die M├╝nzen klirrend in seinen Beutel fallen. Dann bedankte er sich etwas mechanisch, hob eine beringte Hand zum Gru├č und schon war er verschwunden.
„Der scheint ja einen ziemlichen Graus vor der Begegnung mit den Priester zu haben“, meinte Johann, „schade dass er nicht noch einen Augenblick gewartet hat. Jetzt m├╝ssen wir ihn so gut wie wir k├Ânnen beschreiben! Ich m├Âchte doch zu gern wissen, was Priester Menas uns ├╝ber diesen zwielichtigen Gesellen zu berichten hat.“
Peter und Johann eilten in den Innenhof und schafften es nur mit M├╝he, den Priester einzuholen, der mittlerweile im Begriff war, den Hof zu verlassen, in dem au├čer ihm selbst und den Br├╝dern die einzigen Lebewesen einige Katzen waren, die sich Schatten vor sich hind├Âsten.
Als Priester Menas die Br├╝der sah, schaute er mindestens so erstaunt drein wie diese es gewesen war, als sie ihn zuerst erblickt hatten.
„Wo kommen ihr denn her?“, fragte er, ohne die beiden zu begr├╝├čen. „Ich dachte, eure Karawane kommt erst in einer Woche an?“
„Das k├Ânnten wir Sie genauso gut fragen“, erwiderte Peter, „hatten Sie nicht beteuert, dass Sie um keinen Preis der Welt die Sobek-Oasen betreten wollen?“
Der alte Priester kratzte sich verlegen am Bart und er schaute nachdenklich auf den staubigen Boden.
„Ich habe nach eurer Abreise ein schlechtes Gewissen bekommen, dass wenig hilfreich war und dann habe ich ein dem Heft eures Vaters etwas entziffern k├Ânnen, was ich euch mitteilen wollte … “
„Was?“, fragten Peter und Johann zugleich.
„Dass die Mumie aus dem Neith-Tempel der dritten Sobek-Oase stammt“, erkl├Ąrte der Priester mit bedeutungsvoller Miene. „Daher habe ich mir einen Ruck gegeben und bin euch mit der Karawane, die die Route in umgekehrter Richtung zur├╝cklegt entgegengereist.“ Er wischte sich den Schwei├č mit dem ├ärmel aus der Stirn. „Jetzt sollten wir aber schleunigst diese grauenhafte Karawanserei verlassen. Ich fragte mich, ob die St├Ąlle in diesem Jahr ├╝berhaupt schon einmal ausgemistet worden sind. Wir suchen doch besser woanders ein schattiges Pl├Ątzchen und dann erz├Ąhlt ihr endlich, wie es euch ergangen ist.“
Priester Menas f├╝hrte die Br├╝der zu einer Schenke, die sich – wahrscheinlich nicht zuf├Ąllig – in einem Eckhaus gegen├╝ber der Karawanserei befand. Stimmen, klappernde T├Âpfe und der Klang exotischer Musikinstrumente kam durch die ge├Âffneten Fenster und durch die Schwingt├╝r konnte man erkennen, dass der helle, saubere Schankraum und die ordentlich gekleideten G├Ąsten in einem scharfen Kontrast zu der Spelunke standen, in der die Br├╝der unterwegs eingekehrt waren, aber auch diese Schenke war innen aufwendiger dekoriert als man von au├čen vermutete: Auf die leicht gew├Âlbte Decke waren Weinranken mit blauen Trauben aufgemalt und um die W├Ąnde liefen Hieroglyphenb├Ąnder und Friese aus Stierk├Âpfen – die man in der Antike Bukranien genannt hatte - im Wechsel mit Rosetten.
„Ich habe vorab eine Frage“, sagte Johann, als sie sich an der Theke niedergelassen hatte und der Wirt jedem einen Becher Bier serviert hatte. „Kennen Sie einen ├Ągyptischen Kaufmann, der sich Saladin nennen l├Ąsst?“
Der alte Priester sch├╝ttelte lachend den Kopf.
„Ich kenne nur den ber├╝hmten Saladin aus den Kreuzz├╝gen“, erkl├Ąrte er, „und der war Kurde und kein ├ägypter.“
Peter f├╝hrte seinen Becher an den Mund und wollte schon trinken, als der Priester ihm in den Arm fiel.
„Vorsicht, das Bier ist unglaublich stark!“, warnte er in einem eindringlichen Tonfall, „das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, aber ihr habt mich ja die ganze Zeit mit Fragen gel├Âchert“
„Der Kaufmann hat uns auch schon vor dem ├Ągyptischen Bier gewarnt“, meinte Johann und beschrieb anschlie├čend Saladin mit knappen Worten, aber Priester Menas gab weiterhin vor, diesen nicht zu kennen.
„Diese Beschreibung passt auf jeden zweiten ├ägypter“, brummte er ziemlich unwirsch, aber Peter glaubte ihm kein Wort und auch Johanns Miene verriet seine Skepsis.
„Aber dieser Kaufmann kannte Sie“, bohrte Peter daher nach. „Sie h├Ątten sehen sollen, wie er Sie durch das Stallfenster angestarrt hat.“
„Ich bin eben eine auff├Ąllige Erscheinung!“, erkl├Ąrte Priester Menas nicht ohne Selbstgef├Ąlligkeit.
Peter war noch immer der ├ťberzeugung, dass der alte Mann etwas vor ihm verheimlichte, aber er konnte nicht weiter darauf beharren, ohne unh├Âflich zu werden. Also erz├Ąhlte er dem Priester, was ihnen in der Zwischenzeit widerfahren war.
„Das kann ich mir gar nicht vorstellen“, meinte der Priester als Peter geendet hatte. „Auf┬á mich hat Takait einen sehr guten Eindruck gemacht.“
„Ja, wenn man das den Schurken immer ansehen k├Ânnte“, erwiderte Johann und Peter warf ihm einen tadelnden Blick zu, denn er fand, dass sich der Bruder etwas in der Wortwahl vergriffen hatte.
„Wir m├╝ssen versuchen, Takait aus der Hand der finsteren Beduinen zu befreien“, sagte er daher zu Priester Menas. „Ich schlage vor, dass wir morgen fr├╝h im Tempel vorsprechen. Erstens k├Ânnen wir vielleicht n├Ąheres ├╝ber die Mumie erfahren und zweitens haben sie vielleicht etwas von Takait geh├Ârt. Schlie├člich ist sie eine Tempelt├Ąnzerin.“
„Wenn sie entf├╝hrt wurde, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man im Neith-Tempel davon geh├Ârt hat“, wandte der Priester ein, „au├čerdem betrete ich nur unter einer Bedingung diesen Tempel und die ist, dass einer von euch beiden drau├čen bleibt. Ich traue diesen heidnischen G├Âtzenanbetern nicht ├╝ber den Weg. Falls wir nicht zur├╝ckkommen, muss jemand von uns drau├čen in Freiheit sein, der sich um Hilfe bem├╝hen kann.“
„Johann begleitet dich“, erkl├Ąrte Peter ultimativ, denn Priester Menas hatte Recht: Es war wahrscheinlicher Takait auf dem Marktplatz zu treffen als im Tempel und Peter hegte den Verdacht sein Bruder k├Ânne es ihm verschweiten, falls er sie sehen sollte.
Der alte Mann schaute verblüfft von seinem Becher hoch und Johann verzog das Gesicht, aber er widersprach nicht. Peter hoffte, dass die Neugier seines Bruders seine Ängstlichkeit überwog.    
*
Am n├Ąchsten Morgen fehlte noch immer jede Spur von Saladin, was hie├č, dass er nicht in der Karawanserei ├╝bernachtet hatte, sondern augenblicklich zur Karawane zur├╝ckgekehrt war. Was hatte er zu verbergen, dass er vor dem Priester gefl├╝chtet war und warum hielt dieser ganz offensichtlich Informationen ├╝ber den zwielichtigen Kaufmann zur├╝ck?
Diese Fragen besch├Ąftigten Peter, als sie die Karawanserei verlie├čen. Die Menschen, die ihnen entgegen kamen wichen vor ihnen aus und Peter konnte es ihnen nicht verdenken, so abgerissen wie sein Bruder und er aussahen. Noch immer waren sie in die T├╝cher verh├╝llt, die sie in der W├╝ste getragen hatte. Mittlerweile waren diese verdreckt und verschwitzt. Peter hoffte, nicht vom erstbesten Beamten oder wer sonst hier der Vollstrecker des k├Âniglichen Willens sein mochte – festgenommen zu werden.
Obwohl ihnen der Tempel schon aus der Ferne entgegenleuchtete, verliefen sich die Reisegef├Ąhrten mehrfach im Gewirr der Gassen. Immer wieder endete ein Weg pl├Âtzlich in einem Innenhof. Es gab enge Pfade, die sie – aus Angst vor R├Ąubern – nicht zu betreten wagten und H├Âfe, auf denen man sie feindselig anstarrte. Ein hei├čer Wind kam aus der W├╝ste und Peter realisierte, dass der Weg l├Ąnger war als es den Anschein gehabt hatte.
Endlich sahen sie ihr Ziel in der N├Ąhe vor sich aufragen. Sie musste nur noch den Platz ├╝berqueren, auf dem einige H├Ąndler ihre wenige Buden aufgeschlagen hatten, aber es fehlten St├Ąnde mit Lebensmitteln. Die Verk├Ąufer priesen lautstark billige Pilgerandenken aus Terrakotta an. Es waren ├╝berwiegend Statuetten von Nilpferden, Katzen, aber auch einige G├Âtterbilder. Peter erkannte den mumiengestaltigen Osiris und Isis mit dem Horusknaben. Die bewaffnete Frau mit dem strengen Blick war ihm unbekannt, aber er vermutete, dass es sich um die G├Âttin Neith handelte, die hier besonders verehrt wurde. Als sie die St├Ąnde passierte wunderte es Peter nicht, dass sie keiner der Marktschreier bel├Ąstigte, denn sie sahen sicherlich nicht nach potentiellen Kunden aus.
Trotz des ├Ąrmlichen Marktes lungerten Hunderte von M├╝├čigg├Ąngern vor dem Tempel herum, was Peter ziemlich erstaunte. Warum wollten so viele Menschen an diesem Morgen der G├Âttin Neith ihre Reverenz erweisen? War dies ein Festtag der G├Âttin oder war die dritte Oase ein alt├Ągyptisches Lourdes? Offensichtlich waren diese ├ägypter ein sehr gl├Ąubiges Volk.
„Ich habe Hunger“, sagte Johann und riss damit Peter aus seinen Gedanken. „Lass uns etwas Essbares kaufen, bevor ihr in den Tempel geht.“
Fast h├Ątte Peter zu seinem Bruder gesagt, er solle sich nicht so anstellen, aber, wenn er ganz ehrlich war, so musste er zugeben, dass er selbst nichts gegen einen Imbiss einzuwenden h├Ątte, denn das Fr├╝hst├╝ck in der Karawanserei war mehr als spartanisch gewesen.
„Von mir aus“, erwiderte er daher, „aber mir scheint, hier werden nur Pilgerandenken und Skarab├Ąen verkauft.“
Der Priester sch├╝ttelte mit gerunzelter Stirn den Kopf.
„Komisch, sonst wimmelt es hier nur so vor Imbissverk├Ąufern, zumal man in diesen Tempeln meist sehr lang auf eine Audienz warten muss.“
W├Ąhrend sich die drei Fremden ihren Weg durch die Menge bahnten, fragte sich Peter, woher der Priester dies wusste. In Alexandria hatte er den Eindruck gehabt, dass der alte Priester eine Abneigung gegen heidnische Kulte hegte. Aber andererseits, konnte er diese Gepflogenheiten auch zuf├Ąllig bei einem Besuch der Oasen mitbekommen haben.
Ein fliegender H├Ąndler, der getrocknetes Fleisch anbot kreuzte ihren Weg. Peter sah ihn an. Dann hob drei Finger und deutete auf die Ware.
Der H├Ąndler, ein braungebrannter Junge mit – bis auf eine lange Locke - kahl geschorenem Sch├Ądel sagte etwas.
*
„Das ist zuviel!“, rief der Priester emp├Ârt aus. „Nur, weil wir Fremde sind, lassen wir uns nicht derart betr├╝gen!“
Im gleichen Augenblick wusste er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er z├Ąhlte innerlich bis acht. Dann hatte Peter die volle Tragweite seiner Worte erkannt.
„Sie haben verstanden, was er gesagt hat!“, rief er ver├Ąrgert aus. „Sie sprechen wahrscheinlich sogar ihre Sprache! Was verschweigen Sie uns noch alles?“
Der Priester war nicht bereit, sein Geheimnis preiszugeben. Daher versuchte er es mit einem Ablenkungsman├Âver.
„Wir sollten uns beeilen! Vielleicht nimmt die Mumie es ├╝bel, wenn wir sie nicht sofort in ihre Gruft zur├╝ckbringen und es und es kommt auf jede Stunde an!“
Johann schnappte h├Ârbar nach Luft. Zorn funkelte in seinen Augen und der Priester wunderte sich, denn so hatte er den ruhigen Johann noch nie erlebt.
„Ich dachte, Sie waren der Freund unseres Vaters. Warum wollten Sie uns nicht begleiten, wo Sie doch h├Ątten f├╝r uns dolmetschen k├Ânnen? Wenn Sie mitgekommen w├Ąren, dann h├Ątten wir uns Takait nicht aufgehalst!“
Dem Priester war klar, dass er die Br├╝der nicht l├Ąnger hinhalten konnte, denn ├╝ber kurz oder lang w├╝rden sie auch so die Wahrheit erfahren und es war sicher besser, wenn sie sie aus seinem eigenen Munde h├Ârten.
„Bei einem meiner Aufenthalte auf den Oasen“, begann er. Dann griff er nach seinem Weinschlauch, den er in der Schenke aufgef├╝llt hatte und genehmigte sich einen gro├čen Schluck, denn was er sagen musste, war ihm ├Ąu├čerst peinlich, „habe ich eine Witwe kennen gelernt.“
Die Br├╝der starrten ihn fassungslos an und der Priester f├╝hlte Unmut in sich aufsteigen. Trauten sie ihm dies nicht zu?
„Ja, meint ihr, ich w├Ąre nicht auch einmal jung gewesen?“┬á
„Jetzt machen Sie es nicht so spannend“, sagte Johann lachend, w├Ąhrend sein Bruder den Priester mit weit ge├Âffneten Augen anstarrte. „Sie haben diese Witwe mit einem Kind sitzen lassen? Und jetzt haben Sie Angst vor ihren Br├╝dern?“
Priester Menas schluckte und leckte sich dann mit der Zunge ├╝ber die Lippen.
„Schlimmer noch, ich habe sie geheiratet“, gab er widerwillig zu, „koptische Priester d├╝rfen ja in den Ehestand eintreten.“
Nun schmunzelte auch Peter und der Priester ├Ąrgerte ├╝ber die allgemeine Heiterkeit, die sein Gest├Ąndnis hervorgerufen hatte.
„Sie hat sich aber schnell in einen richtigen Hausdrachen verwandelt. Also habe ich mich von ihr getrennt. Das ist nach alt├Ągyptischer Sitte ohne weiteres m├Âglich, aber der Frau steht ein Drittel des Verm├Âgens ihres Ehemannes zu.“
*
„Und das haben Sie ihr nicht gegeben?“, fragte Peter vorsichtig nach, dessen Phantasie bei dem Versuch versagte, sich einen verheirateten Priester Menas vorzustellen.
„Ich habe vielleicht meiner Frau gegen├╝ber meine Situation etwas zu rosig dargestellt, damals, als wie uns kennenlernten.“ Der Priester stockte. Sein Blick wanderte von Peter zu Johann. „und dann hat sie mir nicht geglaubt, wie niedrig das Einkommen eines koptischen Geistlichen ist. Ich besitze als leider kein Verm├Âgen.“┬á┬á
„Aber Sie hatten doch nicht vorgehabt f├╝r immer auf dieser Oase zu bleiben?“, fragte Peter, der bezweifelte, dass der Priester diese Eheschlie├čung ernst genommen hatte. „und nach Alexandria h├Ątten sie unm├Âglich eine heidnische Ehefrau mitbringen k├Ânnen!“
Der Priester machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Sie wusste, dass ich fr├╝her regelm├Ą├čig die Oasen besuchte. Dann habe ich immer bei ihr gewohnt und, wenn sie nicht so eine Xanthippe gewesen w├Ąre, h├Ątte dies auch so weitergehen k├Ânnen.“
Peter bezweifelte dies, aber er sagte sich, dass ihm dies nichts anging. Au├čerdem hatte der Priester nicht Unrecht gehabt, als er gesagt hatte, dass sie keine Zeit zu verschwenden hatten. Sie mussten jetzt pragmatisch sein.
„Wir m├╝ssen also nicht nachfrage, ob einer der Neith-Priester Arabisch spricht, sondern Sie k├Ânnen f├╝r Johann dolmetschen!“
Der Priester sch├╝ttelte bed├Ąchtig den Kopf und kratzte sich dabei an seinem grauen Bart.
„Mein ├ägyptisch ist ziemlich schlecht, aber daf├╝r wird es vielleicht gerade noch reichen.“
„Ich schaue mich solange nach Takait um“, sagte Peter mehr zu sich selbst.
„Aber sie ist doch – wenn ich das richtig verstanden habe - die Gefangene der Karawanenf├╝hrer. Sie kann nicht selbst entscheiden, wohin sie geht“, wandte Menas vorsichtig ein.
„Wenn die Nomaden sie nach Zau verschleppt haben, dann doch bestimmt nur, damit sie im Tempel der Neith f├╝r sie spionieren, l├╝gen und stehlen kann“, entgegnete Johann in einem ziemlich boshaften Tonfall.
„Red nicht so von ihr!“, entfuhr es Peter und er schaute den alten Priester aufmunternd an. „Jetzt sollten wir uns aber endlich auf den Weg machen.“
„Ja, wir haben wirklich lange genug in der Sonne herumgestanden und geredet“, stimmte Johann zu, „aber willst du nicht lieber … “
„Nein!“, unterbrach Peter, „du bist es, der von Alptr├Ąumen gequ├Ąlt wurde!“
Johann nickte, aber als er dem Priester mit einem Schritt Abstand folgte, erinnerte er seinen Bruder an ein Opferlamm.  
Vor dem Portal standen Standbilder einer Frau mit Pfeil und Bogen. Also waren die Statuetten, die die H├Ąndler verkauften wirklich die Abbilder der G├Âttin Neith, aber wenn Peter ganz ehrlich war, so war ihm dies mittlerweile v├Âllig gleichg├╝ltig.┬á
 
Die sch├Âne Frau
19. Die sch├Âne Frau
Fensterl├Ąden wurden ger├Ąuschvoll geschlossen und aus dem Inneren eines Hauses drang Kindergeschrei. Ein Hund bellte und verstummte wieder. Die Sonne hatte ihren h├Âchsten Stand erreicht und ein hei├čer Wind trieb vertrocknete Palmbl├Ątter ├╝ber den Platz. So trostlos hatte er sich ├ägypten nicht vorgestellt. Der Neith-Tempel war zugegebenerma├čen ziemlich eindrucksvoll, wenigstens soweit Peter dies von au├čen beurteilen konnte, aber momentan h├Ątte er ihn gegen einen einzigen ordentlichen Baum eingetauscht, unter dessen Krone er sich h├Ątte niederlassen k├Ânnen.
Die Parkbank haben wohl erst die Engl├Ąnder des letzten Jahrhunderts entdeckt, dachte er schlecht gelaunt als er sich im Schatten eines Hauses auf den staubigen Boden setzte. Aber ohne Vegetation gab es keine Parks: Ein paar verkr├╝ppelte Berberitzen klammern sich hier und da an den ausged├Ârrten Boden. Sonst war die dritte Oase v├Âllig kahl.
Farbenfrohe V├Âgel jubilierten auf dem Dach des Nachbarhauses und Peter stellte sich die fremden L├Ąnder vor, aus denen sie kommen mochten, denn sicherlich waren sie in dieser kargen Ein├Âde nur auf Durchreise. Das einzige was Peter auf diesem Platz wirklich gefiel, waren die ab und zu vorbeikommenden M├Ądchen. Sie bewegten sich mit einer unvergleichlichen Anmut und Grazie, die durch ihre Tracht noch unterstrichen wurde: Die meisten von ihnen trugen ├╝ber d├╝nnen, stark plissierten wei├čen Tr├Ągerkleidern wei├če, fast durchsichtige Umh├Ąnge, die sie unter der Brust geknoteten hatten. Breite Kr├Ągen aus blauen Terrakottaperlen, Armreife und Ohrringe aus Gold, sowie ein Lotosbl├╝ten im Haar vervollst├Ąndigten diese Aufmachung.
Peter, der sich m├╝hsam beherrschen musste, um sie nicht anzustarren beobachtete sie aus den Augenwinkeln, aber leider leerte sich der Platz zunehmend. Die M├╝├čigg├Ąnger suchten den Schutz ihrer H├Ąuser und Peter musste allein unter der gl├╝henden Sonne warten, die alles vor seinen Augen flimmern lie├č! Er ├Ąrgerte sich ├╝ber sich selbst, dass er vorgeschlagen hatte, dass Johann Menas begleitet sollte.┬á
Einige junge M├Ąnner verlie├čen den Tempel. Sie deuteten auf Peter in seiner sch├Ąbigen Beduinenkluft und lachten. Peter verfluchte die alt├Ągytische Tracht der M├Ąnner, denn er h├Ątte es vorgezogen, wenn man ihn f├╝r einen Einheimischen gehalten h├Ątte. Wie aber sollte er es vermeiden Aufsehen zu erregen, wenn die Einheimischen hier halb nackt herumliefen? Zwar trugen einige reich aussehende M├Ąnner lange Gew├Ąnder, aber diese waren fast durchsichtig, h├Ątten also nicht verbergen k├Ânnen, dass der hellh├Ąutige und hoch gewachsene Peter ein Ausl├Ąnder war.
Seine finsteren Gedanken wurden unterbrochen vom festen Schritt zahlreicher F├╝├če. Soldaten marschierten vorbei und Peter staunte ├╝ber diesen Anblick, denn die Existenz einer ├Ągyptischen Armee h├Ątte er nicht f├╝r m├Âglich gehalten, auch wenn diese bestimmt sehr klein war. Ohne nach rechts oder nach links zu schauen folgten die Soldaten ihrem Offizier, der hervorgehoben war durch die schweren Ketten aus Gold. Peter wusste aus seinen B├╝chern, dass diese in ├ägypten das „Gold der Tapferen“ hie├čen.
Peter wurde immer ungeduldiger, denn es wurde immer deutlicher, dass auf dieser Oase alles andere als „normale“ Zust├Ąnde herrschten. Wann kamen der Bruder und Menas endlich wieder zur├╝ck? Vielleicht schwebte er in Lebensgefahr, weil man der G├Âttin Neith Menschenopfer darbrachte? Am Morgen hatte Peter noch die Vorsicht des koptischen Priesters ├╝ber ├╝bertrieben gehalten, als dieser daf├╝r pl├Ądiert hatte, dass einer von ihnen drau├čen warten sollte, aber mittlerweile war Peter besorgt um den Bruder, den er so leichtfertig in den Tempel geschickt hatte.
Von Zeit zu Zeit verlie├čen Besucher den Neith-Tempel - wie vor einigen Minuten die unversch├Ąmten jungen Leute, die Peter ausgelacht hatten. Dies beruhigte ihn etwas, obwohl er bedauerte, dass er nicht nachgez├Ąhlt hatte, wie viele hineingegangen waren und wie viele wieder herauskamen. Unter den Tempelbesuchern waren auch drei Nomaden gewesen, aber Peter hatte die Gesichter der vermummten Gestalten nicht erkennen k├Ânnen. Er fragte sich warum alle so sorgenvoll dreinblickten. Konnte es sein, dass sein Anblick sie beunruhigte? Aber, nein, so gef├Ąhrlich sah er bestimmt nicht aus. Wahrscheinlich hatte er ihren Gesichtsausdruck falsch interpretiert, weil er selbst besorgt war. Peter biss in das Fladenbrot, das er einem der letzten fliegenden H├Ąndler abgekauft hatte, die noch vor einer halben Stunde ihre Ware angepriesen hatten. Es war noch trockener als es aussah. Peter kaute solange gedankenverloren darauf herum, bis es s├╝├č schmeckte. Dann w├╝rgte er es m├╝hsam herunter.
Eine weitere Einheit von Soldaten ├╝berquerte den Platz, sie wirkten noch grimmiger als die des ersten Trupps. Bei ihrem Anblick stoben die letzten M├╝├čigg├Ąnger auseinander, die sich noch auf dem Vorplatz des Tempels aufgehalten hatten. Wovor hatten sie solche Angst? Vielleicht wurde man hier auf offener Stra├če zwangsverpflichtet, wie bei den alten Preu├čen? Peter fragte sich, ob er zu leichtsinnig gewesen war. Wenn weitere Soldaten vorbeiziehen sollten, w├╝rde auch er sich verstecken.
Als die Soldaten in einer Seitenstra├če verschwunden waren, lie├č sich ein Bettler am anderen Ende des Platzes nieder, der wohl abseits gewartet hatte, um nicht gesehen zu werden. Wieder kamen einige M├Ąnner aus dem Portal des Tempels, aber niemand gab dem Bettler etwas. Peter erwog, sich seiner zu erbarmen, als eine schlanke Frau um die Ecke bog. Sie besa├č eine auffallende ├ähnlichkeit mit Takait und Peter bewunderte ihre Sch├Ânheit. Er fragte sich, ob es vielleicht ihre Schwester sein konnte.
Die Frau schlenderte so nah an ihm vorbei, dass Peter ihr bet├Ârendes Parf├╝m riechen konnte. Dabei warf sie ihm einen langen, sehnsuchtsvollen Blick zu, aber kaum, dass sich ihre Augen trafen, blickte sie wieder z├╝chtig zu Boden. Die Reifen an ihren Armen klimperten leise, w├Ąhrend sie sich anmutig an Peter vorbei bewegte. Peter sah ihr nach und er fand, dass sie einen sehr sch├Ânen R├╝cken hatte.
Eine alte ├ägypterin lehnte sich grinsend aus dem Fenster und machte einen l├Ąsterlichen Kommentar, aber Peter war mittlerweile egal, was man von ihm dachte. Er schaute unverhohlen der Frau nach und er ├Ąrgerte sich ├╝ber sich selbst, dass er sie nicht angesprochen hatte, als er die Gelegenheit dazu hatte. Vielleicht kannte sie Takait?
Ganz unerwartet blickte sie ├╝ber ihre Schulter zur├╝ck. Sie hatte wundersch├Âne mandelf├Ârmige Augen, die von schwarzen Linien umrahmt und betont wurden. Ein leichtes L├Ącheln huschte ├╝ber ihr Gesicht. Peter erwiderte das L├Ącheln. Die Frau drehte sich wieder um und setzte mit schwebend leichten Schritten ihren Weg fort. Peter erhob sich vom Boden und schlagartig war die Tr├Ągheit verflogen, in die ihn die Hitze versetzt hatte.
Er hatte den halben Platz ├╝berquert, bevor er realisierte, was er tat: Er folgte der jungen Frau. Warum auch nicht, dachte er. Hier auf dem Platz vers├Ąume ich bestimmt nichts. Bestenfalls w├╝rde er sich einen Sonnenstich einfangen und schlimmstenfalls w├╝rde man ihn in die Armee zwangsrekrutieren. Wahrscheinlich mussten die anderen noch mehrere Stunden lang im Tempel warten - schlie├člich hatte der Priester eine diesbez├╝gliche Andeutung gemacht – und daher war er gut beraten den Platz zu verlassen, wo er geradezu auf dem Pr├Ąsentierteller sa├č.
Die junge Frau schlenderte langsam durch eine enge Gasse, die in der mitt├Ąglichen Hitze wie ausgestorben war. Der Frau schien das Wetter aber nichts auszumachen, so gem├Ąchlich, wie sie ging. An der n├Ąchsten Biegung des Weges drehte sie sich um und wieder traf ihr Blick den von Peter. Sie senkte die Lider und ging weiter. Der Wind drehte sich und trug den modrigen Geruch des Tempelsees ├╝ber die Oase.
Wie gebannt folgte Peter der Frau noch mehrer H├Ąuserblocks weiter, bis er ein Haus erreicht hatte, das aussah wie alle H├Ąuser der Sobek-Oasen – wei├č get├╝nchte W├Ąnde und kleine Fenster -┬á aber es musste ein besonderes Haus sein, denn die junge Frau betrat es.
Sie lie├č die einfache Holzt├╝r einen Spalte breit offen stehen. Wenn dies keine Einladung war, ihr zu folgen? Peter lie├č sich nicht zweimal bitten. Er stie├č die T├╝r auf und betrat das Haus. Dunkel war es drinnen. Peter f├╝hlte den gestampften Lehm unter seinen F├╝├čen, aber er sah nichts. Ehe seine Augen sich an die Lichtverh├Ąltnisse anpassen konnten, versp├╝rte er einen scharfen Schmerz hinter dem rechten Ohr und ihm wurde schwarz vor Augen. „Ich h├Ątte doch lieber auf dem Marktplatz bleiben sollen“, war sein letzter Gedanke bevor er in die Dunkelheit abtauchte.┬á┬á
*
Johann f├╝hlte sich wie ausgelaugt, als er am fortgeschrittenen Abend den Audienzhof des Tempels zusammen mit Priester Menas verlie├č. Die Sonne hing schon tief am Himmel, und die H├Ąuser warfen lange Schatten, was ihnen eine bedrohliche Stimmung erzeugte. ┬á
„Das war eine ziemliche Zeitverschwendung!“, sagte er zu dem Kopten.
„Das kann man wohl sagen“, erwiderte dieser grimmig.
Zuerst hatte man sie stundenlang in einem Innenhof warten lassen. Johann wunderte sich noch immer dar├╝ber, dass so unglaublich viele Menschen im Tempel Rat und Beistand gesucht hatten. Als man Johann und Menas dann endlich vorgelassen hatte, waren die Priester schrecklich kurz angebunden gewesen. Sie hatten ultimativ erkl├Ąrt, dass sie keine Ausk├╝nfte ├╝ber Gr├Ąber geben w├╝rden. Den Namen Bernhard Berggruen hatten sie angeblich noch niemals in ihren Leben vernommen, was durchaus m├Âglich war. Aber der Gipfel war gewesen, dass die Priester behauptet hatten, dass sich so h├Ąufig junge T├Ąnzerinnen bei ihnen vorstellten, dass sie sich unm├Âglich an alle Namen erinnern k├Ânnten. Das war nat├╝rlich eine L├╝ge gewesen, aber Johann hatte den Priestern schlie├člich nicht ins Gesicht sagen k├Ânnen, dass er ihnen nicht glaubte. Au├čerdem war alles viel zu schnell gegangen: Kaum hatte Johann seine drei Fragen gestellt, war die Audienz schon wieder beendet gewesen.
Johann h├Ątte l├╝gen m├╝ssen, wenn er behauptet h├Ątte, dass ihn dieser Misserfolg ├╝berraschte, denn er hatte sich nie viel von diesem Tempelbesuch versprochen. Es war der Bruder, der diese Idee gehabt hatte, nur seltsam, dass er dann freiwillig drau├čen geblieben war.
Ein Seitenblick auf das ger├Âtete Gesicht des alten Priesters ├╝berzeugte Johann davon, dass dieser die schnelle Abfertigung offenbar ziemlich pers├Ânlich genommen hatte. Im Tempel hatte er feststellen m├╝ssen, dass das ├ägyptisch seines Reisegef├Ąhrten ziemlich schlecht war und er fragte sich mittlerweile, wie dieser sich mit seiner Frau verst├Ąndigt hatte. Kein Wunder, dass die Ehe gescheitert war!
„Wo lebt Ihre Frau eigentlich?“, wollt Johann wissen, der es noch immer nicht fassen konnte, dass der fromme koptische Priester eine heidnische Frau geheiratet hatte
Der Priester machte ein verdrie├čliches Gesicht.
„Auf der zweiten Oase.“
Johann begriff augenblicklich, warum der Priester sich der Karawane angeschlossen hatte, die nicht zuerst die erste und zweite Oase bediente.
„Haben Sie Kinder?“
„Ja, eine Tochter“, antwortete er in einem Tonfall, in dem man ein Verbrechen gesteht.
Trat er dem alten Mann zu nahe, wenn er nach deren Alter fragte? Johann wagte es nicht, diese Frage zu stellen, zumal unwillk├╝rlich vor seinem inneren Auge das h├╝bsche Gesicht Takaits aufstieg. Konnte es sein ….? Nein, das h├Ątte er ihnen nicht verschwiegen!
Und wenn Menas doch Takaits Vater war? War er dann genauso wenig vertrauensw├╝rdig wie seine Tochter.
Johann sah den alten Mann forschend von der Seite an und dieser schaute unbefangen zur├╝ck. Johann rief sich ins Ged├Ąchtnis, dass Hunderte von Familien auf den Sobek-Oasen lebten.
„Die Sache mit den Granat├Ąpfelkernen habe ich nicht verstanden, die du vorhin erz├Ąhlt hast!“, brummte der Priester und gab damit dem Gespr├Ąch eine andere Wende.
„Peter hat aus Versehen eine streunende Katze getreten und Takait meinte, er m├╝sse als Gegenmittel Grantat├Ąpfelkerne essen. Sonst w├╝rden ihn irgendwelche G├Âtter als Frevler bestrafen.“
„Warum hat Takait so eine haneb├╝chene Geschichte erfunden?“, entfuhr es Menas, „kein Wunder, dass uns diese G├Âtzenanbeter ausgelacht haben!“
„Wahrscheinlich wollte sie sich unersetzlich machen, damit wir sie mitnehmen“, sagte Johann etwas halbherzig, denn gleich w├╝rden sie auf Peter sto├čen und Johann wollte sich nicht wieder tadeln lassen, weil er schlecht ├╝ber Takait sprach.
„Dann w├Ąre sie wohl kaum heimlich mitten in der Nacht mit eurem Oasenkrokus verschwunden“, wandte Menas irritiert ein.
„Wem sagen Sie das! Ich werde aus Takait einfach nicht schlau“, gab Johann zu und┬á zuckte resigniert mit den Schultern.
Einen Augenblick lang herrschte betretenes Schweigen, zumal ihnen einige Priester entgegen kamen und sich Johann ganz sicher war, dass irgendwer im Neith-Tempel Englisch sprach und ihre Gespr├Ąche belauschte.
„Es ist ein Unversch├Ąmtheit, dass man uns in einem Hof abgefertigt hat“, beschwerte sich Johann nun schon zum mindestens f├╝nften Mal und der alte Menas verdrehte enerviert die Augen.┬á
„Das Betreten eines heidnischen Tempels ist nur dem Pharao – den es bekanntlich nicht mehr gibt - und den allerh├Âchsten Priestern gestattet“, erkl├Ąrte er mit einem gereizten Gesichtsausdruck, „aber das habe ich dir doch vorhin schon mehrfach gesagt.“
Endlich n├Ąherten sie sich der Tempelpforte und Menas beschleunigte seine Schritte.
„Und warum hat uns Takait dann im Tempel der ersten Oase empfangen?“, fragte Johann nach, der langsam niemandem mehr traute und am allerwenigsten Takait.
„Ich wei├č auch nicht, was dort los war“, sagte Menas als sie endlich das Hauptportal des Tempels durchschritten. „Wahrscheinlich hat Takait geistesgegenw├Ąrtig die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und hat - als die Priester vor dem Sphinx geflohen waren - im Tempel die Hausherrin gespielt. Sie war wahrscheinlich gar nicht berechtigt euch zu empfangen.“
Johann frage sich, wie dies wohl vonstatten gegangen war, aber eigentlich war dies auch egal, denn sie sollten sich auf ihre derzeitigen Probleme konzentrieren und das dringlichste davon war, dass Peter nicht vor dem Portal wartete. Johann lie├č seinen Blick ├╝ber den leeren Platz schweifen, aber er konnte den Bruder nirgendwo sehen.
„Hat┬á Peter nicht gesagt, dass er auf uns warten will?“, dacht er laut.
Priester Menas machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Er konnte nicht ahnen, dass wir solange im Tempel warten mussten. Es wird ihm zu langweilig geworden sein. Wahrscheinlich ist er schon in die Karawanserei zur├╝ckgekehrt.“
„Aber das ist eigentlich nicht seine Art“, meinte Johann und wieder hielt er nach Peter Ausschau, obwohl dies eigentlich ├╝berfl├╝ssig war, denn der leere, baumlose Platz war an ├ťberschaubarkeit kaum zu ├╝berbieten.
„Und was machen wir jetzt?“, fragte Johann irritiert und ihm wurde schmerzlich bewusst, dass dies die Standardfrage war, die er sonst dem Bruder stellte, dem er gew├Âhnlich alle Entscheidungen ├╝berlie├č.
„In die Karawanserei zur├╝ckkehren“, brummte Menas.
„Vielleicht sollten wir in alle Seitenstra├čen schauen“, widersprach ihm Johann. „Hier auf dem Platz gab es ja bis vor kurzem keinerlei Schatten! Vielleicht hat Peter sich daher in eine Gasse zur├╝ckgezogen?“
„Es d├Ąmmert bereits. Wir bekommen bestimmt ├ärger, wenn wir nicht vor Einbruch der Dunkelheit von diesem Platz verschwunden sind, denn die Priester des Neith-Tempels kontrollieren in Wahrheit die Stadt“, erkl├Ąrte der Priester mit angespannter Miene, „und au├čerdem scheint hier gerade Ausnahmezustand zu herrschen.“
„Aber das gilt auch f├╝r Peter“, entfuhr es Johann, der vor seinem inneren Auge den Bruder durch die n├Ąchtlichen Gassen irren sah. „Wir m├╝ssen ihn unbedingt finden.
„Mach dir doch nicht soviel Gedanken um Peter! Bestimmt erwartet uns dein Bruder in der Karawanserei“, munterte Priester Menas seinen Reisegef├Ąhrten auf und gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. Dann stie├č er einen leisen Seufzer aus. „Irgendetwas braut sich hier zusammen. Mir gef├Ąllt nicht, dass sich die Einwohner alle bereits in ihre H├Ąuser zur├╝ckgezogen haben.
„Das hat mich auch beunruhigt“, best├Ątigte Johann, „heute Morgen standen doch hier noch unglaublich viel Leute herum.“┬á┬á
Der alte Priester nickte.
„Wir sollten also nicht l├Ąnger hier herumdiskutieren, sondern schleunigst die Karawanserei aufsuchen.
„Von mir aus“, erwiderte Johann ohne gro├če Begeisterung und trottete dem Priester nach, der sich best├Ąndig vorsichtlich umschaute.
Beunruhigt registrierte Johann, dass auch das an den Tempel angrenzende Viertel wie ausgestorben war. Die Fenster waren vernagelt und, obwohl es noch nicht g├Ąnzlich dunkel war, lie├č sich niemand auf der Gasse blicken. Irgendwo in einem Innenhof heult ein Tier, wahrscheinlich ein ver├Ąngstigter Hund, sonst drang aus den H├Ąusern kein einziger Laut.
Mit schlafwandlerischer Sicherheit durchquerte der Priester die wenigen Freir├Ąume zwischen den ineinander geschachtelten wei├č get├╝nchten H├Ąusern. Erinnerte er sich wirklich an das Gewirr der leeren Gassen, das mit gr├Â├čerem Recht den Namen „Labyrinth“ verdient h├Ątte als der Totentempel der Nordoase?┬á┬á
„Sie finden den Weg zur Karawanserei zur├╝ck?“, fragte Johann, dem es vor der Stille graute. „Schlie├člich haben wir uns auf dem Weg zum Tempel st├Ąndig verlaufen.“
„Selbstverst├Ąndlich!“ Der Priester drehte sich um und warf ihm einen jovialen Blick zu. „Ich habe mir den Weg gemerkt.“
Auch in den n├Ąchsten Gassen herrschte Grabesstille. Die Gesch├Ąfte waren geschlossen und aus den Werkst├Ątten kam kein Ton.
Pl├Âtzlich ├Âffnete sich eine T├╝r und ein hagerer Mann mittleren Alters schoss auf die Gasse hinaus. Der Priester starrte ihn an, als ob es sein Todfeind w├Ąre und beschleunigte augenblicklich seine Schritte. Johann bemerkte, dass er leichenblass geworden war.
„Menas!“ rief ihm der ├ägypter nach, aber offensichtlich wollte der alte Priester ihm aus dem Weg gehen. Johann bezweifelte, dass dies eine gute Idee war, denn es bestand die Gefahr, dass der Mann die ganze Nachbarschaft alarmierte.
„Reden Sie mit ihm! Sonst macht er uns noch ├ärger“, bat ihn Johann geradezu inst├Ąndig und hielt den Priester am ├ärmel fest.
Der Fremde rief ihnen etwas nach und endlich blieb Priester Menas stehen.
„Wer ist das eigentlich?“, fragte Johann, obwohl er ahnte, dass es sich nur um ein Mitglied der angeheirateten Sippe des Kopten handeln konnte.
„Bak, mein Schwager, einer der Br├╝der meiner Frau.“
Johann fand, dass die Situation nicht einer gewissen Komik entbehrte. Nur schade, dass er kein Wort verstand. Bak redete heftig auf Menas ein, der Priester erwiderte in einem entschuldigenden Tonfall ein paar Worte, der Ägypter antwortete mit unfreundlicher Stimme und Johann platzte bald vor Neugier.
Langsam entspannte sich die Haltung des Priesters. Offensichtlich hegte sein Schwager keinen t├Âdlichen Groll mehr gegen ihn.
„Was ist los?“, fragte Johann seinen Reisegef├Ąhrten.
„Du hattest eben Recht gehabt“, erkl├Ąrte der Priester. „Es war gut, dass ich mit ihm gesprochen habe. Ich habe eben erfahren, dass meine Frau sich wieder verheiratet hat. Ich muss ihr also nicht mehr aus dem Weg gehen.“
Immerhin kannten sie jetzt einen Einwohner dieses W├╝stennests. Johann fand, dass man eine derartige Gelegenheit am Schopfe packen musste.
„Fragen Sie ihn doch, ob er uns f├╝r ein paar Tage gegen Bezahlung bei sich aufnehmen kann! Diese Karawanserei ist doch unglaublich verdreckt und sch├Ąbig. Wenn wir unser Gep├Ąck abholen, k├Ânnen wir auch gleich Peter Bescheid sagen.“
Der Priester nickte bed├Ąchtig. Dann formulierte er stockend und nach Worten suchend einige S├Ątze. Selbst Johann konnte feststellen, dass seine Aussprache miserabel war.
Bak lauschte mit gerunzelter Stirn. Dann brach er in schallendes Gel├Ąchter aus. Johann w├Ąre es lieber gewesen, wenn er gel├Ąchelt und genickt h├Ątte. Als Bak sich wieder etwas beruhigt hatte ├╝bersch├╝ttete er den Priester mit einem Redeschwall, bei dem es sich nur um Beleidigungen handeln konnte. Dann musterte er Johann und f├╝gte einige h├Ąmische Bemerkungen hinzu, die offensichtlich kommentierten, mit was f├╝r einem heruntergekommenen Gef├Ąhrten der Priester reiste.
Johann wich automatisch einen Schritt zur├╝ck. Was sollte er dazu sagen? Menas w├╝rde es wohl sowieso nicht ├╝bersetzen.
„Es hat keinen Zweck mit diesem ungehobelten Klotz unsere kostbare Zeit zu verschwenden“, erkl├Ąrte der Priester, dem offenbar die Vokabeln fehlten, um etwas zu erwidern. Seine Augen waren weit aufgerissen, und er sog keuchend die schon k├╝hler werdende abendliche Luft ein. „Wenigstens hat er uns eine Herberge in der Umgebung empfohlen. Wenn ich Bak richtig verstanden habe, ist er auch nur zu Gast bei einem Schwager.“
Johann sah ihn fragend an, da er sicher war, dies beiweitem nicht alles war, was der ├ägypter erz├Ąhlt hatte.
„Ich finde, wir sollten jetzt schnell Peter aufsammeln und dann diese Herberge aufsuchen“, sagte Menas hastig.
Bak, der bisher grinsend der Szenerie beigewohnt hatte, verschwand wieder im Haus und schlug die T├╝r hinter sich zu.
„Was hat Ihr Schwager noch alles gesagt?“, fragte Johann, der sich nicht schon wieder so knapp abfertigen, lassen wollte.
„Familien-Angelegenheiten!“
Johann hob eine Augenbraue und sch├╝ttelte am├╝siert den Kopf.
„Ich bin sicher, er hat auch mich beleidigt.“
„Naja, ├╝berwiegend hat er mein Verhalten seiner Schwester gegen├╝ber kritisiert, aber ich habe nicht alles verstanden“, brummte der Priester sichtbar d├╝ster gestimmt.
„Das kann ich mir vorstellen“, kommentierte Johann, womit er sowohl meinte, dass er die Kritik des Schwagers verstehen konnte, als auch, dass ihm klar war, dass der Priester seinem Redeschwall nicht hatte folgen k├Ânnen.
Das Fenster ├Âffnete sich und Bak rief etwas auf die Stra├če. Menas drehte sich w├╝tend um und stapfte mit gro├čen Schritten davon. Johann musste sich beeilen, um ihn wieder einzuholen.┬á
„Das war doch ein ziemlicher Zufall, dass wir hier ausgerechnet Ihren Schwager getroffen haben!“, rief er seinem Reisegef├Ąhrten beschwichtigend nach.
Der Priester blieb abrupt stehen.
„So gro├č war der Zufall nun wieder auch nicht. Meine Frau hat zehn Br├╝der und alle sind sie Kaufleute. Man ist nirgends vor ihnen sicher.“
Kein Wunder, dass sich der Priester standhaft geweigert hatte, auch nur einen Fu├č auf den Boden der Sobek-Oasen zu setzten. Peter h├Ątte jetzt gelacht und fast w├Ąre es auch um Johanns Selbstbeherrschung geschehen, aber bei dem Gedanken an den Bruder war ihm gar nicht mehr zum Lachen zumute.
„Wenn ich nur w├╝sste, wo Peter steckt!“, entfuhr es ihm daher spontan.
Menas blieb stehen und blickte Johann ernst an.
„Au├čer einigen Beleidigungen hat mein Schwager mir eben nachgerufen, dass Feinde in Anmarsch auf die Oase sind und wir besser verschwinden sollten.“
„Deshalb sind alle so aufgeregt“, entfuhr es Johann und im gleichen Augenblick wurde er von einer Welle des Elends ├╝berflutet. Warum musste alles auf einmal so kompliziert sein?
*
Peter f├╝hlte durch die pulsierende Watte, in die er geh├╝llt war, dass sich eine Hand auf seine Stirn legte. M├╝hsam ├Âffnete er ein Auge und sah in das sch├Âne Gesicht eines einfach gekleideten M├Ądchens, das ihn ernst musterte. Langsam kamen die Erinnerungen zur├╝ck: Die Hitze, die langweilige Warterei und die Frau, der er gefolgt war. Sein Sch├Ądel dr├Âhnte und vor seinen Augen tanzten farbige Flecken. Er f├╝hlte sich j├Ąmmerlich, m├╝de und ersch├Âpft, die Steine der Wand stachen ihm in den R├╝cken. Er sah sich um. Es war duster im Raum. Nur ein kleines, hoch angebrachtes, vergittertes Fenster lie├č etwas Licht hinein. Offensichtlich befand Peter sich in einer Art Keller. Auf dem Boden standen Vorratsgef├Ą├če, dazwischen der Strohsack, auf dem er lag.┬á
„Wo bin ich?“, fragte er automatisch auf Deutsch.
Das M├Ądchen sagte etwas, aber Peter verstand kein Wort. Wie konnte er nur vergessen, dass man hier ├ägyptisch sprach! Das Gesicht, das sich zu ihm herunterbeugte strahlte Mitgef├╝hl aus und dies gefiel Peter gar nicht, denn es verhie├č nichts Gutes f├╝r die Pl├Ąne die seine Kerkermeister mit ihm hatten.
Die Frau, der Peter gefolgt war stand nun – zusammen mit zwei M├Ąnnern – vor dem Kellerloch, in dem Peter gefangen gehalten wurde. In dieser sch├Ąbigen Umgebung hatte auch ihre Sch├Ânheit gelitten und Peter wunderte sich ├╝ber sich selbst, dass er sie so unwiderstehlich gefunden hatte. Sie sah auch Takait nicht ├Ąhnlicher als jede beliebige ├ägypterin. Peter versuchte, ihr in die Augen zu schauen, aber sie wich seinem Blick aus. Sie trug dasselbe wei├če Gewand wie auf dem Marktplatz, nur war es nicht mehr sauber.
Das M├Ądchen stellte ein Tablett mit Brot und getrocknetem Fleisch auf einen gro├čen Stein, der neben der T├╝r stand. Dann zog sie ein B├╝ndel heran, das auf dem Flur gelegen hatte. Mit einem Fu├čtritt bef├Ârderte sie das B├╝ndel in die Kammer.
Die junge Frau, die ihn in diese Falle gelockt hatte nickte Peter aufmunternd zu. Peter war au├čer sich vor ohnm├Ąchtiger Wut. Noch nicht einmal beschimpfen konnte er die falsche Schlange!
Mit einer j├Ąhen Bewegung drehte die Frau sich um und verschwand wieder in der Dunkelheit. Die T├╝r schloss sich vor dem Gefangenen und er h├Ârte aus der Ferne das Hochziehen einer Leiter und das Herunterklappen einer Fallt├╝r. Unm├Âglich von hier zu fliehen!
Peter ├Âffnete das B├╝ndel. Es enthielt Kleider und zwar einen kn├Âchellangen Schurz und ein langes, wei├čes Hemd aus einem feinen Tuch, wie es in ├ägypten die Hausfrauen selbst webten. Der Stoff war halb durchsichtig und Peter f├╝hlte eine instinktive Abneigung dagegen, es das Gewand anzulegen, aber sein Beduinengewand war zerrissen. Was hatte man nur mit ihm gemacht? Er konnte sich nicht daran erinnern, sich gewehrt zu haben.
Peter zog sich in die hinterste Ecke des Raumes zur├╝ck, wo er zwischen zwei Tongef├Ą├čen geradeso Platz zum Stehen hatte und band sich unter seinem Nomadenmantel den Schurz um. Dann streifte er das Beduinengewand ab und schl├╝pfte in das Hemd, das nicht zu kurz f├╝r ihn war. Der Saum lag fast auf der gestampften Erde. Dies erstaunte Peter, denn selbst f├╝r einen Europ├Ąer war er hochgewachsen, den ├ägyptern musste er wie ein Riese vorkommen. Und ├╝berhaupt: Warum sollte er hier in┬á diesem dreckigen Keller derart feine Gewand tragen? Sie mussten schlie├člich ziemlich wertvoll sein.
Peter warf einen missmutigen Blick auf das Essen, denn es sah alles andere als appetitanregend aus, aber er musste etwas essen, um bei Kr├Ąften zu bleiben. Einen Augenblick lang ├╝berlegte er, ob die Lebensmittel vergiftet sein k├Ânnten, aber, wenn man ihn h├Ątte umbringen wollen, so h├Ątte man w├Ąhrend er bewusstlos war hinreichend Gelegenheit dazu gehabt.
Als Peter sich auf den Sandsack setzte, schlich sich eine graue Katze an das trockene Brot und das P├Âkelfleisch, das neben ihm lag. Peter hatte nicht bemerkt, dass sie sich durch die offene T├╝r hineingeschl├╝pfte war oder war er von Anfang an im Keller gewesen?
Peter verschlang den gr├Â├čten Teil des Mahls, ohne dass er h├Ątte sagen k├Ânnen, ob es ihm schmeckte, immer die Katze im Blick, deren gr├╝ne Augen seinen Bewegungen folgen, aber Peter blieb standhaft: Die Katze geh├Ârte seinen Entf├╝hrern und er gab ihr nichts von seiner ohnehin schon kargen Ration ab.
Als sein Hunger gestillt war, f├╝hlte Peter Wut in sich aufsteigen, aber vor allem sch├Ąmte er sich. Wie konnte er nur so dumm gewesen sein! Wenn er seinen Bruder jemals wieder sehen sollte, so w├╝rde er in den Boden versinken!
Die Katze blickte ihn weiterhin mit ihren in der Dunkelheit leuchtenden Augen an und Peter f├╝hlte den Stich des schlechten Gewissens. Er schob den Teller von sich weg und sofort machte die Katze sich ├╝ber die Speisereste her. Sie hatte ein leicht zerzaustes, silbernes Fell und war nicht besonders gut gen├Ąhrt. Als sie alles heruntergeschlungen hatte, leckte sie sorgf├Ąltig den Teller ab. Dann schritt sie zu Peter und rieb sich an seinen Beinen.
„Wenigstens habe ich einen Verb├╝ndeten gewonnen“, dachte Peter in einem Anflug von Galgenhumor und er kraulte die Katze, die sogleich zu schnurren begann.
Peter schloss die Augen und atmete tief durch, denn er musste dringend eine Entscheidung treffen. Langsam gelang es ihm, seine Gedanken zu ordnen, aber ihm war noch immer schleierhaft, wie er fliehen konnte.
 
Die Flucht
20. Die Flucht
Es war ein angenehm k├╝hler Morgen. Eine leichte Brise wehte ├╝ber die Dachterrasse, eines der vielen, eng aneinander gebauten H├Ąuser der dritten Oase und streifte Takaits kurzes, dunkles Haar. Zusammen mit den Karawanenf├╝hrern hatte sie hier unter einer palmblattgedeckten Laube kampiert, aber Takait wusste nicht einmal wer der Eigent├╝mer des Hauses war. Alles, was sie erfahren hatte, war, dass der Hausherr abwesend war und, dass die Beduinen ein Dienstm├Ądchen kannten – woher wollte Takait lieber nicht wissen - das sie hier ├╝bernachten lie├č. Zwischen den R├Ąumen der Laube gab es keine T├╝ren. Vorh├Ąnde waren der einzige Schutz der Privatsph├Ąre. Takait h├Ątte es daher vorgezogen, in einem der R├Ąume des Hauses zu schlafen, aber niemand hatte sie nach ihrer Meinung gefragt.
Kinderlachen drang zu ihr und Takait bemerkte zwei M├Ądchen von circa sieben und acht Jahren, die auf der Terrasse des Nachbarhauses Senet spielten. Ihre Mutter gesellte sich zu ihnen. Mit ernstem Gesicht sagte sie etwas zu ihren T├Âchtern und alle drei stiegen ins Haus hinab.
Auf einem anderen Dach legte eine Frau Brotteig zum Aufgehen in die Sonne aus. Auch die Nomaden waren damit besch├Ąftigt, ein karges Mahl vorzubereiten. Takait hingegen zerbr├Âselte ganz vorsichtig zwischen den Fingerspitzen einige Beeren und Bl├Ątter, die sie auf unterwegs heimlich gesammelt hatte. Dabei vermied sie es, auf ihre H├Ąnde zu schauen, um nicht auch die Blicke ihrer Entf├╝hrer dorthin zu lenken. Die anstrengende Reise zur ersten Oase war f├╝r Takait kein v├Âlliger Fehlschlag ┬ágewesen, denn der Priester, der f├╝r die Zubereitung der Heilkr├Ąuter zust├Ąndig war, hatte sie einige ├Ąu├čerst n├╝tzliche Rezepte gelehrt.
Nur leider war ihre Lehrzeit im Klostergarten allzu kurz gewesen und au├čerdem fehlten ihr momentan der M├Ârser und ein Stein zum Reiben. Zur Beruhigung rief Takait sich ins Ged├Ąchtnis, dass selbst wenn ihr die Zubereitung der Medizin misslang, ihre Gefangenschaft bald zu Ende sein w├╝rde, da die Nomaden sie nicht auf Dauer rund um die Uhr bewachen konnten. Sp├Ątestens, wenn sie ihren Dienst im Tempel antrat, war sie dem Zugriff der Karawanenf├╝hrer entzogen. Fast h├Ątte Takait bei der Arbeit vor sich hingesummt, aber sie beherrschte sich, denn ihre gute Laune h├Ątte sicher den Argwohn der Beduinen erregt.
Wieder schweifte ihr Blick ├╝ber das Labyrinth der flachen D├Ącher. Zwar hatte die Dienerin die Leiter, die auf die Dachterrasse f├╝hrte heruntergezogen, aber f├╝r eine akrobatische T├Ąnzerin wie sie w├Ąre es ein Kinderspiel, auf eines der Nachbard├Ącher zu gelangen, wenn nur die Nomaden nicht abwechselnd Wache hielten!
Abdul schaute von seiner Arbeit hoch und als sich ihre Blicke trafen, bedachte er Takait mit einem anz├╝glichen Grinsen. Takait senkte augenblicklich ver├Ąrgert die Lider. Der j├╝ngere Beduine war Takait mittlerweile zuwider, weit mehr noch als sein grober Kamerad, der sie wenigstens in Frieden lie├č.
Bald wird er mich nicht mehr bel├Ąstigen, dachte sie und knetete so unauff├Ąllig wie m├Âglich das kleine, gr├╝ne K├╝gelchen, das sie mittlerweile geformt hatte. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass Abdul sie noch immer beobachtete und sie hoffte, dass er nicht die Bewegungen ihrer Finger bemerkte. Sie musste ihn dringend irgendwie ablenken, am besten, indem sie ein Gespr├Ąch begann.
„Wollt Ihr diesmal selbst in den Tempel einbrechen?“, fragte sie daher, denn sie wunderte sich dar├╝ber, dass die Nomaden bisher noch keinerlei Kontakt zu ihren Komplizen aufgenommen hatten.
„Das wirst du f├╝r uns erledigen“, antworteten beide Beduinen wie aus einem Munde, der ├Ąltere grimmig und der j├╝ngere mit einem sadistischen Grinsen.
Takaits Herz setzte einen Augenblick aus. Dann begann ihr Puls zu rasen, denn mit dieser Antwort hatte sie nicht gerechnet.
„Aber vielleicht bin ich auch so nett, dich zu begleiten“, bot ihr Abdul weiterhin grinsend an.
Takait zwang sich m├╝hsam, nicht zu widersprechen, denn nach einem Streit w├╝rde es noch schwieriger sein, die beiden zu bet├Ąuben. Seit man sie verschleppt hatte, suchte Takait nach einer Gelegenheit, den M├Ąnnern ein Schlafmittel zu verabreichen, aber bisher wusste sie noch immer nicht, wie sie dies bewerkstelligen sollte, denn die Nomaden bereiteten sich ihre Nahrung selbst zu. Diese bestand ├╝berwiegend aus Fladenbrot und gegrillten Wild. Takait bekam ihre Ration von ihnen zugeteilt, ohne dem Kochgeschirr auch nur nahe zu kommen.
Auch in die Getr├Ąnke konnte man den M├Ąnnern keine Kr├Ąuter sch├╝tten, denn - au├čer Wasser aus dem Brunnen - war Wein die einzige Fl├╝ssigkeit, die die Nomaden zu sich nahmen, wenn sie weitab der St├Ądte durch die W├╝ste zogen - und den Weinschlauch h├╝tete Abdul wie seinen Augapfel. Ihre Bitte, ihr auch etwas abzugeben hatte er mit der Bemerkung beantwortet, sie sollte vorher etwas netter zu ihm sein.
Takaits Gr├╝belei wurden j├Ąh unterbrochen von dem Dienstm├Ądchen, das hastig die Leiter heraufgeklettert kam. Sie war klein, sch├╝chtern und mager, aber Takait stellte voller Neid fest, dass sie sch├Âne, eng am Kopf anliegende Ohren besa├č.
„Ihr m├╝sst sofort verschwinden! Mein Herr ist pl├Âtzlich zur├╝ckgekommen!“, tuschelte sie mit ged├Ąmpfter Stimme. Ihr Gesicht war wie versteinert, ihre K├Ârperhaltung h├Âchst angespannt, aber Takait h├Ârte dies nur allzu gern, denn alle Feinde der beiden Nomaden waren ihre nat├╝rlichen Verb├╝ndeten.
„Hast du nicht gesagt, dass er noch f├╝nf Tage abwesend sei?“, fragte der ├Ąltere Nomade. Er machte keinerlei Anstalten zu verschwinden.
Das Dienstm├Ądchen blickte ihn geradezu verzweifelt an.
„Es ist etwas Schreckliches geschehen: Die Bewohner der ersten Oase habe uns den Krieg erkl├Ąrt. Ihr Labyrinth ist eingest├╝rzt und auch der gro├če Sphinx wurde zerst├Ârt. Nun machen sie unsere Neith-Priester f├╝r den Zorn der Hathor verantwortlich, denn sie glauben, diese h├Ątten die G├Âttin durch Magie gegen sie aufgebracht. Als mein Herr dies vernommen hat, hat er seine Gesch├Ąftsreise beendet.“┬á
Die Nomaden reagierten erstaunlich ruhig auf diese niederschmetternde Nachricht. Takait hingegen f├╝hlte, wie ein eisiger Schauer sie durchfuhr. Wenn sie der Hausbesitzer w├Ąre, h├Ątte sie ihr Heil in der Flucht gesucht, statt vorzeitig zur├╝ckzukehren.
„Wir bleiben hier!“, erkl├Ąrte der ├Ąltere Beduine ohne mit der Wimper zu zucken, „├╝berleg dir gef├Ąlligst irgendeine Ausrede. Von mir aus, kannst du gern sagen, dass wir deine Verwandten sind.“
„Aber…“
Der Nomade machte eine abwehrende Handbewegung, die er durch einen w├╝tenden Blick unterstrich.
„Geh jetzt! Es wird besser sein, wenn du mit deinem Herrn sprichst, bevor er uns findet.“
Das arme M├Ądchen war offensichtlich sein ganzes Leben lang Magd gewesen, denn sie gehorchte ohne weitere Widerrede.
„Warum verschwinden wir nicht, bevor der Kampf beginnt?“, fragte Takait, nachdem das M├Ądchen wie ein getretener Hund die Treppe hinab gestiegen war. „Wenn die Feinde siegen…“
„Wer auch immer siegen mag, es wird ein gro├čes Durcheinander geben, genau der richtige Zeitpunkt f├╝r unseren Beutezug, denn dann werden die Priester abgelenkt sein“, antwortete der ├Ąltere Nomade, der es noch immer nicht f├╝r n├Âtig befunden hatte, Takait seinen Namen zu verraten, eigentlich verst├Ąndlich, wenn man bedachte, dass es sich um einen Gesetzlosen handelte.
Die Dienerin kehrte nach kurzer Zeit zur├╝ck. Sie hatte verweinte Augen und noch immer rannen ihr Tr├Ąnen die Wangen hinab.
„Der Herr m├Âchte euch sprechen. Ich soll euch zu ihm bringen!“
Takait stand auf und zu ihrem Ärger machten die beiden Beduinen Anstalten, ihr zu folgen.
„Mein Herr hat darauf bestanden, die junge Frau unter vier Augen zu sprechen“, f├╝gte sie einem entschuldigenden in Richtung der Nomaden hinzu.┬á
Takait beeilte sich die Terrasse zu verlassen, weil sie bef├╝rchtete, den beiden k├Ânnte doch noch ein Vorwand einfallen, sie zu begleiten. Sie vermeinte, als sie auf die Leiter zuging, den bohrenden Blick der beiden geradezu im R├╝cken zu sp├╝ren.
Als Takait den Hauptraum des Hauses betrat, musste sie zugeben, dass sie das Haus ihres unfreiwilligen Gastgebers im flackernden Licht der Kerzen falsch einsch├Ątzt hatte. Es war keinesfalls ein einfaches Haus wie jedes andere: Bemalte Friese liefen um die W├Ąnde und umrahmten die T├╝ren. Es roch nach frischen Schnittblumen und die R├Ąume waren gro├čz├╝gig mit Truhen, h├Âlzernen Liegen, runden Tischen und gedrechselten St├╝hlen mit geflochtenen Sitzfl├Ąchen ausgestattet.
Auf einem dieser St├╝hle sa├č ein beleibter Mann mittleren Alters mit einem freundlichen Gesicht, das aber an diesem Morgen alles andere als Wohlwollen ausdr├╝ckte. Er bedachte die Nomaden, die auch in ├Ągyptischer Kleidung nicht besonders vertrauenserweckend aussahen mit finsteren Blicken. Die helle Haut des Hausherrn verriet, dass er nicht im Freien arbeiten musste. Wahrscheinlich handelte es sich um einen h├Âheren Beamten, wozu auch das wohleingerichtet Haus gut passen w├╝rde.
„Das sind meine Vettern Ipepi und Sethos“, sagte die Dienerin auf die M├Ąnner deutend. Takait h├Ątte ihr kein Wort geglaubt, wenn sie anstelle ihres Herrn gewesen w├Ąre, zumal die beiden Gesellen nicht nach ├ägyptern aussahen.
Die Dienerin stockte und Takait wusste warum, denn sie wusste nicht, wer Takait war. Takait beschloss spontan, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die Unsicherheit des M├Ądchens auszunutzen.
„Ich bin die Tempelt├Ąnzerin Takait“, stellte sie sich vor, denn schlie├člich war dies kein Geheimnis. „Ich habe vor Eurem Haus einen Schw├Ącheanfall erlitten und Eure Dienerin war so nett, mich zu bewirten.“ Takait warf dem M├Ądchen das freundlichste L├Ącheln zu, das sie unter diesen misslichen Umst├Ąnden zustande brachte. „Gl├╝cklicherweise geht es mir wieder besser und ich m├Âchte Euch nicht l├Ąnger zur Last fallen, zumal man mich im Tempel der Neith bereits erwartet.“
Takait wartete nicht auf eine Antwort, sondern wandte sich augenblicklich zum Gehen. Als sie dem Hausherrn zum Abschied zunickte, bemerkte sie, dass dieser sie mit Wohlgefallen betrachtete. 
„Man sieht sofort, dass Ihr nicht zu diesen, diesen M├Ąnnern geh├Ârt.“ Er spuckte das Wort aus wie eine Beleidigung.
Abdul ├Âffnete den Mund zum Sprechen, aber der andere Nomade, den das M├Ądchen genannt hatte, bedeutete ihm mit einer Handbewegung zu schweigen.
„Vielen Dank f├╝r alles, aber ich muss jetzt gehen“, erkl├Ąrte Takait, „Ich hatte heute Nacht einen Traum, von dem ich dem obersten Priester des Neith-Tempels berichten muss.“
Takait hatte dies aufs Geradewohl gesagt, aber im selben Augenblick, als sie diese Worte aussprach wusste sie, dass dies der Wahrheit entsprach, obwohl ihr der Traum erst jetzt ins Bewusstsein kam.
„Dann will ich Euch selbstverst├Ąndlich nicht l├Ąnger aufhalten!“ Das Gesicht des Hausherrn lie├č erkennen, dass er beeindruckt war.┬á „Bitte empfehlt mich dem obersten Priester.“
„Selbstverst├Ąndlich!“, erkl├Ąrte Takait, die hoffte, dass man sie nun endlich gehen lie├č, „die G├Âtter sind mit den Gastfreundlichen.“
Takait lie├č sie sich von dem Dienstm├Ądchen herausf├╝hren, das offensichtlich froh war wenigstens einen der unliebsamen Besucher loszuwerden.
„Du schuldest mir noch einen Gefallen f├╝r die Geschichte, die ich deinem Herrn aufgetischt habe“, sagte Takait und sah dem M├Ądchen fest in die Augen. „Als Gegenleistung m├Âchte ich, dass du sagst ich sei nach rechts gegangen, nur f├╝r den Fall, dass dich jemand danach fragen sollte.“
Die Dienerin nickte geflissentlich, aber Takait wusste, dass das M├Ądchen alles gleich br├╝hwarm den Nomaden berichten w├╝rde und nat├╝rlich auch ihrem Herrn, der sie offenbar attraktiv fand. Aber Takait wusste, dass die M├Ąnner ihr nicht trauten und daher meinen w├╝rden, dass sie gelogen hatte. Aus diesem Grund hatte Takait auch dem Hausherrn wahrheitsgem├Ą├č mitgeteilt, dass sie den Tempel aufsuchen wolle. Nun w├╝rden die Beduinen sie ├╝berall suchen, nur nicht im Tempel der Neith.
Gl├╝cklicherweise besa├č das Haus, wie die meisten Bauten der Oase kein Fenster zur Stra├če, weshalb man von innen nicht beobachten konnte, wohin Takait ging. Auf der Stra├če angekommen wartete sie, bis die T├╝r hinter ihr abgeschlossen wurde, erst dann bog sie in die rechte Stra├če ein. Sie war bereits um die n├Ąchste Ecke gebogen, als Takait schlagartig einfiel, dass sie den dicken Mann nach seinem Namen h├Ątte fragen sollen. Sie schalt sich selbst eine N├Ąrrin, denn nun konnte sie seine Botschaft nicht ausrichten. Wer wei├č, wozu dies noch gut gewesen w├Ąre!
*
Besucher hatten ihre Namen in die W├Ąnde der Umfassungsmauer des Tempels geritzt. Dies zeigte, dass der Neith-Tempel als Sehensw├╝rdigkeit galt und zugleich ein Ziel frommer Pilger war. Auch Takait hatte sich schon darauf gefreut, den Tempel endlich wieder einmal zu besuchen, jedoch nicht unter diesen misslichen Umst├Ąnden! Sie hatte sich am Vortag als T├Ąnzerin beworben und es hatte den Anschein gehabt, als ob ihre Chancen angenommen zu werden gut waren. Ihr Tanz hatte jedenfalls den Priestern gefallen. Leider waren aber die Nomaden nicht von ihrer Seite gewichen. Sie hatten sich als ihre Br├╝der ausgegeben, die angeblich ihrem Vater geschworen hatte, sie zu besch├╝tzen. Es hatte sie irritiert, dass man den M├Ąnnern nicht den Zutritt verweigert hatte, denn normalerweise war dieser nur dem Pharao und den Priestern gestattet. Ob die Nomaden bereits Komplizen im Tempel besa├čen?
Takaits Blick wanderte an einer der beiden Nadeln aus Stein hoch. In ihren vergoldeten Spitzen spiegelte sich das Sonnenlicht. Dies schaffte eine Verbindung zum Sonnengott, den Sohn der Neith. Die Inschriften auf der Nadel priesen den Pharao und die G├Âtter. Takait las etwas „von ewigen Durst“, zu dem die Feinde des Tempels verflucht werden sollten und es schauderte sie.
Sie dachte an das Schreiben, das sie Peter mitgegeben hatte und dieser Gedankte l├Âste sich widersprechende Gef├╝hle aus, einerseits bekam sie ein schlechtes Gewissen, andererseits ├Ąrgerte sie sich, mit welcher Selbstverst├Ąndlichkeit die Fremden hingenommen hatten, dass sie die schwierige Kunst des Schreibens beherrschte. Dies war selbst unter den M├Ąnnern eine sehr seltene F├Ąhigkeit, die Takait nur erlernt hatte, weil sie die Stieftochter eines Vorlesepriesters war.┬á
Als das Portal durchschritt, das von zwei Skulpturen der Neith bewacht wurde f├╝hlte sie nicht besonders wohl in ihrer Haut. Eigentlich hatte sie kein Recht mehr, das Haus der G├Âttin zu betreten. Es haftete ein Makel an ihr, den jeder sehen konnte. Sie war keine T├Ąnzerin, sondern eine Spionin, schlimmer noch, sie hatte geholfen das Pharaonengrab der ersten Oase zu berauben.
Zwei Priester der Tempelpforte traten ihr in den Weg und Takait ├Ąu├čerte ihr Anliegen. Die beiden M├Ąnner erwiderten nichts, sondern beratschlagten so leise untereinander, dass die T├Ąnzerin kein Wort verstand. Dann verschwand einer von ihnen mit einer wichtigen Miene im Inneren der Anlage. Noch ehe Takait sich dar├╝ber beschweren konnte, dass man sie unn├Âtig warten lie├č kehrte er mit einem Priester zur├╝ck, dessen reicher Schmuck auf hohen Rang hinwies. Er trug nicht nur das Leopardenfell der Priester der ersten Ordnung, sondern auch unz├Ąhlige goldene Armreife, wertvolle Ohrringe und einen juwelbesetzten Brustschmuck.
„Bitte folge mir“, sagte er in einem befehlsgewohnten Tonfall zu Takait schritt ihr voran durch den Innenhof.
Der goldene Schmuck des Priesters glitzerte in der Sonne und Takait war heilfroh, im Tempel in Sicherheit vor den Nomaden zu sein. Kauernde Sphingen s├Ąumten den die Au├čenmauern und in die Tempelfront waren monumentale Reliefs eingehauen. Sie berichteten von der Erschaffung der Welt und von den Taten der G├Âttin Neith.
Zwillingssteinnadeln s├Ąumten den Eingang des auf den Hof folgenden Traktes. Ihr F├╝hrer durchma├č mehrere aufeinander folgende repr├Ąsentative S├Ąle und langsam fragte sich Takait, wohin er sie wohl brachte. In einem Raum, der kleiner war als die vorangegangenen, blieb der Priester abrupt vor dem r├╝ckw├Ąrtigen Portal stehen. Er wandte sich der T├Ąnzerin zu und musterte sie wie ein strenger General einen schw├Ąchlichen Rekruten.
Die Wachen traten beiseite und Takait durchschritt das Portal. Sie gelangte in einen hohen Raum von gewaltigem Ausma├č, dessen Decke von zwei S├Ąulenreihen getragen wurde.
Gro├če G├Âttin, ich bin im innersten Heiligtum des Tempels, durchfuhr es sie mit einem Schauer. Wie oft hatte sie von diesem Augenblick getr├Ąumt! Doch damals hatte sie sich vorgestellt, zur Neith-Priesterin geweiht zu werden. Es sollte ein Freudentag werden, doch be├Ąngstigend war ihr heutiger Besuch!
Takait f├╝hlte sich wie eine zum Tode verurteilte Gefangene. Es beunruhigte sie, dass der reich geschm├╝ckte Priester drau├čen geblieben war. Sie war allein. Takait schalt sich selbst eine T├Ârin. Wie konnte sich nur annehmen, dass der Saal menschenleer war. Als sich ihre Augen etwas an das D├Ąmmerlicht im Tempel gew├Âhnt hatten, bemerkte sie zu beiden Reihen des Mittelgangs lange Reihen von kahlk├Âpfigen, wei├čgewandeten Priestern mit Weihrauchwedeln in den H├Ąnden. H├Âlzernen Statuen gleich standen sie reglos Spalier.
Wie von einer fremden Kraft angezogen schritt Takait langsam auf das Allerheiligste des Tempels zu. Schon konnte sie die drei Nischen mit den G├Âtterbildern erkennen, deren Heimst├Ątte dieser Tempel war. Ihre K├Ârper waren farbig und Takait kannte ihre Namen. In der mittleren Nische, die etwas gr├Â├čer war als die beiden anderen stand die Herrin dieses Tempels: Die menschengestaltige Neith, die die Wege ├Âffnete. Daher schritt sie als Schutzg├Âttin voran, gefolgt vom Pharao und seinem Heer. Sie trug die rote Krone Unter├Ągyptens, was nur noch eine Erinnerung an eine l├Ąngst vergangene glanzvolle Zeit war. Die G├Âttin wurde meist mit Pfeil und Bogen dargestellt, aber sie war auch die Vorsteherin des Bienenhauses des Osiris zu Sais und die Besch├╝tzerin des Wassers. Zu ihren Seiten assistierten ihr ihre beiden S├Âhne: Re mit der Sonnenscheibe und der krokodilgestaltige Sobek. Vor diesem Wassergott mit seinem todbringenden Z├Ąhnen hatte es Takait schon immer gegraut. Daher w├Ąre sie auch am liebsten Priesterin der friedlichen Hathor gedient.
Ein vergoldeter Stuhl stand auf einem dreistufigen Podest vor der mittleren Nische. Seine F├╝├če hatten die Form von L├Âwenpranken, w├Ąhrend die Armlehnen in L├Âwenk├Âpfen endeten. Auf diesem pr├Ąchtigen Sitz thronte ein alter Mann, bei dem es sich nur um den obersten Priester in vollem Ornat handeln konnte, denn sein Schmuck war noch viel wertvoller als der seines Boten.┬á Er trug einen sorgsam gef├Ąltelten Schurz und goldene Sandalen.
Der schwere Geruch von Weihrauch machte Takait leicht benommen und der oberste Priester verstr├Âmt eine Autorit├Ąt die ihren Blick zu Boden dr├╝ckte, zumal sie auf diese Begegnung nicht vorbereitet war.
Sie war davon ausgegangen, dass man sie lange warten lassen w├╝rde und sie dann zuerst vor einen niedrigrangigen Priester gef├╝hrt werden w├╝rde. Daher hatte sie sich noch nicht ├╝berlegt, welches ihrer Anliegen sie zuerst vorbringen sollte. Zu nervenaufreibend war der Weg zum Tempel f├╝r sie gewesen, als dass sie auch nur einen Gedanken daran verschwendet h├Ątte. Immer erwartend, dass sich eine pl├Âtzlich eine Hand von hinten auf ihre Schulter legen w├╝rde, hatte sie sich erst sicher gef├╝hlt, als der Priester der Pforte sie hereingelassen hatte.
Als Takait schlie├člich vor dem Thron stand, machte sie eine tiefe Verbeugung und bedankte sich f├╝r die Ehre, in den inneren Tempel vorgelassen zu werden.
Die stechenden Augen des alten, glatzk├Âpfigen Mannes signalisierte Takait, dass seine Zeit nicht mit H├Âflichkeitsformeln verschwendete. Ihr Blick wich dem seinen aus und streifte zuf├Ąllig die rechte Seitenwand des Saals, die mit Wandmalereien bedeckt waren, die in mehreren Registern l├Ąngst verstorbene Priester zeigten, sowie Pharaonen, die ihnen huldigten.
Dann gab sie sich einen Ruck und begann zu sprechen. 
„Ich bin…“
„Takait, die T├Ąnzerin, die sich gestern in unserem Tempel beworben hat.“ Der oberste Priester sprach ruhig und getragen, aber er fixierte die T├Ąnzerin noch immer mit seinen dunklen Augen. „Bitte verschwende also nicht meine kostbare Zeit und komm zur Sache. Der Priester der Pforte sagt, du hast einen bedeutungsvollen Traum gehabt.“
Takait sagte sich, dass es vielleicht wirklich das Beste war, mit ihrem Traum zu beginnen.
„Ich habe im Traum, gesehen, dass Ptah einem jungen Pharao das Chepesch-Schwert ├╝berreicht hat, damit er das alte Reich von Ober- und Unter├Ągypten wiederherstellen m├Âge!“
Der oberste Priester warf einen scharfen Blick ├╝ber die Schulter nach hinten und sofort kam ein j├╝ngerer Priester herangeschossen.“
„Du hast ihre Worte geh├Ârt?“
Unm├Âglich zu sagen, was in dem obersten Priester vorging. Auch sein j├╝ngerer Kollege verzog keine Miene. Er nickte langsam und bed├Ąchtig.
„Lass dir aus dem Stall des Tempels einen Streitwagen und zwei Pferde geben und reite sofort zu unserem Feldherrn. Er muss diese Nachricht noch vor der Schlacht erhalten.“
Wieder nickte der j├╝ngere Priester. Ohne zu fragen, wo er den Feldherrn finden k├Ânne eilte er davon.┬á┬á ┬á
Der oberste Priester musterte Takait von Kopf bis Fu├č. Wenn ich vor ihm h├Ątte vortanzen m├╝ssen, h├Ątte ich dies nicht vermocht, dachte sie ├Ąu├čerst beunruhigt. Was mochte dieser schreckliche Mensch von ihr wollen?
„Zwei Fremde haben nach dir gefragt.“
Die Worte trafen Takait wie ein Faustschlag. Hatten die Nomaden sie bereits aufgesp├╝rt? Lauerten sie ihr im Tempel auf? Aber dann h├Ątte der Priester wohl kaum von Fremden gesprochen, denn schlie├člich hatte er die Beduinen am Vortag bereits kennengelernt.
„Tats├Ąchlich?“, frage sie so beil├Ąufig wie m├Âglich. „Haben sie ihre Namen genannt?“
„Ja, aber sie waren so unaussprechlich, dass ich sie mir nicht gemerkt habe.“ Der oberste Priester sah Takait mit seinen durchdringenden braunen Augen an. „Es waren ein alter Mann mit einem barbarischen, wei├čen Bart, der ein noch barbarischeres ├ägyptisch sprach und ein junger rothaariger, der sich f├╝r die Gr├Ąber der Pharaonen interessiert hat. Der junge Mann hat in einer uns allen unbekannten Sprache Fragen gestellt und der alte hat seine Worte mehr schlecht als recht ├╝bersetzt.“
Es waren also nicht die Beduinen! Takait war dar├╝ber so erleichtert, dass sie fast gelacht h├Ątte, aber der oberste Priester be├Ąugte sie noch immer absch├Ątzig. Dann fragte sie sich ganz pl├Âtzlich, ob es sich bei dem jungen Mann am Ende um Johann handelte. Aber wer war dann der Alte? Und wie hatte Johann die dritte Oase so schnell erreichen k├Ânnen? Schlie├člich sollte die Karawane erst in wenigen Tagen hier ankommen.┬á
„Der Vorlesepriester hatte mich rufen lassen, damit ich mir den jungen Fremden selbst ansehe“, unterbrach die leicht h├Ąmische Stimme des obersten Priesters Takaits Gedanken, „denn er fand es merkw├╝rdig, dass dieser nach einer Tempelt├Ąnzerin namens Takait gefragt hat, die ihm angeblich etwas gestohlen hat. Leider hat er nicht gesagt, was es war.“
Takait verschluckte sich fast vor Schreck. Der oberste Priester kostete die Wirkung seiner Worte gen├╝sslich aus. Offensichtlich machte es ihm Freude, andere Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen.
Takaits Gedanken ├╝berschlugen sich. Wenigstens hatte Peter nicht den Oasenkrokus beim Namen genannt. Oder hielt der Priester weiterhin Informationen zur├╝ck? Takait war nicht mehr gewillt, dies Spiel mitzuspielen. Sie musste schleunigst dem Gespr├Ąch eine andere Wendung geben.
„Das ist eine lange Geschichte“, begann sie schlie├člich, „aber ich habe nicht die Zeit sie zu erz├Ąhlen, denn dem Tempel der Neith droht Gefahr.“
„Und warum hast du dem Bruder des jungen Fremden erz├Ąhlt er m├╝sse Grant├Ąpfelkerne essen?“, fragte der Priester, ohne auf ihre Bemerkung einzugehen.
Takait ├Ąrgerte sich ├╝ber die Hartn├Ąckigkeit des alten Mannes.
„Er hat eine Katze getreten und danach begann er sich aufzul├Âsen“, log Takait, weil ihr keine vern├╝nftige Begr├╝ndung f├╝r ihr Verhalten einfiel. „Sein Bruder kann mich nicht leiden …“
„Das war nicht zu ├╝bersehen“, unterbrach der oberste Priester. „Fasse dich kurz. Was ist dir ├╝ber die Gefahr bekannt, die unserem Tempel angeblich droht? Du sagtest doch dergleichen zum Priester der Pforte und hast eben schon wieder eine diesbez├╝gliche Andeutung gemacht?“
Ohne gro├č nachzudenken, beschloss Takait alles zu gestehen. Dann berichtete sie von den Grabr├Ąubern, die sie erpresst hatten, wobei sie aber mit Nachdruck betonte, dass sie keinerlei Anteil an deren Sakrileg gehabt hatte. Der Priester h├Ârte sich ihre Geschichte an ohne die Mine zu verziehen.
„Die beiden M├Ąnner, die sich als meine Br├╝der vorgestellt haben sind Karawanenf├╝hrer“ fuhr Takait fort. „Sie haben mit den Grabr├Ąubern zusammengearbeitet. Dann haben sie mich entf├╝hrt, denn sie wollten mich zwingen ihnen zu helfen. Durch einen gl├╝cklichen Zufall gelang es mir, ihnen zu entkommen…“
„Warum hast du dies nicht gleich gesagt?“
Weil ihr mich nicht habt ausreden lassen, h├Ątte Takait am liebsten erwidert, doch sie verkniff sich den Kommentar.
Der alte Mann schlug auf einen Gong und aus allen Richtungen kamen kahlk├Âpfige M├Ąnner herbeigeeilt. Dann warf der oberste Priester Takait einen finsteren Blick zu.
„Preise dich gl├╝cklich, dass du diesen Traum gehabt hast. Anderenfalls h├Ątten wir dich f├╝r dein Verhalten in der ersten Oase zur Rechenschaft gezogen!“ Takait hatte den Eindruck, dass es ihm sehr Leid tat, davon Abstand nehmen zu m├╝ssen. „Aber, wenn Ptah dich als Werkzeug auserw├Ąhlt hat so ist es nicht an uns, dich zu verurteilen.“
Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen, dachte Takait. Sie murmelte einige halbherzige Dankesworte. Dann zog sie sich gerade so schnell zur├╝ck, dass es nicht nach einer Flucht aussah, denn sie bef├╝rchtete, dass der f├╝r seine Strenge bekannte oberste Priester es sich anders ├╝berlegen k├Ânnte.
„Vielleicht interessiert dich, was einer unserer Spitzel vorhin berichtet hat“, sagte der alte Mann als Takait den Saal bereits zu einem Drittel durchquert hatte. „Ein selbsternannter Priester hat einen Fremden entf├╝hrt. Er will ihn dem Sobek opfern, damit die Feinde unserer Oase in der W├╝ste verdursten.“
Wie angewurzelt blieb Takait stehen. Die Worte durchbohrten sie wie ein Dolch. Das konnte nur einer ihrer Reisegef├Ąhrten sein. Takait begann am ganzen K├Ârper zu zittern, doch sie versuchte, sich ihren Schrecken nicht anmerken zu lassen, denn sie sp├╝rte, dass der oberste Priester dies sagte, um sich an ihrem Entsetzen zu weiden. Au├čerdem war es den Bewohnern der Sobek-Oasen verboten, mit Fremden zu sprechen, auch wenn sich niemand daran hielt.
„Wisst Ihr, wie er hei├čt?“, fragte sie mit klopfenden Herzen, obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie die Antwort wissen wollte.
„Das hat unser Informant nicht gesagt. Er hat nur berichtet, dass es sich um einen jungen Mann von Anfang Zwanzig handelt, der auf dem Tempelvorplatz herumgelungert hat.“
Takait war einen Augenblick lang irritiert, denn der Bericht des Priesters hatte danach geklungen, dass Johann mit einem alten Mann den Tempel aufgesucht hatte. Konnte es sein, dass sein Bruder drau├čen geblieben war? Takait versuchte, diesen unangenehmen Gedanken wegzuschieben, was ihr jedoch nicht gelang. Der Gedanke kam zur├╝ck, lauter, dr├Ąngender. Takait fand es gerade emp├Ârend, dass die Priesterschaft dieser Barbarei kein Ende bereitete, wer auch immer der Ungl├╝ckliche sein mochte, den man dem Krokodilgott opfern wollte.┬á┬á
„Und warum unternehmt ihr nichts?“, fragte Takait daher heftiger als sie wollte, zumal ihr bewusst geworden war, dass sie wie angewurzelt inmitten des kolossalen Saales stehen geblieben war und der haftende Blick des obersten Priesters noch immer auf ihr ruhte.
„Normalerweise w├╝rden wir selbstverst├Ąndlich einzugreifen versuchen, aber momentan, wo unsere Feinde vor der Stadt lagern, ist dies zu gef├Ąhrlich. Au├čerdem ist es doch nur ein Fremder. Vielleicht haben wir Gl├╝ck und Sobek nimmt das Opfer gn├Ądig an. Der Krokodilgott ist schlie├člich der Sohn der Neith und wir k├Ânnen momentan nicht auf einen derart m├Ąchtigen Verb├╝ndeten verzichten.“
Takait st├╝rzte aus dem Raum, bevor sie Gefahr lief etwas Unkluges zu sagen. Als sie an den beiden Priestern vorbeieilte, die das Portal bewachten, kam ihr pl├Âtzlich in den Sinn, dass die Nomaden ihr drau├čen auflauern k├Ânnten. Leider waren sie nicht dumm und viele M├Âglichkeiten auf dieser Oase unterzutauchen gab es nicht.
Sie blieb abrupt stehen und dachte einen Augenblick lang nach. Dann begab sie sich zu Hori, dem Priester des ersten Tempelhofes, denn es war ihr am Vortag nicht entgangen, wie dieser versucht hatte, sie nicht anzustarren, als sie bei ihrer „Aufnahmepr├╝fung“ vor der Priesterschaft getanzt hatte. Wieder war Takait froh, dass der oberste Priester sich nicht die Ehre gegeben hatte.
„K├Ânntet Ihr vielleicht beim Verwalter der Tempelg├Ąrten ein gutes Wort f├╝r mich einlegen?“, fragte sie ihn mit dem freundlichsten L├Ącheln, das sie zustande brachte. „Ich w├╝rde sehr gern f├╝r einige Tage im Tempel Quartier nehmen, notfalls ├╝bernachte ich im Garten.“
„Warum so unbequem?“, fragte Hori mit einem undefinierbarem Gesichtsausdruck zur├╝ck. Takait f├╝hlte sich in seiner Gegenwart unwohl, denn sie hatte das ungute Gef├╝hl, dass er sie durchschaute. „Wir haben im Tempelbereich auch einige G├Ąstezimmer, da manchmal ausw├Ąrtige Priester hier ├╝bernachten.“
Takait bedankte sich ├╝berschw├Ąnglich, doch war sie bereits in Gedanken woanders. Wie konnte sie nur – ohne den gr├Ąsslichen Karawanenf├╝hrern in die Arme zu laufen - Kontakt mit Johann aufnehmen, um ihn zu fragen, wie es seinem Bruder ging? ┬á┬á┬á
 
Das Wiedersehen
21. Das Wiedersehen
„Wachen Sie auf“, sagte Johann und sch├╝ttelte Menas an der Schulter. Seine verschwitzten Finger umklammerten eine kleine Schriftrolle, deren Inhalt er augenblicklich dem Reisegef├Ąhrten mitteilen musste.
„Was ist denn los? Kannst du mich nicht ausschlafen lassen“, fragte der alte Mann unwirsch, g├Ąhnte herzhaft und rieb sich noch v├Âllig schlaftrunken die Augen.
„Ich habe wichtige Nachrichten!“, erkl├Ąrte Johann und hielt dem Priester die Schriftrolle vorwurfsvoll unter die Nase.
„Du bist ja ganz aufgeregt!“, meinte Menas und der grantige Ausdruck verschwand aus seinem Gesicht. „Ist dein Bruder endlich zur├╝ckgekommen?“
Eben hatte sich Johann noch ├╝ber die Nachricht, die er erhalten hatte gefreut, aber bei dem Gedanken an Peter wich seine Euphorie der Ern├╝chterung. Johann f├╝hlte sich, als ob man ihm einen Eimer kalten Wassers ├╝ber den Kopf gesch├╝ttet h├Ątte. Es war egoistisch von ihm gewesen, dass er den Bruder einen Augenblick lang vergessen hatte.
„Nein“, murmelte er und lie├č sich auf das leere Lager fallen, auf dem Peter vor seinem Verschwinden geschlafen hatte. Noch immer logierten sie nicht in der Herberge, die der Schwager des Priesters ihnen empfohlen hatte, sondern hausten weiterhin in der verlausten Karawanserei, da der Bruder sie gewiss hier als erstes suchen w├╝rde, wenn er zur├╝ckkommen sollte. „Ein Bote hat mir vorhin f├╝r ein horrendes Bakschisch eine Nachricht des Priesters des ersten Tempelhofes ├╝bermittelt.“ Johann hielt die Schriftrolle demonstrativ in die Luft und machte eine kurze Pause, um seinen Worten eine gr├Â├čere Bedeutung zu verleihen. „Offenbar konnte Takait fl├╝chten! Sie hat mittlerweile im Tempel Zuflucht gefunden.“
Menas st├╝tzte sich schl├Ąfrig auf seinen Ellbogen und nahm das Schriftst├╝ck ohne gro├če Begeisterung in Empfang.
„Also das Englisch dieses Hori, der den Text verfasst hat, ist auch nicht besser als mein ├ägyptisch, ├╝ber das du dich so lustig gemacht hast“, brummte er, w├Ąhrend seine Augen ├╝ber die Zeilen wanderten, aber er machte noch immer keinerlei Anstalten aufzusehen.
„Wir sollten unsere Zeit nicht mit Schlafen verschwenden“, dr├Ąngte Johann, der bei dem Gedanken an die herannahenden Soldaten von Panik ergriffen wurde, „wir m├╝ssen dringend Peter finden und au├čerdem brauche ich dringend diesen seltsamen Oasenkrokus, damit der ├Ągyptische Schatten mich nicht noch mal heimsucht! Daher m├Âchte ich nicht riskieren, dass die wankelm├╝tige Takait mir schon wieder entwischt.“
„Unwahrscheinlich, erst ├╝bermorgen verl├Ąsst eine Karawane die dritte Oase. Auch wir m├╝ssen solange hier ausharren“, erkl├Ąrte der alte Mann und drehte Johann den R├╝cken zu, „ich vers├Ąume daher nichts, wenn ich noch ein paar Minuten schlafe.“
„Aber …“
„Es ist eine reine Gef├Ąlligkeit, dass ich dich noch mal in den Ort begleite und dabei riskiere schon wieder einem Familienmitglied meiner Frau ├╝ber den Weg zu laufen“, unterbrach der alte Kopte Johann, „aber, wenn es denn unbedingt sein muss, m├Âchte ich wenigstens einigerma├čen ausgeschlafen sein. Also lass mich gef├Ąlligste noch mindestens eine halbe Stunde in Ruhe.“
Einen Augenblick lang beschlich Johann der h├Ąssliche Verdacht, dass Menas diese Oasenkrokus-Geschichte nur erfunden hatte, um ihn zu beruhigen oder schlimmer noch: Um ihn loszuwerden, denn Menas hatte sie in Alexandria zwar in seinem Hause beherbergt, aber hatte sich gezeigt, dass er dieses spontane Angebot bald bereut hatte. War es nur ein Ammenm├Ąrchen, dass der Oasenkrokus gegen ruhelose Geister half? Aber das konnte nicht sein! Schlie├člich existierte dieses Wunderkraut tats├Ąchlich und es wurde bewacht wie ein Kronschatz.
„Sie meinten ihre ehemalige Frau“, verbesserte Johann schlie├člich den Reisegef├Ąhrten. Am liebsten h├Ątte er hinzugef├╝gt, dass nur sein ├╝berm├Ą├čiger Weinkonsum vom Vortag daran schuld war, dass es ihm momentan so schlecht ging, aber Johann war auf die Hilfe des alten Mannes angewiesen. Also sollte er ihn nicht mutwillig ver├Ąrgern.
„Ja, ich vergesse immer wieder, dass wir nach ├Ągyptischen Recht nicht mehr verheiratet sind“, brummte Menas in sich hinein und drehte Johann den R├╝cken zu.
Johann fragte sich, wie es dem Bruder nur gelungen war, dass man ihn ernst nahm. F├╝nf Minuten lang schaute er ver├Ąrgert den in seine Decke vermummten Priester an und trommelte dabei mit den Fingern auf Boden, was aber leider den alten Mann nicht zu st├Âren schien. Dann konnte er sich nicht mehr beherrschen.
„Ich w├╝rde jedenfalls gern so schnell wie m├Âglich von hier verschwinden“, fuhr er den Schlafenden an. „Wenn die Einheimischen Konflikte miteinander haben, sollen sie diese unter sich ausmachen! Statt unsere Zeit in dieser grauenhaften, verlausten Karawane zu verschwenden, sollten wir so schnell wie m├Âglich alles erledigen, was uns hier noch h├Ąlt. Wir m├╝ssen uns diesen komischen Krokus wiederbeschaffen, wir m├╝ssen die Mumie in ihr Grab bringen und vor allem m├╝ssen wir endlich Peter finden!“
Johann wurde es bei dieser Aufz├Ąhlung ganz beklommen. Wie sollten sie all dies nur schaffen? Und noch dazu in kurzer Zeit! Johann f├╝hlte sich, als seinen ihm, die schier unl├Âsbare Aufgaben des Herkules gestellt worden. Trotz der sommerlichen Hitze begann er zu fr├Âsteln.
„Ist ja schon gut!“, seufzte Menas, Johann mit einem finsteren Blick bedenkend. Trotz allem aufgesetzten Desinteresse war mittlerweile un├╝berh├Ârbar, dass auch die Nerven des alten Mannes blank lagen. „Wenn es denn sein muss! Was mir am immer Orient gefallen hat, ist dass es hier nicht hektisch ist wie in Europa.“ ┬á┬á
*
Als Menas und Johann den Ort durchquerten, herrschte ├╝berall eine gespenstisch Atmosph├Ąre: Ohne Passanten und Marktst├Ąnde, ohne spielende Kinder und Wasserverk├Ąufer wirkte die dritte Oase wie eine Geisterstadt. Die H├Ąuser waren verrammelt, die verwaisten Gassen und Pl├Ątze vom Flugsand bedeckt. ├ťberall war es unnat├╝rlich still.
Die glei├čende Helligkeit stach Johann wie Messerklingen in die Augen, die sich augenblicklich zu schmalen Schlitzen verengten, aber er sah noch immer den Sand der Sahara, den der Wind herwehte und der ├╝ber kurz oder lang alle drei Sobek-Oasen unter sich begraben w├╝rde.
Noch immer konnte Johann es sich beim besten Willen nicht erkl├Ąren, wo der Bruder stecken mochte. So wie die Fremden bei jedem Schritt, den sie machten von den ├ägyptern be├Ąugt wurden, war es kaum vorstellbar, dass er unbemerkt irgendwohin verschwunden war. Falls er sich verlaufen haben sollte, h├Ątte ihm doch eigentlich jeder Oasenbewohner helfen k├Ânnen, denn es bedurfte wenig Phantasie, um sich vorzustellen, dass er die Karawanserei suchte.
Johann f├╝hlte Wut ├╝ber Takait in sich aufsteigen. Das war alles nur ihre Schuld! Wenn diese t├╝ckische Person nicht den Oasen-Krokus gestohlen h├Ątte, w├╝rden Peter und er noch mit der restlichen Karawane reisen und h├Ątten sich wahrscheinlich nicht voneinander getrennt.
Als die beiden Fremden den Neith-Tempel erreichten, waren die Wachen verdoppelt worden. Johann wunderte dies nicht, in diesen schlimmen Zeiten konnte man gar nicht vorsichtig genug sein. Bestimmt hatten es alle zwielichtigen Existenzen der Sobek-Oasen auf das goldene Opfergeschirr des Tempels abgesehen.
Menas sprach einen der Bewaffneten an, bei denen es wohl nicht um Soldaten, sondern um Priester handelte, denn sie waren kahl geschoren und mit einfachen, wei├čen Leinenschurzen bekleidet. Johann verstand nur ein Wort: Takait und er hielt den Atem an und fragte sich warum er eigentlich so reagierte. Wusste er nicht bereits, dass die Tempelt├Ąnzerin sich hinter den hohen Mauern des Tempels versteckte?
Ohne den alten Kopten eines Kommentars zu w├╝rdigen, ├Âffnete der Wachtposten das Portal einen Spalt breit und rief einem seiner Kollegen im Inneren des Tempels einige barsche Worte im Befehlston zu.
Menas lachte laut auf und Johann fragte sich, ob der alte Priester noch immer betrunken war.
„Was ist hier denn hier komisch?“, fuhr er ihn an und bereute im gleichen Augenblick seinen harschen Tonfall. „Er macht mich langsam ganz krank, dass ich in diesem Land nichts verstehe!“, f├╝gte er daher beschwichtigend hinzu.
Menas schaute ihn, noch immer schmunzelnd an.
„Er hat in den Hof gerufen: fragt Takait, ob sie da ist.“
Johann wunderte sich ├╝ber sich selbst, dass er erleichtert war, dass Takait nicht in der Zwischenzeit wieder verschwunden war. Dabei war es doch h├Âchst unwahrscheinlich, dass die T├Ąnzerin etwas ├╝ber den Verbleib des Bruders wusste.
„Also sind wir nicht schon wieder v├Âllig umsonst durch dieses W├╝stenkaff gewandert“, sagte er l├Ąchelnd zu seinem ├Ąlteren Begleiter.
„Warten wir ab, ob sie sich nicht am Ende verleugnen l├Ąsst“, wandte der immer vorsichtige Menas ein.┬á┬á
Johann spitzte die Ohren und lauschte mit angehaltenem Atem: Aus dem Tempel drang lautes Stimmengewirr und er vermeinte eine weibliche Stimme zu h├Âren. Oder war dies nur einer der jungen Priester? Manche von ihnen schienen noch halbe Kinder zu sein. Johann h├Ârte aus der Ferne Schritte. Dann kam Takait mit steinerner Miene durch den Innenhof geschritten, gefolgte von einem j├╝ngeren, ziemlich energisch aussehendem Priester, vor dem sie offensichtlich noch mehr Angst hatte als vor dem Wiedersehen mit ihrem Opfer. F├╝r einen kahlk├Âpfigen ├ägypter, der seltsame Kleidungst├╝cke trug fand Johann ihn recht attraktiv. Ob das dieser Hori war, der ihm die Nachricht ├╝ber Takait geschickt hatte? Die Tatsache, dass er sie offenbar loswerden wollte, sprach eigentlich daf├╝r.
Der junge Priester machte eine leicht ironische, einladende Geste in Richtung Menas und f├╝gte einige Worte in einem befehlsgewohnten Tonfall hinzu. Blass und ├╝bern├Ąchtig trat Takait ins Freie. Mit einem lauten Knall schloss sich hinter ihr die T├╝r, kaum dass die T├Ąnzerin das Portal durchschritten hatte.
Menas starrte sie wortlos an. Es war Johann, der die Initiative ergriff, indem er Takait beschimpfte.
„Du bist ein Diebin und eine L├╝gnerin!“ Der alte Menas sah Johann an, als ob er bef├╝rchtete, Johann k├Ânnte sich an Takait vergreifen, so w├╝tend wie er war. „Was hast du mit dem Oasenkrokus gemacht? Gib ihn mir sofort zur├╝ck!“
„Aber, das darf ich doch nicht!“ Die Tempelt├Ąnzerin rang sichtbar nach Worten. „Es tut mir so leid! Ich wollte euch eigentlich nicht bestehlen.“
„Das hast du aber!“, rief Johann au├čer sich vor Zorn. „Warum hast du das getan?“
Ein Ausdruck von Schuldbewusstsein trat in Takaits Augen und verschwand im selben Augenblick.
„Ich konnte nicht anders!“
„Warum?“
„Johann hat ein Recht auf eine Antwort“, mischte sich Menas mit seiner gesamten priesterlicher Autorit├Ąt ein. „Warum hast du ihm den Oasenkrokus gestohlen, nachdem er und sein Bruder gro├če Strapazen auf sich genommen haben, um ihn zu besorgen?“
Takait blickte an den beiden M├Ąnnern vorbei in die Ferne. Man sah ihr an, wie verzweifelt sie nach Argumenten suchte, die zu ihren Gunsten sprachen.
„Du bist doch nur zum Stehlen zur Nordoase gereist!“, fuhr Johann die T├Ąnzerin an, bevor sie sich ihre Worte zurecht gelegt hatte, „ich habe dich durchschaut! Bestimmt hast du von Anfang an gemeinsame Sache mit den Grabr├Ąubern gemacht!“
Endlich bracht Takait das Schweigen.
„Nein, das stimmt nicht.“ Sie schaute zwischen Johann dem alten Menas hin und her. „Ich wollte im Hathor-Tempel als Priestersch├╝lerin aufgenommen werden, aber unterwegs haben mich die Grabr├Ąuber erpresst. Sie haben mitbekommen, dass mein Stiefvater mich verheiraten wollte und ich daher von zuhause ausgerissen bin. In Wahrheit bin ich vor den Grabr├Ąubern und ihren Komplizen geflohen.“
„Dabei h├Ąttest du meinen Oasenkrokus nicht mitnehmen m├╝ssen“, protestierte Johann lautstark, obwohl er sich mit schlechtem Gewissen an die finsteren Karawanenf├╝hrer erinnerte, die Takait entf├╝hrt hatten.
Die T├Ąnzerin und r├╝ckte ihre Z├Âpfchenper├╝cke zurecht, die auf dem staubigen Tempelvorplatz seltsam pomp├Âs wirkte. Johann hatte den Eindruck, dass sie dies immer tat, wenn sie nerv├Âs war.
„In der Nacht, in der ich aus der Karawanserei geflohen bin, hatte ich einen schrecklichen Alptraum, in dem Hathor mir als die blutr├╝nstige L├Âwin Sachmet erschienen ist. Sie hat mir aufgetragen, zu verhindern, dass die Zwiebel ├ägypten verl├Ąsst.“ Takait sah Johann mit ihren gro├čen, mandelf├Ârmigen Augen an. „Ich habe euch unterwegs nicht gefragt, was ihr mit der Oasenkrokus-Zwiebel vorhabt, denn ich wollte es gar nicht wissen. Aber jetzt stelle ich dir diese Frage: Wozu brauchst du den Krokus eigentlich so dringend, dass du daf├╝r durch die W├╝ste reist?“
„Um den Fluch zu neutralisieren, der auf dem Mumiensarg steht“, antwortete Menas, bevor Johann ein Wort herausbekam und berichtete dann mit wenigen Worten, was bisher alles vorgefallen war.
„Sein Vater ist am Fluch gestorben! Das ist ja schrecklich! Wenn ich das gewusst h├Ątte!“, entfuhr es Takait, aber sie machte noch immer keinerlei Anstalten, die Zwiebel herauszur├╝cken.
Johann gab sich innerlich einen Ruck und er ├Ąrgerte sich ├╝ber sich selbst, dass er sich fast h├Ątte von der Tempelt├Ąnzerin einwickeln lassen.
„Gibst du ihn mir nur freiwillig, oder ….“
Johann schreckte davor zur├╝ck, den Satz zu beenden. W├╝rde er wirklich Gewalt gegen Takait anwenden?
„Aber er darf doch ├ägypten auf keinen Fall verlassen“, erkl├Ąrte die T├Ąnzerin in einem geradezu verzweifelten Tonfall, „ich kann ihn dir daher nicht geben!“
„Das h├Ąttest du dir fr├╝her ├╝berlegen sollen, du heimt├╝ckisches Biest!“, entfuhr es Johann heftiger als er wollte, aber das Gespr├Ąch begann sich im Kreis zu drehen. „Du hast uns den Krokos ausgraben lassen und jetzt geh├Ârt er mir!“
„Nein! Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht! Ich habe meine Tat sp├Ąter bereut. Mir wurde bewusst, dass ich mich am Garten der G├Âttin Hathor vergriffen habe und ich habe Angst vor ihrer Rache bekommen“, beteuerte Takait, „ihr d├╝rft den Krokus nicht mitnehmen!“
„Warum sonst hast du uns gezeigt, wo der Krokus w├Ąchst?“, fragte Johann, ein Gedanke, der ihm zuvor seltsamerweise nicht in den Sinn gekommen war.
Mit einem r├Ątselhaften L├Ącheln, das Johann geradezu provozierte sah Takait ihm in die Augen.
„Vielleicht wollte ich, dass ihr weiterhin meine Dienste als Dolmetscher ben├Âtigt?“
„Und dann stiehlst du dann unsere Zwiebel und fliehst?“, protestierte Johann. „Du widersprichst dir doch selbst! Willst du mich eigentlich f├╝r dumm verkaufen?“
Wieder zupfte Takait an ihrer L├Âckchen-Per├╝cke.
„Wie ich schon mehrfach gesagt habe: Ich habe euch geholfen, den Oasenkrokus zu stehlen, weil ich mich ├╝ber die Hathore ge├Ąrgert habe, die mich abgewiesen hat“, wandte sie schlie├člich ein, „ich war verletzt und zornig, aber ich h├Ątte daran denken m├╝ssen, dass der Oasenkrokus ├ägypten nicht verlassen darf!“.
„Das wird er auch nicht!“
Dieser ungeheuerliche Vorschlag seines Reisegef├Ąhrten lie├č Johann verstummen, obwohl er seinen Vorrat an Schimpfworten noch lange nicht ersch├Âpft hatte.
Menas kostete Johanns Fassungslosigkeit aus. Auch Takait starrte ihn mit offenem Mund an. Erst als er sich der Aufmerksamkeit der beiden jungen Streithammel sicher war, gab der Kopte eine Erkl├Ąrung f├╝r seine Worte ab: „Der Sinn dieses Ausfuhrverbotes ist, dass kein Unbefugter den heiligen Oasen-Krokus z├╝chten darf. Wir werden hier auf der dritten Oase eine Medizin daraus zubereiten. Dagegen werden deine heidnischen G├Âtter nichts haben.“
Takait schwieg einen Augenblick lang mit angespanntem Gesichtausdruck. Auch Johann sagte nichts, da er den Eindruck hatte, dass Menas Takait verziehen hatten. Er selbst misstraute ihr jedoch noch immer, denn er konnte nicht vergessen, wie sie ihm nachts den Oasenkrokus gestohlen hatte.
„Ich werde dar├╝ber nachdenken“, meinte Takait einen Augenblick sp├Ąter und Johann war sicher, dass dies in Wahrheit nein hie├č, „aber wir sollten so schnell wie m├Âglich von dieser Oase verschwinden.“
„Nicht ohne Peter!“, protestierte Johann und Takait wurde pl├Âtzlich ganz blass.
„Wie konnte ich ihn vergessen!“, begann das M├Ądchen mit bebender Stimme, „Ich bin zu zur├╝ckgekommen, weil…“
„Nicht ganz freiwillig“, unterbrach sie Johann ungehalten.
„Doch, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich hatte vor, mit euch Kontakt aufzunehmen, denn ich habe etwas Schreckliches erfahren. Bisher habe ich es nicht ├╝ber das Herz gebracht, davon zu reden, habe ich einfach nicht glauben wollen, dass …“ Takaits Stimme wurde immer leiser und war schlie├člich kaum noch ein Fl├╝stern. „Wo ist dein Bruder Peter? Ist er in der Karawanserei geblieben?“, fragte sie nach ein einem kurzen Z├Âgern.
„Sch├Ân w├Ąre es!“, erkl├Ąrte Johann und eine schreckliche Vorahnung stieg in ihm auf. „Peter wollte hier drau├čen warten, als wir gestern im Tempel waren, aber als wir wieder herauskamen, war er verschwunden und er ist auch seitdem nicht wieder aufgetaucht. Ich habe ihn schon ├╝berall gesucht.“
„Dann haben sich meine Bef├╝rchtungen also best├Ątigt“, erwiderte Takait und sie erbleichte, „ich f├╝rchte, man hat ihn gefangen genommen, um ihn …┬á um ihn … dem Sobek zu opfern.“
„Wir m├╝ssen ihn befreien!“, rief Johann spontan aus, der vom schlechten Gewissen geplagt wurde, dass er den Bruder w├Ąhrend des Streites mit Takait fast vergessen hatte.
Immer noch totenbleich berichtete Takait, was sie im Haus des Beamten erfahren hatte.
Als sie geendet hatte, starrte Johann die T├Ąnzerin entsetzt an und war unf├Ąllig ein Wort herauszubekommen. Es sprengte seine Vorstellungskraft, dass seinem gro├čen Bruder etwas zugesto├čen sein k├Ânnte. Immer war es Peter gewesen, der ihn in Schutz genommen hatte und nun war es umgekehrt: Peter bedurfte Johanns Hilfe und er wusste nicht, was er tun sollte.
„Wir m├╝ssen etwas unternehmen … irgendetwas …“, stammelte er hilflos vor sich hin. Fast h├Ątten sich seine Augen mit Tr├Ąnen gef├╝llt
„Ich verstehe das nicht!“ Menas bedachte Takai mit skeptischen Blicken. „Wenn ich richtig informiert bin, ist dieser Sobek ein krokodilk├Âpfiger G├Âtze? Also wird er wohl am Nil verehrt werden, aber hier sind wir doch weit weg vom Strom?“
Takait sah den alten Priester mit freundlichem Bedauern an. Johann dachte sich, dass sie zu jedem nett war, nur nicht zu ihm, aber andererseits beruhte dies wohl auf Gegenseitigkeit.
„Nicht unbedingt. Es gibt Sobek-Tempel in St├Ądten weitab vom Nil, wie zum Beispiel hier, auf der dritten Oase. Zu ihnen geh├Âren heilige Teiche, in denen Krokodile gehalten werden…“
„Ich habe es die ganze Zeit gewusst, dass es hier Krokodile gibt! Was habe ich auf der ersten Oase gesagt“, unterbrach Johann automatisch und im selben Augenblick wurde ihm schmerzhaft bewusst, dass der Bruder ihn nicht h├Âren konnte und es daher v├Âllig gleichg├╝ltig war, dass er Recht behalten hatte. Bei dem Gedanken, dass man Peter eben diesen Krokodilen zum Fra├č vorwerfen wollte, schauderte es ihm.
Takait ignorierte Johanns Kommentar, aber das tat sie doch eigentlich seit dem Beginn ihrer Bekanntschaft, nur dass es ihn fr├╝her nicht im Mindesten gest├Ârt hatte.
„Die offiziellen Priester w├╝rden niemals dem Sobek oder einer anderen Gottheit Menschenopfer darbringen. Also wird dieser selbsternannte Sobek-Priester Peter sicher zum heiligen Teich bringen, wo es echte Krokodile gibt“, sagte die T├Ąnzerin nachdenklich.
„Dann sollten wir doch augenblicklich dort nach dem Rechten sehen!“, entfuhr es Johann, „Wir m├╝ssen den T├╝mpel noch vor der fanatischen Menge erreichen.
„Nicht, wenn wir daf├╝r schon wieder den Ort durchqueren m├╝ssen“, protestierte Menas und Johann fragte sich, ob der alte Priester eine gr├Â├čere Angst vor seiner angeheirateten Familie hatte als vor dem Krokodilgott und seinen Anh├Ąngern.
„Das ist viel zu gef├Ąhrlich f├╝r euch. Es wird besser sein, wenn ich allein dorthin gehe“, meinte Takait leise. Ihr Blick wanderte von Menas zu Johann. „Ich werde sehen, was ich ausrichten kann.“
„Seit wann gibst du hier eigentlich die Kommandos?“ fragte der alte Priester mit einem in dieser Situation v├Âllig inad├Ąquaten am├╝sierten L├Ącheln. „Das erinnert mich doch unangenehm an jemanden! Sind eigentlich alle ├Ągyptischen Frauen so herrschs├╝chtig?“
„So war das nicht gemeint“, erwiderte Takait beschwichtigend, „aber wollt ihr riskieren, dass man euch ebenfalls dem Sobek opfert? Auch ihr seid schlie├člich Fremde!“
Johann musste zugeben, dass Takaits Worte nur allzu vern├╝nftig klangen. Es w├╝rde Peter auch nichts n├╝tzen, wenn sie ihm bei den Krokodilen Gesellschaft leisteten, aber er konnte doch seinen Bruder nicht einfach im Stich lassen!
„Das kommt nicht in Frage! Ich komme mit“, protestierte er daher.
Der Kopte ├Âffnete den Mund, wie Johann vermutete um ihm dies auszureden, aber Johanns brachte ihn mit einem w├╝tenden Blick zum verstummen.
Takait nickte, aber sie machte alles andere als einen gl├╝cklichen Eindruck.
„Ich habe bef├╝rchtet, dass du so reagieren w├╝rdest. Aber schlie├člich ist er dein Bruder. Wenigstens kannst du – wenn es sein muss - eher als Menas unauff├Ąllig in der Menge untertauchen.“
Johann fand es nett von Takait, dass sie nicht gesagt hatte, dass er in seiner verdreckten Beduinenkluft, zur Not als besonders heruntergekommener Ägypter durchgehen konnte, obwohl sie sicherlich genau dies gemeint hatte.
„Aber, was wollt ihr zu zweit ausrichten?“, fragte Menas, der bezeichnenderweise gar nicht erst vorgab, sich den beiden andern anschlie├čen zu wollen, „Dieses Unterfangen erscheint mir ziemlich aberwitzig!“
Takait sah ihn mit einem gezwungenen L├Ącheln an.
„Auch zu dritt k├Ânnen wir es nicht mit einer aufgebrachten Volksmenge aufnehmen.“┬á
Johann wurde es immer mulmiger zumute und pl├Âtzlich kam ihm der Gedanke, ob die T├Ąnzerin im Tempel nicht n├╝tzlicher sein konnte.
„Willst du nicht lieber die Priester der Neith um Hilfe bitten?“
„Das habe ich schon vergeblich versucht“, erwiderte Takait, aber Johann glaubte ihr nicht recht. „Sie wollen nicht eingreifen. Im Gegenteil, ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie das Menschenopfer billigen, Hauptsache, sie m├╝ssen es nicht selbst vollstrecken!“┬á┬á
„Trotzdem macht es keinen Sinn, was ihr vorhabt“, widersprach Menas halbherzig, der offenbar weder bereit war, Johann allein gehen zu lassen, noch ihm Gesellschaft zu leisten, „Ich werde daher in der Zwischenzeit versuchen, in der Karawanserei Verb├╝ndete zu finden.“
„Von mir aus“, entgegnete Johann, dem dieser Vorschlag wie eine ziemlich faule Ausrede erschien, „aber nun haben wir genug Zeit mit Reden verschwendet.“
„Ich glaube nicht, dass wir heute jemandem am Teich begegnen“, sagte Takait nachdenklich, den Blick dabei auf Johann gerichtet. „Morgen hingegen ist der Festtag des Sobek. Dann werden sie handeln.“
„Das h├Ąttest du auch gleich sagen k├Ânnen“, protestierte Johann und Menas nickte zustimmend, aber er wusste nicht, ob er sich freuen sollte, dass er noch einen Tag Galgenfrist hatte.
*
Auf dem R├╝ckweg vom Tempelteich des Sobek-Tempel, wo sie erwartungsgem├Ą├č keinen Menschen angetroffen hatten, redete Johann solange auf Takait ein, bis diese sich endlich bereit erkl├Ąrte, eine Medizin aus der Oasenkrokus-Zwiebel zu bereiten. Dabei betonte Johann immer wieder nachdr├╝cklich, dass sie allein daf├╝r verantwortlich war, dass Peter nun in Lebensgefahr schwebte, denn schlie├člich hatten sich sein Bruder und er nur deshalb von der Karawane entfernt, weil sie den Oasenkrokus gestohlen hatte.┬á
„Von mir aus“, murmelte Takait schlie├člich, als sie die Karawanserei vor sich sahen, „wir haben heute Nachmittag ja noch etwas Zeit.“┬á┬á
„Was brauchst du daf├╝r?“, fragte Johann und er hoffte, dass sich diese Ingredienzien tats├Ąchlich in diesem W├╝stenkaff auftreiben lie├čen. Vor seinem inneren Auge sah er die wohleingerichtet Schwanen-Apotheke in seiner Heimatstadt, in der ein getrocknetes Krokodil an der Decke hing und wo man Mumia als Heilmittel anbieten wollte. Wenn der Onkel w├╝sste, wo sie gerade waren und, dass man Peter den heiligen Krokodilen opfern wollte! Mit einem leisen Seufzer dachte Johann, dass es besser war, dass seine Familie, dies nicht einmal ahnte.
„Nur ganz einfache Dinge, die ich in der K├╝che der Karawanserei besorgen kann“, erkl├Ąrte Takait, was Johann ziemlich erstaunte, denn er hatte mit exotischen Zutaten, wie Nilkr├Âten oder Drachenz├Ąhnen gerechnet. Ob besorgen wohl ein Euphemismus f├╝r stehlen war? Oder womit wollte Takait zahlen?
„Warte bitte einen Augenblick!“, sagte Takait, kaum das sie das Portal der Karawanserei durchschritten hatten, „ich gehe nur schnell in die K├╝che. Wir treffen uns dann im Innenhof.“
Fast h├Ątte Johann ihr nachgerufen, ob sie ihn schon wieder hereinlegen wollte, aber vielleicht meinte sie es ausnahmsweise ehrlich. Schlie├člich hatte Johann w├Ąhrend der Reise den Eindruck gehabt, dass sie Peter mochte. Trotzdem blieb Johann vorsichtshalber im Eingang stehen, damit Takait nicht heimlich wieder verschwinden konnte.
Gl├╝cklicherweise waren diese Karawansereien stets mit hohen Mauern umgeben und in der Regel besa├čen sie nur einen einzigen Eingang. Sie waren so angelegt, dass sie sich gut gegen ├ťberf├Ąlle von R├Ąubern verteidigen lie├čen, ein Umstand, den die Reisenden beim bevorstehenden Angriff der feindlichen Armee auszunutzen gedachten. Schon hatte man Sands├Ącke neben dem Hauptportal gestapelt und die wenigen, kleinen Fenster in der Au├čenwand mit Brettern vernagelt.
Der Wind, der Johann ins Gesicht wehte trug den Gestank der Kamele und des alten Strohs in den St├Ąllen zu ihm und er fragte sich schon, ob es nicht doch einen Geheimgang ins Freie gab, den Takait benutzte haben konnte, als die der Tempelt├Ąnzerin mit einem Tablett in der Hand vorbeihuschen sah. Ganz pl├Âtzlich hielt sie in der Bewegung inne und drehte sich nach Johann um, den sie offenbar erst jetzt bemerkte.
„Warum wartest du drau├čen vor der T├╝r?“, fragte sie erstaunt.
„Drinnen ist die Luft so schlecht“, schob Johann als Vorwand vor.
Takait sch├╝ttelte lachend den Kopf.
„Wenn du in einem dieser H├Ąuser aufgewachsen w├Ąrst“, Takait machte eine Kopfbewegung in Richtung der gegen├╝berliegenden Bruchbuden, dann w├╝rdest du das gar nicht mehr wahrnehmen.“
„Deshalb willst du also unbedingt Priesterin werden?“
Johann achtete sorgf├Ąltig auf ihre Reaktion, aber diese fiel anders aus als er erwartet hatte: Wieder lachte Takait, was er ziemlich befremdlich fand.
„Wenn du w├╝sstest, unter welchen Bedingungen die Frauen hier leben, w├╝rdest du keine derartigen Fragen stellen!“
Auch diese Antwort verbl├╝ffte Johann, der bisher angenommen hatte, dass Takait sehr religi├Âs war. Da er nicht sicher war, ob ihr Vorwurf auch ihn umfasste, nahm er der T├Ąnzerin das Tablett ab, obwohl dieses - wie er dabei feststellte - ganz leicht war. Takait ging voran und Johann folgte, bis sie eine der Feuerstellen erreichten, an denen die reicheren Reisenden abends Hammelfleisch grillten.
Takait ging in die Hocke und entfachte mit wenigen, einge├╝bten Handbewegungen ein Feuer. Am Anfang der Reise hatte Peter ihr bei solchen Gelegenheiten stets Z├╝ndh├Âlzer angeboten, aber f├╝r Takait h├Ątte man diese nicht erfinden m├╝ssen. Sie kam auch mit ihrem h├Âlzernen Ger├Ąt zurecht, das aus einer Art Bodenplatte mit einer Vertiefung bestand, in der ein Holzstab zwischen den Handfl├Ąchen gequirlt wurde.┬á
„Wo ist eigentlich Menas?“, fragte sie, als die Flammen auf das Brennholz der Lagerstelle ├╝bersprangen.
„Keine Ahnung“, entfuhr es Johann, der sich in der Zwischenzeit zu Takait auf den staubigen Boden gehockt hatte, „das ist mir auch ziemlich egal, eine gro├če Hilfe ist er heute sowieso nicht gewesen!“
„Ja! Ganz im Gegenteil!“ Takait seufzte. „Ich habe nur nachgefragt, weil ich ihn momentan gar nicht gebrauchen kann, denn ich muss einige Beschw├Ârungsformeln sagen, damit der Trank wirksam ist.“
Johann lie├č seinen Blick ├╝ber den Innenhof schweifen, auf dem fast alle G├Ąste der Karawanserei – es waren nicht mehr als zwanzig - wild diskutierenden in Kleingruppen herumstanden, aber Menas war nicht darunter.
„Wahrscheinlich ist er drinnen und schl├Ąft seinen Rausch aus“, meinte Johann schlecht gelaunt. Oder er hat wieder mit dem Trinken begonnen, f├╝gte er im selben Augenblick innerlich hinzu.
Sehr gut“, murmelte Takait, w├Ąhrend sie einen Topf mit Wasser auf das Feuer stellte.
„Hast du das schon einmal gemacht?“, fragte Johann vorsichtig nach, da er keine Lust hatte, einen falsch zubereiteten Zaubertrank zu probieren.
„Keine Sorge, das Rezept ist ganz einfach“, beruhigte ihn Takait, „und die Formeln hat mir dieser schreckliche Oberg├Ąrtner des Tempels der ersten Oase verraten, der mich die ganze Zeit mit seinen Ann├Ąherungsversuchen bel├Ąstigt hat.“
Als das Wasser wallte, goss Takait etwas davon in einen kleinen Krug und zog die W├╝stenkrokus-Zwiebel aus dem buntgemusterten Beutel, die sie am G├╝rtel trug. Diesen legte sie vorsichtig in die Kanne und Johann f├╝hlte sich an den Hustensaft erinnert, den die Mutter zuzubereiten pflegte, wenn die Jungs sich eine Erk├Ąltung eingefangen hatten. Takait streute einige der Kr├Ąuter, die sie aus der K├╝che mitgebracht hatte in den Sud. Dann holte sie den Topf vom Feuer und sch├╝ttete das ├╝bersch├╝ssige Wassers in den Sand. Bevor Johann sich einen Vers daraus gemacht hatte, was Takait damit bezweckte,┬á hatte sie die kleine Kanne in den Topf gestellt und diesen zur├╝ck auf das Feuer gebracht.
Jetzt wird es ernst! dachte Johann. Er beugte sich neugierig vor und versp├╝rte zugleich ein flaues Gef├╝hl im Magen. Das war wie der Teufelspakt in Goethes Faust!
Der Inhalt des Kruges im Wasserbad begann zu dampfen und Takait murmelte leise Zaubersprüche auf Ägyptisch vor sich hin, die Johann zu seinem Bedauern nicht verstand.
Er fand ihre Stimme so melodisch wie eine Harfe, war aber entt├Ąuscht dar├╝ber, dass nichts Spektakul├Ąres geschah: Keine gr├╝ne, brodelnde Suppe, keine fluoreszierender, wabernder Nebel, kein Schwefelgestank und keine Geisterstimmen! So n├╝chtern hatte er sich die Magie nicht vorgestellt. Aber Hauptsache, die Medizin erf├╝llte ihren Zweck!
Schlie├člich nahm Takait den Topf vom Feuer und hob den kleinen Krug heraus. Mit einem Holzst├Ąbchen stocherte sie darin herum, um sich zu vergewissern, dass die Zwiebel gar war. Dann goss sie den Sud durch einen Trichter in eine kleine Flasche, die sie anschlie├čend sorgf├Ąltig verkorkte.
„├ťbermorgen ist Vollmond“, erkl├Ąrte sie feierlich, w├Ąhrend sie Johann die Medizin ├╝berreichte, „dann ist die Medizin wirksam.“
„Das wurde aber auch Zeit!“, brummte eine tiefe Stimme von hinten.
Johann h├Ątte vor Schreck das Fl├Ąschchen fast in den Sand fallen lassen und Takait stie├č einen leisen Schrei aus.
„Menas! Wie konnten Sie uns nur so erschrecken!“, entfuhr es Johann. „Es sind schon Menschen aus geringeren Anl├Ąssen tot umgefallen!“
Der alte Kopte blickte finster auf die beiden jungen Leute herunter.
„Ich kann auch wieder gehen, wenn ich die traute Zweisamkeit st├Âre!“
Takait err├Âtete heftig und Johann sprang auf.
„Welche Laus ist Ihnen denn ├╝ber die Leber gelaufen?“, fragte er, als er mit Menas auf gleicher Augenh├Âhe war, denn so hatte er den bed├Ąchtigen Kopten noch nie erlebt.
„Ach, nichts besonderes“, murmelte dieser in seinen Bart hinein. Dann sah er Johann besorgt in die Augen. „Aber, falls wir lebend diese Oase verlassen sollten, muss ich ein ernstes W├Ârtchen mit dir reden.“┬á
Johann wollte nachfragen, was um Himmels Willen er damit meinte, aber Menas drehte sich br├╝sk um und durchma├č mit gro├čen Schritten den Innenhof der Karawanserei.┬á Nach einer Schrecksekunde, beschloss Johann, Menas zur Rede zu stellen. Er sollte augenblicklich verraten, was er mit ihm zu besprechen hatte und sich nicht nur in bedeutungsvollen Andeutungen ergehen! Johann folgte dem alten Mann so schnell, dass er gerade nicht rennen musste, aber als er durch die Eingangst├╝r der Karawanserei treten wollte, stie├č er mit einem Mann zusammen. Mit einem unterdr├╝ckten Fluch wollte Johann eine Entschuldigung vor sich hinmurmelnd an dem Mann vorbeigehen, aber dieser hielt ihn am ├ärmel fest.
„Warum so eilig, junger Effendi?“, fragte die leicht ironische Stimme des Mannes, den er Saladin nennen sollte, „Haben Sie keine Zeit, mit einem alten Freund ein paar Worte zu wechseln?“
Johann fragte sich, ob Menas so schnell verschwunden war, weil er dem Kaufmann nicht begegnen wollte.
„Ich wusste gar nicht, dass Sie in der Karawanserei wohnen“, entfuhr es Johann, der sich noch im Unklaren dar├╝ber war, was er von dieser Wendung halten sollte.
„Unsere Karawane ist mittlerweile eingetroffen und ich habe mich zu meinen Kollegen gesellt“, erkl├Ąrte Saladin mit einem verbindlichen L├Ącheln.
„Woher kennen Sie eigentlich den alten Priester Menas?“, fragte Johann, der sich ziemlich dar├╝ber ge├Ąrgert hatte, dass der Kopte ihm eine Antwort auf diese Frage schuldig geblieben war.
„Ich kenne jeden, das geh├Ârt zu meinem Beruf“, entgegnete der Kaufmann mit vollendeter H├Âflichkeit und wieder fragte sich Johann, was sein so genannter Beruf noch alles umfassen mochte.
Au├čerdem gefiel ihm gar nicht, dass die Karawane bereits die dritte Oase erreicht hatte, denn er hatte hier noch eine Menge zu erledigen.
„Wann geht es wieder zur├╝ck nach Alexandria?“, fragte er daher bang.
„F├╝r den restlichen R├╝ckweg haben wir neue Karawanenf├╝hrer angeheuert und wir sind┬á mit ihnen ├╝bereingekommen, dass wir den Kamelen nur einen Tag Ruhe g├Ânnen werden. Dann brechen wir auf, bevor der Krieg beginnt. Ich gehe doch davon aus, dass ihr werter Bruder und Sie sich uns dann anschlie├čen werden?“
Eine Welle des Elends schwappte ├╝ber Johann zusammen. War er den nur vom Ungl├╝ck verfolgt? W├╝rden die anderen ohne sie aufbrechen, falls es ihm ├╝berhaupt gelingen sollte, den Bruder zu befreien. Dann fiel ihm die Mumie ein und ihm wurde so ├╝bel, dass er sich am T├╝rrahmen festhalten musste.
 
Das Grab
Vorsichtig streifte Johann mit der Rechten die ├äste eines Berberitzenstrauchs beiseite, um sich nicht an den Stacheln sein Gewand zu zerrei├čen. Dann lag endlich die Grabanlage vor ihm, die er solange gesucht hatte, das Ziel seiner Expedition nach ├ägypten. So eindrucksvoll die Anlage war, sich Johan sich nicht lang mit dem eigentlichen Geb├Ąude auf, sondern - wie von einer unsichtbaren Macht angezogen - stieg er mit klopfendem Herzen steile Treppen und dunkle, absch├╝ssige G├Ąnge hinab.
Seine Fackel flackerte ungleichm├Ą├čig und warf ein gespenstisches Licht auf die nackten Steinw├Ąnde, aber noch immer hatte er sein Ziel noch nicht erreicht. Er war bestimmt zehn Minuten durch diesen steinernen, unterirdischen Irrgarten gelaufen, als sich endlich am Ende des Wegs der Korridor weitete. Johanns Schritte beschleunigten sich immer mehr, bis er fast rannte. Nachdem er ein trapezf├Âmiges Portal durchschritten hatte, gelangte er schlie├člich in einen weitr├Ąumigen Saal, dessen Decke von mindestens zwanzig aus dem Fels gehauenen S├Ąulen getragen wurde, die voneinander in Durchmesser und Form so unterschiedlich waren, dass in Johanns automatisch an einen versteinerten Wald denken musste.
In die R├╝ckwand des Raums war - zwischen mehreren Registern von kleinformatigen Alltagsszenen - die ├╝berlebensgro├če Figur einer sch├Ânen Frau eingemei├čelt. Die Herrin der Anlage konnte so alle Arbeiten ├╝berschauen, die von im kleineren Ma├čstab wiedergebenen Figuren ausgef├╝hrt wurden.┬á
Als sein Blick das Wandbild eher zuf├Ąllig streifte, wandte die Frau sich ihm zu und Johann fragte sich, ob seine ├╝berreizten Sinne ihm einen Streich spielten. Obwohl er wusste, dass die unm├Âglich war, h├Ątte er wetten m├Âgen, dass die Herrin ihn mit lebendigen, mandelf├Ârmigen Augen anschaute. Der Anflug eines L├Ąchelns huschte ├╝ber ihr Gesicht und diesmal war Johann sich sicher, dass dies keine Illusion sein konnte, denn wenige Augenblicke zuvor hatte eine tiefe Melancholie in ihrem Blick gelegen.
Mit einer grazilen Bewegung ihrer feinen Hand mit den langen Fingern deutet sie auf die gegen├╝berliegende Wand der Kammer. Dort war riesige T├╝r mit fein behauenen Simsen in den Fels gemei├čelte. Sie bestand aus Stein und f├╝hrte nirgendwohin. Johann erinnerte sich gelesen zu haben, dass diese Scheint├╝ren die Welt der Lebenden mit der der Toten verbanden.
„Tritt ein, Fremder! Ich habe dich schon erwartet!“, forderte ihn pl├Âtzlich eine melodische, weibliche Stimme auf.
Johann blickte sich erschrocken um. War Ihm jemand unbemerkt gefolgt? Mit seiner Fackel leuchtete Johann alle Winkel der Kammer aus, doch er war allein.
„Tritt ein, Fremder!“
Es bestand nicht der geringste Zweifel daran, dass dies keine Bitte war, sondern ein Befehl.
Johann realisierte, dass nur die Herrin des Grabes zu ihm gesprochen haben konnte. Oder war die Stimme von jenseits der Wand zu ihm gedrungen?
Mit einem seltsamen Geschmack im Mund schritt er auf das steinerne Portal mit zu, aber er tat dies ganz langsam, denn er hielt es f├╝r ein sinnloses Unterfangen, mit dem Fu├č gegen den harten Stein zu treten. Als er das Portal erreicht hatte, blieb er unschl├╝ssig stehen.
„Tritt ein“, forderte ihn die Stimme erneut auf, barscher, dr├Ąngender und Johann machte einen vorsichten Schritt in Richtung T├╝r.
Im gleichen Augenblick h├Ârte er ein Knirschen, zuerst leise, dann immer lauter. Johann hielt erschrocken in der Bewegung inne. Das ist unm├Âglich, durchfuhr es ihn. Doch vor seinen ungl├Ąubigen Augen ├Âffnete sich die in den Stein gemei├čelte T├╝r wie von Geisterhand und produzierte dabei ein knirschendes Ger├Ąusch, das in der Gruft widerhallte.
Johann fragte sich, ob er dabei war, seinen Verstand zu verlieren, aber dann gab er sich einen Ruck, denn er war neugierig darauf, was sich wohl hinter der Scheint├╝r befinden mochte. Au├čerdem wollte er nicht den Zorn der Besitzerin der mysteri├Âsen Stimme zu sp├╝ren bekommen.
Mit zugekniffenen Augen durchschritt er den T├╝rrahmen. Ihm war dabei ├Ąu├čerst unwohl, da er bef├╝rchtete, die zuschlagende Steint├╝r k├Ânnte ihn zerquetschen, aber nichts dergleichen geschah. Kaum hatte er den Fu├č auf den Boden gesenkt, schlug der T├╝rfl├╝gel hinter ihm mit einem dumpfen Knall zu.
Johann wirbelte erschrocken um seine eigene Achse, aber es war zu sp├Ąt: Die Scheint├╝r war verschwunden und Johann fand sich in einer n├Ąchtlichen Landschaft wieder, die von einem breiten Stromes durchschnitten wurde. An dessen Ufer lag ein langes Schilfboot mit zwei Reihen Ruderern, die sich leise wispernd unterhielten. Ansonsten herrschte eine geradezu gespenstische Stille: Kein Vogelgesang war zu h├Âren, keine Zikaden musizierten im finsteren Schilf und keine geisterhaften Insekten flogen summend von einer bleichen Bl├╝te zur n├Ąchsten.
Die Dunkelheit, die hier herrschte war mehr als die Abwesenheit von Licht. Sie hatte ihre eigene Qualit├Ąt, aber trotzdem konnte Johann seltsamerweise tief in die Landschaft blicken und er erkannte auf dem anderen Ufer des Stroms eine gespenstische Wiese mit farblosen Blumen.
Das sind Asphodelischen Feldern, wo der der bleiche Asphodill w├Ąchst und Orion nach geisterhaftem Wild jagt, durchfuhr es ihn. In dieser trostlosen Region gingen die Seelen von Heroen im Gedr├Ąnge der Fr├╝hverstorbenen umher. ┬á
Eine dunkle Wolke kreiste in weiten B├Âgen ├╝ber dem Feld. Erst als sie n├Ąher kam, erkannte Johann mit gemischten Gef├╝hlen, dass es sich um einen Schwarm von Flederm├Ąusen handelte, der aus Tausenden von Tieren bestehen musste.
Hinter ihnen, fern am dunklen Horizont, erhob sich ein Palast von modrig gr├╝ner Farbe, der aussah als w├╝rde er bald in sich zusammenfallen. Durch seine Fenster drang blasses Licht und Johann fragte sich, ob dies der Wohnsitz des Hades war. Im gleichen Augenblick ├Âffnete sich das riesige Portal des Palastes und ein schwarzer Wagen sprengte heraus, gezogen von vier Rappen. Der meistgehasste aller G├Âtter schien selbst tot zu sein, war ein dunkler Schatten, kaum materieller als die grauen Phantome, ├╝ber die er herrschte.
├ťberall ist es besser als hier, dachte Johann erschrocken und hastete zu der schwankenden Barke, die offenbar auf ihn gewartet hatte, denn kaum war er an Bord gesprungen, stie├čen die Ruderer das Schilfboot vom Ufer ab. Das schwarze Wasser kr├Ąuselte sich unter dem Schlag ihrer Paddel. Ab und zu waren in der Tiefe undeutliche Schemen zu sehen, aber Johann vermochte nicht zu erkennen, worum genau es sich handelte.
Vorsichtig streckte Johann seine Hand aus und tastete nach der Bordkante. Ganz langsam richtete er sich auf, denn Gischt hatte das Schilfboot schl├╝pfrig gemacht. Mehr kriechend als aufrecht gehend, schob er sich im schmalen Mittelgang zwischen den Ruderern nach vorn, bis er den Bug des Schilfbootes erreichte. Dort beugte er sich ├╝ber Bord und schaute in die wirbelnden Wogen. Was f├╝r ein Geheimnis schlummerte unter ihrer Oberfl├Ąche?
Langsam wurde das Ufer immer felsiger, bis sie eine regelrechte Berglandschaft durchfuhren. Im Stein klafften hier und da die dunklen Eing├Ąnge von H├Âhlen, aus denen heulende Ger├Ąusch drangen. Johann vermutete, dass sie von Tieren verursacht wurden. Was f├╝r gr├Ąssliche Kreaturen in den Schl├╝nden hausten, wollte er allerdings lieber gar nicht wissen. Er versuchte, seine Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren, aber er konnte diese schaurigen Laute nicht einfach ausblenden.
Johann fragte sich noch, wohin wohl diese n├Ąchtliche Bootsfahrt f├╝hren mochte, als er┬á einen kleinen H├╝gel sah, der sich in einer Talsenke erhob. Die Ruderer trieben die Barke immer weiter den schwarzen Strom hinab und als der niedrige H├╝gel n├Ąher kam, zeigte sich, dass dieser gelb-braun gescheckt war. Johann schwante nichts Gutes, aber er konnte seinen Blick nicht von dem schuppigen Etwas lassen, das bestimmt keine normale Bodenerhebung war.
Am liebsten h├Ątte Johann das Kommando zur R├╝ckfahrt gegeben h├Ątte, aber die Ruderer vermieden geradezu demonstrativ jeden Blickkontakt mit ihm.
„Wohin um Himmels Willen fahren wir?“, schrie er sie an. Jedoch erhielt er keine Antwort.┬á Wahrscheinlich sprachen die Ruderer nur ├Ągyptisch oder sie hatten Weisung, nicht mit ihrem Passagier zu sprechen.
Pl├Âtzlich h├Ârte Johann vor sich etwas wie das Zischen einer Schlange, nur sehr viel lauter. Seine Augen folgten dem Ger├Ąusch. Als er dessen Quelle gefunden hatte, glaubte er,┬á jeden Augenblick zu Eis erstarren zu m├╝ssen: Von der Spitze des H├╝gels funkelten ihn die kalten, gr├╝nen Augen eines Reptils b├Âsartig an. Der vermeintliche H├╝gel war in Wahrheit eine riesige zusammengerollte Schlange mit dunklen Flecken auf einem gelben K├Ârper, die sich zu regen begonnen hatte!
Lautlos glitt sie ins schwarze Wasser und Johann erinnerte sich mit Schrecken an das riesige, aufgerissene Schlangenmaul, dass er im Tempel der ersten Oase durchschreiten musste. Warum nur hatte er Takait nicht nach dessen Bedeutung gefragt?
Der Lindwurm rollte sich langsam auf und seine zahlreichen Windungen verschwanden nacheinander im Wasser, bis sein gesamter schuppiger Leib v├Âllig in den dunklen Fluten des Stroms untergetaucht war.
Johann atmete erleichtert auf. Das war noch einmal gut gegangen! Aber das Blut gerann ihm fast in den Adern, als ganz pl├Âtzlich der riesige Kopf der Schlange direkt vor dem leichten Schilfboot auftauchte. Sie starrte ihn mit ihren t├╝ckischen gr├╝nen Augen an. Dann richtete sich ihr Leib blitzschnell auf. Ihr Kopf stie├č vor, ihre lange gespaltene, Zunge schoss zwischen langen spitzen Z├Ąhnen heraus und verschwand wieder in ihrem Maul.
Johann schrie vor Schreck laut auf. Bei dem Versuch, sich auf den Boden zu werfen, rutschte er auf dem glitschigen Brettern aus und w├Ąre fast ├╝ber Bord getaumelt, aber es gelang ihm im letzten Augenblick, die Kante des Schilfboots zu umklammern. Als er wieder nach vorn sah, hoffte er inst├Ąndig, dass das Untier verschwunden sein m├Âge, aber die Barke nahm weiterhin mit unverminderter Geschwindigkeit Kurs auf die riesige Schlange.
„Seid ihr denn wahnsinnig? Dreht sofort um!“, br├╝llte Johann die Ruderer in hilfloser Wut an, aber diese steuerten sehenden Auges direkt in das aufgerissene Maul des Lindwurms, das vor ihnen im Wasser aufragte, wie ein mit Z├Ąhnen bewehrter Tunnel. Schon glitt die Barke zwischen den Rei├čz├Ąhnen des Untiers hindurch und ├╝ber den wasserumsp├╝lten Unterkiefer.
Die Schlange schloss ganz pl├Âtzlich das Maul und schon erwartete Johann, ihren langen Hals herunterzufallen, als er realisierte, dass die Barke auf ihrer Zunge wie auf einer Sandbank lag. Zitternd vor Entsetzen drehte Johann sich um und warf zwischen den Giftz├Ąhnen hindurch einen letzten, verzweifelten Blick auf den dunklen Strom.
Eine neue Welle des Grauens ├╝berkam ihn, als das Boot nach unten absackte. Die Ruderb├Ąnke ├Ąchzten und zwei Seeleute wurden ├╝ber Deck geschleudert. Einen Augenblick lang, hatte Johann den Eindruck, als sei das Boot in der Mitte geborsten, aber die Vertauung der Schilfsb├╝ndel war nicht gerissen.┬á
Wieder sackte das Boot nach unten, diesmal noch schneller. Johann schloss die Augen machte sich innerlich auf einen Sturz ins Bodenlose gefasst.
Einige Sekunden vergingen in qualvoller Langsamkeit. Dann blinzelte Johann, da er die Ungewissheit nicht mehr ertrug, sie mittlerweile schlimmer fand als den schrecklichsten Anblick. Gel├Ąhmt vor Entsetzen starrte er auf die Fangz├Ąhne der riesigen Schlange, die ihr schreckliches Maul wieder weit aufgerissen hatte. Sie war mitten in der Bewegung erstarrt. Dann sog sie ganz langsam die eisige Luft ein, die den schwarzen Raum erf├╝llte und ganz pl├Âtzlich spie sie das Boot im weiten Bogen aus. Johann wurde von grellen Sonnenstrahlen geblendet als die Barke wieder zu Boden fiel und fragte sich verzweifelt, woher all dies Licht pl├Âtzlich kam.
*
„Wo ist die Schlange?“, rief er aus und er w├Ąre am liebsten davongelaufen, doch er wusste nicht wohin.
Er rieb sich die Augen und brauchte einige Sekunden lang, um zu begreifen, dass er auf seinem verlausten Lager in der Karawanserei der dritten Oase lag.
„Schrei doch nicht so!“, h├Ârte er die tiefe Stimme seines Reisegef├Ąhrten Menas sagen, der ihn fest an der Schulter gepackt hatte. „Du hast nur getr├Ąumt.“
Schwer atmend und noch etwas panisch Johann schaute sich um. Sein Blick streifte die grimmigen Gesichter einiger Kaufleute, die sich um sein Lager versammelt hatten. Menas richtete auf Arabisch einige beschwichtigende Wort an sie und die H├Ąndler entfernten sich wieder, wobei sie Dinge vor sich hinbrummten, die sich anh├Ârten wie „der hat komplett den Verstand verloren“.
Johann schloss die Augen, da er sich sch├Ąmte. Wie gut, dass keiner der Kaufleute ihn verstanden haben konnte, falls er im Schlaf geredet haben sollte! Aber Takait hatte ihn verstanden! Was mochte sie wohl nun von ihm denken? Beunruhigt lie├č Johann seinen Blick durch den Schlafsaal schweifen, aber er fand die Tempelt├Ąnzerin nicht.
„Wo ist Takait?“, fragte er den alten Priester, w├Ąhrend er sich von seinem Lager aufrappelte.
„Weg“, brummte Menas, „keine Ahnung wohin, ist aber auch besser so.“ Er schaute Johann von der Seite an. „Bist du wieder in Ordnung?“
Johann nickte, obwohl er noch ziemlich mitgenommen war.
„Was genau hast du eben getr├Ąumt?“, fragte der Reisegef├Ąhrte mit kaum verhohlener Neugier.
„Ich habe von der Unterwelt getr├Ąumt“, erkl├Ąrte Johann und kam sich uns├Ąglich albern vor. „Zweifellos liegt es an den unz├Ąhligen falschen B├╝chern, die ich gelesen habe, dass ich beweilen derartige Tr├Ąume habe.“
„Von der Unterwelt? Es geht sicher auch etwas pr├Ąziser?“
Mit anfangs leicht zitternder Stimme erz├Ąhlte Johann seinen schrecklichen Traum, aber langsam erwachten seine Lebensgeister wieder. Durch die kleinen Fenster des Saals drangen Sonnenstrahlen, in denen die Staubk├Ârner tanzten. Offenbar war es bereits mindestens acht Uhr Morgens.
„Lass uns lieber fr├╝hst├╝cken. Ich wollte eigentlich gar nicht so lang schlafen!“, schlug er daher seinem Reisegef├Ąhrten vor.┬á┬á
„Dagegen habe ich keinerlei Einw├Ąnde“, erwiderte Menas, „aber w├Ąhrend des Fr├╝hst├╝cks erz├Ąhlst du mir noch einmal ganz genau, was du im Traum gesehen hast.“
„Das habe ich doch eben bereits getan!“, protestierte Johann, der sich fragte, ob der alte Mann schwerh├Ârig war.
„Du hast mir nicht alles erz├Ąhlt! Im Traum hast du n├Ąmlich etwas von einem Grab gefaselt und daran bin ich interessiert.“
„Von mir aus“, entfuhr es Johann, „aber ich glaube nicht, dass uns dies hilft, meinen Bruder zu befreien.“
„Du hast noch eine andere wichtige Aufgabe zu erledigen. Denk dran, dass du nach ├ägypten gefahren bist, um die Mumie in ihr Grab zur├╝ckbringen“, erinnerte ihn Menas und Johann nickte gedankenverloren.
Das Fr├╝hst├╝ck verdiente eigentlich nicht diesen Namen: Als Johann im Innenhof der Karawanserei einen Keramikbecher ziemlich ungenie├čbaren, kalten Kaffees trank und dazu ein paar unertr├Ąglich s├╝├če Datteln verzehrte, stieg vor seinem inneren Auge unweigerlich der reichlich gedeckte Fr├╝hst├╝ckstisch im Elternhaus auf. Er rief sich ins Ged├Ąchtnis, dass er dankbar sein musste, dass die Kunst der Kaffeezubereitung in dieser Karawanserei ├╝berhaupt praktiziert wurde, denn den alten ├ägyptern war die Kaffeebohne unbekannt. Sie hatten daher morgens lauwarmes Bier getrunken.
„Also, was hast du vorhin getr├Ąumt? Bitte erz├Ąhl mir jede Einzelheit, an die du dich erinnern kannst, vor allem wenn sie das Grab betrifft“, insistierte Menas und Johann verfluchte das erstaunlich gute Ged├Ąchtnis des alten Mannes.
Er kippte den restlichen Kaffee herunter und verzog wegen des bitteren Nachgeschmacks, den dieser zur├╝cklie├č, das Gesicht. Dann begann er – obwohl es ihm bei der Erinnerung schauderte - seinen Traum erneut zu schildern.┬á
„Wo sagtest du hat sich dieses Grab befunden?“, fragte Menas, der mit angehaltenem Atem gelauscht hatte.
„Keine Ahnung!“, erwiderte Johann ungehalten. Schlie├člich besa├čen Tr├Ąume ihre ganz eigenen Realit├Ąten. „Es wird wohl irgendwo in ├ägypten gewesen sein.“
„Etwas Genauer kannst du das nicht sagen?“
Die Augen des alten Mannes funkelten ihn vorwurfsvoll an und Johann ├╝berlegte, welche Laus Menas wohl ├╝ber die Leber gelaufen war.
„Wahrscheinlich war es auf dieser gottverdammten Oase“, sagte er aufs Geratewohl, weil er vermutete, dass sein Gegen├╝ber genau diese Antwort h├Âren wollte.
„Aber wo auf dieser Oase?“
Der Tonfall des Kopten war dr├Ąngend. Doch Johann zuckte nur mit den Schultern, da er sich beim besten Willen nicht entsinnen konnte. Schlie├člich hatten in seinem Traum keine Wegweiser herumgestanden. Noch immer blickte ihn Menas erwartungsvoll an.
„Versuch, dich zu konzentrieren!“
Johann tat sein bestes, aber er konnte sich einfach nicht entsinnen, wie er in seinem Traum zu dem Grab gelangt war.
„Irgendwo unter der Erde, wo Gr├Ąber eben so sind“, meinte er schlie├člich v├Âllig enerviert. „Aber warum fragen Sie? Schlie├člich haben Sie doch vorhin selbst gesagt, dass es nur ein Traum war.“
Johann hoffte, dass Menas ihn endlich als hoffnungslosen Fall aufgeben w├╝rde, doch der Kopte holte eine altmodische Taschenuhr aus seiner Westentasche.
„Schau einfach hin und denk an gar nichts“, forderte er Johann auf, w├Ąhrend er die Kette umfasste und die Uhr herunterh├Ąngen lie├č.
„Es ist eine Taschenuhr! Ich habe auch so eine“, protestierte Johann und war im Begriff, seine eigene Uhr zu pr├Ąsentieren.
Menas sch├╝ttelte ungeduldig den Kopf.
„Bitte konzentrier dich auf meine Uhr.“
Langsam schwang die Uhr vor Johanns Nase. Automatisch folgten seine Augen der silbernen Scheibe, die von rechts nach links wanderte und zur├╝ck. Auch seine Blicke wanderten hin und her, hin und her, hin und her, hin und her … Allm├Ąhlich begannen seine Gedanken sich aufzul├Âsen, sein Kopf wurde schwer, seine Lider fielen fast zu, aber es gelang ihm mit letzter Kraft sie wieder aufzurei├čen, denn ganz pl├Âtzlich kam ihm die Idee, Menas k├Ânnte ein Zauberer sein. Aber im n├Ąchsten Augenblick war ihm wieder ganz schwindlig.
„Stell dir das Grab vor, das du besucht hast“, h├Ârte er eine tiefe Stimme den Nebel durchdringen, in den er sich eingeh├╝llt f├╝hlte. „Du stehst jetzt davor und du schaust dich um.“┬á┬á
Aber Johann sah nur das schwarze Wasser eines breiten Stroms, der durch ein ├Âdes Land floss.
„Da ist Wasser“, sagte er, aber die Brandung war so laut, dass er nicht verstehen konnte, was Menas auf seine Worte erwiderte. „Und eine riesige Schlange.“
„Und wie sah es vor dem Grab aus?“, fragte der Priester mit langsamer, suggestiver Stimme, da durchdringend genug war, dass sie die Brandung ├╝bert├Ânte.
Johann f├╝hlte sich, als ob er durch einen dichten Nebel irren w├╝rde. Dann schweiften seine Blicke pl├Âtzlich ├╝ber eine steinige Ein├Âde und er sah die W├╝ste vor sich, einen gro├čen Tempel und einige Str├Ąucher. Er sah die H├Ąndler auf dem Tempelvorplatz und wieder stachlige Str├Ąucher.
„Was siehst du?“, fragte eine dumpfe, aber forschende Stimme, die von weither zu ihm drang.
„Ein ├Âdes St├╝ck Land, mit Ruinen und Str├Ąucher, und dahinter ist der Tempel der Neith.“
Johann war ganz schummrig, aber das Pendel hatte aufgeh├Ârt zu schwingen. Langsam hob er den Kopf und blickte, noch immer benommen in das vor Aufregung gl├╝hende Gesicht des alten Kopten.┬á
„An der Stelle, die du mir genannt hast, hat dein Vater wahrscheinlich die Mumie gefunden. Nach deiner Beschreibung m├╝ssten wir eigentlich in der Lage sein, die Grabkammer zu finden“, erkl├Ąrte Menas erstaunlich sachlich f├╝r die ungeheuerliche Behauptung, die er soeben von sich gegeben hatte. „Wir sollten uns daher augenblicklich mit der Mumie dorthin auf den Weg machen.“
Johann starrte den alten Mann fassungslos an und einen Augenblick lang zweifelte er an dessen Verstand. Was w├╝rde wohl Peter dazu sagen, dass dieser es offenbar f├╝r m├Âglich hielt, dass er im Traum das richtige Grab gesehen hatte?
„Denk daran, Morgen fr├╝h bricht die Karawane auf und bis dahin m├╝ssen wir hier alles erledigt haben“, dr├Ąngte Menas und riss Johann damit aus seinen Gedanken.
„Nicht ohne Peter!“, erkl├Ąrte Johann, dem es nicht gefiel, dass der Plan des Kopten es vereiteln w├╝rde, dass er mit Takait zum Sobek-Tempel ging.
„Takait hatte Recht: Wir riskieren eher ebenfalls geopfert zu werden, als dass wir ihr beistehen k├Ânnen.“
„Aber wir k├Ânnen doch nicht … “, begann Johann.
„Mach dir keine Sorgen, ich bin ganz sicher, dass es Takait gelingen wird, deinen Bruder zu befreien. Aber du solltest dich lieber um die Mumie k├╝mmern, wegen der ihr schlie├člich hierher aufgebrochen seid.“
„Was wird Takait sagen?“, fragte Johann, der sich bei dem Gedanken sch├Ąmte, dass ihm dies wichtig war.
„Sie wird sich freuen, dass du ihr nicht zur Last f├Ąllst!“, erwiderte Menas und sah Johann ernst an. „Ich teile Takait mit, dass wir sie nicht begleiten werden, aber ich halte es f├╝r ratsam, ihr nicht zu erz├Ąhlen, was genau wir uns anschicken zu tun.“
„Warum ….“
„Frag nicht so viel! Wir treffen uns in zehn Minuten im Lagerraum. Bereite w├Ąhrend meiner Abwesenheit schon einmal die Mumie f├╝r den Transport vor“, befahl ihm Menas mit energischen Gesichtsausdruck.
Johann wollte sich weigern dies zu tun, denn er hatte w├Ąhrend der Reise jedem Kontakt mit der Mumie konsequent vermieden, aber der alte Priester lie├č ihn nicht zu Worte kommen.
„Ich gehe zum Pf├Ârtner und hinterlasse schnell eine Nachricht f├╝r Takait“, erkl├Ąrte dieser ultimativ. „Dann bringen wir die Mumie endlich zur├╝ck in ihr Grab. Die Toten sollen in Frieden ruhen. Selbst wenn es unverbesserliche Heiden waren.“
Johann trottete schicksalsergeben in den Lagerraum und blickte sich vorsichtig um. Au├čer ihm war nur ein Beduine im Schuppen, der sein Kamel belud. Johann musste nicht lang warten, bis dieser das Tier herausgetrieben hatte, was nichtzuletzt am bestialischen Gestank im Stall lag, der von Tag zu Tag schlimmer wurde. Als er sicher war, dass niemand ihn beobachtete, schleifte er die Mumie mitsamt ihrem Sarkophag aus der Versandkiste, die gl├╝cklicherweise auf dem Boden stand. Johann h├Ątte die schwere Last nicht zu heben vermocht. W├Ąhrend er den Mumienkasten m├╝hsam in einen Teppich einwickelt, hoffte er inst├Ąndig, dass sie wirklich das richtige Grab finden w├╝rden. Wegen des menschengestaltigen Sargs w├╝rde die Last diesmal weit schwerer sein als an jenem Fr├╝hlingstag, als sie die Mumie aus der Apotheke seines Onkels gestohlen hatten.
Johann war gerade mit seiner schwei├čtreibenden Arbeit fertig, als Menas durch die T├╝r kaum. Er schleppte zu Johanns Erstaunen allerlei Ger├Ątschaften herbei: Fackeln, eine Schaufel, ein Stemmeisen, einen Reisigbesen und kleinere Werkzeuge.
„Die werden uns noch gute Dienste erweisen“, erkl├Ąrte der Kopte und sie wickelten den Teppich wieder auf, um alles darin zu verstauen.
Als die beiden Reisegef├Ąhrten das Portal der Karawanserei passierten hoffte Johann fast, dass der Pf├Ârtner an ihrer seltsamen Last Ansto├č nahm, denn er war noch immer der Ansicht, dass er Takait begleiten sollte, aber der diensthabende Beamte hatte seinen Arbeitsplatz verlassen.
Trotz der Hitze gingen Johann und Menas rasch durch die leeren Gassen in Richtung Tempel. Unterwegs versuchte Johann nicht an den Bruder zu denken, aber dies bewirkte nur das Gegenteil. Es machte ihn ganz krank, dass er momentan nichts f├╝r Peter tun konnte, als zu hoffen, dass Takaits Bem├╝hungen vom Erfolg gekr├Ânt sein w├╝rden.┬á┬á
Sie begegneten einer Mutter, die ein sch├╝chternes Kind hinter sich herschleifte. Als es die beiden Fremden sah, fing es an leise zu quengeln.
„Die Einheimischen m├Âgen keine b├Ąrtigen M├Ąnner“, erkl├Ąrte Menas und warf dem Kind einen derart unwirschen Blick zu, dass es sich hinter seiner Mutter versteckte. „Sie k├Ânnen Kopten nicht von Arabern unterscheiden.“
Schon sah Johann die Umfassungsmauer des Tempels zum Greifen nah vor sich, als Menas vor einem eingez├Ąunten Hof auf der linken Seite der Gasse innehielt.
„Ich brauche eine Verschnaufpause“, erkl├Ąrte er, w├Ąhrend er sich im Schatten die verschwitzte Stirn mit einem speckigen Taschentuch betupfte und sich anschlie├čend einen kr├Ąftigen Schluck aus seinem Weinschlauch genehmigte, „schlie├člich bin ich nicht mehr der J├╝ngste.“
Eines der verrammelten Fenster des Nachbarhauses wurde lautstark ge├Âffnet und wie auf Kommando packten Johann und der alte Priester je ein Ende des schweren B├╝ndels und bevor man sie verjagen konnte, waren die beiden Reisegef├Ąhrten schon wieder verschwunden.
Sie gingen weiter in Richtung Tempel, bis sie zur Rechten ein verwahrlostes Grundstück passierten, das von Dornenhecken überwuchert war, aus denen einige alte Trümmer herausragten.    
„Eigentlich ├Ąrgere ich mich ├╝ber mich selbst“, meinte Menas, als sein Blick ├╝ber das Brachland schweifte, „hier sind wir doch mindestens zehn mal hier vorbeigegangen und mir ist nicht einmal aufgefallen, dass hier durchaus fr├╝her der Eingang zu einer Grabanlage gewesen sein kann.“┬á┬á
Menas sagte dies mit einer derartig geradezu professionellen Emp├Ârung, dass Johann sich erschrocken fragte, ob auch der koptische Priester sich bereits als Grabr├Ąuber bet├Ątigt hatte.
Menas hatte unterwegs einen d├╝rren Ast aufgesammelt, mit dem er sich nun – das Kopfende des Kastens in der rechten Hand - mit der Linken seinen Weg zwischen den Hecken hindurch bahnte, bis die beiden Reisegef├Ąhrten vor der verfallenen Ruine eines quadratischen Baus standen, die sich inmitten des kleinen Grundst├╝cks befand. Einst hatte eine Freitreppe zu dessen Eingang gef├╝hrt, aber durch das angestiegene Bodenniveau war diese mittlerweile von der Erde bedeckt.
Die T├╝r aus Zedernholz hing nur noch schr├Ąg in den Angeln, aber dank des trockenen W├╝stenklimas war sie noch nicht verrottet. Der trapezf├Ârmige Eingang wurde von einem Architrav bekr├Ânt, der eine Inschrift von Hieroglyphen trug.
Menas bedeutete Johann, den Kasten auf den Boden zu stellen. Dann las er mit zusammengekniffenen Augen und auf die linke Schulter gelegten Kopf Schriftzeichen f├╝r Schriftzeichen der leicht verwitterten Schrift.
„Was steht da?“, fragte Johann einige Minuten sp├Ąter nach, obwohl er bezweifelte, dass sie ihre knapp bemessene Zeit mit ├Ągyptologischen Studien verschwenden sollten.
„Nur die ├╝blichen Verw├╝nschungen“, meinte Menas und Johann bekam weiche Knie, „aber das muss uns nicht k├╝mmern. Schlie├člich wollen wir hier nichts rauben. Im Gegenteil: Wir bringen etwas zur├╝ck!“
Menas trat gegen die riesige T├╝r und sie brach splitternd auseinander. Ein Staubregen rieselte auf die beiden M├Ąnner. Der Kopte klopfte den Schmutz von seinem Gewand ab und Johann musste niesen. Menas warf ihm einen vorwurfsvollen Blick ├╝ber die Schulter zu und dann bedeutete er ihm mit einer Geste, den Mumienkasten wieder hochzuheben.
Mit einem leisen Seufzer tat Johann wie im gehei├čen, und dann traten sie endlich in den Pavillon ein, der nur aus einem einzigen schmucklosen Raum bestand, dessen Decke eingest├╝rzt war. ├ťberall lagen Sand, Ger├Âll, Holzsp├Ąne und zerbrochene Dachschindeln herum. Johann war ├╝ber diesen trostlosen Anblick ern├╝chtert und er wollte schon feststellen, dass sie doch wohl kaum die Mumie hier abstellen konnten, als Menas wieder Anstalten machte, den Sarg abzustellen.
Als dies geschehen war, holte er den Besen aus ihrem B├╝ndel und begann, den von Ger├Âll bedeckten Boden zu fegen. Johann war versucht, ihn zu fragen, ob er sich als Tempelputzfrau verdingt hatte, aber der Spott blieb ihm im Halse stecken, als er sah, dass Menas eine vom Schutt verdeckte Steinplatte freigelegt hatte. Er dr├╝ckte beide Handballen in die Eintiefungen an den Kanten der Platten und hob sie mit hochrotem Kopf empor. Verbl├╝fft stellte Johann fest, dass dies eine Fallt├╝r war und darunter f├╝hrte eine Treppe in die Tiefe. Johann fragte sich, womit er dies verdient hatte, dass er die schwere Mumie jetzt auch noch diese Stufen hinabschleppen musste.
„Das ist ein geheimer Ort, den nicht viele Menschen kennen. Ich glaube nicht, dass Takait von ihm wei├č“, meinte Menas, w├Ąhrend er eine der mitgebrachten Fackel anz├╝ndete.
Dann machte er eine einladende Geste in Richtung Kellereingang. Johann hob mit einem leisen Seufzer die Teppichrolle hoch. Er ging mit der Fackel in der Linken voran und Menas folgte. Die Treppe f├╝hrte in einem fast quadratischen Innenraum mit einem steinernen Tisch in der Raummitte, auf dem sie die Mumie abstellten.
Johanns sah vor seinem inneren Auge eine mit Fr├╝chten und Blumen reich geschm├╝ckte Tafel, die einst in die R├╝ckwand gemei├čelt war. Sprachlos vor Erstaunen blickte er sich um: Es war der gleiche Raum, den er in seinem Traum betreten hatte. Nur war er inzwischen verlassen und verwahrlost, als seien seit seinem Besuch Jahrhunderte ins Land gegangen.
„Hier k├Ânnen wir doch eigentlich die Mumie lassen!“, schlug Johann halbherzig vor und┬á drehte sich zu dem alten Kopten um.
„Ich h├Ątte nichts dagegen. Damit h├Ątten wir zumindest unseren guten Willen bewiesen“, brummte dieser in seinen Bart hinein und nahm Johann die brennende Fackel aus der Hand, „aber ich bezweifle stark, dass dies dem unruhigen Schatten wirklich gen├╝gen w├╝rde.“
„Wenn es denn sein muss“, maulte Johann, denn ihm tat schon das Kreuz weh vom Schleppen. Au├čerdem gefiel es ihm noch immer nicht, dass er dem Bruder nicht zur Hilfe geeilt war. Was ihn aber vor allem beunruhigte, war dass er ihm der Raum, in dem sie sich gerade befanden aus seinem Traum bekannt war, aus einem Traum, in dem er von einer Riesenschlange verschluckt worden war.┬á┬á ┬á┬á┬á
„Da geht es in die Gruft!“, erkl├Ąrte Menas in einem fachm├Ąnnischen Tonfall, eine T├╝r in der R├╝ckwand beleuchtend, neben der sich gro├če Steinquader auft├╝rmten. Hatte sein Vater diese schweren Steine aus einer vermauerten T├╝r entfernt? Johann sagte sich, dass er nicht soviel nachgr├╝beln sollte. Schlie├člich hatten sie nur wenig Zeit, da die Karawane am n├Ąchsten Tag aufbrach. Aber er w├╝rde die Oase nicht ohne den Bruder verlassen!
Hinter der T├╝r f├╝hrte ein leicht absch├╝ssiger Gang in die Tiefe, der kontinuierlich niedriger wurde. Das letzte Mal war Johann ihn gedankenlos heruntergeeilt. Diesmal bemerkte er hingegen im Schein seiner Fackel an den W├Ąnden die Reliefs von anmutigen, tanzenden M├Ądchen, Feldarbeitern bei der Getreideernte und Bildhauern, die an einem Sphinx mei├čelten. Alles war so kunstvoll ausgef├╝hrt, dass er automatisch stehenblieb, um die Bilder zu bewundern. Aus der N├Ąhe betrachtet wirkten sie in ihrer Ausf├╝hrung unvollendet: manche Teile der Darstellung waren als eingetieftes Relief in die Felswand geschnitten, andere als Zeichnung eingeritzt und viele Details waren nur mit Farbe auf den Stein aufgemalt. Im unruhigen Licht der Fackel wirkten die Figuren wie zum Leben erweckt, aber Johann fragte sich, was er von der fl├╝chtigen Ausf├╝hrung halten sollte.┬á┬á
„Tr├Ąumst du schon wieder?“
Fast h├Ątte Johann den alten Priester beschuldigt, ein Banause zu sein, aber es gelang ihm mit letzter Kraft, sich zu beherrschen und nicht ausfallend zu werden.
Widerwillig setzte er seinen Weg fort, drehte sich aber nochmals nach einem besonders sch├Ânen Detail um, als sein linker Fu├č ganz pl├Âtzlich ins Leere trat. Er verlor das Gleichgewicht und stie├č vor Schreck einen Schrei aus. Schon f├╝rchtete er, in einen Abgrund hinabst├╝rzen, aber im letzten Augenblick riss ihn ein kr├Ąftiger Ruck auf den festen Boden zur├╝ck. Menas hatte den Kasten mit aller Kraft nach hinten gezogen und damit auch Johann zur├╝ckgerissen.
Schwer atmend stellte Johann den Kasten gegen die Wand. Er f├╝hlte sich an den Alptraum von der Schlange erinnert, aber diesmal hatte sich nichts ├ťbernat├╝rliches ereignet. Schaudernd blickte Johann in einen Abgrund hinab, der sich vor ihm im Boden ├Âffnete.
„Was ist das?“, fragte er den alten Priester, obwohl er eigentlich nicht erwartete, dass dieser seine Frage beantworten konnte.
„Diese Brunnen genannten Sch├Ąchte finden sich in vielen Gr├Ąbern. Sie dienen unter anderen der Entw├Ąsserung, denn selbst hier in der W├╝ste kann es nach Regeng├╝ssen zu ├ťberschwemmungen kommen, aber vor allen Dingen sind es Fallen f├╝r unachtsame Grabr├Ąuber“, h├Ârte er Menas hinter sich sagen und wieder wunderte Johann sich, dass dieser sich offenbar sehr gut in heidnischen Gr├Ąbern auskannte.
Johann wollte lieber gar nicht wissen, woher sein Reisegef├Ąhrte diese profunden Kenntnisse besa├č, aber er nahm sich vor, dem Boden in Zukunft mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
„Lassen Sie uns lieber von hier weggehen“, meinte er schlie├člich, nachdem er vorsichtig um den Brunnen herumgegangen war, denn ihm war der dunkle Schacht unheimlich.
Dann lie├č er sich das Kopfende des Sarkophags reichen und der Abstieg ging weiter. Mittlerweile war der Korridor so niedrig, dass Johanns Kopf die Decke fast ber├╝hrte. Aus einer ├ľffnung ├╝ber ihm drang ein schmaler Lichtkegel in den dunklen Gang, was Johann erstaunte. Er musste er sich zu seiner Besch├Ąmung eingestehen, dass er v├Âllig die Orientierung verloren hatte.
Schlie├člich gelangten die beiden Reisegef├Ąhrten in einen kleinen Raum mit schr├Ąger Decke, der Johann an das Innere einer riesigen Puppenstube erinnerte. Anders als in der Grabkammer seines Traumes, war jedoch keine ├╝berlebensgro├če Dame in die R├╝ckwand eingemei├čelt, sondern um alle vier W├Ąnde liefen B├Ąnder mit winzigen Hieroglyphen. Trotzdem war er sich sicher, dass es sich um dieselbe Kammer handelte.
Endlich am Ziel, dachte Johann und er kam sich vor wie ein Kapit├Ąn, der nach langer Irrfahrt endlich Land am Horizont sah und im gleichen Augenblick wurde ihm erst bewusst, dass er schon wieder in Bildern dachte, die der Odyssee entlehnt waren.
„Was mag da wohl stehen?“, fragte Johann den alten Menas. Nachdem sie den Sarkophag auf dem Boden abgestellt hatten, da es in der Grabkammer keine M├Âbel gab erleuchtete dieser n├Ąmlich die Inschriftb├Ąnder mit der Fackel. „werden hier wieder die Grabr├Ąuber verflucht?“
„Nein“, entgegnete dieser leichthin, „das sind nur ganz harmlose Pyramidentexte. Sie schildern die Reise des Sonnengottes durch die Unterwelt und das J├╝ngste Gericht der ├ägypter, bei dem das Herz gewogen wird. Nur wenn es leichter ist als eine Feder d├╝rfen die Verstorbenen das Land jenseits des Stroms betreten.“
Johann lie├č seinen Blick mit einem wohligen Schauer ├╝ber die W├Ąnde schweifen, aber er erkannte nirgendwo Osiris als Totenrichter. Als er die Scheint├╝r sah, fiel ihm ganz pl├Âtzlich ein, dass er Menas bisher gar nicht nach der Bedeutung der schrecklichen Schlange gefragt hatte.
„Was war das eigentlich f├╝r eine riesige Schlange, die ich im Traum gesehen habe?“
„Das war Apophis, die Verk├Ârperung von Aufl├Âsung, Finsternis und Chaos. Sie ist der gro├če Widersacher des Sonnengottes und muss allmorgendlich besiegt werden, damit die Sonne aufgehen kann“, erkl├Ąrte Menas, ohne von der Wand wegzuschauen. „Das ist seltsam: Die Frau, die hier bestattet ist, hei├čt doch tats├Ąchlich Takait und sie war eine T├Ąnzerin des Amun.“
„Takait? Und sie war eine T├Ąnzerin“, rief Johann v├Âllig vom Donner ger├╝hrt aus und h├Ątte fast vor Schreck ein Gef├Ą├č fallen lassen, das er von Boden aufgehoben hatte.
Menas nickte.
„Sie erfinden das nicht nur?“, vergewisserte sich Johann, da er das ungute Gef├╝hl hatte, dass dies ein schlechter Scherz sein sollte.
Statt eine Antwort zu geben, sch├╝ttelte der alte Mann nur den Kopf und Johann beschloss, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und Menas eine Frage zu stellen, die ihn sehr besch├Ąftigte.
„Was wollten Sie mir eigentlich ├╝ber unsere Takait berichten?“, fragte er in einem beil├Ąufigen Tonfall, w├Ąhrend er sich neben den alten Mann stellte und so tat, als ob er die Hieroglyphen studieren w├╝rde.
„Ach, nichts Besonderes“, murmelte Menas, ebenfalls mit schlecht gespielter Nonchalance, „das hat wirklich noch Zeit. Wir sollten wirklich schnellstm├Âglich von hier verschwinde.“
„Sie klangen aber sehr ernst!“, pr├Ązisierte Johann, obwohl er sicher war, dass Menas wieder abwiegeln w├╝rde.
Dieser seufzte leise und schaute einen Augenblick lang so angestrengt auf den Boden, als ob es dort ebenfalls Hieroglyphen zu entziffern g├Ąbe.
„Irgendwann muss ich es dir ja doch erz├Ąhlen, also warum nicht jetzt?“ Johann schaute den alten Mann beklommen an, der seinen Blick wieder zu den Pyramidentexten gehoben hatte, da er tief in seinem Inneren bef├╝rchtete, dass Menas ihm mitteilen wollte, dass Takait ein leichtes M├Ądchen sei. „Ich habe mittlerweile erfahren, dass sie┬á …┬á┬á meine Tochter ist. Das stand n├Ąmlich in den Aufzeichnungen ihres Vaters. Ich habe … “ Menas schluckte und leckte sich dann ├╝ber die Lippen. Johann hingegen war so geschockt und zugleich erleichtert ├╝ber diese ungeheuerliche Enth├╝llung, dass er nicht wusste, was er sagen sollte. „Ihre Mutter fr├╝her recht gut gekannt. Dass sie schwanger war, als sie geheiratet hat, hat mir aber niemand erz├Ąhlt.“
„Und Ihre Frau?“
„Ach ├╝berspringen wir lieber diesen Punkt“, brummte Menas, „aber jetzt, da ich wei├č, dass ich Takaits Vater bin, mache ich mir doch Sorgen wegen ihres Umgangs …“
„Wollen Sie etwa andeuten, dass ich einen schlechten Einfluss auf diese L├╝gnerin und Diebin habe? Was f├╝r eine gemeine Verdrehung der Tatsachen! Irgendjemand h├Ątte das M├Ądchen besser erziehen sollen, egal wer!“, rief Johann ver├Ąrgert aus und die W├Ąnde warfen seine Stimme von allen Seiten als Echo zur├╝ck. Er sah seinen Reisegef├Ąhrten von der Seite an, aber er fand, dass Takait ihm gar nicht ├Ąhnlich sah.
„Ich habe damit nicht nur dich gemeint“, erkl├Ąrte Menas in einem beschwichtigenden Tonfall. „Was ich neulich andeuten wollte: Takait geh├Ârt hierher. Das ist ihre Welt. Sie ist noch nicht einmal eine halbe Europ├Ąerin. Wir Kopten sind die Nachkommen der alten ├ägypter. Ich kann mir vorstellen, dass dein Vater Takait mitnehmen wollte und ihre Mutter ihm deshalb die Wahrheit erz├Ąhlt hat, zumal sie, obwohl sie sich mittlerweile verheiratet hatte, trotzdem nicht ihr Kind verlieren wollte.“
Johann sah das Gesicht der eigenen Mutter vor sich, falls Vater mit Takait vor der T├╝r gestanden h├Ątte. Er wollte sich lieber gar nicht vorstellen, was dann geschehen w├Ąre.
„Aber weshalb um Himmels Willen h├Ątte Vater sie nach Deutschland mitnehmen sollen?“, fragte er schlie├člich entgeistert nach.
„Weil der Mann von Takaits Mutter sein Freund war und er daher dachte, sie sei die Tochter seines Freundes. Aber jetzt genug gefragt!“, erkl├Ąrte Menas und er riss sich von den Inschriftb├Ąndern los, „wir sollten lieber wieder verschwinden. Das sieht hier alles nicht besonders stabil aus.“
Der Kopte zeigte auf einen tiefen Riss in der Decke und Johann durchlitt einem Anfall von Platzangst, aber trotzdem war er nicht sicher, ob sie bereits ihrer Pflicht gen├╝ge getan hatten.
„Aber wir k├Ânnen den Sarkophag doch nicht einfach hier so liegen lassen!“, protestierte er daher, obwohl seine Gedanken noch immer bei der befremdlichen Vorstellung weilten, dass Takait die Tochter des alten Kopten war.
„Nein, nat├╝rlich nicht, wir packen ihn nat├╝rlich aus dem wertvollen Teppich aus. Es w├Ąre ein Jammer, ihn hier liegen zu lassen.“
„Das ist nicht, was ich gemeint habe! Sollen wir die Mumie einfach auf den nackten Boden legen?“, erkl├Ąrte Johann, obwohl er sicher war, dass ihn Menas absichtlich falsch verstanden hatte.
Menas ging mit langen Schritten zu ihrer Last  und Johann folgte ihm.
„Eigentlich m├╝sste hier ein Liege stehen, und andere M├Âbel, aber offenbar haben Grabr├Ąuber alles ausger├Ąumt. Das ist jedoch nicht so schlimm. Wenn wir die Mumie so an die Westwand stellen, dass sie die aufgehende Sonne sehen kann wird es nach der hiesigen Glaubensvorstellung in Ordnung sein.“
Als sie den bemalten Sarkophag durch die Kammer schleppten, fragte Johann sich wie sein Reisegef├Ąhrte hier unten die Himmelsrichtungen bestimmen wollte, und wie die Mumie im ewigen Dunkel dieser Grabkammer die Sonne sehen sollte. Aber er ging diesen Fragen nicht nach, denn er wollte das Grab so schnell wie m├Âglich verlassen: Noch immer beunruhigte ihn die schadhafte Stelle in der Decke zutiefst.
Endlich war der Mumiensarg gegen die Wand gelehnt, die Menas f├╝r die ├Âstliche hielt. Einen Augenblick lang schauten die beiden den pr├Ąchtigen Kasten an und Johann konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihn tats├Ąchlich der Geist des vor Jahrtausenden gestorbenen M├Ądchens zu Hause bei Nacht erschienen war, dessen Mumie diese kunstvolle Umh├╝llung enthierl. Er musste v├Âllig von Sinnen gewesen sein, dies geglaubt zu haben.
Und der Morgenmantel, den der Vater ihn mitgebracht hatte? Zum ersten Mal in seinem Leben fragte sich Johann, ob er m├Âglicherweise ein Schlafwandler war. Vielleicht hatte er selbst im Schlaf den Mantel irgendwo im Haus versteckt. Und wenn er ihn bei seiner R├╝ckkehr nicht wiederfand. Johann ermahnte sich, dass er nicht an die Zukunft denken sollte, bevor sie den Bruder gerettet hatten.
Menas bekreuzigte sich nach orthodoxem Brauch und Johann tat es ihm gleich, aber er traute seinen Ohren kaum, als der alte Priester anschlie├čend einige alt├Ągyptische Gebete murmelte.
„Woher kennen Sie diese heidnischen …“
„Schaden kann es bestimmt nicht“, erkl├Ąrte Menas unvermittelt, als er sich wieder zu seinem Reisegef├Ąhrten umdrehte. „Und jetzt nichts wie raus aus dieser Bruchbude!“
Johann f├╝hlte sich hintergangen.
„Sie haben alles gewusst!“, entfuhr es ihm schlie├člich beim erklimmen der steilen Stufen, „Warum haben Sie uns nicht erz├Ąhlt, wie gut Sie sich hier auskennen?“ Menas, der vor ihm die Treppe hinaufstieg antwortete nicht. „Und was verbergen Sie uns sonst noch alles?“
Johann hatte fast gebr├╝llt, damit Menas nicht behauptete, ihn nicht verstanden zu haben.
„Ich wusste jedenfalls nicht, woher die Mumie stammt. Das h├Ątte ich euch selbstverst├Ąndlich mitgeteilt. Ansonsten wollte ich euch nicht mit unangenehmen Details bel├Ąstigen.“
„Sehr freundlich“, entgegnete Johann und er fand die ├ähnlichkeit zwischen Vater und Tochter mittlerweile ziemlich ausgepr├Ągt.┬á
 
Sobek
23. Sobek
Hori, der Priester des ersten Tempelhofes leistete den Wachen Gesellschaft, um sich selbst ein Bild von der Lage auf dem Tempelvorplatz zu machen. Als er seinen Blick ├╝ber den – bis auf ein paar H├Ąndler – menschenleeren Platz schweifen lie├č, ├Ąrgerte er sich, dass man ausgerechnet ihn mit der undankbaren Aufgabe betraut hatte, die Gl├Ąubigen abzuweisen, die sicherlich bald Zuflucht im Neith-Tempel suchen w├╝rden. Es war noch sehr fr├╝h am Morgen, weshalb die meisten Einwohner der dritten Oase sicherlich noch schliefen. Andere hatten sich bereits vor Angst in ihren Kellern verschanzt und der Priester hatte das ungute Gef├╝hl, dass es bald an der Tempelpforte nur so vor Hilfesuchenden wimmeln w├╝rde, aber was sollte er ihnen sagen? Dass dem obersten Priester der Schutz seines Schatzes mehr am Herzen lag als ihr Wohlergehen und er daher strikte Anweisung erhalten hatte, niemanden einzulassen?┬á
Die rangh├Âheren Priester machten es sich ziemlich einfach! Sie waren es, die die heiligen Riten vollzogen und daher fielen ihnen Anerkennung und materielle Verg├╝nstigungen geradezu in den Scho├č, aber die unpopul├Ąren Ma├čnahmen delegierten sie an die jungen Priester. Ansonsten nahmen sie von den „dienstbaren Geistern“ kaum Notiz. Es war bezeichnend, dass der oberste Priester sich noch nicht einmal seinen Namen merken konnte. Er hie├č Hori und nicht Hor, aber, wenn er den m├Ąchtigsten Priester der G├Âttin Neith verbesserte, w├╝rde er niemals in der Hierarchie aufsteigen. Au├čerdem ├Ąrgerte es Hori, dass die oberen Priester sich w├Ąhrend seiner Anwesenheit unterhielten, als w├Ąre er eine Statue oder ein M├Âbelst├╝ck. Anderenfalls w├Ąre ihm sicherlich verborgen geblieben, wie erst die Lage war: Zwar war die dritte Oase die bev├Âlkerungsreichste der drei Sobek-Oasen, aber sie war ein religi├Âses Zentrum, in dem die Steuern fast ausschlie├člich in den Bau und den Unterhalt der Tempel geflossen waren, w├Ąhrend man in der ersten in den letzten Jahren eine Armee aus Beduinen und Nubiern rekrutiert hatte.
In seinen tr├╝bsinnigen Gedanken versunken, bemerkte Hori die beiden ortsfremden M├Ąnner erst in dem Augenblick als sie bereits fast den halben Tempelplatz ├╝berquert hatten. Aus seiner Gr├╝belei aufschreckend erkannte er sie sofort: Es waren die beiden Halunken, die behauptet hatten, die Br├╝der der Tempelt├Ąnzerin Takait zu sein. Sp├Ąter hatte das M├Ądchen dann dem obersten Priester berichtet, dass sie keinesfalls mit den beiden Beduinen verwandt war. Vielmehr geh├Ârten diese zu einer ber├╝chtigten Bande von Grabr├Ąubern, die auf den Sobek-Oasen ihr Unwesen trieb.
Im Licht der milden Herbstsonne passierten die Beduinen bereits die St├Ąnde der Devotionalienh├Ąndler. Letztere waren offensichtlich wie Hori der Ansicht, dass die Angst bald die Menschen zum Tempel treiben w├╝rde, denn am Vortag hatten weit weniger von ihnen auf dem Tempelvorplatz ihre Skarab├Ąen, G├Âtterfig├╝rchen und Amulette zum Kauf angeboten.
Einen Augenblick lang erwog Hori, den Haushofmeister zu rufen, damit dieser die beiden Schufte festnehmen lassen konnte, aber er verwarf diesen Gedanken wieder, denn die steinerne Miene, mit welcher der oberste Priester das Gest├Ąndnis Takaits angeh├Ârt hatte, war ein untr├╝gliches Kennzeichen daf├╝r, dass er ihr nicht glaubte. Zwar hatte er Takait huldvoll „verziehen“, aber Hori hatte er nicht t├Ąuschen k├Ânnen. Der oberste Priester hielt Takait f├╝r eine Hochstaplerin, die nur zum Spionieren in den Tempel gekommen war. Auch Hori vermutete, dass die T├Ąnzerin ihnen nicht alles gesagt hatte, was sie wusste, aber was ihre beiden Entf├╝hrer und deren finstere Absichten betraf, so hatte sie bestimmt die Wahrheit gesagt.
„Seid gegr├╝├čt, ehrw├╝rdiger Priester der Neith“, sagte die j├╝ngere der beiden finster wirkenden Kerle, die auch in ├Ągyptischer Kleidung wie Beduinen aussahen, da sie ihre wettergegerbte, dunkle Haut nicht verbergen konnten. Dabei machte er eine unterw├╝rfige Verbeugung. „Wir m├╝ssten so bald wie m├Âglich in einer wichtigen Familienahngelegenheit mit unserer Schwester Takait sprechen.“
Hori war froh, dass Takait bereits wieder mit den beiden Fremden verschwunden war oder genauer gesagt, dass er sie dazu gen├Âtigt hatte, mit ihnen zu gehen. Er hatte dies getan, um die T├Ąnzerin vor dem Zorn des obersten Priesters zu sch├╝tzen. Nur weil sie diesen bedeutsamen Traum gehabt hatte, war Takait nicht als Handlangerin der Grabr├Ąuber zum Tode verurteilt oder wenigstens des Tempels verwiesen worden. Doch Hori bef├╝rchtete das Schlimmste f├╝r sie, falls die Armee der dritten Oase die Schlacht verlieren sollte. Aber selbst, wenn diese – wider alle Erwartungen - die feindlichen Soldaten besiegen sollte, w├╝rde in Friedenszeiten der gesunde Menschenverstand dem obersten Priester sagen, dass es niemals wieder einen Pharao geben w├╝rde. Das ├Ąu├čerste, was die Bewohner der Sobek-Oasen von der Zukunft erhoffen durften war, dass sie weiterhin im Verborgenen weiterexistieren durften. Da aber Takait die R├╝ckkehr des Pharao geweissagt hatte, w├Ąre damit ihre Karriere als Prophetin beendet.
„Sie weilt leider nicht in diesem Tempel“, antwortete Hori wahrheitsgem├Ą├č. Dann versuchte er einen sorgenvollen Gesichtsausdruck anzunehmen. „Grauenhafte Dinge haben sich in der Zwischenzeit ereignet, grauenhafte Dinge! Mir sind Ger├╝chte zu Ohren gekommen, dass Takait zusammen mit einem jungen Fremden von einem abtr├╝nnigen Priester gefangen genommen worden ist, der die beiden dem Sobek opfern m├Âchte, damit der Sohn der Neith unserer Oase im bevorstehenden Kampf beisteht.“
Hori behauptete dies, weil er sich des Verdachtes nicht erwehren konnte, dass das frevlerische Unterfangen des angeblichen Priesters, der das Volk aufwiegelte, nur ein Ablenkungsman├Âver war, mit dem Ziel, dass man Wachen vom Neith-Tempel abzog. Und dies, wo eine Schlacht vor den Toren der Stadt bevorstand! Sicherlich geh├Ârte dieser heimt├╝ckische Volksverhetzer zur gleichen R├Ąuberbande wie die beiden Karawanenf├╝hrer, die die Frechheit besa├čen in eben diesem Tempel ein- und auszugehen, den sie sp├Ąter berauben wollten. Hori hoffte, dass die Strafe der G├Âtter, die der geplante Frevel eines Menschenopfers unweigerlich hinter sich ziehen w├╝rde, auch die beiden Beduinen treffen m├Âge, zumal sie Takait erpresst und gefangen gehalten hatten.
Die beiden M├Ąnner starrten Hori mit weit aufgerissenen Augen an.
„Seid Ihr sicher?“
Diesmal war es der ├Ąltere der beiden M├Ąnner, der sprach. Er fragte sich bestimmt, ob seine Handlanger seine Anweisungen falsch verstanden hatten, denn er brauchte Takait, damit sie f├╝r ihn spionieren konnte.
Hori straffte seine Schultern. Dann runzelte er die Stirn und bedachte die Nomaden mit einem arroganten Blick. Dabei nahm er sich den obersten Priester zum – sicherlich unerreichbaren - Vorbild.
„Ihr zweifelt doch wohl nicht etwa am Wort eines Priesters der Neith?“, fragte er in einem Tonfall, als ob dies nur eine rethorische Frage sei.
„Wir haben uns nur gewundert…“, der j├╝ngere Nomade beendete den Satz nicht, wahrscheinlich, weil sein Kamerad ihn w├╝tend anstarrte und kurz davor stand, ihm den Mund zu verbieten.
„Dann will ich eure Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen“, sagte Hori, auch mit diesen Worten den obersten Priester imitierend. Er entlie├č sie mit einer l├Ąssigen Bewegung, als ob sie sein Hofstaat w├Ąren.
Die beiden Nomaden hatten verstanden, dass ihre Audienz damit beendet war. Sie verabschiedeten sich mit einigen konventionellen H├Âflichkeitsformeln und Hori w├╝nschte ihnen insgeheim, dass man sie anstatt des Fremden dem Krokodilgott opfern m├Âge. Wenn man denn unbedingt derartige Br├Ąuche wiederbeleben musste, so waren diese beiden Grabr├Ąuber die passenden Opfer.
„Stimmt das, was Ihr eben ├╝ber Takait gesagt habt?“
Hori drehte sich nach dem jungen Wachposten um, der diese Frage gestellt hatte, und der Offenbar ein Auge auf die sch├Âne T├Ąnzerin geworfen hatte, denn alle Farbe war ganz pl├Âtzlich aus seinem Gesicht gewichen.
„Wenn du zu viele Fragen stellst, wirst du es niemals zum Priester ersten Ranges bringen“, tadelte Hori den verliebten Wachposten, bem├╝hte sich aber dabei um einen kollegialen Tonfall, denn er wollte nicht riskieren, dass dieser sich ├╝ber ihn beim obersten Priester beschwerte.
Dann fragte er sich ganz pl├Âtzlich, ob er richtig gehandelt hatte. War es wirklich eine gute Idee gewesen, die beiden Nomaden dorthin zu schicken, wohin auch der alte Menas aufgebrochen war. Sein ├ägyptisch war mit den Jahren, die er jenseits der Sobek-Oasen verbracht hatte noch barbarischer geworden, weshalb Hori ihn nur mit M├╝he verstanden hatte. Den Kopten hatte ein junger, rothaariger Europ├Ąer begleitet, der Hori an den alten Frevler erinnert hatte, der im Fr├╝hjahr leider von der Oase gefl├╝chtet war. Konnte dies wirklich ein Zufall sein?
Als dieses ungleiche Paar mit Takait verschwunden war, hatte Hori sich gefragt, woher die beiden die T├Ąnzerin wohl kannte und ob auch der Fremde, den die Fanatiker dem Sobek opfern wollten zu ihnen geh├Ârte.
Andererseits konnten die zwielichtigen Karawanenf├╝hrer ihm nun den Weg zu ihren Komplizen zeigen, die sie bestimmt aufsuchen w├╝rden, nachdem sie diese Hiobsbotschaft erhalten hatten. Hori musste ihnen nur unauff├Ąllig folgen. Zwar hatte er eine grobe Vorstellung, wann der Frevel begangen werden sollte. Es konnte n├Ąmlich kein Zufall sein, dass just an diesem Tage das Fest des Sobek auf dem ewigen Festtagskalender stand. Daher hatte Hori bereits am Vortag beschlossen, dem heiligen See des Sobek-Tempels im Lauf des Tages einen Besuch abzustatten, aber der Besuch der Beduinen erleichterte die Sache, denn nun musste er ihnen nur noch folgen, um zur richtigen Zeit den Ort des Frevels zu erreichen.┬á┬á
„Ich muss den Tempel wegen einer wichtigen Angelegenheit f├╝r einige Stunden verlassen“, sagte Hori kurz entschlossen zu den beiden Tempelw├Ąchtern und begl├╝ckw├╝nschte sich selbst dazu, dass er dem j├╝ngern von ihnen vorhin geraten hatte, keine unn├Âtigen Fragen zu stellen.
Dann suchte er die Spendenkammer auf und holte aus einer Truhe, die gestiftete Textilien enthielt ein einfaches, wei├čes Gewand, denn erstens sollten die Nomaden nicht bemerken, dass er ihnen folgte und zweitens legte er keinen Wert darauf, auf der Stra├če als Priester erkannt zu werden, denn dann w├╝rden ihn die ver├Ąngstigten Einwohner, die bald den Tempel aufsuchen w├╝rden, mit Bitten und Gesuchen best├╝rmen.┬á
*      
Peter lag auf dem mit Stroh bestreuten Boden aus gestampftem Lehm und konnte es noch immer nicht fassen, was ihm geschehen war. Er schlang seinen Umhang fest um den K├Ârper, fr├Âstelte aber noch immer trotz der sommerlichen Hitze. Der Raum war von einem bei├čenden Gestank erf├╝llt, der Peter an die Karawanserei erinnerte, in der Johann sich mittlerweile wohl sorgte, wo sein gro├čer Bruder geblieben war. Zuerst hatte Peter in seinem Verlies getobt, hatte durch das kleine, vergitterte Fenster um Hilfe gerufen und mit den F├Ąusten gegen die Kellert├╝r geh├Ąmmert, bis ihm die Knochen schmerzten, aber die Bewohner des Hauses hatten gar keine Notiz genommen und auch es waren auch keine Nachbarn herbeigeeilt, um ihm zu helfen. ┬á┬á
Am ersten Tag hatte Peter gehofft, dass man ihn gegen ein L├Âsegeld wieder freilassen w├╝rde und hatte jeden Augenblick die Ankunft des Bruders erwartet. Die folgende Nacht hatte er in dumpfem Br├╝ten durchlitten. Im Halbschlaf durchwachte Stunden wechselten mit unruhigem Schlaf, aus dem ihn immer wieder Alptr├Ąume aufschrecken lie├čen, nur um festzustellen, dass seine Lage die Tr├Ąume an Schrecklichkeit ├╝bertraf. Als nach dieser mit qu├Ąlender Langsamkeit verstrichenen Nacht noch immer niemand kam um ihn zu befreien, war seine anf├Ąngliche Hoffnung tiefer Verzweiflung gewichen.
Peter h├Ątte nicht zu sagen vermocht, wie viel Zeit im Halbdunkel des Kellers vergangen war, als der Riegel der Kellert├╝r ger├Ąuschvoll aufgeschoben wurde und die T├╝r einen Spalt breit ge├Âffnet wurde. Pl├Âtzlich war Peter hellwach. Der Kopfschmerz und die Benommenheit, die von dem Schlag auf den Hinterkopf herr├╝hrten, waren wie weggeblasen und Peter rappelte sich auf m├╝hsam vom Boden auf. Durch den T├╝rspalt sah er eine kleine untersetzte Frau mit welligem Haar, das bereits von grauen Str├Ąhnen durchzogen war mit einer Fackel in der Hand. Sein Herz machte vor Freude einen Sprung, da er einen Augenblick lang glaubte, er k├Ânnte die Frau einfach zu Seite schieben und die Treppe hinaufst├╝rmen. Schlie├člich war er j├╝nger und kr├Ąftiger als sie.
Dann realisierte er mit Schrecken, dass die Kellert├╝r mit einer Kette gesichert war. Sein Magen zog sich zusammen und eine namenlose Entt├Ąuschung ├╝berflutete ihn.┬á
Die Frau mittleren Alters schob mit dem Fu├č einen Teller mit einem St├╝ck Trockenfleisch und einem halben Fladenbrot durch die T├╝r. Offenbar war sie mit der Aufgabe betraut, zu verhindern, dass der Gefangene verhungerte. Zu mehr taugte die magere Portion gewiss nicht.
„Warum h├Ąlt man mich in diesem Loch gefangen?“, fuhr Peter die Besucherin in wilder Verzweiflung an.
Die Frau schrak zusammen und starrte Peter mit vor Furcht weit aufgerissenen schwarzen Augen an. Sicherlich hatte sie nicht erwartet, von dem Gefangenen angesprochen zu werden. Aber nat├╝rlich verstand sie kein Wort.
Sie stammelte etwas vor sich hin, w├Ąhrend sie hastig die Kellert├╝r schloss und mit zitternden H├Ąnden verriegelte. Dann h├Ârte sie Peter die Treppe hinaufeilten. Als sie oben ankam, rief eine barsche m├Ąnnliche Stimme der Frau etwas zu und daraus entwickelte sich ein Streit, der mit einer derartigen Heftigkeit gef├╝hrt wurde, dass er nicht nur im Keller, sondern bestimmt auch in s├Ąmtlichen Nachbarh├Ąusern zu h├Âren sein musste.
Peter versuchte sich auf jede Kleinigkeit zu konzentrieren, die von oben in den Keller drang, die er bei seiner geplanten Flucht ausn├╝tzen k├Ânnte. Ganz pl├Âtzlich war es im Haus wieder ganz still.
Er wird ihr doch hoffentlich nicht meinetwegen etwas angetan haben, fragte sich Peter bang.
Wieder verfiel er in sein vorheriges dumpfes Gr├╝beln und er zermarterte sich sein Hirn, was er tun k├Ânnte, um doch noch zu entfliehen. Aber es wollte ihm einfach kein Ausweg einfallen. Wenn er doch wenigstens einen Spaten h├Ątte! Dann k├Ânnte er wie der Graf von Monte Christo einen Tunnel graben. Da der Boden des Kellers aus gestampfter Erde bestand, w├╝rde er daf├╝r auch nicht wie sein Vorbild drei├čig Jahre brauchen. Peter schaute sich verzweifelt in seinem Verlie├č um, aber er fand keinen Gegenstand, der sich als Werkzeug zweckentfremden lie├č.
Noch nicht einmal Schreibmaterial hatte man ihm gelassen, unm├Âglich dem Bruder eine Nachricht zu schreiben! Aber wie sollte ich ihm einen Zettel zukommen, dachte er einen Augeblick sp├Ąter resigniert.
So vergingen einige Stunden, bis ein st├Ąmmiger Mann in einfacher Gewandung, der der Ehemann der Frau sein mochte Peter eine weitere Mahlzeit „servierte“, die auch nicht gehaltvoller oder wohlschmeckender war als die erste. Seine abweisende Miene signalisierte unmissverst├Ąndlich, dass der Mann nicht mit seinem Gefangenen zu verhandeln gedachte.
Peter haderte noch immer mit seinem Schicksal, als er am folgenden Morgen ├╝berraschenderweise Besuch von mehreren Personen erhielt: Im hellen Schein einer Fackel standen die heimt├╝ckische Frau, die den anderen als Lockvogel gedient hatte und f├╝nf M├Ąnner, die Peter noch niemals zuvor gesehen hatte. Alle waren in Gew├Ąnder aus besonders feinem Leinen gekleidet.┬á
Die sch├Âne Frau, der er gefolgt war hatte ├╝ber ihr Kleid ein schlauchf├Ârmiges, perlenverziertes Netz gezogen. Mit einer Geste bedeutete sie Peter, ihr zu folgen. Da die ├ťberzahl seiner Feinde erdr├╝ckend war, tat er wie ihm gehei├čen, wenn auch ├Ąu├čerst widerwillig, denn er f├╝hlte geradezu k├Ârperlich, dass ihm oben gro├če Gefahr drohte.
Es kostete Peter einige M├╝he, die Kellertreppe hinaufzusteigen, so geschw├Ącht war er von seiner Gefangenschaft. Ihm war schwindlig und seine Beine wollten ihm den Dienst versagen. Pl├Âtzlich streifte etwas Weiches seine Wade. Es war die Katze, die ihm in Keller Gesellschaft geleistet hatte. Bei Tageslicht betrachtet wirkte sie nicht mehr ganz so h├Ąsslich wie im Halbdunkel seines Verlieses und Peter war froh, dass er sein Mahl mit ihr geteilt hatte.
Einer der M├Ąnner zeigte anklagend auf das Tier und machte eine h├Ąmische Bemerkung. Mit finsterer Miene machte die Frau eine abwehrende Handbewegung. Offensichtlich betritt sie, dass die Katze ihr geh├Ârte und Peter sagte sich, dass das arme Tier sehr schlecht behandelt worden sein musste, dass die wenigen Happen, die er ihr abgegeben hatte, es f├╝r ihn eingenommen hatten.┬á┬á
Die sch├Âne Frau, die Peter in die Falle gelockt hatte, machte eine sp├Âttische Bemerkung und die Umstehenden lachten. Dann gab man Peter einen Sto├č in den R├╝cken, um ihn zu bedeuten, nicht l├Ąnger vor der Kellertreppe herumzustehen.
Mit Peter in ihrer Mitte durchquerten die M├Ąnner die Diele aus gestampftem Lehm, wie sie in den einfacheren H├Ąusern der Sobek-Oase weit verbreitet waren. Hier roch es angenehm nach frischem Brot und nach Kr├Ąutern. Der Duft lie├č Peter das Wasser im Mund zusammenlaufen und es emp├Ârte ihn, dass man ihm immer einen derartigen Schlangenfra├č in den Keller gebracht hatte, wo es im Haus offenbar kein Mangel an bessere Speisen gab. Peter f├╝hlte eine ohnm├Ąchtige Wut in sich aufsteigen, aber er wusste zugleich, dass er einen klaren Kopf behalten musste, wenn es ihm gelingen sollte, doch noch irgendwie zu entkommen.
Vier der M├Ąnner blieben vor der Haust├╝r stehen, w├Ąhrend der f├╝nfte Peter in einen angrenzenden Raum schleifte. Kaum dass er die Schwelle ├╝berschritten hatte, wurde die T├╝r ger├Ąuschvoll hinter ihm geschlossen. Das Sonnenlicht, das durch ein hohes Fenster fiel blendete Peter und er erschrak, als zwei Schemen ihm mit drohend erhobenen Gegenst├Ąnden entgegen schritten. Dann erkannte er erleichtert, dass es Frauen, nach ihrer Kleidung zu schlie├čen Dienerinnen waren. In ihren H├Ąnden hielten sie keine Waffen, sondern K├Ąmme, Gef├Ą├če und T├╝cher.
Eine der Frauen ├Âffnete eine Alabasterflasche. Ihr Inhalt roch so bet├Ârend nach einer exotischen Blume, dass Peter schwindlig wurde. Sein Blick fiel auf einen gro├čen Bottich und er erkannte, dass der Raum, in den man ihn gebracht hatte als Badezimmer diente. Ehe er protestieren konnte, hatte man ihn mit Wasser besprengt, wieder abgetrocknet und mit duftenden Salben parf├╝miert. Eine Frau brachte ihm ein paar neue Sandalen, w├Ąhrend sich sein Gewand zurechtzupfte und sein Haar k├Ąmmte, das ihm mittlerweile bis auf die Schultern fiel.
W├Ąhrend Peter willenlos die ganze Prozedur ├╝ber sich ergehen lie├č, war sein Verstand damit besch├Ąftigt herauszufinden, warum man ihn in einen pr├Ąsentablen Zustand zu versetzen suchte. Kaum wagte er zu hoffen, dass man ihn endlich gegen L├Âsegeld ausliefern w├╝rde. Aber warum eigentlich nicht? Vielleicht hatten sich die Entf├╝hrer mit seinem Bruder geeinigt und nun hatten sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihn in einem dreckigen Keller gefangen gehalten hatten.
Die beiden Dienerinnen begutachteten ihn, traten einen Schritt zur├╝ck und steckten die K├Âpfe tuschelnd zusammen. Dann klopfte eine von ihnen an die T├╝r, die augenblicklich aufgerissen wurde. In der Diele erwarteten die Hausherrin und die f├╝nf M├Ąnner ihren Gefangenen.
Die Haust├╝r stand sperrangelweit offen und einer der M├Ąnner gab Peter einen unsanften Sto├č, der ihn zum Stolpern brachte. Nur im letzten Augenblick fand er sein Gleichgewicht wieder, sodass er nicht fiel. Dann fand er sich auf der Gasse wieder und ehe er sich versah, f├╝hlte er die Spitze eines Schwertes im R├╝cken. Peter wurde von Panik ├╝berflutet. Er drehte den Kopf ganz leicht um einen verstohlenen Blick nach hinten werfen zu k├Ânnen und begann am ganzen K├Âper zu zittern, als er erkannte, dass der Besitzer des Schwertes aussah wie ein Soldat.
Sosehr er sich in den letzten beiden Tagen gew├╝nscht hatte, das Tageslicht wieder zu sehen und endlich wieder frische Luft zu atmen, so hatte Peter sich seine „Befreiung“ aus dem Keller nicht vorgestellt.
Auch die Umgebung lie├č zu w├╝nschen ├╝brig: Mit ihrem abbr├Âckelnden Putz waren die Umgebenden H├Ąuser so trostlos, dass Peter sich fragte, ob er v├Âllig von Sinnen gewesen war, ein derart sch├Ąbiges Viertel zu betreten. Sein Bruder w├╝rde ihn sicherlich mit Vorw├╝rfen ├╝bersch├╝tten, wenn er davon erfuhr. Peter rief sich ins Ged├Ąchtnis, dass er zuerst fliehen musste, ehe ihn jemand tadeln konnte und eine neue Welle der Panik stieg ihn ihm auf.
Was hatte man mit ihm vor? Dies sah nicht aus, wie die ├ťbergabe eines Entf├╝hrten! Peter sp├╝rte geradezu k├Ârperlich, wie sich etwas Unheilvolles ├╝ber ihm zusammenbraute, denn die Fenster der H├Ąuser waren verh├Ąngt, die Werkst├Ątten mit ihren L├Ąden geschlossen und aus ihrem Inneren, drangen das Klagen von Frauen und das Weinen von Kindern. Wovor um Himmels Willen f├╝rchteten die Einwohner der dritten Oase sich so?
Sein m├╝der Blick fiel auf die graue Katze mit dem struppigen Fell, die zu ihm hochblickte und er murmelte ihr einige aufmunternde Worte zu, die er jedoch selbst bitter n├Âtig gehabt h├Ątte.
Einer der M├Ąnner fuhr Peter barsch an und machte eine Handbewegung, die nur bedeuten konnte, dass er vorangehen sollte. Wieder fragte Peter sich, wohin man ihn wohl bringen wollte. Die Sonnenstrahlen blendeten ihn und er begann zu blinzeln, aber bald machte die Gasse einen Knick und nun brannte ihn die Sonne auf den Nacken, aber er wagte es nicht, sich den Hals abwischen, weil er Angst hatte, dass seine Armbewegung missverstanden werden k├Ânnte.
Die ├Ąrmlichen H├╝tten, die Peter passierte, besa├čen weder Terrassen noch G├Ąrten. Offenbar war es offensichtlich auf diesen Oasen nur den Priestern verg├Ânnt, unter Palmb├Ąumen zu lustwandeln. Der gr├Â├čte Teil des Volkes musste hingegen mit diesen engen Unterk├╝nften vorlieb nehmen, die nicht einmal vorkragende D├Ącher besa├čen, die etwas Schatten h├Ątten spenden konnte.
Peter schritt schneller, da ihn die Spitze des Schwertes in die Haut bohrte. Als er das Ende der Gasse erreicht hatte, zeigte sich, dass das Haus, in dessen Keller man ihn eingesperrt hatte keinesfalls ungew├Âhnlich heruntergekommen war: Je weiter der Zug sich vom Zentrum entfernte, desto verwahrloster wurden die Behausungen bis sie kaum mehr als Notunterk├╝nfte waren, elende Schuppen, deren W├Ąnde keine richtigen D├Ącher trugen, sonder nur mit Palmbl├Ąttern abdeckt waren.
Ab und zu ├Âffnete sich eine morsche Haust├╝r oder ein ├Ąrmliches Hoftor. Heraus kamen M├Ąnner mit finsterem Gesichtsausdruck - manche von ihnen sogar mit T├╝chern vermummt - die sich ihnen anschlossen. Ein paar Frauen und M├Ądchen folgten ihnen mit einigem Abstand, aber Peter sah keine Kinder in der stetig anwachsenden Menge. Beim Anblick der grimmigen Gesichter wurde es ihm noch mulmiger zumute, falls dies ├╝berhaupt noch m├Âglich war. Aber am schlimmsten waren die mitleidigen Blicke, die ihm der eine oder andere Oasenbesucher verstohlen zuwarf, wenn er glaubte, dass ihr Gefangener dies nicht bemerkte. Sie gingen Peter durch Mark und Bein.
Wo mochte wohl Johann gerade stecken? Hatte der Bruder ├╝berhaupt irgendwelche Anstalten unternommen, um ihm zu helfen? Dies war das erste Mal in seinem Leben, dass Peter seine Hilfe ben├Âtigt h├Ątte und schon lie├č Johann ihn im Stich.
Die Neuank├Âmmlinge starrten Peter an, doch waren lag in ihren Blicken eher Neugier als B├Âsartigkeit. Wahrscheinlich hatten die meisten von ihnen noch niemals einen Europ├Ąer aus der N├Ąhe gesehen.
Ein einfach aussehender, ├Ąlterer Mann mit sch├╝tterem Haar und Bauchansatz fuhr Peter in einem groben Tonfall an. Wahrscheinlich gefiel ihm nicht, dass der Gefangene seinen Blick hatte schweifen lassen. Trotz seines unversch├Ąmten Auftretens konnte der alte Mann nicht verbergen, dass ihn etwas beunruhigte.
Noch immer sp├╝rte Peter die Schwertspitze in seinem R├╝cken. In einem Anflug von Galgenhumor sagte er sich, dass er wahrscheinlich noch daf├╝r dankbar sein musste, dass man ihn nicht gefesselt hatte. Warum eigentlich nicht? Daf├╝r konnte es eigentlich nur eine Erkl├Ąrung geben: Was diese Menschen vorhatten verstie├č gegen die Gesetze der dritten Oase. So konnten sie im Zweifelsfall behaupten, er w├╝rde sie aus freien St├╝cken begleiten. Und da er die Landessprache nicht beherrschte, konnte Peter sie noch nicht einmal der L├╝ge bezichtigen.
Auf dem Marsch durch die gaffende Menge vermochte Peter bald nicht mehr alle Einzelheiten festzuhalten. Vor seinen, durch dem Aufenthalt in der Dunkelheit empfindlich gewordenen Augen verschwamm alles um ihn herum in einen Wirbel, die halbnackten M├Ąnner, die farbigen Kleider der Frauen, das Geraune der Schaulustigen, das Gebr├╝ll von Tieren, die mitgeschleift wurden.┬á┬á
Als sie das Ortsende hinter sich gelassen hatten und sich vor ihnen ein mauerumg├╝rteter Tempel in einer ├Âden Steppenlandschaft erhob, war die Menge bereits auf mindestens f├╝nfzig Personen angewachsen.
Anscheinend war der Tempel das Ziel der Prozession und Peter fragte sich mit gemischten Gef├╝hlen, welchem tierk├Âpfigen heidnischen Gott dieser Sakralbau wohl geweiht sein mochte, dessen verschlossenes Portal von drei kahlk├Âpfige, aber bewaffnete Priester patrouillierten wurde.
Noch bevor der Zug die Pforte erreichte, kam der ├Ąlteste und daher wohl rangh├Âchste der W├Ąchter ihnen mit langsamen, w├╝rdevollen Schritten entgegen. Er donnerte der Menge einige Worte entgegen, die nur hei├čen konnten, dass er ihr den Zutritt verwehrte, aber er tat dies in einer unversch├Ąmten Art und Weise, die erkennen lie├č, dass er seine Pflichten missachten w├╝rde, wenn man ihn daf├╝r angemessen entlohnte.
Trotzdem hoffte Peter einen Augenblick lang wider alle Vernunft, dass die Priester den Oasenbewohnern ins Gewissen reden k├Ânnten.
Aber die anderen berieten sich nicht einmal, sondern der Mann, in dessen Keller Peter eingesperrt gewesen war, schien die Reaktion des Priesters erwartet zu haben. Er trat n├Ąmlich vor und dr├╝ckte dem W├Ąchter eine Silberm├╝nze in die Hand, die dieser mit einer schnellen, einge├╝bten Bewegung in dem Beutel, der am seinem G├╝rtel hing verschwinden lie├č.
Dann rief der korrupte W├Ąchter den anderen beiden Priestern etwas zu, wahrscheinlich dass er seine Beute mit ihnen teilen w├╝rde und sie daher den Weg freigeben sollten. Die schweren T├╝rfl├╝gel aus Zedernholz wurden ge├Âffnet und die die Menge konnte ungehinderte das Portal der Umfassungsmauer des Tempels passieren.
Ihre Anf├╝hrer bogen in einen staubigen Pfad ein, der entlang des Tempels f├╝hrte und diesen mit einem kleinen Palmenhain verband. Mittlerweile war Peter vom Hunger und dem Marsch durch die Sonne so ersch├Âpft, dass er den Hain wie in Trance durchquerte. Mechanisch setzte er einen Fu├č vor den anderen und bei jedem Schritt f├╝rchtete er das Bewusstsein zu verlieren.
Dann stand er unvermittelt am Rande eines sumpfigen T├╝mpels, an dessen Ufer Schildgras wuchs. Lilien und Lotosbl├╝ten bedeckten seine Oberfl├Ąche. Einige von ihnen waren fast so gro├č wie Teller und dazwischen regte sich etwas unter Wasser.
Vor dem Teich hatte sich bereits eine Menschenmenge um einen muskul├Âsen Mann mit kahl geschorenem Sch├Ądel versammelt, der den Schurz der ├Ągyptischen Priester trug, aber Peter bezweifelte, dass dieser grobknochige Geselle mit seinem brutalen Gesichtsausdruck tats├Ąchlich ein richtiger Priester war. Trotzdem - oder vielleicht gerade deshalb - fl├Â├čte ihm der Anblick des Mannes eine namenlose Furcht ein.
Eine vage Ahnung, was hier stattfinden sollte, begann in Peter aufzusteigen. Jedoch er weigerte er sich zu glauben, dass er dies tats├Ąchlich sein konnte. Soweit er informiert war, gab es bei den alten ├ägyptern keine Menschenopfer, aber seitdem waren viele Jahrhunderte vergangen und die Sitten konnten sich inzwischen ge├Ąndert haben. Bei dieser Vorstellung ├╝berkam Peter eine derartige ├ťbelkeit, dass er sich fast ├╝bergeben h├Ątte. Trotz der Hitze des Sommertages lief ihm ein eisiger Schauder den R├╝cken hinunter, auf seinen Armen bildete sich eine G├Ąnsehaut und seine Fingerspitzen waren kalt und taub.
In der irrationalen Hoffnung, den Bruder in der Menschenmenge zu erkennen, schaute Peter sich um. Sein Blick blieb an einem quadratischen Stein haften, der ganz in seiner N├Ąhe stand und von dem eine schwache Rauchfahne in die Luft aufstieg. Das ist ein Altar, durchfuhr es Peter. Auf dem Boden war eine Blutlache, ├ťberbleibsel eines vor kurzem vollzogenem Opfers.┬á
Dieser Anblick fl├Â├čte ihm ein wahres Grauen ein, zumal sich der selbsternannte Priester mittlerweile hinter dem Altar aufgebaut hatte. Ihm waren zwei M├Ąnner in den langen Gew├Ąndern der Beduinen gefolgt, die angeregt mit dem Priester sprachen. Erst als sich einer der beiden umdrehte, erkannte Peter sie und am liebsten h├Ątte er sie laut beschimpft: Es waren die beiden ehemaligen Karawanenf├╝hrer, die Takait entf├╝hrt hatten. Wo mochte die Tempelt├Ąnzerin nur stecken? Hatten ihre Entf├╝hrer sie hierher mitgeschleppt? Peter lie├č seinen Blick ├╝ber die K├Âpfe der Menge schweifen, aber Takait war nirgends zu sehen. Er atmete erleichtert auf, denn er hatte schon bef├╝rchtet, dass sie mittlerweile mit den Beduinen gemeinsame Sache machten k├Ânnte.
Der ├Ąltere der beiden Nomaden zeigte mit dem Finger auf ihn und der Mann in Priesterkleidung sch├╝ttelte den Kopf, aber ehe Peter sich aus dem Verhalten der M├Ąnner einen Vers machen konnte, zog eine Gruppe alter Frauen seine Aufmerksamkeit auf sich. Mit zeremoniellen, bed├Ąchtigen Schritten trugen sie eine kleine h├Âlzerne Barke herbei, in deren Buk und Heck Krokodilk├Âpfe eingeschnitzt waren. In der Mitte der Barke befand sich ein Schrein aus Ebenholz, der mit T├╝chern verh├Ąngt war. Die Frauen sangen leise im Chor eine Hymne, die f├╝r Peters Ohren geradezu schmerzhaft dissonant klang. Ihre Prozession endete am Tempelteich, wo sie die Barke auf den Boden stellten. Sie zogen der Vorh├Ąnge zur├╝ck und enth├╝llten ein farbig bemaltes h├Âlzernes G├Âtterbild.
Erschrocken bemerkte Peter, dass das G├Âtterbild den Kopf eines Krokodils besa├č. Der Tempel au├čerhalb des Ortes war also die Heimstatt dieses schrecklichen Mischwesens und die Schemen, die er vorhin im T├╝mpel gesehen hatte, waren die irdischen Verk├Ârperungen dieses krokodilk├Âpfigen Gottes!
Immer mehr Menschen begannen zu singen. Ihre Augen waren auf das gr├Ąssliche Standbild gerichtet, ihre H├Ąnde klatschen einen monotonen Rhythmus, zu dem einige mit den F├╝├čen stampfen. Andere hatten Sistren dabei.
Am Rand der Gruppen standen einige gaffende junge Leute, die nicht in den Gesang eingestimmt hatten und die offenbar weniger ihre Gl├Ąubigkeit als schiere Sensationsgier zum Tempelteich gef├╝hrt hatte. Peter fragte sich verzweifelt, wann endlich der Bruder zu seiner Rettung kam.
*
Takait hatte nicht im Neith-Tempel, sondern in der Karawanserei ├╝bernachtet, da sie sich vor dem obersten Priester f├╝rchtete. Wenn sie nur an seine eiskalten Augen dachte, schauderte es sie. Au├čerdem f├╝hlte sie sich von diesem Hori durchschaut, der so unversch├Ąmt gewesen war, sie einfach auf den Marktplatz zu schupsen, wo die Fremden auf sie gewartet hatten.
Leider hatte sie die Karawanserei sp├Ąter verlassen als beabsichtig, da sie Johann ├╝berall gesucht hatte. Erst als sie zum dritten Mal durch den Haupteingang geschossen war, hatte sich der Pf├Ârtner endlich daran erinnert, dass er ihr eine Nachricht von Menas┬á ├╝bermitteln sollte. Zur Strafe f├╝r seine S├Ąumigkeit hatte Takait dem Pf├Ârtner kein Bakschisch gegeben, noch nicht einmal ein ganz kleines. Das w├╝rde ihm sicher eine Lehre f├╝rs Leben sein, aber es brachte Takait aber die verlorene Zeit auch nicht wieder zur├╝ck.
Einerseits beruhigte es sie, dass Johann nun doch nicht an ihrer gef├Ąhrlichen Mission teilnahm. Andererseits fand sie es typisch f├╝r den alten Menas, dass er sich nicht nur selbst gedr├╝ckt hatte, sondern auch Johann dazu verleitet hatte es ihm gleich zu tun.
Als sie endlich den Sobek-Tempel erreichte, wunderte sie sich ├╝ber die pflichtvergessenen W├Ąchter, die trotz der drohenden Kriegsgefahr das Portal hatten sperrangelweit aufstehen lassen. Auch die Kontrolle der Besucher schien an diesem Tag ├Ąu├čerst nachl├Ąssig zu sein, denn Takait hatte schon fast das Portal passiert, als sich endlich ein W├Ąchter blicken lie├č. Es war ein magerer Bursche mit gro├čen F├╝├čen und schlechtem Gebiss.┬á
„Ich bin Tempelt├Ąnzerin!“, erkl├Ąrte Takait, da ihr kein besseres Argument einfiel, um in den heiligen Bezirkt eingelassen zu werden.
„T├Ąnzerin seid ihr?“, fragte der Priester erstaunt nach, „dann solltet Ihr Euch lieber beeilen! Die anderen erwarten Euch sicherlich bereits am Tempelteich!“
Takait erschrak, als sie diese Worte h├Ârte. War sie zu sp├Ąt gekommen? Hatte man Peter bereits dem Krokodilgott geopfert?
Mit klopfenden Herzen folgte sie hastig dem ausgetretenen Pfad, der zum Tempelteich f├╝hrte, an dessen Ufer sich eine be├Ąngstigend gro├če Menschenmenge versammelt hatte. Einige sangen, andere beteten, wieder andere standen einfach herum.
Schon von weitem erkannte Takait Peter an seiner K├Ârpergr├Â├če und an seiner hellen Haut. Hinter ihm stand ein Mann in Priesterkleidung, dessen Gesicht Takait nicht sehen konnte. Dies war also der abtr├╝nnige Priester, der das Volk aufgehetzt hatte!
Wenigstes lebt Peter noch! Ich kann noch das Schlimmste verhindern, durchfuhr es Takait. Bei seinem Anblick war sie so erleichtert, dass sie ihm h├Ątte um den Hals fallen k├Ânnen. Zugleich war ihr aber auch ziemlich mulmig zumute. Was mochte Peter nun von ihr denken? Wahrscheinlich hasste er sie und sie konnte es ihm nicht verdenken! Johann hatte v├Âllig Recht! Durchfuhr es Takait. Das ist alles meine Schuld. Ich h├Ątte die Karawane nicht verlassen d├╝rfen! Takait versuchte, ihr schlechtes Gewissen zu bes├Ąnftigen, denn schlie├člich war sie gekommen, um den Gefangenen zu retten, doch der Gedanke kam immer wieder, lauter und st├Ąrker.
Eigentlich hatte Takait vorgehabt, am Tempelteich tanzen um das Eingreifen der G├Âttin Hathor zu bewirken, aber sie bezweifelte mittlerweile, ob sich dieser Plan durchf├╝hren lie├č. W├╝rde dieser aufgeregte Mob sie ├╝berhaupt tanzen lassen? Und selbst falls es ihr gelingen sollte, w├╝rde die G├Âttin ihretwegen erscheinen, obwohl sie den Oasenkrokus in ihrem Garten gestohlen hatte?
Takaits Schritte beschleunigten sich immer mehr, bis sie fast rannte, aber sie sagte sich, dass sie ruhig und w├╝rdevoll auftreten musste, wenn sie Erfolg haben wollte. Also zwang sie sich, hoheitsvoll zu schreiten.
Endlich erreichte sie die Volksmenge, aber niemand nahm von ihr Notiz, was eine neue Erfahrung f├╝r Takait war, die es bisher gewohnt gewesen war, ├╝berall durch ihre Sch├Ânheit Aufsehen zu erregen.
Mit Schrecken stellte es fest, dass man Peter bereits vor den Opferaltar geschleift hatte. Gl├╝cklicherweise war er nicht gefesselt, aber ein vierschr├Âtiger ├ägypter, der wie ein Soldat wirkte, bedrohte ihn mit seinem blanken Schwert.
„Ihr wisst alle, warum wir uns zu dieser schweren Stunde hier versammelt haben!“, rief der falsche Priester in diesem Augenblick pathetisch aus. Seine hohe, etwas schrille Stimme verursachte Takait eine G├Ąnsehaut. Sie wusste, dass sie diese Stimme schon einmal geh├Ârt hatte, konnte sich aber nicht entsinnen, wem sie geh├Ârte. „Ich werde diesen Fremden dem Krokodilgott Sobek in seinem Heiligtum opfern, damit seine Mutter, die m├Ąchtige G├Âttin Neith uns den Sieg ├╝ber die ├ťbermacht unserer Feinde schenken m├Âge!“, Er hielt das blutbefleckte Opfermesser in der hoch erhobenen Hand, sodass es alle sehen konnten, und ein Raunen ging durch die Menge.
„Haltet ein!“, entgegnete Takait spontan und ohne Nachzudenken. „Die G├Âtter missbilligen das Opfer von Menschen! Lasst diesen unschuldigen Fremden sofort wieder frei oder der gerechte Zorn der Hathor wird euch alle treffen!“
Der Mann in Priesterkleidung drehte sich um, sodass Takait sein Gesicht sehen konnte und sie war einen Augenblick lang irritiert, da er ihr vage bekannt vorkam. Dann fiel ihr pl├Âtzlich ein, woher sie diese stechenden Augen kannte, die so dunkel waren, dass sie fast schwarz wirkten. Sie geh├Ârten einem der Kaufleute, mit denen sie zur Nordoase gereist war. Aber wie hatte er sich ver├Ąndert! Konnte aus dem unauff├Ąlligen, schweigsamen Mann mit den h├Ąngenden Schultern eine derart furchteinfl├Â├čende Erscheinung geworden sein? Er war gro├č und drahtig, was Takait zuvor entgangen war und sein dichtes, dunkles Haar war von einzelnen grauen Flechten durchzogen, doch schien er noch jung zu sein. Hochaufgerichtet baute sich dieser schreckliche Mann vor Takait auf, seine bohrenden, kohleschwarzen Augen auf sie gerichtet und den Dolch noch immer drohend in der Rechten.
„Und du wei├čt, was die G├Âtter w├╝nschen?“, fragte er in einem h├Ąmischen Tonfall, wobei er das Wort „du“ stark dehnte.┬á
Jemand machte eine sp├Âttische Bemerkung, die Takait aber ignorierte. Sie bek├Ąmpfte den Impuls, auf einer respektvolleren Anrede zu bestehen. Ver├Ąrgert fragte sie sich, welchen Groll dieser falsche Priester gegen sie hegte. Vielleicht lie├č er sie nun daf├╝r b├╝├čen, dass ihre Reisegef├Ąhrten sich stets von den H├Ąndlern ferngehalten hatten? Takait beschloss, vorsichtshalber vorerst nicht zuzugeben, dass sie ahnte, wer er war. Vielleicht hatte sie Gl├╝ck und er erkannte sie in Frauenkleidern nicht wieder.
Beunruhigt schluckte Takait, dann nahm sie all ihren Mut zusammen, richtete sich zu ihrer ganzen, f├╝r eine Frau nicht unbetr├Ąchtlichen K├Ârperl├Ąnge auf und holte tief Luft.
„Ja, ich wei├č, was die G├Âtter von uns Menschen erwarten!“, widersprach sie dann mit fester Stimme. „Mein Name ist Takait …“
„Das brauchst du uns nicht zu sagen?“, unterbrach der falsche Priester mit bei├čendem Spott in der Stimme. „Wir alle kennen deinen Namen! Schlie├člich bist du auf dieser Oase geboren und aufgewachsen!“ Er warf einen beifallerheischenden Blick in die Menge und Takait realisiert mit Schrecken, dass sie den Mann verwechselt hatte: Er war nicht der Kaufmann mit den h├Ąngenden Schultern, mit dem er eine fl├╝chtige ├ähnlichkeit besa├č, sonder er geh├Ârte zur Familie des alten Mannes, mit dem ihr Stiefvater sie verheiraten wollte. Wie soll das alles wohl noch enden? Dachte sie bang und bedauerte in diesem Augenblick von ganzen Herzen, dass sie auf diese von den G├Âttern verdammte Oase zur├╝ckgekehrt war.┬á
„Statt in den Ehestand einzutreten, reist Takait lieber mit fremden M├Ąnnern durch die W├╝ste!“, erkl├Ąrte der selbsternannte Priester, als ob er ihre Gedanken gelesen h├Ątte und wieder ging ein Raunen durch die Menge. „Oder sie treibt sich in der s├╝ndigen Metropole Alexandria herum!“
„Ich bin eine T├Ąnzerin der Hathor! Zu Ehren der G├Âttin zu tanzen ist meine Berufung!“, erkl├Ąrte Takait trotzig, obwohl sie doch eigentlich lieber Priesterin geworden w├Ąre.
„Du bist gekommen, um f├╝r uns zu tanzen?“, fragte eine schneidende Stimme, aber es war nicht der schreckliche Priester, der gesprochen hatte, sondern Abdul, der j├╝ngere der beiden Karawanenf├╝hrer, den Takait bisher nicht in der Volksmenge bemerkt hatte. Bei seinem Anblick packten sie wahre Mordgel├╝ste. „Diese Frau ist es nicht wert, f├╝r die G├Âtter zu tanzen, denn sie ist eine L├╝gnerin und eine Diebin!“ Takait fragte sich schon, wie der Beduine vom Raub des Oasen-Krokus erfahren hatte, als ihr das Kamel wieder einfiel, das sie sich ausgeliehen hatte. „Und dieser Mann, den wir dem Sobek opfern wollen, ist kein beliebiger unschuldiger Fremder ist“. Der finstere Mann spuckte das Wort unschuldig aus wie eine Beleidigung, „sondern das gn├Ądige Schicksal hat uns den Sohn des Mannes in die H├Ąnde gespielt, dem ihr das Sakrileg, das er begangen hat gro├čm├╝tig verziehen habt, den Sohn des Mannes, der unsere Welt verraten wollte, den Sohn des Mannes, dessen Namen in unserer Sprache gr├╝ner Berg bedeutet.“
Ein kollektiver Aufschrei der Menge war die Antwort auf diese Beschuldigung. Auch Takait erschrak ├╝ber die verbl├╝ffende Enth├╝llung halb zu Tode und sie musste sich an am Stamm einer Palme festhalten, damit niemand sah, dass sie am ganzen Leib zitterte. Sie schalt sich selbst eine N├Ąrrin. Sie h├Ątte ihre Reisegef├Ąhrten warnen sollen, dass deren Vater auf der dritten Oase als Frevler galt. Aber sie hatte geschwiegen, weil sie ihnen nicht die Erinnerung an den Vater verderben wollte. Au├čerdem sahen f├╝r sie selbst - wie sie in Alexandria festgestellt hatte - alle Europ├Ąer gleich aus. Daher hatte sie nicht erwartet, dass jemand die Familien├Ąhnlichkeit zwischen den Br├╝dern und ihrem Vater bemerken k├Ânnte.
Takait sagte sich, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt war, um sich Vorw├╝rfe zu machen. Sie durfte nicht aufgeben – sonst war Peter verloren - und daher beschloss sie, zum Gegenangriff ├╝berzugehen.┬á
„Wir d├╝rfen den Sohn nicht f├╝r die Taten des Vaters verantwortlich machen“, begann sie und blickte dann den Nomaden finster an. „Au├čerdem wundert mich, dass ausgerechnet du die Unverfrorenheit besitzt, mich eine Diebin zu hei├čen, obwohl du selbst ein Grabr├Ąuber bist!“ Takait hatte so laut gesprochen, dass alle ihre Worte geh├Ârt haben mussten und diese verfehlten nicht ihre Wirkung, denn ganz pl├Âtzlich herrschte ein betretenes Schweigen vor dem Tempelteich.
Abdul trat in einer j├Ąhen Bewegung auf Takait zu und erhob den Arm zum Schlag, aber sein Bruder hielt ihn zur├╝ck.
Takaits Blick streifte Peter und sie bemerkte, dass er sie so argw├Âhnisch anblickte, als ob er bef├╝rchtete, dass sie die Menge noch mehr gegen ihn aufgebracht haben k├Ânnte. Er hatte kein Wort verstanden, wie Takait sich ins Ged├Ąchtnis rief. Trotzdem verletzte sie sein unausgesprochener Vorwurf.
„Glaubt ihr kein Wort“, erkl├Ąrte nun der ├Ąltere Beduine. „Wie mein Bruder schon sagte, sie ist eine notorische L├╝gnerin und eine abgefeimte Diebin!“
„Und dieser Mann hier“, Takait deutete auf ihn. „Ist sein Bruder und Komplize. Sie sind nur hierher gekommen, um den Tempel der Neith zu berauben!“ Takait machte eine Kunstpause, um ihre Worte wirken zu lassen. Dann zeigte sie mit dem Finger auf selbsternannten Priester, der als Volk aufgewiegelt hatte. „Und der dritte im Bunde ist auch kein Priester, sondern ein einfacher Oasenbewohner wie ihr selbst!“
„Das ist er leider doch!“ Takait erkannte sofort die Stimme des Mannes, der nun aus der Menge trat, auch wenn sie ihm bisher stets aus dem Weg gegangen war. Sie geh├Ârte Hori, dem Priester des Tempelhofs, den sie vorhin noch verflucht hatte. Er warf seinen Umhang ab und nun konnten alle an seinen Insignien sehen, dass er ein Priester der Neith war. Die Menge begann wieder unruhig zu werden. „Zumindest fr├╝her war er tats├Ąchlich ein Priester, aber wir haben ihn aus unseren Reihen versto├čen, weil er die Spenden der Gl├Ąubigen unterschlagen hat. Er wurde als unw├╝rdig befunden, weiterhin unserer G├Âttin zu dienen.“
Der angema├čte Priester wollte widersprechen, aber Hori brachte ihm mit einer ungeduldigen Handbewegung zum Schweigen.
„Takait hat die Wahrheit gesagt. Was ihr vorhabt ist ein gro├čes Unrecht! Ihr werdet alle nach der Schlacht daf├╝r zur Verantwortung gezogen werden!“
Takait fragte sich, ob es klug war, einer aufgebrachten Volksmenge zu drohen.
„Du bist doch nur neidisch, dass ich einen h├Âheren Rang innehabe als du“, konterte der Mann in Priesterkleidern. „Ich bin Oberpriester, w├Ąhrend du doch noch immer nur ein besserer Pf├Ârtner bist!“
„Aber immerhin bin ich noch ein offizieller Priester“, konterte Hori und dann warfen sich die beiden Priester gegenseitig Beleidigungen an den Kopf.
Die Gl├Ąubigen starrten sie in wortlosem Entsetzen an. Dann kam pl├Âtzlich Bewegung in die Menge: Alle redeten aufeinander ein, doch keiner schien dem anderen zuzuh├Âren, und Takait nutzte das Durcheinander, um langsam und wie zuf├Ąllig auf Peter zuzugehen, ohne dass dies jemand zu verhindern suchte. Erstaunt bemerkte Takait, dass eine zerzauste Katze neben Peter auf dem Boden sa├č.
„Du schwebst in gro├čer Gefahr“, raunte sie Peter zu, der sie ernst anschaute. In seinen Augen stand ein merkw├╝rdiger, fiebriger Glanz. „Man will dich dem Krokodilgott Sobek opfern.“
Peter sch├╝ttelte mit einem freudlosen Lachen den Kopf.
„Das habe ich ihrem Verhalten bereits entnommen, aber was hast du zu ihnen gesagt?“
„Das erz├Ąhle ich dir nachher, wenn wir in Sicherheit sind“, versprach Takait, „der Priester, der eben gesprochen hat, ist auf deiner Seite. Lass uns also m├Âglichst unauff├Ąllig zu ihm gehen“┬á
Takait ergriff Peter am Arm, der sich dies gl├╝cklicherweise gefallen lie├č. Sie zog ihn am Opferaltar vorbei durch die Menge, bis sie endlich Hori erreicht hatten.
Den beiden Priestern, waren offenbar die Schimpfworte ausgegangen. Sie standen einander wortlos gegen├╝ber und starrten sich feindselig an, umringt von der gar nicht mehr so aufgebrachten Menschenmenge. In den Gesichtern der umstehenden M├Ąnner und Frauen sah Takait nichts au├čer Skepsis, Schuldbewusstsein und Angst.
Wie konnte sie diesen Stimmungswandel nur f├╝r ihre Zwecke n├╝tzen? Bevor sich Takait diese Frage beantwortet hatte, machte der Volksverhetzer einen Ausfallschritt nach hinten und trat dabei die graue Katze, die sich in der dicht gedr├Ąngten Menge nicht beizeiten retten konnte.
Die Katze fauchte wild, ihre Nackenhaare str├Ąubten sich und sie machte einen Buckel.
„Jetzt seht ihr, was von diesem selbsternannten Priester zu halten ist!“, verk├╝ndete Hori in einem leicht ├╝bertriebenen pathetischen Tonfall. „Jede Gewalttat gegen ein Tier ist bekanntlich ein Frevel gegen die G├Âtter. Wie ihr wisst, ist die Katze der G├Âttin Bastet heilig!“
Takait musste neidlos zugeben, dass dies ein sehr kluger Schachzug war. Schlie├člich mussten die Verstorbenen beim Totengericht des Osiris beteuern, dass sie kein Tier gequ├Ąlt hatten. Dann erst wurde ihre Seele gewogen. Und was Bastet betraf, so wurde ihr zu Ehren sogar Katzen mumifiziert. Dann kam Takait endlich die rettende Idee.
„Genauso war es auf der ersten Oase, bevor das Unheil begann! Jemand hat eine Katze getreten“, erkl├Ąrte Takait mit lauter Stimme, wobei sie nat├╝rlich verschwieg, dass es ausgerechnet der ungl├╝cksselige Peter gewesen war, dem dieses Missgeschick zugesto├čen war, „nur wenige Stunden sp├Ąter sind das Labyrinth und der Sphinx eingest├╝rzt!“
Inzwischen war die Volksmenge in wilder Aufregung begriffen.
„Das war ein ganz normales Erdbeben, wie es bei uns nicht ungew├Âhnlich ist! Die Armee der ersten Oase sucht doch schon lange nach einem Vorwand um uns anzugreifen“, rief der falsche Priester den Umstehenden zu, aber niemand schien von dieser banalen Erkl├Ąrung ├╝berzeugt zu sein.
„Vielleicht sollten wir lieber den Priester dem Sobek opfern? Er hat eine Katze gequ├Ąlt!“, br├╝llte eine aufgebrachte m├Ąnnliche Stimme aus der Menge. Jubelnder Applaus bewies, dass er nicht der der einzige war, der so dachte.
„Hier wird niemand geopfert“, entgegnete Hori mit einem zornigen Unterton in der Stimme.
„Aber wir m├╝ssen doch Neith gn├Ądig stimmen!“, rief eine andere m├Ąnnliche Stimme, und wieder jauchzte die Menge. Die Gl├Ąubigen traten n├Ąher an den Altar heran und Takait streckte ihre Hand nach Peter aus, aber dieser hatte schon verstanden. Langsam, um kein Aufsehen zu erregen entfernten sich die beiden vom Teich.
Zur├╝ckschauend sah Takait, dass obwohl Hori weiter gegen die Lynchjustiz protestierte, die Menge den falschen Priester und die beiden Nomaden bis an den Teichrand gedr├Ąngt hatte, wo ein Schilfboot am Ufer stand, das die M├Ąnner im Begriff waren zu betreten. Fast h├Ątte Takait ihnen zugerufen, dass dies nur ein Zeremonialboot war, mit dem sie nicht weit kommen w├╝rden. Dann besann sie sich eines Besseren, denn sie durfte Peters Flucht nicht gef├Ąhrden.
Schritt f├╝r Schritt durchquerten Takait und Peter die Menschenmenge, die sich nicht mehr f├╝r sie interessierte. Als sie das Tempelportal fast erreicht hatten, drangen von hinten Schreie an Takaits Ohren, die sogar das laute Gejohle der Menge ├╝bert├Ânten. Takait schaute ├Ąngstlich zur├╝ck, obwohl sie nicht sicher war, ob sie wirklich sehen wollte, was in der Zwischenzeit geschehen war. Die Volksmenge blickte auf den T├╝mpel, obwohl es dort nicht viel zu sehen gab: Das Schilfboot war gekentert. Von seinen beiden Insassen fehlte jede Spur. Nur f├╝nf gro├če Krokodile schwammen um die mit Wasser vollgesogenen Schilfb├╝ndel, die mit Blutflecken besudelt waren.
„Das ist ja schrecklich!“, stammelte Peter, der neben Takait stand und sich ebenfalls umgeschaut hatte.
„Wir sollten schleunigst von hier verschwinden“, entgegnete Takait, „du bist erst in Sicherheit, wenn wir diese von den G├Âttern verdammte Oase verlassen haben.“
Peter nickte und wandte sich zum Weitergehen.
Sie haben ihre gerechte Strafe erhalten, durchfuhr es Takait und sie sch├Ąmte sich im selben Augenblick f├╝r diesen Gedanken.
 
Der Aufbruch
24. Der Aufbruch
Nur Formularende
mit allerletzter Kraft schleppte Peter sich zur Karawanserei. Wahrscheinlich h├Ątte er es allein nicht geschafft, den Ort zu durchqueren. Aber kaum dass sie das ausgedehnte Gel├Ąnde des Sobek-Tempels hinter sich gelassen hatten, hatte ihn Takait dazu ermuntert, sich auf sie zu st├╝tzen. Die Gefangenschaft im Keller, das v├Âllig unzureichende Essen und die Ungewissheit ├╝ber sein Schicksal hatten mehr an seinen Kr├Ąften gezehrt, als ihm bewusst gewesen war. Der Anspannung der vorangegangenen Stunden war nun eine tiefe Ersch├Âpfung gefolgt, die sich in Lethargie zu verwandeln drohte.┬á
Als er ├╝ber die Schwelle des Hauptportals wankte, glaubte er einen Augenblick lang, dass die Oase von einem Erdbeben heimgesucht wurde, aber es waren seine Sinne, die ihm einen Streich spielten. Dann wurde zog sich ein schwarzer Vorhang vor seine Augen und er hatte den Eindruck in einen Brunnen zu fallen. Das letzte, was er wahrnahm, waren die aufgeregten Stimmen M├Ąnnern in langen Gew├Ąndern.
Als er die Augen wieder ├Âffnete, schaute er in das Gesicht seines Bruders, in dem die Besorgnis einem Ausdruck der Erleichterung wich.
„Er ist wieder aufgewacht!“, rief Johann durch das Fenster in den Innenhof und Peter schaute sich in dem gro├čen Raum um, der nach Schwei├č und Stroh roch.
Erleichtert stellte er fest, dass es sich um den Schlafsaal der Karawanserei handelte. Einen Moment lang wunderte er sich, wie er hierher gelangt war, aber dann erinnerte er sich, dass er das Bewusstsein verloren hatte. Offenbar hatten die anderen ihn in den hierher getragen und nach dem Stand der Sonne zu schlie├čen, die seitlich durch die Fester schien, hatte er einige Zeit geschlafen.
„Wie lange … ?“, begann er seine Frage zu formulieren.
„Mehrere Stunden“, antwortete Menas, den der Ruf des Bruders herbeigelockt hatte. Auch Takait stand neben seinem Lager. „Das ist auch gut so, denn du musst so schnell wie m├Âglich wieder zu Kr├Ąften kommen. Unsere Karawane bricht morgen sehr fr├╝h auf.“
„Schon Morgen?“, entfuhr es Peter, der gehofft hatte, sich l├Ąnger in der Karawanserei erholen zu k├Ânnen.
„Du wirst dies vielleicht nicht mitbekommen haben“, begann Menas in einem belehrendem Tonfall, „aber die Bewohner der ersten Oase machen die Priester der dritten Oase daf├╝r verantwortlich, dass das Labyrinth eingest├╝rzt und der Sphinx zerst├Ârt worden ist. Sie werfen ihnen vor, sich schwarzer Magie bedient zu haben. Dabei ist die wahrscheinlichste Erkl├Ąrung, das nur die Erde gebebt hat…“
„Sie sind uns milit├Ąrisch ├╝berlegen und suchen schon lange nach einen Vorwand, uns zu erobern“, erkl├Ąrte Takait, bevor Peter richtig stellen konnte, dass es keinesfalls nur ein Erdbeben war.
„Aber ich finde, dass die Kaufleute in einer Sache v├Âllig recht haben: die Einheimischen sollen dies unter sich selbst ausmachen“, brummte Menas. „Dieser schreckliche Saladin hat sich zugegebenerma├čen als sehr n├╝tzlich erwiesen. Er hat n├Ąmlich mit dem Anf├╝hrer der feindlichen Armee– gegen Zahlung einer gewissen Summe versteht sich - f├╝r die Kaufleute unserer Karawane freies Geleit ausgehandelt. Sicherlich hat er einen Teil des Geldbetrags als Dank f├╝r seine Bem├╝hung in die eigene Tasche gewirtschaftet, aber niemand hat sich dar├╝ber beschwert, denn wir alle sind froh, ungeschoren den zuk├╝nftigen Kriegschauplatz verlassen zu d├╝rfen.“
„Ich hoffe nur, dass wir nicht unserer Truppe in die Arme laufen“, bemerkte Takait mit besorgter Miene, „mit deren Anf├╝hrer haben wir keine Vereinbarung getroffen und er k├Ânnte uns daher f├╝r Verr├Ąter halten. Au├čerdem gef├Ąllt mir gar nicht, dass ich seit vielen Stunden keinen einzigen Soldaten gesehen habe. Ich w├╝rde zu gern wissen, wo sie alle stecken.“
Bestimmt sind sie desertiert, dachte Peter, aber Menas l├Ąchelte bedeutsam in sich hinein.
„Auch in diesem Fall wird sich bestimmt eine L├Âsung finden lassen.“┬á
Peter hatte den Eindruck, der alte Mann wartete nur darauf, dass man ihn fragte, wie er dies meinte, aber er tat ihm nicht den Gefallen, da ihm seine Geheimniskr├Ąmerei auf die Nerven ging. Stattdessen rappelte er sich von seinem Lager auf und handelte sich damit die tadelnden Blicke der Umstehenden ein.
„Du solltest dich wirklich weiterhin schonen“, ermahnte ihn Takait und Peter f├╝hlte sich unangenehm an seine Mutter erinnert.
„Der Schlaf hat mich wieder einigerma├čen in Form gebracht. Mir geht es wieder einigerma├čen“, beteuerte er. „Daher m├Âchte ich mir jetzt erstmal den Dreck und Staub runterwaschen. Au├čerdem habe ich einen B├Ąrenhunger.“
„Dann brauchst du mich ja wohl nicht mehr!“, erkl├Ąrte Menas und schaute dann mit entschlossener Miene auf Johann. „Komm wir trinken solange einen Kaffee im Innenhof der Karawanserei.“
Mit einem Ausdruck des Bedauerns in den Augen folgte der Bruder und Peter wunderte sich sehr dar├╝ber, dass Johann offenbar dem alten Kopten gehorchte.
„Und ich gehe schnell in den Neith-Tempel und hole dir etwas Gutes zu essen“, erkl├Ąrte Takait. „Ich glaube, man hat dort heute T├Ąubchen geopfert.“
Kaum hatte sie dies gesagt, war sie auch schon fortgehuscht. Peter r├Ąkelte sich, bevor er aufstand. Leider war ein Bad in einer Oasenstadt ein Luxus, den die Einheimischen nur vom H├Ârensagen kannten. So musste Peter sich damit begn├╝gen, sich hockend an einer Sch├╝ssel mit lauwarmem Wasser zu waschen und dann wieder seine alles andere als frische Reisekleidung ├╝berzustreifen. Anschlie├čen verzehrte er ein paar getrocknete Datteln, da er nicht glaubte, dass Takait tats├Ąchlich so schnell wiederkommen w├╝rde, auch wenn sie dies versprochen hatte.
Dann schlenderte er in den Innenhof, wo ihn Menas und sein Bruder mit frisch aufgebr├╝hten Kaffee erwarteten, der gr├Ąsslich roch und ebenso schmeckte.
Bevor er auch nur ein Wort herausbekommen hatte, berichtete Johann mit vor Aufregung gl├╝hendem Gesicht, wie er die Mumie in eine Grabanlage gebracht hatte, die sich unter einem verwahrlosten Grundst├╝ck nahe des Neith-Tempels befand. Angeblich hatte Menas festgestellt, dass die Mumie aus eben dieser Anlage entwendet worden sei, aber Peter vermutete, dass der alte Mann dies nur behauptet hatte, um Johann zu beruhigen. Peter h├Ârte allerdings nur mit halben Ohr zu, weil ihn noch immer etwas besch├Ąftigte: Als sich die beiden Priester am Tempelteich gestritten hatten, war von seinem Vater die Rede gewesen. Takait hatte eine diesbez├╝gliche Bemerkung gemacht, wollte aber dann doch nichts Genaueres verraten. Stattdessen hatte sie ihn an Menas verwiesen und Peter hatte langsam genug von der Heimlichtuerei.
„Takait hat mir verraten, dass Sie unseren Vater gekannt haben. Ich w├Ąre Ihnen also sehr verbunden, wenn mir endlich mitteilen k├Ânnten, was ihn hierher auf diese Oase gef├╝hrt hat“, sagte er daher zu Menas, kaum dass der Bruder seinen Bericht beendet hatte, „offenbar wissen Sie weit mehr ├╝ber unseren Vater, als Sie bei unserem Besuch in Alexandria zugegeben habe.“
Johann stand da wie vom Donner ger├╝hrt, der Kopte hingegen sch├╝rzte die Lippen und zog finster die Brauen zusammen.
„Einschlie├člich dessen, was Sie aus Vaters Notizbuch erfahren haben“, erg├Ąnzte Johann und schaute dann mit gro├čen Augen den Bruder an, „darin stand ├╝brigens, dass er Takaits Vater ist.“
„Takait ist unsere Schwester?“, rief Peter verbl├╝fft aus. Das letzte, was er momentan gebrauchen konnte, war eine weitere kleine Schwester. Ihm gen├╝gte die niedliche Sophie, der Liebling aller Verwandten.
Johann lachte.
„Nein, nicht unser Vater, sondern Menas ist Takaits Vater, aber er hat dies auch erst vor kurzem erfahren und ausgerechnet in dieser Gruft, in die wir die Mumie zur├╝ckgebracht haben, hat er es mir erz├Ąhlt.“
Peter wunderte sich, warum ihn diese angeblich sensationelle Enth├╝llung nicht in Erstaunen versetzte und er gestand sich selbst ein, dass er unterbewusst die ganze Zeit schon geahnt hatte, dass die Tempelt├Ąnzerin die Tochter des Priesters war. Als Menas Takait┬á als Dolmetscherin angeworben hatte, war es Peter nicht entgangen, dass sich die beiden recht gut kannten, auch wenn Menas dies zu verheimlichen versucht hatte. Nun ├Ąrgerte sich Peter ├╝ber sich selbst, dass er damals der Sache nicht auf den Grund gegangen war.
„Das liegt daran, dass du mich in der Grabkammer mit Fragen gel├Âchert hast, aber sprich bitte nicht so laut“, wandte Menas ein und blickte sich mit vorgestrecktem Kopf vorsichtig im Hof um, was ihm das Aussehen einer melancholischen Schildkr├Âte gab. „Takait wei├č es noch gar nicht.“
„Keine Sorge, Takait h├Ârt uns nicht, denn sie ist gleich wieder in den Neith-Tempel zur├╝ckgeeilt“, beruhigte ihn Peter und er versp├╝rte, einen bitteren Geschmack im Mund, „Ich glaube, sie hat ein Auge auf diesen gut aussehenden Priester Hori geworfen.“
Johann blickte ihn erschrocken an. Sein Gesicht war ganz blass und Peter fragte sich, ob er in der Zwischenzeit etwas Wichtiges verpasst hatte. Schlie├člich hatte der Bruder die Tempelt├Ąnzerin fr├╝her nicht ausstehen k├Ânnen. Aber Peter schob diesen beunruhigenden Gedanken wieder beiseite. Es war ihm momentan wichtiger, dass der alte Priester ihm endlich die Wahrheit sagte.
„Was wissen Sie ├╝ber unseren Vater?“, fragte er daher erneut.
Menas’ Blick verd├╝sterte sich. Er griff schweigend nach der Kaffeekanne, um sich etwas einzugie├čen, aber sie enthielt nur noch wenige Tropfen. Seine Hand krampfte sich um den leeren Becher. Dann st├╝tze er sich mit einer Hand auf dem Boden auf und erhob sich, wenn auch recht m├╝hsam. Johanns entt├Ąuschte Blicke folgten ihm.
„Ich habe ich genug in der Hitze herumgesessen und geredet. Ich muss dringend etwas trinken“, erkl├Ąrte der Kopte mit belegter Stimme und leitete damit seinen R├╝ckzug ein. „Wir alle sollten unsere Kr├Ąfte schonen, denn morgen werden wir sehr fr├╝h aufbrechen. Wenn wir wieder in Alexandria sind, erz├Ąhle ich euch alles, aber jetzt gehe ich in die n├Ąchste Schenke.“
„Ich …“
„Nein, ihr bleibt beide hier!“, unterbrach der Kopte Peter, „es ist viel zu gef├Ąhrlich f├╝r euch, die Karawanserei zu verlassen. Mir tun die Einheimischen schon nichts. Schlie├člich kennen sie mich.“┬á
„Vielleicht gerade deshalb“, rief ihm Johann grinsend nach. Dann gab er seinem Bruder einen Klaps auf den R├╝cken. „Aber mach dir nicht soviel tr├╝bsinnige Gedanken, sondern ruh dich lieber etwas aus. Menas hat v├Âllig Recht: Es liegt ein anstrengender Tag vor uns.“┬á
*
Als die Karawane die Oase kurz nach dem Morgengrauen verlie├č, war kein Mensch in den Plantagen zu sehen, obwohl um diese Zeit sonst Dutzende von M├Ąnnern dort arbeiteten, um die k├╝hlen Morgenstunden auszun├╝tzen. Im roten Schimmer der aufgehenden Sonne sahen die Dattelpalmen aus wie auf einem Gem├Ąlde eines dieser den Orient verherrlichenden franz├Âsischen und englischen Maler, die vom Fernweh der Daheimgebliebenen profitierten. Die ganze Welt war in warme T├Âne getaucht und alles sah heiter und friedlich aus. Johann musste sich regelrecht ins Ged├Ąchtnis rufen, dass vor der Stadt bereits eine feindliche Armee im Anmarsch war und wo die wahrscheinlich erb├Ąrmlichen Truppen der dritten Oase augenblicklich stecken mochten, war selbst Takait unbekannt.
An den R├Ąndern der Oase, wo es nicht mehr genug Wasser f├╝r Palmen gab, gediehen verkr├╝ppelte B├╝sche, dann nur noch die stachlige Berberitze und einige vertrocknete Grasb├╝schel. Bald lie├čen die j├Ąmmerlichen Grasb├╝schel ihre langen, trockenen Halme kraftlos zu Boden h├Ąngen und die Disteln k├╝mmerten vor sich hin. Dahinter begann die W├╝ste.
Der Himmel strahlte mittlerweile in dunklem Azur und die Hitze nahm kontinuierlich zu. Vor der Karawane erstreckte sich ein staubiger, unbefestigter Pfad, der hier und da mit kleinen Gesteinsbrocken ├╝bers├Ąt war, aber bald w├╝rde der Karawanenpfad f├╝r einen Laien nicht mehr erkennbar sein.
Die neuen Karawanenf├╝hrer schienen zum selben Stamm zu geh├Âren, wie die beiden Halunken, die den Grabr├Ąubern zugearbeitet hatten und wahrscheinlich waren sie auch nicht besser als diese. Es war schon bezeichnend, dass sie es – wie ihre Vorg├Ąnger - nicht f├╝r n├Âtig erachtet hatten, sich den Kaufleuten vorzustellen. Zumindest hatte Johann nichts dergleichen mitbekommen und so hatte er sie mit Spitznamen versehen, um sie auseinander halten zu k├Ânnen. W├Ąhrend er die beiden Schurken der Alte und der Junge getauft hatte, nannte er die neuen Karawanenf├╝hrer der Gro├če und der Kleine, wobei auch ersterer nicht so hochgewachsen war wie er selbst und der Bruder. Es waren zwei gef├Ąhrlich aussehende finstere Gesellen, in deren Gesichtern sich das Erbe der vielen V├Âlker zeigte, die sich hier vermischt hatten. In Anbetracht des bevorstehenden Krieges fand Johann es jedoch beruhigend, dass sie mit Gewehren bewaffnet waren.
Unterwegs herrschte eine gespannte Stille: Niemand sagte ein Wort und alle schauten sie best├Ąndig um. Selbst die sonst so phlegmatischen Kamele wirkten schreckhaft, als ob sich die beklemmende Angst, die auf der dritten Oase lastete, sich selbst auf die Tiere ├╝bertragen h├Ątte.
Takait ritt zwischen Johann und Peter. Wie auf dem Hinweg hatte sie sich als Junge verkleidete, was Johann nicht recht einleuchten wollte. Sicherlich hatte inzwischen jeder einzelne Kaufmann mitbekommen, dass sie ein M├Ądchen war. Johanns Augen wanderten geradezu automatisch zu der Tempelt├Ąnzerin und er musste sich m├╝hsam beherrschen, um sie nicht st├Ąndig anzustarren. Aber wenn er sich unbeobachtet w├Ąhnte, beobachtete er sie aus den Augenwinkeln und wunderte sich ├╝ber sich selbst, dass ihm nicht fr├╝her aufgefallen war, wie sch├Ân sie war.
Undenkbar, dass sie fast auf der Oase geblieben w├Ąre! Takait hatte sich der Karawane n├Ąmlich zuerst auf keinen Fall anschlie├čen wollen. Nur mit vereinten Kr├Ąften hatten Menas und die Br├╝der sie schlie├člich davon ├╝berzeugen k├Ânnen, dass sie jederzeit zur dritten Oase zur├╝ckkehren konnte, wenn der Krieg vor├╝ber war. Johann konnte sich jedoch des unangenehmen Verdachtes nicht erwehren, dass der Kopte sie nur deshalb zu der Reise ├╝berredet hatte, weil er seinen Bruder Peter gern zum Schwiegersohn h├Ątte, wahrscheinlich, weil dieser Rechtswissenschaft studierte. Dabei w├╝rdigte Takait Peter keines Blickes mehr, seit dieser Hori auf den Plan getreten war. Leider schien sie auch Johann gar nicht wahrzunehmen, aber er wusste, dass er sich dies selbst zuzuschreiben hatte. Nun suchte er nach einer Gelegenheit, um mit ihr zu sprechen, aber dann forderte die Reise seine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Johann sah n├Ąmlich in der Ferne B├Ąume, Geb├Ąude, sowie eine Staubwolke, die von Menschen, Kamelen und Streitwagen aufgewirbelt worden war, die sich vor einem Feldlager sammelten. Dies musste die angreifende Armee sein, die an einem Brunnen lagerte. Das Wetter meinte es gut mit ihnen. Kein hei├čer W├╝stenwind oder fliegender Sand behinderte die Sicht.
Im N├Ąherkommen wurde deutlich, dass sie ihr Lager direkt neben dem Karawanenpfad aufgeschlagen hatten, wo ein kleiner Palmenhain mehr schlecht als recht gedieh. Die Feinde hatte ihre farbenpr├Ąchtigen Zelte, auf denen im W├╝stenwind die Wimpel flatternden, vor einem in Bau befindlichen Bollwerk mit einem runden Turm aufgeschlagen. Die Befestigungsanlage wies Zerst├Ârungsspuren auf, f├╝r die m├Âglicherweise die feindlichen Soldaten verantwortlich waren. ob sie sich wohl an die Vereinbarung halten w├╝rden, die sie mit ihnen getroffen hatten?
Johann beunruhigte es zutiefst, dass die Karawane kontinuierlich auf die gegnerischen Soldaten zuschritt, so wie die Lemminge zum Meer rannten, um sich darin zu ertr├Ąnken. Trotz seiner Bef├╝rchtungen begriff er aber, dass sie den Karawanenpfad nicht verlassen durften, wenn sie nicht riskieren wollten vom Weg abzukommen oder im Treibsand zu versinken. Auch die Kaufleute waren offensichtlich von der Armee stark beunruhigt, denn sie sa├čen in einer geduckten Haltung auf ihren Kamelen, als ob sie sich am liebsten unsichtbar gemacht h├Ątten. Man konnte nur hoffen, dass die feindliche Truppe sich an die getroffene Vereinbarung hielt.
Am Wegrand lagen Skelette von Kamelen, als wollten sie die Reisenden nachdrücklich auf die Gefahren der Wüste hinweisen. Johann wandte sich schaudernd von den Gerippen ab.  
Als die Karawane das Lager fast erreicht hatte, konnte er die Soldaten genauer beobachten als ihm lieb war. Bisher hatte er sich der Illusion hingegeben, dass auf den Sobek-Oasen nur Bauern, Handwerker und Priester lebten, aber diese Soldaten machten einen sehr professionellen Eindruck. Sie waren ganz bestimmt keine Bauernl├╝mmel, die man auf die Schnelle zum Wehrdienst verpflichtet hatte. Nicht nur ihre Waffen, sondern auch ihre milit├Ąrische Haltung verriet ihren Beruf.
Das Fu├čvolk bildete den gr├Â├čten Teil dieser Truppe, die aus nicht mehr als zweihundert Soldaten bestand. Sie trugen kurze R├Âcke und Sandalen und sch├╝tzten ihre K├Ârper mit┬á┬á Brustpanzern und Beinschienen aus in der Sonne gl├Ąnzender Bronze. Ihre K├Âpfe waren mit Helmen gesch├╝tzt, die mit Federn oder H├Ârnern geschm├╝ckt waren. Ihre Bewaffnung bestand aus ziemlich langen Schwertern, Lanzen und runden Schilden aus Holz.
Es gab auch zwei Dutzend barf├╝├čige Bogensch├╝tzen in knielangen Gew├Ąndern, aber sie wirkten mit ihren altmodischen Waffen nicht sehr bedrohlich, zumindest versuchte Johann sich dies einzureden. Wie gut, dass die Beduinen mit Gewehren bewaffnet waren!
Die zahlenm├Ą├čig kleinste Waffengattung war die Kavallerie, bestehend aus zehn leichten Streitwagen mit gro├čen R├Ądern, denen jeweils zwei Pferde vorgespannt waren. Auf den R├╝cken der Tiere lagen farbige, gestreifte Satteldecken und ihre K├Âpfe schm├╝ckten exotische Federn. Die Wagen waren mit seitlichen Haltevorrichtungen f├╝r Lanzen und riesige K├Âcher ausgestattet und ihre Lenker schienen - nach ihrer aufwendigen R├╝stung zu schlie├čen - alle Offiziere zu sein.┬á┬á
Die Soldaten ├╝berpr├╝ften gerade ihre Waffen. Ihre Speere blinkten in der Sonne und die Pferde scharrten unruhig mit den Hufen, w├Ąhrend die Dromedare, die der Truppe als Lasttiere dienten, auf die Soldaten hochm├╝tig herabsahen.
Pl├Âtzlich gab ein Wachtposten mit einer Art Trompete ein Signal und augenblicklich begaben sich die Soldaten in Formation. In geordneten Reihen standen sie neben dem Karawanenpfad und bedachten die Kamele der Kaufleute und die Last, die sie trugen mit hasserf├╝llten Blicken. Einer der Offiziere an den Heerf├╝hrer heran und sagte mit leiser Stimme etwas zu ihm. Der General nickte. Dann br├╝llte er einen Befehl in den hei├čen W├╝stenwind. Die Offiziere sprangen auf ihre Wagen, die Bogensch├╝tzen spannten ihre B├Âgen und das Fu├čvolk zog die Schwerter aus der Scheide. Johann blieb bei diesem Furcht einfl├Â├čenden Schauspiel fast das Herz vor Schreck stehen.
Hoffentlich beschlie├čen sie nicht, den Kaufleuten ihre Ware zu rauben, durchfuhr es Johann. Wie konnte man ihnen nur begreiflich machen, dass besa├čen der Bruder und er keine wertvollen Dinge besa├čen, die zu verteidigen sich lohnte.
Johann schaute sich nach den Karawanenf├╝hrern um, und er fand sie mit geschultertem Gewehr am Ende der Karawane. Sie gaben den Kaufleuten ein Kommando und mit einem Ruck kam die Karawane zum Stehen. So fest er konnte, zog Johann am Z├╝gel seines Dromedars, da er bef├╝rchtete, es k├Ânnte selbst├Ąndig weiterlaufen. Als das Tier mit einem Ruck zum Stehen kam, wurde Johann ganz mulmig zumute, denn noch immer warfen die Soldaten begehrliche Blicke auf die reich beladenen Dromedare. Diese trugen auf beiden Seiten prall mit Salz, Getreide und - wie Johann vermutete - auch mit Antiquit├Ąten gef├╝llte S├Ącke, denn der ├╝berst├╝rzte Aufbruch von der dritten Oase hatte manches Gesch├Ąft nicht zustande kommen lassen.
„Die wollen uns berauben“, murmelte Menas, der sich ebenfalls am Kopf der Karavane befand, w├Ąhrend sich Peter und Takait, die ihre Reittiere schneller gez├╝gelt hatten in einigem Abstand hinter ihm befanden.
„Ich fass es einfach nicht! Haben wir nicht f├╝r unser freies Geleit bezahlt!“
Zwar hatte Johann vor kurzen selbst bef├╝rchtet, dass man sie um ihre Waren erleichtern wollte, aber trotzdem emp├Ârte ihn dies.
Menas sch├╝ttelte mit einem freudlosen Lachen den Kopf.
„Bist du naiv! Es herrscht Krieg! Und die Waren und Geldb├Ârsen zu rauben, ist noch viel ertr├Ąglicher als nur Schutzgeld zu erpressen, von den wertvollen Reittieren ganz zu schweigen!“┬á
Der kleinere der beiden Karawanenf├╝hrer richtete mit gef├Ąhrlich leiser Stimme einige Worte an die Soldaten, doch die Drohung, die sich dahinter verbarg war un├╝berh├Ârbar.
Der Heerf├╝hrer erwiderte etwas einen befehlsgewohntem, barschen Tonfall. Sein Harnisch, seine Arm- und Beinschienen, sowie sein K├Âcher waren vergoldet. Auf dem Kopf trug er eine blaue Kappe, die mit einer goldenen Kobra verziert war, deren Kopf sich drohend erhob. Ma├čte er sich die Pharaonenw├╝rde an?
Mehre Kaufleute protestierten zugleich mit erz├╝rnten Gesichtern und blickten dabei┬á anklagend auf Saladin, aber dieser zuckte mit den Schultern und machte dann eine beschwichtigende Geste. Dabei wirkte er so enerviert, dass Johann spontan Mitleid mit ihm empfand, obwohl er dies noch vor einer Stunde nicht f├╝r m├Âglich gehalten h├Ątte. Schlie├člich hatte Saladin getan, was er konnte und es war nicht seine Schuld, wenn die Soldaten ihr Wort nicht hielten.
Saladin machte Anstalten, sich an der Verhandlung zu beteiligen, aber bevor er etwas sagen konnte, wandte der General sich wieder der Karawane zu und knurrte die Karawanenf├╝hrer in einem harschen Tonfall an.
Johann wartete darauf, dass diese etwas erwiderten, aber sie sagten kein Wort. Alles was er in der angespannten Stille h├Ârte, war das metallische Klicken, als die Beduinen die H├Ąhne ihrer Gewehre spannten. Johann wunderte sich, dass die Soldaten offenbar keine Schusswaffen besa├čen. Diese mochten bei ihnen ge├Ąchtet sein, aber ihre schiere Existenz konnte ihnen doch wohl kaum unbekannt sein.
Mit angehaltenem Atem erwartete Johann, dass ein Schuss sich l├Âste. Dann w├╝rden die Bogensch├╝tzen zum Einsatz kommen.
Pl├Âtzlich kam Bewegung in die Truppe. Der General r├╝gte seine Soldaten, aber trotzdem l├Âsten sie sich aus ihrem Verband. Auch die Kaufleute schien etwas erschreckt zu haben. Jedenfalls sa├čen sie einer nach dem anderen rasch ab und versteckten sich hinter ihren Dromedaren. Johann tat es ihnen vorsichtshalber gleich, obwohl er noch immer keine Ahnung hatte, was vorgefallen war.
„Schau!“, rief┬á Menas und deutete auf die zerst├Ârte Befestigungsanlage, der Johann keine weitere Beachtung geschenkt hatte.
Wie aus dem nichts war dort eine Kompanie Bogensch├╝tzen aufgetaucht. Mit gespannten B├Âgen standen sie entlang der Mauer auf dem Rundturm. Ihre Bewaffnung entsprach der der gegnerischen Soldaten, aber der Anf├╝hrer trug keinen Goldschmuck. Sein grimmiges Gesicht mit den senkrechten Stirnfalten lie├č keinen Zweifel daran, dass mit ihm nicht zu spa├čen war.
Mit einem ver├Ąchtlichen Unterton in der Stimme gab der Heerf├╝hrer der dritten Oase einen Befehl. Johann bedurfte keines ├ťbersetzers um zu begreifen, dass er die feindliche Armee dazu aufforderte zu kapitulieren oder zumindest augenblicklich das Feld zu r├Ąumen. Seine Truppe schien zwar der Armee der ersten Oase zahlenm├Ą├čig unterlegen zu sein, aber sie bestand ausschlie├člich aus Bogensch├╝tzen und sie waren besser positioniert als die gegnerischen Soldaten, denn das Geb├Ąude, in dem sie offenbar die ganze Zeit gelauert hatte bot ihnen Schutz.
Warum haben sie ihre Feinde nicht schon l├Ąngst von hinterr├╝cks erschossen? Fragte sich Johann. Daf├╝r gab es eigentlich nur eine Erkl├Ąrung: Die Soldaten hatten auf die Karawane gewartet. Aber woher hatten sie gewusst, dass diese am Morgen aufbrechen w├╝rde? Johann schob den unsch├Ânen Gedanken beiseite, dass es in ihren Reihen einen Verr├Ąter geben k├Ânnte. Schlie├člich hatte bestimmt die gesamte Bev├Âlkerung der verdammten Oase dies gewusst.
Die Zeit war einige Minuten lang wie eingefroren. Die Soldaten fixierten einander mit hasserf├╝llten Blicken. Noch immer hielten sie ihre gespannten B├Âgen drohend aufeinander und hinter ihnen standen die Nomaden, die mit ihren Gewehren auf sie zielten.
Das Schweigen wurde von dem letzten Mann gebrochen, von dem Johann dies erwartet hatte: Der alte Menas trat mit entschlossener Miene vor die Soldaten. Mit der Rechten schwenkte er einen schmuddeligen Stofffetzen, der einst einmal wei├č gewesen sein mochte und Johann hoffte inst├Ąndig, dass man in der W├╝ste die Bedeutung der Parlament├Ąrflagge kannte. Die Soldaten machten ihm eine Gasse frei, bis er vor ihrem General stand.
Menas radebrechte wild gestikulierend etwas auf Ägyptisch und Johann zuckte zusammen, als er das Wort Takait aufzuschnappen vermeinte.
Ein Blick in das blasse Gesicht der Tempelt├Ąnzerin gen├╝gte ihm, um zu wissen, dass er sich nicht verh├Ârt hatte.
„Was ist los?“, rief er Takait ├╝ber die K├Âpfe dreier Kaufleute hinweg zu.
Sie beachtete ihn nicht, sondern lauschte der Antwort des feindlichen Generals. Menas wollte etwas erwidern. M├╝hsam suchte er nach Worten und wieder fragte sich Johann, wie der Kopte sich fr├╝her mit seiner Frau verst├Ąndigt hatte. Noch immer suchte er verzweifelt Blickkontakt mit der T├Ąnzerin aufzunehmen, aber Takait schaute wie gebannt auf ihren Vater.
Mit einem leisen Fluch huschte Johann in geduckter Haltung hinter den Kamelen zum Ende der Karawane, bis er die Tempelt├Ąnzerin erreicht hatte.
Aber bevor er sie ansprechen konnte, sprang Takait unvermittelt auf. Mit hoch erhobenem Kopf schritt sie zu ihrem Vater. Johanns Herz setzte einen Augenblick lang aus. Musste sie sich mutwillig einem derartigen Risiko aussetzen?
Einzelne Proteste wurden laut und Takait schlug mit einer anmutigen Bewegung die Kapuze ihres Umhangs zur├╝ck. Jetzt konnten alle sehen, dass ihr Kopf nach alt├Ągyptischer Sitte kahl geschoren war, aber noch immer schienen die Soldaten nicht ├╝berzeugt zu sein. Takait warf ihnen einen vernichtenden Blick zu. Dann streifte sie ihren Umhang ab, unter dem sie ein einfaches ├Ągyptisches Frauengewand aus ungebleichten Leinen trug. Es war verschwitzt und fleckig, aber Johann fand Takait selbst in dieser Aufmachung wundersch├Ân.
Er war es leid, unt├Ątig zuzuschauen und unternahm einen halbherzigen Versuch, sich Takait anzuschlie├čen, aber bevor er sich richtig erhoben hatte, packte ihn der Bruder am ├ärmel seines Umhangs und zog ihn unsanft zur├╝ck.┬á
„Bist du eigentlich v├Âllig ├╝bergeschnappt? Denk nicht einmal daran“, fuhr Peter ihn mit ged├Ąmpfter Stimme an.
Die T├Ąnzerin ├╝bersetzte offenbar die Ansprache ihres Vaters. Wie viel lieblicher h├Ârte sich die ├Ągyptische Sprache aus ihrem Munde an!
„Ich ertrage diese Ungewissheit nicht!“, protestierte Johann, „ich will endlich wissen, was hier vorgeht!“┬á
„Menas hat die Angreifer mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass es seine Tochter war, die mit ihrem Tanz den Sphinx unsch├Ądlich gemacht hat. Sonst h├Ątte das zum Leben erweckte Untier gro├čen Schaden auf ihrer Oase angerichtet“, erkl├Ąrte Saladin in seinem besten Oxford English und es dauerte einen Augenblick lang, bis Johann realisierte, dass dieser offenbar Deutsch verstand.
„Danke“, erwiderte Johann irritiert und er fragte sich allen Ernstes, ob Saladin auch einige Semester in Heidelberg studierte hatte.
Die feindlichen Soldaten wirkten langsam unentschlossen, aber der General erweckte nicht den Anschein, als werde er von Zweifeln an der Rechtm├Ą├čigkeit seines Tuns beschlichen. Mit barscher Stimme br├╝llte er etwas in Richtung Menas zur├╝ck.
Der alte Priester antwortete und diesmal schien er dem Heerf├╝hrer der ersten Oase zu drohen. Alle starrten Takait an, die mit unbeweglicher Miene neben ihrem Vater stand. Diesmal ├╝bersetzte sie seine Worte nicht. Ein entsetzlicher Tumult brach aus. Wenn der General nicht furchteinfl├Â├čende Blicke in die Runde geworfen h├Ątte, w├Ąren ihm sicherlich seine Soldaten desertiert. Aus ihren Gesichtern war die Kampeslust verschwunden. Kaum dass sie nicht ihre gez├╝ckten Waffen senkten.
Johann schaute Saladin fragend an.
„Der wahnsinnige Kopte hat ihnen damit gedroht, dass seine Tochter sie alle vernichten wird, wenn sie uns nicht ziehen lassen. Dann w├╝rde Takait mit ihrem Tanz einige gr├Ąssliche G├Âtzen herbeirufen, deren Namen ich lieber nicht in den Mund nehmen will“, zischte ihm dieser zu. „Irgendwer muss diesen Verr├╝ckten stoppen. Haben Sie vielleicht Einfluss auf ihn?“
Johann und Peter schauten sich an. Dann sch├╝ttelten beide den Kopf.
Atemlos vor Anspannung erwarteten sie eine Antwort des Generals, aber diese kam diesmal nicht sofort, denn der Soldat dachte aber einen Augenblick nach. Seinem verkniffenen Gesicht war deutlich anzusehen, dass er ├╝blicherweise lieber Waffen als Argumente sprechen lie├č. Ganz pl├Âtzlich ging ein Ruck durch seinen K├Ârper und er wandte sich Takait zu.
Mit einer seltsamen Mischung aus berufsgedingter Arroganz und missgl├╝ckter H├Âflichkeit stellte er der T├Ąnzerin eine Frage. Er wird ihr doch hoffentlich keinen Heiratsantrag gemacht haben? Durchfuhr es Johann und er bedauerte, dass Peter ihn vorhin zur├╝ckgezogen hatte.
├ťber Takaits Gesicht huschte ein gl├╝ckliches L├Ącheln. Dann nickte sie. Hatte sie den Antrag angenommen? Das entsetzte Gesicht ihres Vaters lie├č dies bef├╝rchten. Der General br├╝llte einen Befehl in die ├Âde Landschaft und seine Soldaten senkten die Waffen. Der Heerf├╝hrer der dritten Armee gab seinen Bogensch├╝tzen ein Zeichen. Auch deren Haltung entspannte sich. Dann verschwanden sie einer nach dem anderen in der Ruine.
Hilfesuchend schaute sich Johann nach Saladin um, der in der Zwischenzeit wieder aufgestanden war. Auch Johann erhob sich wieder vom Boden. Das Gesicht des Kaufmanns nahm einen mitleidigen Ausdruck an.
„Man hat Takait angeboten, mit der feindlichen Armee als Priesterin auf die erste Oase zur├╝ckzukehren und sie hat dies Angebot freudig akzeptiert. Das war die Bedingung des Generals f├╝r den R├╝ckzug seiner Truppe.“
„Der wusste doch genau, dass die Bogensch├╝tzen seine Leute anderenfalls erschossen h├Ątten“, erwiderte Johann, der noch immer nicht recht fassen konnte, was er eben erfahren musste. Er hatte ganz pl├Âtzlich den Eindruck, der Boden w├╝rde sich unter ihm drehen. „Dieser alte Heuchler hat doch nur einen Vorwand gesucht, um sein Gesicht zu wahren.“
„Das nennt man Diplomatie“, bemerkte Saladin lakonisch.
Die Kaufleute waren inzwischen aus ihrem Versteck hervorgekommen und beratschlagten untereinander. Offenbar dolmetschten diejenigen, die Ägyptisch verstanden, was sich ereignet hatte.
„Wenigstens heiratet sie jetzt nicht diesen schrecklichen Hori.“ Peter gab seinem Bruder einen Klaps auf den R├╝cken. „Au├čerdem war es Takaits sehnlichster Wunsch, Priesterin zu werden. Es w├Ąre egoistisch von uns, wenn wir versuchen w├╝rden, sie davon abzuhalten.“
Du hat gut reden, dachte Johann und verkniff sich m├╝hsam eine boshafte Bemerkung ├╝ber Anneliese von Gaimersdorf. Ohne den Bruder eines weiteren Blickes zu w├╝rdigen eilte er zu Takait, aber wieder beachtete sie ihn nicht. Neben ihr stand ihr Vater und redete heftig auf sie ein. Johann h├Ârte etwas von „heidnischem Aberglauben“, „Gottesl├Ąsterung“ und „nicht meine Tochter“, aber der Priester schien auf verlorenem Posten zu sein.
„Das ist deine eigene Schuld“, erwiderte die T├Ąnzerin l├Ąchelnd, „wenn du nicht mit meinen F├Ąhigkeiten angegeben h├Ąttest, war er nicht auf diese Idee verfallen.“
Menas zog ein betroffenes Gesicht.
„Aber das habe ich doch nur so gesagt, um ihnen Angst zu machen! Wer konnte denn gleich ahnen, dass dich mitnehmen wollten.“
Ehe Takait etwas erwidern konnte, sprach sie der Heerf├╝hrer der dritten Oase an, der sich bisher nicht an den Verhandlungen beteiligt hatte. Johann erschrak, da er ihn nicht hatte kommen sehen. Konnte es sein, dass es unterirdische G├Ąnge unter der Ruine gab? Takaits Gesicht verd├╝sterte sich als der Soldat auf die Br├╝der deutete.
„Nach dem Gesetz unserer Oasen darf kein Fremder, der unser Territorium betritt es wieder verlassen“, ├╝bersetzte Takait, „wir haben schon fr├╝her ab und zu eine Ausnahme gemacht. Aber das mindeste, was wir erwarten ist, dass die beiden Fremden einen heiligen Eid schw├Âren, ├╝ber alles Stillschweigen zu bewahren, was sie hier gesehen haben.“
Johann wurde von einer Welle der Verzweiflung durchflutet, als er realisierte, dass man sie ziehen lie├č. Einen irrationalen Augenblick lang hatte er gehofft, dass der Heerf├╝hrer darauf bestand, dass sie blieben.
Peter hingegen war sichtlich erleichtert ├╝ber die Worte, die Takait gedolmetscht hatte. Ohne eine Sekunde zu z├Âgern, gelobte er ewige Verschwiegenheit. Johann schloss sich widerwillig seinem Versprechen an.
Der Heerf├╝hrer nickte knapp und drehte den Br├╝dern wieder die kalte Schulter zu.
„Haben auch Sie diesen Eid abgelegt?“, fragte Johann den alten Menas, denn ihm war eingefallen, dass der Kopte in diesem Fall ihnen nicht h├Ątte den Sammelpunkt der Karawanen verraten d├╝rfen.“
„Schon, aber“, begann Menas, aber einer der┬á Karawanenf├╝hrer bedachte ihn mit einigen unfreundlichen Worten, die sicherlich hie├čen, dass sie keine Zeit mit Reden verschwenden sollten.
„Ehe die Abendsonne sich vom Tag verabschiedet, muss die Karawane das Territorium der dritten Oase verlassen haben“, ├╝bersetze Saladin mit einer ironischen Verbeugung. Offenbar war er wieder ganz der alte.┬á
„Aber wir haben doch wohl noch die Zeit, um Abschied voneinander zu nehmen!“
Es war Peter, der gesprochen hatte.
„Die Kaufleute wollen sich keinen Sonnenstich holen“, erwiderte Takait entschuldigend, „au├čerdem muss die Karawane bald wieder aufbrechen, wenn sie vor Einbruch der D├Ąmmerung das n├Ąchste Wasserloch erreichen will.“
„Warum sagst du nicht: Sie haben Angst?“, fragte Johann erbost.
Mit einer wahren Mordlust im Herzen blickte er sich nach den Reisegef├Ąhrten um. Er fand seine schlimmste Bef├╝rchtung best├Ątigt: Die Karawane sammelte sich bereits. Die Furcht starrte den Kaufleuten noch immer aus den Augen. Deshalb wollten sie so schnell wie m├Âglich von hier fort. Unm├Âglich mit ihnen ├╝ber einen Aufschub zu verhandeln!
Johann wollte Takait umarmen und ihr noch etwas sagen, wusste aber nicht was. Die Kehle war ihm wie zugeschn├╝rt. Peter schob sich zwischen sie und verabschiedete sich von der T├Ąnzerin. So verstrich die Gelegenheit ungenutzt.
„Bleiben Sie bei ihrer Tochter?“, fragte Johann den alten Menas und einen Augenblick lang erwog er, sich ihm im Zweifelsfall anzuschlie├čen.
„Bei diesen Heiden?“ Takait schaute sich vorwurfsvoll nach ihrem Vater um. „Nat├╝rlich besuche ich dich von Zeit zu Zeit.“
Johann h├Ątte ihm an ihrer Stelle kein Wort geglaubt. Takait hatte ihren neu gefundenen Vater gleich wieder verloren.
Er stammelte einige H├Âflichkeitsfloskeln, die Takait mit einem L├Ącheln erwiderte. Dann hievte sich Johann wieder auf sein Kamel.
Ein Ruck ging durch die Karawane und die Kamele setzten einen Fu├č vor den anderen. Schritt f├╝r Schritt stapften sie ├╝ber die sandige Piste in die endlose W├╝ste hinein und die Reisenden entfernten sich langsam, aber sicher von den beiden Armeen, die sich zu mischen begannen.
Johann machte sich keine Illusionen dar├╝ber, dass die jahrtausende alte Kultur der Sobek-Oasen dem Untergang geweiht war. Zwar hatte man ihnen das Gel├╝bde zu schweigen auferlegt, aber fr├╝her oder sp├Ąter w├╝rde jemand reden. Auch wenn die Bewohner der beiden Oasen im letzten Augenblick davon Abstand genommen haben, einander in einem absurden Krieg auszurotten, war es doch nur eine Frage der Zeit, bis die Segnungen des modernen Lebens auch hier Einzug halten w├╝rden. Zumindest falls nicht vorher der Sand die kleinen Inseln im weiten Meer der Sahara unter sich begraben haben sollte.
Nach einem Ritt von einer Viertelstunde waren bereits die Soldaten zu Ameisen zusammengeschrumpft und das Geschrei von Mensch und Tier wurde leiser, bis es kaum noch zu h├Âren war und dann v├Âllig verstummte.┬á
Als die Sonne am h├Âchsten stand, fiel ganz unvermittelt ein Lastkamel tot um. Es hatte schon den ganzen Tag lang gehinkt und Johann musterte misstrauisch sein eigenes Tier, aber es wirkte zwar ersch├Âpft, aber nicht krank.
Der Zwischenfall sorgte f├╝r einige Aufregung, denn die Lasten die das verendete Dromedar getragen hatte, mussten nun auf die anderen Tiere aufgeteilt werden. Als dies nach einem lauten Palaver endlich ├╝ber die B├╝hne gebracht war, lie├č man das Kamel einfach dort liegen, wo es hingefallen war. Bald w├╝rde dort wieder ein von der Sonne ausgebleichtes Gerippe liegen, dass die Reisenden erschrecken w├╝rde.
Die Karawane setzte sich wieder in Bewegung. Johann h├Ârte hinter sich ein Ger├Ąusch und ├Ąngstlich schaute er sich um, aber er sah keine R├Ąuber. Nur das tote Kamel, das in der endlosen Sandfl├Ąche lag.
Am Abend erreichte die Karawane eine winzige Oase, die eigentlich nur aus einem Wasserloch und einigen, wenigen vertrockneten B├╝schen bestand, sowie strohgelben vertrockneten Grasb├╝scheln, die nur m├╝hsam ├╝berlebten.
Apathisch und noch immer wie innerlich bet├Ąubt sa├č Johann von seinem Dromedar ab um Wasser zu holen. Dabei dachte er unentwegt an Takait. Achtlos lief er zwischen den Berberitzenstr├Ąuchern hindurch, deren Dornen L├Âcher in seinen Umhang rissen und seine Haut aufritzten. Kletten setzten sich an ihm fest. In seinem Haar blieben trockene Bl├Ątter h├Ąngen.
„Was ist eigentlich mit dir los?“, fuhr der Bruder ihn an und riss ihn zur├╝ck. „Siehst du nicht, dass du um die Str├Ąucher herumgehen kannst?“
Johann sch├╝ttelte den Kopf. Als ob der Bruder nicht w├╝sste, warum er in dieser beklagenswerten Verfassung war!
„Ach lass mich doch in Frieden“, murmelte Johann vor sich hin.┬á
Die folgenden Tage vergingen einer wie der anderer: Im Morgengrauen aufstehen, karges Fr├╝hst├╝ck und dann der Ritt durch die gl├╝hende Sonne. Das Atmen fiel Johann zunehmend schwer, so hei├č war die Luft. Er a├č zu wenig und trank zu viel, wenigstens was den billigen Wein des alten Priesters betraf.
Abends wurde Peter manchmal b├Âse, weil Johann ihm nicht zugeh├Ârt hatte, w├Ąhrend Menas kaum mit den Br├╝dern sprach. Mit jeder Meile, die sie zur├╝cklegten verschwamm die Erinnerung zu einem seltsamen Traum. Schon konnte sich der v├Âllig ├╝berm├╝dete Johann kaum noch an die Tempelbauten erinnern und auch Takait erschien ihm entr├╝ckt wie eine Fatamorgana.
 
Des R├Ątsels L├Âsung
??
25. Des R├Ątsels L├Âsung
Als die Karawane nach einer langen und beschwerlichen Reise endlich das trostlose Kaff am Rand der Sahara erreichte, von dem sie aufgebrochen war, kam es Peter vor, als seien seitdem Jahrhunderten vergangen. Alles hatte sich in der Zwischenzeit ver├Ąndert, nur die heruntergekommene Karawanserei war noch immer die gleiche. Allenfalls hatte der trockene W├╝stenwind die wei├če Farbe, mit der sie get├╝ncht war, noch mehr abgerieben. Trotzdem war diese Karawanserei geradezu luxuri├Âs im Vergleich mit den anderen, mit denen die Br├╝der hatten Vorlieb nehmen m├╝ssen. Sie besa├č sogar eine Art Speisesaal, in der die Reisenden verk├Âstigt wurden, was Peter aber auf dem Hinweg selbstverst├Ąndlich gefunden hatte.
Das gemeinsame Mahl war eine ausgezeichnete Gelegenheit, um endlich darauf zu bestehen, dass Menas ihnen alles erz├Ąhlte, was er ├╝ber den Vater wusste. Leider war er, w├Ąhrend sie die W├╝ste durchquert hatten, den Br├╝dern konsequent aus dem Weg gegangen. Seit sie die dritte Oase verlassen hatten, war dies die erste Gelegenheit, die sich bot mit dem alten Kopten zu sprechen und Peter wollte diese Gelegenheit am Schopfe packen.
Obwohl Peter und Johann lieber in Ruhe gebadet h├Ątten, beeilten sie sich um so schnell wie m├Âglich im Speisesaal zu sein, um den Kopten zur Rede zu stellen. Genauer gesagt hatte Peter den apathischen Bruder dazu gedr├Ąngt. Noch immer konnte Peter nicht recht nachvollziehen, warum Johann, der Takait von Anfang an nicht leiden konnte, es so schwer genommen hatte, dass die T├Ąnzerin auf der Sobek-Oase zur├╝ckgeblieben war. Auch die Trauermiene des alten Kopten provozierte Peter geradezu. Sein ganzes Leben hatte Menas sich vor jeder Verantwortung gedr├╝ckt und nun entdeckte er ganz pl├Âtzlich v├Ąterliche Gef├╝hle f├╝r seine erwachsene Tochter, die seiner Hilfe mittlerweile l├Ąngst nicht mehr bedurfte.
Peter war gr├╝ndlich von seinem Fernweh kuriert. Es war ern├╝chternd festzustellen, dass sich die Bewohner der Sobek-Oase sich mit denselben Problemen herumschlagen mussten wie die der Heimatstadt. Nur dass sie abergl├Ąubisch waren und unter der Fuchtel von machthungrigen Priestern standen.┬á┬á
Mittlerweile bereute Peter sein Versprechen, nicht über die unglaublichen Dinge zu sprechen, die er gesehen hatte. Er hatte dies spontan zugesichert, da er sich bedroht gefühlt hatte. Damit hatte er seine Aussichten zunichte gemacht, ein berühmter Ägyptologe zu werden.
Peter rief sich schlecht gelaunt ins Ged├Ąchtnis, dass das Ziel der Exedition gewesen war, die Mumie zur├╝ckzubringen. Daher war sie kein v├Âlliger Fehlschlag gewesen. Peter musterte verstohlen seinen Bruder von der Seite, um abzusch├Ątzen, ob er nun endg├╝ltig von seinen Alptr├Ąumen befreit sein mochte. Johanns blasses Gesicht verhie├č nichts Gutes. Hatte er tats├Ąchlich geglaubt, Takait k├Ânnte ihm nach Deutschland folgen? Denk lieber nicht dar├╝ber nach, dachte sich Peter. Schlie├člich muss ich jetzt Menas zur rede stellen. Wenn ich in Gedanken woanders bin, erhalte ich niemals eine Antwort auf meine Fragen.
Sie fanden Menas mit m├╝rrischem Gesicht am Ende einer langen Bank sitzend. Peter quetschte sich neben ihn, w├Ąhrend Johann am gegen├╝berliegenden Ende der Bank Platz nahm.
„Wir w├╝rden gern mit ihnen reden“, sagte Peter.
Menas antwortete nicht sofort, sondern machte er eine schnelle, ausweichende Bewegung, da ein dicker Kaufmann ihn sonst angerempelt h├Ątte. Dies lag an der bedr├╝ckenden Enge, die im Speisesaal herrschte. Jeder verf├╝gbarer Platz des einfachen Raumes, dessen Boden aus gestampfter Erde bestand, war mit roh gezimmerten, langen Tafeln und kippligen St├╝hlen verstellt. Peter f├╝hlte sich an das Refektorium eines besonders asketischen M├Ânchsordens erinnert. Dieser Eindruck wurde verst├Ąrkt durch die eint├Ânige Kleidung der G├Ąste. Die wei├čgekleideten ├ägypter h├Ątten Zisterzienser und die Beduinen in ihren dunkleren Umh├Ąngen Bettelm├Ânche sein k├Ânnen.┬á┬á
„Sie haben mir versprochen, mir nach unserer R├╝ckkehr in die Zivilisation endlich zu erz├Ąhlen was sie ├╝ber unseren Vater wissen“, wiederholte Peter seinen Wunsch.
„Wir sind noch nicht in Alexandria angekommen!“, entgegnete der Kopte grimmig, aber Peter war nicht bereit, sich schon wieder mit einer Ausrede abspeisen zu lassen.
„Aber wir haben die W├╝ste hinter uns gelassen!“ Johann nickte. „Ich habe ein Recht auf mehr Informationen und lasse mich nicht immer nur vertr├Âsten“, stelle Peter daher in einem insistierenden Tonfall fest. „Daher frage ich Sie noch einmal: Was wissen Sie ├╝ber unseren Vater?“
„Vielleicht wird es dir nicht gefallen, was du zu h├Âren bekommst“, wandte Menas mit sorgenvoller Miene ein.
„Ich will es trotzdem h├Âren“, behauptete Peter, obwohl er sich gar nicht sicher war, ob dies wirklich stimmte. Eine schreckliche Vorahnung ergriff ihn und einen Augenblick lang erwog er, seinen Wunsch zur├╝ckzuziehen.
Menas schaute vor sich auf den Tisch und betrachtete seinen Teller, auf dem abgenagte H├╝hnerknochen lagen. Dann schluckte er, aber er wirkte entschlossen.
„Ihr m├╝sste versprechen, dass all dies unter uns bleibt! Ihr wisst, ich muss als Geistlicher auf meinen Ruf achten.“
Beide Br├╝der beteuerten einstimmig ewige Diskretion und Verschwiegenheit. Peter dachte sarkastisch, dass es nun auf ein weiteres idiotisches Versprechen auch nicht mehr ankam. Dann begann Menas z├Âgernd zu sprechen: „Vor zehn Jahren habe ich euren Vater zuf├Ąllig in Alexandria kennen gelernt. Es war zu recht sp├Ąter Stunde in kleinen Spelunke und ich hatte schon einiges getrunken …“
Er will sich auf mangelnder Zurechnungsf├Ąhigkeit herausreden, durchfuhr es Peter in einer fernen Erinnerung an sein ungeliebtes Jura-Studium.
„Irgendwie kam ich ins Gespr├Ąch mit eurem Vater und ich muss wohl etwas zu viel geredet haben, denn am n├Ąchsten Tag hat er mich mit einem Freund in meiner Kirche aufgesucht. Die beiden wollten unbedingt zu der Oase aufbrechen, die ich angeblich beschrieben habe, auch wenn ich mich an nichts mehr daran erinnern konnte. Nat├╝rlich habe ich alles abgestritten. Daraufhin hat mich der Freund eures Vaters gefragt, was wohl die Mitglieder meine Gemeinde dazu sagen w├╝rde, wenn sie von meiner heidnischen Ehefrau erf├╝hren. Ich glaube im Nachhinein, dass er mich nicht wirklich denunziert h├Ątte, denn inzwischen wei├č ich, dass er kein schlechter Mensch war. In diesem Augenblick hingegen, habe ich die Drohung ernst genommen.
Kurz und gut: Ich habe den beiden verraten, wie man zu den Sobek-Oasen gelangt. Ihr k├Ânnt mir aber glauben: Wenn ich gewusst h├Ątte, wie dies noch alles endet, ich h├Ątte es nicht getan! Dein Vater und sein Freund haben sich also – so wie ihr - einer Karawane angeschlossen und sind hierher gereist. Den Bewohnern der dritten Oase haben sie die L├╝ge aufgetischt, ihr Schiff sei von Piraten gekapert worden und man habe sie in die Sklaverei verkauft. Sicherlich wusste dein Vater, dass es im alten ├ägypten keine Sklaven gab und man ihnen daher Asyl gew├Ąhren w├╝rde.
Offiziell haben euer Vater und sein Freund einen Kolonialwaren-Laden betrieben, aber heimlich haben sie Antiquit├Ąten gesammelt und sie irgendwo beiseite geschafft, wie ich inzwischen vermute in der morschen Pavillonanlage, aus der die Mumie stammt. Der Freund – sein Name tr├Ągt nichts zur Sache bei - hat nach einer Weile Takaits Mutter geheiratet, aber er hat wahrscheinlich niemals erfahren, dass sie damals bereits schwanger war.“
Und zwar von einem opportunistischen koptischen Priester, der bestimmt ein sehr schlechter Vater gewesen w├Ąre, dachte Peter boshaft.
„Alles ging etwa zwei Jahre lang gut, dann geschah ein schlimmes Ungl├╝ck: Die beiden falschen Kolonialwarenh├Ąndler wurden beim Einsturz einer Grabkammer versch├╝ttet. Das war auf der zweiten Oase. Die Priester haben sie zu bergen versucht. F├╝r den Freund eures Vaters kam jede Hilfe zu sp├Ąt. Euer Vater wurde zwar schwer verletzt gerettet, aber nun galt er den Priestern als Frevler. Zur Strafe musste er f├╝r den Neith-Tempel arbeiten. Schlimmer noch: Er durfte die Tempelanlage nicht mehr verlassen, denn den Priestern war zu Ohren gekommen, dass er vorhatte, ein Buch ├╝ber ihre Oasen zu schreiben. Das h├Ątte nat├╝rlich bewirkt, dass sie nicht mehr im Verborgenen ihren G├Âtzendienst h├Ątten praktizieren k├Ânnen.“
„Zu Ohren gekommen ist eine sehr allgemeine Formulierung“, bemerkte Peter, „also Vater hat es ihnen bestimmt nicht gesagt.“
„Meine Frau hat mir vorgeworfen, ich k├Ânnte mich verplaudert haben“, stie├č er dann mit hei├čerer Stimme zwischen den Z├Ąhnen hervor, „aber genauso gut kann es die Witwe des Freundes gewesen sein.“┬á┬á
Er glaubt, dass seine fr├╝here Geliebte unseren Vater verraten hat! durchfuhr es Peter. Ob sie dies getan hatte, weil sie der Ansicht gewesen war, dass der Vater ihren Mann auf Abwege gebracht hatte? Peter konnte sich dies nicht vorstellen. Bestimmt war es umgekehrt gewesen!
„Und was glauben Sie?“, fragte Peter nach.
┬á„Wahrscheinlich wird sich dies wohl niemals kl├Ąren lassen!“, erwiderte der Kopte, „mehr habe ich jedenfalls nicht zu sagen.“
„Und wie konnte Vater entkommen?“, fragte Johann, der ganz offensichtlich entt├Ąuscht ├╝ber das abrupte Ende der Erz├Ąhlung war.
Menas machte ein abweisendes Gesicht und Peter f├╝hlte sich an einen Stra├čenr├Ąuber erinnert. Er konnte sich in diesem Augenblick den Kopten beim besten Willen nicht beim Predigen vor seiner Gemeinde in Alexandria vorstellen.
„Das wei├č ich leider auch nicht. Das n├Ąchste, was ich von Bernhard Bergruen geh├Ârt habe, war das was ihr mir erz├Ąhlt habt, n├Ąmlich, dass er es ihm irgendwie gelungen sein muss zu fliehen und dass er zuhause gestorben ist.“
„Und Sie verbergen wirklich nichts mehr vor uns?“, fragte Johann vorsichtig. Er schien nach den richtigen Worten zu suchen, „zum Beispiel weil es Ihnen┬á … peinlich ist.“
Peter erwartete einen Augenblick lang, Menas w├╝rde Johann wegen seiner nicht gerade sehr h├Âflichen Frage, barsch zurechtweisen, aber dann brach der alte Mann in schallendes Gel├Ąchter aus.
„Langsam ist mir gar nichts mehr peinlich“, sagte er dann mit Tr├Ąnen in den Augen und wischte sich die verschwitzte Stirn mit dem ├ärmel ab, „aber wenn ich euch einen Ratschlag geben darf, fragt diesen schleimigen Kaufmann, der sich Saladin nennt. Ich kann ihn zwar noch immer nicht ausstehen, da ich mir ziemlich sicher bin, dass er mir im Auftrag meiner Frau in Alexandria nachspioniert hat, aber …“ Menas z├Âgerte, „nach den Ger├╝chten, die mir zu Ohren gekommen sind, hat er die Flucht eures Vaters organisiert. Aber erz├Ąhlt ihm bitte nicht weiter, dass ich dies gesagt habe!“
Einige Dankesfloskeln vor sich hinmurmelnd sprang Johann von der Tafel auf und machte Anstalten, den Speisesaal zu verlassen. Peter, der darüber irritiert war, dass der Bruder ihn nicht gefragte hatte, ob er mitzukommen wollte, schloss sich an. 
„Aber ich warne euch! Mit diesem Saladin zu reden, kann ziemlich teuer werden!“, rief Menas den Br├╝dern warnend nach.
„Die Erfahrung habe ich leider auch schon gemacht!“, erwiderte Peter, sich lachend zu dem Priester umdrehend. Er nahm sich vor, nachher ein paar freundliche Worte zu dem alten Mann zu sagen, den er in seiner ruppigen und etwas ungelenken Art gut leiden konnte.
Obwohl er fast rannte, erreichte er Johann, der es offenbar unglaublich eilig hatte, erst als dieser den Speisesaal verlassen hatte, wobei er die T├╝r unn├Âtig laut hinter sich schloss.
„Hoffentlich ist Saladin ├╝berhaupt noch in der Karawanserei“, brummte Johann, dessen Enthusiasmus beim Anblick des staubigen Korridors, der auf den Speisesaal folgte etwas ged├Ąmpft zu sein schien, „er k├Ânnte irgendwo in diesem verfluchten Kaff sein.“┬á
„Das stimmt, aber wir sollten es erst einmal mit dem Warenlager versuchen“, meinte Peter, „wenn er dort nicht ist, macht das aber auch nichts. Sp├Ątestens heute Abend sehen wir ihn sowieso wieder, denn es w├╝rde mich sehr wundern, wenn er nicht unter irgendeinem Vorwand noch etwas Geld bei den Kaufleuten eintreiben w├╝rde.“
„Vielleicht daf├╝r, dass er sie bei der n├Ąchsten Tour wieder ber├╝cksichtigt wird“; schlug Johann grinsend vor.
„Ich sehe, du hast unterwegs viel gelernt“, meinte Peter und die Br├╝der eilten in den gro├čen Frachtraum, der fast einen ganzen Fl├╝gel der Karawanserei einnahm. Dort waren einige Kaufleute mit dem Versch├╝ren ihrer Waren besch├Ąftigt, von denen sie wahrscheinlich wegen weniger hatten absetzten konnten als sie gehofft hatten, aber Saladin war nicht unter ihnen.┬á
Wie dumm, dass wir nicht nach Saladin fragen k├Ânnen, durchfuhr es Peter, bestimmt wissen seine Kumpanen, wo er steckt.┬á┬á
„Wollen wir im Stall nachsehen?“, fragte er dann den Bruder.
„Von mir aus“, entgegnete Johann ohne gro├če Begeisterung, „obwohl in diesen St├Ąllen immer so schrecklich stinkt. Ich frage mich, ob die jemals ausmisten!“
Peter ging diesmal voran und Johann folgte, als sie einen anderen Fl├╝gel der Karawanserei aufsuchten. Offenbar hatten die R├Ąume, die sie passierten zu mehreren Geb├Ąuden geh├Ârt, die man durch das Niederrei├čen diverser W├Ąnde und Mauern zu einem Haus gemacht hatte.
Sie rochen den Stall, bevor sie ihn sahen. Mit angehaltenem Atem lugte Peter durch die Tür, aber selbst im trüben Licht, das durch die kleinen Fenster einfiel, konnte man auf einen Blick sehen, dass ur Dromedare und ein paar Esel zwischen den Futterkrippen standen. 
„Ich schaue mal schnell um den Block!“, meinte Johann, „die frische Luft wird mit gut tun und ich glaube nicht, dass Saladin weit weggegangen ist.“
„Aber bitte sei vorsichtig und denk dran, dass wir morgen nach Alexandria aufbrechen, mit dir oder ohne dich“, ermahnte ihn Peter, der dem Bruder am liebsten verboten h├Ątte, die Oase zu verlassen. Aber er wusste, dass Johann trotzdem gehen w├╝rde, wenn er sich dies einmal in den Kopf gesetzt hatte, „ich komme bis zur Pforte mit.“
Peter sagte sich, dass er nicht jeden ├ägypter unterstellen durfte, dass er ein fanatischer G├Âtzenanbeter auf der Suche nach einem Opfer sei.
Als die Br├╝der sich dem Ausgang n├Ąherten, war Peter erleichtert, dort im Gegenlicht einen Mann zu sehen, der keinen Beduinenumhang, sondern pr├Ąchtige orientalische Kleidung trug. Dies konnte nur Saladin sein, der in ein Gespr├Ąch mit dem Pf├Ârtner, einem alten Mann mit lustlosen, schicksalsergebenen Gesicht verwickelt war.
„K├Ânnten wir Sie vielleicht einen Augenblick sprechen?“, sprach Peter den gut gekleideten Mann von hinten an, aber als dieser sich umdrehte, stellte Peter entt├Ąuscht fest, dass es ein Fremder war.
Der ├ägypter sagte etwas f├╝r Peter Unverst├Ąndliches auf Arabisch, aber da der Mann nicht unfreundlich wirkte, beschloss Peter einen Kommunikationsversuch zu wagen.
„Saladin“, sagte er daher gedehnt und der reich gekleidete Mann sch├╝ttelte lachend den Kopf.
Wahrscheinlich dachte er an den ber├╝hmten Heerf├╝hrer aus den Kreuzz├╝gen meinte nun, dass Peter scherzte, aber ein Aufleuchten huschte ├╝ber das Gesicht des m├╝rrischen alten Pf├Ârtners.
„Sal┬á a┬á din?“, wiederholte er und die Br├╝der nickten stumm.
Ein fl├╝chtiges L├Ącheln trat auf die Z├╝ge des Pf├Ârtners. Sogleich verlie├č er seine Stube und bedeutete den beiden Fremden mit einer Geste ihm zu folgen. Peter blickte Johann an. Dieser zuckte mit den Schultern und murmelte: „Schaden kann es nicht!“
Dann trotteten die Br├╝der dem Pf├Ârtner nach, der sie zu einer einfachen Holzt├╝r in einem dunklen Korridor geleitete. Er klopfte dreimal an und eine Stimme rief etwas aus dem Inneren des Raums. Der Pf├Ârtner zog am T├╝rknauf und mit angehaltenem Atem schaute Peter durch den T├╝rspalt in einen kleinen Raum hinein, der wie das B├╝ro eines barocken Handelskontors eingerichtet war. Hinter einem altmodischen, englischen Schreibtisch sa├č Saladin im Beduinenumhang, aber trotz dieser einfachen Gew├Ąnder h├Ątte Peter wetten m├Âgen, dass seine Finger mindestens zwei juwelenbest├╝ckte Ringe mehr schm├╝ckten, als bei ihrer letzten Begegnung. Peter gab dem Pf├Ârtner ein Trinkgeld und trat ein.
„Womit kann ich dienen?“, fragte der Kaufmann mit ├╝bertriebener H├Âflichkeit, als er die Br├╝der sah.
„Menas aus Alexandria, der Freund unseres Vaters“, begann Peter, obwohl er sich gar nicht mehr so sicher war, dass man diesen unsicheren Kantonisten wirklich als einen Freund bezeichnen konnte, „hat uns erz├Ąhlt, Sie w├╝ssten, wie unser Vater aus der dritten Oase entkommen ist.“
„Wollen Sie nicht Platz nehmen?“, meinte der Kaufmann mit einer einladenden Geste auf zwei unlackierte Holzst├╝hle mit geflochtener Sitzfl├Ąche, die vor seinem Schreibtisch standen.
Die Br├╝der lie├čen sich auf die Sitzgelegenheiten fallen und Peter ├╝berlegte schon, ob er seine Frage wiederholen sollte, da einen Augenblick lang Schweigen herrschte. Aber er beherrschte sich, da er festgestellt hatte, dass es Landessitte war, eine Sache weitschweifig zu umkreisen, ehe man Interesse zeigte. Seine Ungeduld hatte ihn dazu verleitet, gegen diese fundamentale Regel zu versto├čen.┬á┬á
„Wir w├╝ssten gern, wie unser Vater geflohen ist“, sagte Johann, der sich offenbar nicht um die hiesigen Geflogenheiten scherte. Wie gut, dass der Kaufmann in England studiert hatte und dies daher nicht ver├╝belte.
„Da sind Sie an der richtigen Adresse, denn ich selbst habe einen bescheidenen Beitrag dazu geleistet“, erkl├Ąrte Saladin, nicht ohne Selbstgef├Ąlligkeit. Seine Stimme war ungezwungen, aber in seinen Augen war Anspannung zu sehen.
„Und was m├Âchten Sie daf├╝r, dass sie uns davon erz├Ąhlen?“, fragte Peter, der beim Anblick des Kaufmanns schon die Piaster klimpern h├Ârte.
„Als Zeichen meines guten Willens ist diese Auskunft gratis, zumal mich Ihr Vater bereits mehr als gut bezahlt hat!“ Saladin l├Ąchelte, wobei er zwei Reihen wei├čer, makelloser Z├Ąhne entbl├Â├čte. „Ich war vor einiger Zeit Gast im Neith-Tempel und einer der Priester hat mir stolz die Tempelg├Ąrten gezeigt. Ihr Vater, der dort als G├Ąrtner gearbeitet hat, hat mir einige Feigen f├Ârmlich aufgedr├Ąngt, unter denen St├╝ck ein Papyrus versteckt war. Darauf hatte er eine Botschaft notiert, in der er mich gebeten hat, ihm bei der Flucht behilflich zu sein. Wir sind uns dann schnell handelseinig geworden …“
„Wie haben Sie das gemacht, wo Vater doch gefangen gehalten wurde?“, unterbrach Johann.
„Berufsgeheimnis“, entgegnete Saladin mit einem leicht ironischen L├Ącheln, „Ich kann aber vielleicht soviel verraten: Die arme, verlassene Ehefrau Ihres neuen Reisegef├Ąhrten hat dabei eine wichtige Rollen gespielt. Gemeinsam haben wir die Antiquit├Ąten Ihres Vaters in Sicherheit gebracht, f├╝r den Transport verpackt und in der Karawanserei gelagert.“
„Eine ├ägypterin hat Ihnen geholfen, Dinge, die aus pharaonischen Gr├Ąbern stammen au├čer Landes zu bringen?“, fragte Peter erstaunt, da er an Takait und ihre Skrupel denken musste.
Saladin zuckte kaum wahrnehmbar mit den Schultern.
„Bei diesem Ehemann, hat sie wohl alle Illusionen verloren. Au├čerdem brauchte sie das Geld, als er sie hat sitzen lassen.“
Hinter dem ungezwungenen Ton, den Saladin in Oxford geübt haben mochte, spürte Peter einen Anflug von Ungeduld. 
„Wohnt sie noch immer auf der dritten Oase?“, fragte Peter, der bedauerte, die Dame nicht kennen gelernt zu haben.
„Sowie ich informiert bin schon, aber sie hat wieder geheiratet und einen neuen Namen angenommen, damit ihr zweiter Mann nicht ….“
„Ich verstehe, aber wie konnte Vater fliehen, wo er unter st├Ąndiger Beobachtung stand?“, unterbrach Johann, da er sich den Rest des Satzes vorstellen konnte. Wahrscheinlich ahnte der zweite Ehemann weder, dass seine Frau die Witwe eines Grabr├Ąubers war, noch dass man diesem die Tochter des Kopten untergeschoben hatte. Oder vielleicht doch? Vielleicht wollte er sie deshalb unbedingt verheiraten.┬á
„Als die Vorbereitungen abgeschlossen waren, habe ich es so eingerichtet, dass die Karawane am Tag des gro├čen Fests der Neith die Oase verlassen hat. Wie bei allen ├Ągyptischen Festen, wurde sehr viel getrunken und ihr Vater konnte im allgemeinen Durcheinander entkommen.“┬á┬á┬á┬á┬á
„Waren auch die Tempelw├Ąrter betrunken?“, fragte Johann erstaunt.
Saladin l├Ąchelte hinterh├Ąltig.
„Nat├╝rlich nicht! Aber ich habe demjenigen, der ein Auge zugedr├╝ckt hat, versprochen, seinen Namen geheim zu halten.“
Unweigerlich stieg vor Peters innerem Auge das Bild des gut aussehenden Priesters auf, der ihn gerettet hatte.
„Und warum haben Sie uns all dies nicht vorher gesagt?“, wollte er wissen, denn ihn ├Ąrgerte die Heimlichtuerei.
Saladins Mundwinkel strafften sich und sein Blick wanderte durch das Fenster in die Ferne.
„Sie habe mich niemals danach gefragt, ob ich ihren Vater gekannt habe“, erkl├Ąrte Saladin mit der gr├Â├čten Selbstverst├Ąndlichkeit und Peter h├Ątte ihm die Gurgel umdrehen k├Ânnen. „Aber Sie werden mich entschuldigen. Die Pflicht ruft!“ Der Kaufmann zeigte anklagend auf einen Sto├č Zettel und einige Papyrusrollen auf seinem Schreibtisch.
„Selbstverst├Ąndlich!“
Peter erhob sich von seinem unbequemen Stuhl auf und Johann tat es ihm gleich. Im Herausgehen warf er dem Kaufmann einen vernichtenden Blick zu. 
„Schade, dass nicht ihn der Fluch der Mumie getroffen hat“, meinte Johann erstaunlich heftig, als sich die T├╝r hinter ihnen geschlossen hatte und Peter wunderte sich sehr ├╝ber seinen sanften Bruder. „Er l├Ąsst sich doch von allen bezahlen: Von den Kaufleuten, den Grabr├Ąubern, den ├Ągyptischen Priestern und von ihren Gefangenen, sowie erst unl├Ąngst von der feindlichen Armee, die im Anmarsch auf die dritte Oase ist. Er ist zweifelsohne der schlimmste von allen.“
„Aber denk dran, dass er Vater geholfen hat!“, gab er zu bedenken.
„Ich wei├č“, entgegnete Johann mit einem leisen Seufzer, „meinst du, dass er noch am Leben w├Ąre, wenn er auf der dritten Oase geblieben w├Ąre?“
„Das werden wir wohl niemals erfahren, aber Mutter wird sich freuen, wenn wir ihr erz├Ąhlen, dass Vater nicht nach Hause gekommen ist, weil man ihn hier gefangen gehalten hat“, erwiderte Peter und als er von seiner Mutter sprach, bekam er augenblicklich ein schlechtes Gewissen. „Wir h├Ątten ihr wirklich schreiben sollen!“
„Ich habe ihr eine Postkarte aus Alexandria geschickt“, entgegnete Johann gedankenverloren, „meinst du, dass wir ├ägypten jemals wieder sehen?“
Peter war sich nicht sicher, ob er dies wollte, aber dem Bruder zuliebe sagte er: „Warum nicht? Schlie├člich wissen wir nun, wo wir in Alexandria ├╝bernachten k├Ânnen.“
„Aber meldet euch gef├Ąlligst vorher an“, brummte Menas, der zuf├Ąllig vorbeikam, aber Peter fand, dass sich dies nach einer Einladung anh├Ârte, die n├Ąchsten Semesterferien bei ihm zu verbringen.
 
 
 
 
Die Zauberblume
13. Die Zauberblume
„Du hast uns doch die ganze Reise lang nur belogen!“, fuhr Johann Takait an, kaum dass sie das Portal des Tempels durchschritten hatten. Auf dieses erste Portal folgte ein zweites, das aussah wie das aufgerissene Maul einer Schlange, die durch ihre farbige Bemalung erschreckend lebendig wirkte. Johann blieb wutentbrannt stehen um Takait zur Rede zu stellen, denn er war nicht bereit, sich von ihrem melodramatischen Auftritt beeindrucken zu lassen, „und warum tr├Ągst du pl├Âtzlich diese bombastische Kleidung? Du willst uns doch wohl nicht weismachen, dass du nicht von Anfang an vorgehabt hast, auf dieser bl├Âden Oase zu bleiben. Du hast uns doch nur dazu ben├╝tzt, hierher zu kommen und jetzt l├Ąsst du uns schm├Ąhlich im Stich!“
„Sie nicht b├Âse auf sie“, sagte Peter leise, „sie hat uns eben vor dem Zorn der Priester gerettet.“
„Trotzdem ist sie eine notorische L├╝gnerin!“
„Ich bin T├Ąnzerin des Amun“, erkl├Ąrte Takait ohne auf Johanns Vorw├╝rfe einzugehen und schaute dabei Peter tief in die Augen, „doch es ist mein sehnlichster Wunsch eine Hathore, eine Priesterin der Hathor zu werden.“
„Ich kann es noch immer gar nicht fassen, dass es hier noch Heiden gibt“, erkl├Ąrte dieser kopfsch├╝ttelnd, „Ich dachte, in ├ägypten sind alle Mohammedaner, abgesehen, von den paar Kopten?“
„Wie Priester Menas euch schon mitgeteilt hat, werden auf den Sobek-Oasen die alten Traditionen gepflegt“, meinte Takait leichthin.
„Stammst du von dieser Oase!“, wollte Peter wissen und Johann fand, dass der Bruder die Verr├Ąterin viel zu freundlich behandelte.
„Ich bin in der dritten Oase aufgewachsen, aber …“, Takait lie├č den Satz unbeendet, jedoch Peter sah ihr solange in die mandelf├Ârmigen, dunklen Augen bis sie weitersprach.
„Ich bin von zu Hause ausgerissen, um nicht heiraten zu m├╝ssen, aber Alexandria war eine gro├če Entt├Ąuschung f├╝r mich. Ich wusste ├╝berhaupt nicht, was ich in einer Stadt ohne Tempel anfangen sollte. Daher bin ich zur├╝ckgekehrt, um mich hier zur Hathore ausbilden lassen.“
F├╝r Johanns Geschmack waren Takaits Worte voller Widerspr├╝che, ein untr├╝gliches Zeichen daf├╝r, dass sie log.
„Wenn ich das richtig verstanden habe, so liegen die drei Sobek-Oasen nur jeweils eine Tagesreise voneinander entfernt“, begann er laut zu denken und versuchte dabei nicht in das riesige aufgerissene Maul der Schlange vor sich zu blicken, „deine Leute werden also bald erfahren, dass du in zur ersten Oase zur├╝ckkehrt bist und dich wieder in den Scho├č der Familie zur├╝ckholen!“
„Die Bewohner der ersten und der dritten Oase sind seit Menschengedenken miteinander verfeindet“, erkl├Ąrte Takait in dem sachlichen Tonfall, in dem man allbekannte Tatsachen referiert.
Johann fand es ziemlich befremdlich, dass die Oasenbewohner nicht zusammenhielten, so von der Au├čenwelt isoliert wie sie waren, aber dies ging ihn wahrscheinlich wieder einmal nichts an. Trotzdem war er nicht bereit Takaits hinterh├Ąltiges Verhalten einfach so ad acta zu legen.
„Willst du dich nicht wenigstens anstandshalber zu meinen Vorw├╝rfen ├Ąu├čern?“, forderte er sie daher ver├Ąrgert auf.┬á
„Sp├Ąter“, erwiderte sie mit einem honigs├╝├čen L├Ącheln und deutete in Richtung Tempelinneres, „uns bleibt nicht viel Zeit bis die Priester zur├╝ckkehren.
„Sie sind vor dem Erdbeben gefl├╝chtet?“, wollte Peter wissen, der offenbar wie Peter bef├╝rchtete, dass die Erde erneut beben k├Ânnte.
„Welches Erdbeben? Die Priester sind alle zu der eingest├╝rzten Grabkammer geeilt!“, erkl├Ąrte Takait mit einem erstaunten Gesichtsausdruck, „aber jetzt kommt endlich mit!“
Sie schritt durch das zweite Tempelportal und den Br├╝dern blieb nichts anderes ├╝brig als ihr zu folgen. Johann zog automatisch den Kopf ein, als er die Fangz├Ąhne der steinernen Schlange ├╝ber sich w├Ąhnte und er sp├╝rte, dass dieses schreckliche Portal nichts Gutes verhie├č. Wahrscheinlich war dies auch der Grund daf├╝r, dass die Priester des Labyrinths es vorgezogen hatte, drau├čen zu bleiben.
Der Saal, den sie nun betraten ging ├╝ber die Breite des gesamten Geschosses. Seine monumentale Gro├čartigkeit ├╝bertraf selbst das Labyrinth. Im Inneren herrschte ewiges D├Ąmmerlicht. Johann bemerkte, dass es hier Tische im ├ťberfluss gab. Aus Holz geschnitzt und mit Einlegearbeiten verschiedener Techniken versehen, standen sie entlang der W├Ąnde. Jede Tischplatte war mit Gegenst├Ąnden ├╝berladen, davon manche sch├Ân, viele seltsam, alle wertvoll. In Alabastervasen standen frisch geschnittene Blumen, dazwischen Schalen mit Fr├╝chten. Bl├Ąulicher Rauch stieg aus einem goldenen Becken auf.
Peter verschwand ohne Z├Âgern in der Tiefe des d├╝steren Raumes und Johann folgte ihm notgedrungen, bis sie einen Altar aus schwarzem Granit erreicht hatten. Johann wunderte sich, dass man sie soweit in den Tempel hatte vordringen lassen denn er hatte geh├Ârt, dass nur Priester die ├Ągyptischen Gottesh├Ąuser betreten durften.
Auf dem Granitaltar stand eine Schale mit kleinen Beeren. Der Oasenkrokus!, durchfuhr es Johann. Wenn er es nicht besser gewusst h├Ątte, h├Ątte er die Beeren jedoch f├╝r die Kerne von Granat├Ąpfeln gehalten.
„Willkommen im Haus der G├Âttin Hathor“, sagte Takait, w├Ąhrend sie die Schale in beide H├Ąnde nahm.
Johann wurde von einer dunklen Ahnung beunruhigt, da er sich an Persephone erinnert f├╝hlte, die die Unterwelt nicht wieder verlassen durfte, da sie Granatapfelkerne gegessen hatte. Das war es also, was Takait bezweckte!, durchfuhr es ihn und er hatte den Eindruck, dass der vorher schon d├╝stere Tempel noch finsterer wurde.
„Iss nichts davon!“, sagte er inst├Ąndig zu dem Bruder, „Sonst kannst du nie wieder nach Hause!“
┬á„Wie kommst du nur auf solche Ideen?“, fragte Peter lachend, „wir sind nicht in der Unterwelt! Wenn wir zur├╝ck sind, nehme ich dir die Odyssee weg!“
Johann erwiderte nichts, sondern er packte Peter am Arm um ihn aus dem Tempel herauszuschleifen, aber Takait trat ihnen in den Weg. Ein L├Ącheln huschte ├╝ber ihr Gesicht, doch ihre Augen blieben ernst.
„Dies ist die traditionelle Art, einen Fremden im Tempel der G├Âttin zu begr├╝├čen.“
In Takaits dunklen Augen tanzten winzige wei├če Flecken.
„Wenn dies stimmen w├╝rde, h├Ąttest du auch mir Samen angeboten.“
„Du hast kein Tier gequ├Ąlt. Hier wird Hathor verehrt, die im Zorn zur wilden L├Âweng├Âttin Sackmet wird, die im Blut ihrer Feinde badet. Sie duldet nicht, dass man sich an ihren Katzen vergreift!“
Johann fragte sich, woher Takait wusste, dass Peter aus Versehen eine Katze getreten hatte? Bestimmt von den Priestern, die den Bruder und ihn wahrscheinlich die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatten. Au├čerdem entbehrten Takaits Wort jeglicher Logik.
„Merkst du eigentlich nicht, dass du dir selbst widersprichst?“, stellte er sie zur Rede, „ist dies nun die traditionelle Art G├Ąste zu begr├╝├čen, oder hat Peter einen unverzeihlichen Frevel begannen, als er im Sandsturm eine streunende Katze ├╝bersehen hat?“
So als ob Johann gar nicht existierte ging Takait auf Peter zu, der dem Gespr├Ąch mit einem leicht belustigten Gesichtsausdruck beigewohnt hatte.
„Zeige mir deine H├Ąnde“, sagte sie leise und sah Peter dabei tief in die Augen. Peter streckte ihr irritiert die Handfl├Ąchen entgegen und Takait betrachtete zuerst die eine und dann die andere Hand. Johann fragte sich, was sie bezweckte. Sie wollte doch wohl sicherlich nicht Peters Zukunft aus seinen Handlinien lesen? ┬á┬á┬á┬á
„Sie l├╝gt, wenn sie nur den Mund aufmacht! Sie m├Âchte dich hier behalten“, warnte er den Bruder, aber mit Schrecken bemerkte er, dass dieser sehr blass war. War dies ein Vorzeichen daf├╝r, dass diese L├Âweng├Âttin ihm schon langsam das Leben entzog? Oder hatte Takait ihm nur Angst eingejagt?
„Das ist v├Âllig absurd!“, rief Takait ver├Ąrgert aus, den Blick von Peters H├Ąnden hebend, „dein Bruder sollte endlich einige der Kerne essen. ├ťber kurz oder lang kommen die Priester zur├╝ck. Sie sind aufgebracht, wegen des Einbruchs im Labyrinth, aber sie m├╝ssen die G├Âtter morgens wecken und sie einkleiden. Sie bringen ihnen Speisen und brennen zu ihren Ehren R├Ąucherwerk ab…“
Takait stockte, schaute Peter mit unendlich traurigen Augen an und erste Zweifel nagten in Johann. Er sp├╝rte, wie sein Widerstand zerbr├Âckelte.
„Ich esse die Kerne drau├čen“, erkl├Ąrte Peter unvermittelt
Er wollte sich die Beeren schnappen, aber Takait war schneller und hielt die Schale hinter ihren R├╝cken. Sie sch├╝ttelte den Kopf und sah die Fremden an als w├Ąren sie unerzogene Kinder.
„Wollt ihr ohne die Zwiebel des Oasenkrokus nach Hause zur├╝ckkehren, nach all den Strapazen, die ihr auf euch genommen habt?“
„Das ist nicht der Oasenkrokus?“, fragten beide Br├╝der zugleich.
Takait lachte, dies war das erste Mal, dass Johann sie lachen sah, nicht l├Ącheln, sondern richtig lachen und er musste widerwillig zugeben, das ihr dies gut stand.
„Nein, das sind gew├Âhnliche Granat├Ąpfel“, sagte sie, den Br├╝dern die Schale vor die Nase haltend und Johann ├Ąrgerte sich ├╝ber sich selbst, dass er nicht seinen Instinkten gefolgt war. „Ihr habt wohl gar keine Ahnung von Botanik? Die Oasenkrokusse wachsen im ummauerten Garten hinter dem Tempel.“
Johann sah Peter an und beide mussten lachen. Dann griff Peter in die Schale und schob sich drei Kerne in den Mund. Takait atmete sichtbar auf. 
„Willst du auch einen?“, fragte sie dann Johann mit einem angedeuteten L├Ącheln.
„Wenn du ihm gleich etwas angeboten h├Ąttest, dann h├Ąttet ihr euch nicht herumstreiten m├╝ssen“, bemerkte Peter, noch immer auf den Kernen herumkauend, „Johann steckt mich langsam mit seinem Griechenfimmel an.“
Wortlos griff Johann nach einem der Kernbeeren, die wie sich herausstellte wunderbar aromatisch schmeckte.
„Jetzt solltet ihr euch wirklich beeilen. Wenn die Priester zur├╝ckkommen ist es zu sp├Ąt, denn niemals zuvor haben sie eine ihrer heiligen Pflanze einem Fremden gegeben.“
„Sie hat Recht“, sagte Peter mit entschlossenem Gesichtsausdruck und die Br├╝der folgten Takait durch den Tempel, dessen r├╝ckw├Ąrtiger Ausgang in den Garten f├╝hrte.
„Ihr d├╝rft im Tempelgarten nichts anfassen“, ermahnte sie ihre G├Ąste unterwegs, „keine Blumen pfl├╝cken, keine Fr├╝chte essen, keine Bl├Ątter abrei├čen, keine ├äste knicken…“
„Und keine Katzen treten“, erg├Ąnzte Johann grinsend.
Takait drehte sich mit einer schnellen, doch eleganten Bewegung um.
„Das ist nicht komisch.“ Johann und Peter sahen sich wortlos an konnten sich beide nur m├╝hsam das Lachen verkneifen. „Im Tempelgarten werden heilige B├Ąume kultisch verehrt. Ganze Expedition wurden unter den Pharaonen in fremde L├Ąnder ausgeschickt um seltene Pflanzen hierherzubringen, zum Beispiel Bergpflanzen aus dem S├╝den.“
Noch immer war Johann argw├Âhnisch. Er bef├╝rchtete, dass es sich um eine Falle handeln k├Ânnte. Vielleicht versteckten sich im Garten Priester, die sie im Tempel nicht festnehmen durften, weil dieser den Fremden Asyl gew├Ąhrte. So fragte er schlie├člich: „Was hast du eigentlich davon uns zu helfen? Warum verst├Â├čt Du unsretwegen gegen die Gesetze deines Landes?“
„Lass sie doch endlich in Ruhe“, raunte Peter ihm zu, „ehe sie es sich am Ende noch anders ├╝berlegt.“
„Das erz├Ąhle ich euch ein andermal, wenn wir es nicht so eilig haben“, erwiderte Takait, ohne sich zur├╝ckzuschauen. Wahrscheinlich wollte sie nicht, dass Peter ihr Gesicht sah, denn ihrer Stimme war anzuh├Âren, dass ihr die Frage unangenehm war.
Johann war nicht bereit, sich schon wieder mit einer derart ausweichenden Antwort abspeisen zu lassen, aber der Anblick des Gartens verschlug ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache. Hinter hohen Mauern war er eine gegen den Au├čenbereich abgeschlossene, wohlgeordnete Welt, deren Pracht sonst nur den Priestern vorhalten war. Er bestand aus symmetrisch angeordnete Baumreihen und Wasserbecken, deren R├Ąnder mit Blumen geschm├╝ckt waren. Kiesbestreute Wege f├╝hrten durch die Beete, die sich bis zu den Gartenmauern ausdehnten. Unvorstellbar, dass diese Idylle sich mitten in der W├╝ste befand!
„Dort z├╝chtet man den Oasenkrokus!“, sagte Takait und deutete auf einen steinernen Pavillon mit reliefverzierten W├Ąnden und gro├čen Fenstern, der sich zum Wasserbecken hin ├Âffnete, aber ansonsten auf dem nackten Boden zu stehen schien.
Der Kies knirschte unter ihren F├╝├čen als Takait und die Br├╝der dem Weg zum Pavillon beschritten und ein Ibis flatterte auf. Drinnen war es stickig feucht und noch w├Ąrmer als im Garten. Es roch nach Erde, Bl├Ąttern und Blumen, deren Duft so bet├Ąubend war, dass Johann einen Augenblick brauchte, um sich daran zu gew├Âhnen. Kr├Ąuter und Blumen der unterschiedlichsten Art wuchsen in Blumenk├╝beln aus gebrannter Terrakotta, die teils auf dem Boden und teils auf Regalbrettern standen. ┬á
„Das ist er“, sagte Takait und zeigte auf eine rot bl├╝hende Blume, die wie ein Krokus aussah, aber Krokusse bl├╝hen normalerweise nicht im Sommer, und schon gar nicht in der W├╝ste.
„Woher wei├čt du das eigentlich alles? Du bist doch selbst erst seit wenigen Tagen in dieser Oase“, fragte Johann, w├Ąhrend sich Peter von einem Klapptisch, auf dem Gartenwerkzeuge lagen einen miniaturhaft kleinen Spaten holte.
„Auf Oasenkrokus beruht die Heilkunst der Sobek-Oasen. Daher ist der Priester, der f├╝r die Pflege des Gartens verantwortlich ziemlich eingebildet. Er hat von fr├╝h bis sp├Ąt mit der Wichtigkeit seines Amtes geprahlt. Ich musste ihm noch nicht einmal Fragen stellen.“
Peter b├╝ckte sich zum Boden und griff nach einem der roten Krokusse. Johann konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Blumen mit den roten Bl├╝ten vor der Schaufel zur├╝ckzuckten. Im gleichen Augenblick ersch├╝tterte wieder ein Erdsto├č die Oase.
Es war nur ein leichtes Beben, wahrscheinlich ein Nachbeben der letzten St├Â├če. Peter hielt in der Bewegung inne. Er umschloss den Griff der Schaufel mit zitternden Fingern. Dann gab er sich einen sichtbaren Ruck und stach mit der Schaufelspitze in den Boden. Ein undefinierbares Ger├Ąusch drang an Johanns Ohr, das vage an die Schreie der D├Ąmonen in der W├╝ste erinnerte. Peter schien es nicht wahrzunehmen oder er ignorierte es. Mit angehaltenem Atem beobachtete Johann, wie Peter eine Pflanze mitsamt der Zwiebel ausgrub.
Takait stie├č einen halbunterdr├╝ckten Schrei aus, denn von der fleischfarbigen Zwiebel tropfte eine rote Fl├╝ssigkeit herab. Voller Entsetzten starrte Peter auf den Oasenkrokus in seiner Hand, an deren Spitze die blut├Ąhnliche Fl├╝ssigkeit zu trocknen begann.
„Was f├╝r eine verfluchte Blume hast du ihn ausgraben lassen?“, fuhr Johann au├čer sich vor Wut und Ekel Takait an.
„Ihr selbst habt danach verlangt“, erwiderte Takait, die sich als erste wieder gefasst hatte, „aus dem Saft des Oasenkrokus wird die Prometheische Salbe gemacht, denn diese Blume ist in den Schluchten des Kaukasus entsprossen, an der Stelle, an der das Blut des angeketteten Prometheus auf den Boden tropfte als der Adler an seiner Leber nagte. Die Erde br├╝llte und bebte als der Oasenkrokus herausgerissen wurde.“
„Ganz reizend“, kommentierte Johann, „warum h├Ârst du nur immer wieder auf Takait?“
„Es ist geschehen“, erkl├Ąrte Peter, immer noch blass, aber gefasst, „nun sollten wir den Garten schleunigst wieder verlassen.“
Bevor Johann oder Takait etwas erwidern konnte, begann die Erde erneut zu beben, diesmal mit weit gr├Â├čerer Vehemenz als zuvor. Alle drei st├╝rzten aus dem Pavillon und blieben drau├čen abrupt stehen. Das Labyrinth begann zu schwanken, zuerst kaum merklich. Dann verschoben sich seine Mauern und das ohrenbet├Ąubende Ger├Ąusch zusammenst├╝rzender Steinmassen ersch├╝tterte die Luft. Eine riesige Staubwolke schien nach allen Richtungen geradezu zu explodieren. Als die Luft wieder klar war, konnte man sehen, dass das Dach des Labyrinthes zerst├Ârt war. Nur die massiven S├Ąulen standen noch aufrecht. Auch der Tempel wankte, aber er hielt der Ersch├╝tterung stand und st├╝rzte nicht ein.
Schweigend durchquerten Takait, Peter und Johann die Beete, denn leider war die Gartenmauer zu hoch, um ├╝ber sie klettern zu k├Ânnen. Sie eilten besorgt durch den noch immer leeren Tempel und atmeten erst auf, als sie durch dessen beide Portale geschritten waren, denn sie hatte bef├╝rchteten, auch der Tempel k├Ânnte einst├╝rzen. Als die Sonne sie wieder begr├╝├čte, schloss Johann gen├╝sslich die Augen, aber seine Erleichterung hielt nur einen Augenblick an.
Ganz pl├Âtzlich wurde die Stille durchschnitten von einem Gebr├╝ll, das nichts Menschliches an sich hatte. Johann riss die Augen auf und schaute sich um voller ├╝bler Vorahnungen um. Er sah sein schlimmster Alptraum war wahr geworden: Der Sphinx hatte seinen Kopf gewendet und schaute ihn aus lebendigen leuchtendgr├╝nen Augen an.
Peter b├╝ckte sich nach einem der Steine, die seit dem Einsturz des Labyrinths auf dem ganzen Gel├Ąnde herumlagen.
„Ihr k├Ânnt ihn nicht besiegen! Er ist ein Gott, ein Gott, der lebendig geworden ist um die Feinde ├ägyptens zu strafen!“, rief Takait und ihre Stimme ├╝berschlug sich fast vor Entsetzen. Dann br├╝llte sie etwas auf ├ägyptisch in eine kleine T├╝r, an der Schmalseite des Tempels; anders konnte man ihre heftigen Worte nicht bezeichnen.
Wenige Augenblicke sp├Ąter eilten drei, mit breiten Halsketten, schweren Ohrringen und Armringen geschm├╝ckte Frauen heraus. Sie brachten Musikinstrumente mit: ein kleines Saiteninstrument mit einem ziemlich langen Hals, eine Bogenharfe und die kultischen Rasseln, die von den Griechen Sistrum genannt wurden. Sie bestanden aus auf Dr├Ąhten aufgereihten Perlen aus Bronze, die ein melodisches Klimpern erzeugten.
Als die drei Frauen sich im Halbkreis aufstellten, sah Johann, dass die M├Ądchen vor Angst zitterten. Er konnte es ihnen nicht verdenken, denn auch ihn graute es, obgleich er irgendwo das Gef├╝hl nicht loswurde, dass all dies nicht wirklich passierte. Als sei dies nur ein Traum.
Takait richtete sich zu ihrer f├╝r eine ├ägypterin betr├Ąchtlichen L├Ąnge auf und warf den Musikerinnen einen Blick zu, der fast so furchteinfl├Â├čend war wie der des Sphinxen. Die jungen Frauen begannen zu singen und zu musizieren. Die beiden Saiteninstrumente spielten eine fremdartige Melodie, w├Ąhrend das Sistrum den Rhythmus vorgab. Die Musik klang anders als alle Musik, die Johann jemals geh├Ârt hatte, archaisch, aber doch ├╝ppig.
Takait stellte sich vor die Musikerinnen. Sie l├Âste mit einer entschlossenen Bewegung ihren G├╝rtel. Im gleichen Augenblick durchschnitt ein schauerliches L├Âwengebr├╝ll die Luft. Johann wagte es nicht, sich nach dem Sphinx umzudrehen, denn er bef├╝rchtete der blo├če Anblick w├╝rde ihn vor Schreck tot umfallen lassen. Die Musikerinnen h├Ârten nacheinander auf zu spielen. Es war un├╝bersehbar, dass sie bald fl├╝chten w├╝rden, aber Johann fragte sich wohin, denn vor dem riesigen Sphinx war man nirgends auf der Oase sicher.
Eine der jungen Frauen stie├č einen schrillen Schrei aus und deutete mit kalkwei├čem Gesicht und weit aufgerissenen Augen auf den Sphinx. Johanns Blick folgte automatisch ihrem Finger und fast h├Ątte auch er aufgeschrieen, denn der Sphinx hatte mit seinen riesigen L├Âwenpranken einen ├Ągyptischen Bauer gepackt. Die Menschenmenge, die der L├Ąrm herbeigelockt hatte, rannte panisch in alle Richtungen davon und Johann sah entsetzt, wie der Mann zappelnd und schreiend hochgehoben wurde. Der Sphinx riss das Maul auf und bleckte seine wei├čen Z├Ąhne. Noch immer rief sein Opfer um Hilfe und Johann schaut vor Grauen weg, aber er h├Ârte noch das Ger├Ąusch von brechenden Knochen. Dann herrschte ganz pl├Âtzlich wieder Stille.
Die Musikerinnen standen schreckensstarr vor dem Tempel, sie zitterten vor Angst und eine von ihren schluchzte laut. Takait rief ihnen einige ermutigende Worte zu und zu Johanns Erstaunen begannen sie wieder zu musizieren, aber ihre Musik klang dissonant, als ob sie es nicht schafften, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Takait streifte ihr Gewand ├╝ber den Kopf und warf es auf den Boden. Sie trug jetzt nur noch einen kurzen Schurz, sonst war sie nackt. ├ťber ihren blo├čen Br├╝sten war ein dreifach gekreuztes Band geschlungen und auf ihren rechten Oberschenkel war das Bild eines tanzenden dicken Mannes mit Knollnase t├Ątowiert.
Takait, die f├╝r ein M├Ądchen muskul├Âs war, erhob die Arme und lie├č ihre H├╝fte kreisen, zuerst langsam, dann immer schneller, da sich der Rhythmus der Musik steigerte. Sie griff nach dem Sistrum, das an ihrem rechten Handgelenk an einer Schlaufe hing und produzierte damit klappernde Ger├Ąusche w├Ąhrend sie sich bewegte.┬á
Der Sphinx br├╝llte nochmals so laut, dass es noch in der n├Ąchsten Oase zu h├Âren sein musste. Diesmal drehte Johann sich automatisch um, aber zu seiner Erleichterung hatte sich der Sphinx nicht von der Stelle bewegt. Er beobachtete seine Opfer, in der Art und Weise wie eine Spinne auf eine Fliege schaut, die in ihrem Netz zappelt. Oder konnte ihn die Musik tats├Ąchlich friedlich stimmen?
Takait wiegte die H├╝ften und lie├č sich nach hinten fallen. Dann streckte mit hoch erhobenen Armen ein Bein in die H├Âhe. Johann f├╝hlte sich an einen Kranich erinnert. Es war erstaunlich, wie gelenkig Takait war, aber Johann hatte andere Vorstellungen vom anmutigen Tanz eines jungen M├Ądchens. Trotzdem starrte er sie so gebannt an, dass er einen Augenblick lang den Sphinx verga├č.
Bald ├╝bert├Ânten das Klatschen der H├Ąnde und das Klappern des Sistrums das Spiel der Musikinstrumente. Takait knickte ihren Oberk├Ârper zur Seite ab, die Arme in die H├╝ften gestemmt und wieder lie├č sie ihren Kopf kreisen, zuerst langsam, wie in Trance, dann immer schneller.
Die Musikerinnen spielten eine neue Melodie und Takait beugte sich so tief nach vorne, dass ihre Fingerspitzen und ihre Haare den Boden ber├╝hrten. Bevor sie sich wieder aufrichten konnte br├╝llte der Sphinx zum dritten Mal. Er sch├╝ttelte dabei seinen Kopf so heftig, dass sich sein Kopftuch l├Âste. Seine M├Ąhne flatterte im Wind, der das riesige Tuch mit sich fortrug und in die W├╝ste wehte.
Hin- und hergerissen zwischen Furcht und Faszination schaute Johann von der T├Ąnzerin zum Sphinx und wieder zur├╝ck. Peter stand reglos neben ihm. Er hatte nur Augen f├╝r Takait, die mit geschlossenen Augen ihren Tanz fortsetzte, der zunehmend akrobatisch wurde. Sie schlug eine Br├╝cke und machte einen Handstand. Das geflochtene Haar fiel ihr ins Gesicht.
Warum versuchten die Priester nicht, den Sphinx zu bannen? Johann schaute sich auf dem Platz um, aber die Priester lie├čen sich nicht blicken. Nur zehn bis f├╝nfzehn Einheimische und zwei der Kaufleute waren zusammengelaufen und wohnten mit weit aufgerissenen Augen dem schrecklichen Geschehen bei.
An Johanns Ohr drangen Ger├Ąusche, die ihn an einen Sandsturm erinnerten. Er gab sich einen Ruck und schaute noch einmal zur├╝ck. Was er nun sah lie├č ihm das Blut in den Adern erstarren: Der Sphinx stand auf. Ganz langsam, als ob ihm dies k├Ârperliche Schmerzen bereitete, verlagerte er sein Gewicht auf seine Vorderpfoten und streckte sie durch. Er sa├č nun da wie ein Hofhund, auf den Hinterbeinen sitzend, aber hoch aufgerichtet. Seine Katzenaugen verengten sich zu Schlitzen und sein riesiger Schwanz peitschte nach rechts und links. Er wirbelte eine Sandwolke auf, die alles mit einer feinen Sandschicht bedeckte.
Laut kreischend sprangen die Musikerinnen auf. Takait rief ihnen tadelnde Worte nach, aber die Ermahnung verfehlte diesmal ihre Wirkung. Die M├Ądchen lie├čen ihre Musikinstrumente achtlos auf den Boden fallen. Spitze Schreie aussto├čend fl├╝chteten sie sich in den Tempel.
Takait begann wieder zu tanzen, diesmal ohne Musik. Sie hob die Arme und lie├č sie kreisen, wobei das Sistrum laut in einem monotonen Rhythmus klapperte. Sie warf ihren Kopf vor und zur├╝ck, zu einer Musik, die nur f├╝r sie selbst h├Ârbar war. Das Klappern ihrer Rassel war das einzige Ger├Ąusch, das dieses gespenstische Szenario begleitete.
Wieder ersch├╝tterte ein Erdsto├č die Oase. Palmen schwankten, Kamele br├╝llten, Kinder schrieen. Dann herrschte ganz pl├Âtzlich wieder Stille, aber nur f├╝r einen Herzschlag, bevor leichte Ersch├╝tterungen alles vibrieren lie├čen.
Der Sphinx br├╝lle auf, offenbar von gro├čen Schmerzen gequ├Ąlt. Immer noch blickte er zornig in die Runde, aber ganz langsam verebbte sein Gebr├╝ll, wurde immer leiser, bis es v├Âllig verstummte. Sein Schwanz und seine Hinterbeine begannen wieder zu versteinern. Gelbes Fell verwandelte sich kontinuierlich in Sandstein, bis der ganze Sphinx wieder eine aus dem Fels gehauene Skulptur einer gro├čen Katze war.
Johann hatte erwartet, dass der Spuk nun vorbei sei, aber ein scharfes Ger├Ąusch, durchdringend wie ein Peitschenhieb durchschnitt die Luft. Risse bildeten sich auf der steinernen Oberfl├Ąche des Sphinxen. Laut knirschend zerbarst der Sandstein in mehrere Teile, die wiederum ganz langsam zerbr├Âckelten. Gro├če Felsbrocken zersprangen zu kleineren und auch dieser zerfielen unaufhaltsam.
Takait rief dem Sphinx etwas zu, aber sie sprach nur noch ins Leere. Dort, wo noch vor wenigen Augenblicken der Verteidiger Ägyptens gedroht hatte, erhob sich jetzt ein Sandberg, der unter dem eigenen Gewicht zusammensackte, bis er nur noch eine breite Düne übrig war.
Die Musikerinnen lugten aus dem Eingang des Tempels heraus, wohl angelockt vom Verstummen des Sistrums und von den Rufen Takaits, doch von den Priestern fehlte weiterhin jede Spur. Die T├Ąnzerin warf den M├Ądchen einen finsteren Blick zu, w├Ąhrend sie sich ihr wei├čes Gewand ├╝ber den Kopf streifte. Sie wirkte erstaunlich gefasst f├╝r die t├Âdliche Gefahr, die nur im letzten Augenblick abgewehrt worden war. Auf ihrer Stirn gl├Ąnzten Schwei├čperlen, aber diese war wohl dem Tanz zuzuschreiben und nicht der Angst.┬á
Peter ging zu Takait und Johann schloss sich ihm an, schon um sicher zu sein, dass ihm nichts entging.
„Du hast uns gerettet“, erkl├Ąrte Peter mit feierlicher Stimme, w├Ąhrend er die T├Ąnzerin bewundern ansah.
„Die G├Âtter lieben den Tanz“, erwiderte Takait, noch etwas kurzatmig von der Anstrengung. Dabei ordnete sie mit gro├čer Sorgfalt ihre schwarze Per├╝cke. „Tefnut, die L├Âweng├Âttin hat sich einst in die W├╝ste zur├╝ckgezogen, wo sie durch ihre Wildheit Angst und Schrecken verbreitet hat. Die anderen G├Âtter versprachen ihr, dass man sie durch Musik und T├Ąnze unterhalten w├╝rde. Daraufhin hat sie eingewilligt, wieder in die Stadt zur├╝ckzukehren, wo sie sich in ein sanftes M├Ądchen verwandelte und ihre L├Âwennatur v├Âllig aufgab.“
„Was haben die Musikantinnen eigentlich vorhin eigentlich gesungen?“, wollte Johann wissen, da er sich fragte, ob es sich um Zauberformeln gehandelt hatte.
„F├╝r dich t├Ânen die Trommeln, der Himmel und die Sterne. F├╝r dich t├Ânen die Trommeln ├╝ber die ganze Erde. F├╝r dich tanzen vor Freude die Tiere“, erkl├Ąrte sie, „dies ist eine Hymne zu Ehren Hathors.“ ┬á┬á┬á
Unwillk├╝rlich stieg vor Johanns innerem Auge das Bild von tanzenden Sphingen auf.
„Lass uns diesen Ort des Schreckens und des Todes verlassen“, entfuhr es ihm. „Ich habe genug von dieser Oase.“
„Der Tod ist ├╝berall“, entgegnete Takait d├╝ster.┬á
 
Das Lybyrinth
12. Das Labyrinth
Die geringe Abmessung der Karawanserei am Rande der Oase war ein Hinweis darauf, dass niemals Z├╝ge von mehr als maximal zwanzig Kamelen hier Unterschlupf suchten. Im Innenhof, der von St├Ąllen, Lagergeb├Ąuden und Unterk├╝nften umgeben war, sa├čen die m├╝den Reisenden von ihren Dromedaren ab. Peter bemerkte, dass nicht alle Kaufleute sich mit den Einheimischen verst├Ąndigen konnten und er lauschte auf den Klang der Sprache, derer sich die Oasenbewohner bedienten. Es handelte sich definitiv nicht um Arabisch, sondern die Laute ├Ąhnelten denen des Koptischen, das der alte Priester w├Ąhrend der Messe gesprochen hatte.
„Was ist das f├╝r eine Sprache?“, wollte Johann wissen, der offenbar die gleiche Beobachtung gemacht hatte.
„Das ist ├ägyptisch“, erwiderte Takait mit der gr├Â├čten Selbstverst├Ąndlichkeit und Peter ├╝berlegte, was sie wohl damit meinte und er kam zu dem Schluss, dass man hier eine Sprache verwendete, die der der alten Pharaonen ├Ąhnlich. Schon wollte er Takait fragen, ob sie auch Arabisch sprach, als er sich daran erinnert, wie sie sich mit den Kaufleuten herumgestritten hatte.┬á┬á
Aber warum wunderst du dich dar├╝ber, dass sie ├ägyptisch reden?, fragte Peter sich. Die altert├╝mliche Sprache passt hervorragend zu den Geb├Ąuden, die er aus der Ferne fassungslos bestaunt hatte. Nichts hatte ihn auf die fremdartige Welt vorbereitet, die er nun betreten w├╝rde: Nicht die reichlich vagen Warnungen des alten Priesters und auch nicht die konkreteren Schilderungen Takaits, die im Hause des Priesters von ihrer Heimat berichtet hatte. Als sie ihm erz├Ąhlt hatte, dass man auf den Sobek-Oasen wie fr├╝her lebte, hatte er sich ein altmodisches ├Ągyptisches Dorf ohne Gaslaternen und englische Tageszeitungen vorgestellt, aber keine halbnackten Bewohner, die gef├Ąltelte Schurze, wei├če, plissierte Gew├Ąnder und Per├╝cken trugen. Kein einziges Minarett einer Moschee ragte in den blauen Himmel und weit und breit waren keine Turbane zu sehen. Auch versteckten sich die Frauen nicht z├╝chtig verschleiert im Inneren ihrer H├Ąuser, sondern sie standen barh├Ąuptig auf den Gassen und betrachteten die Ankunft der Karawane mit unverhohlener Neugier.
„Du erinnerst dich an alles, was ich dir erkl├Ąrt habe?“, fragte Takait und Peter nickte automatisch, obwohl ihm nicht recht klar war, worauf sie hinauswollte.
„Dann braucht ihr mich ja heute nicht mehr“, stellte sie sachlich fest und bevor Peter – verbl├╝fft wie er war – etwas erwidern konnte, hatte sie schon die Z├╝gel ihres Kamels einem Stallknecht in die Hand gedr├╝ckt und war in der Menge verschwunden.
„Warum hat sie es denn so eilig?“, fragte Johann in einem beil├Ąufigen Tonfall der vermuten lie├č, dass er glaubte, dass sie im Auftrag des Bruders irgendetwas erledigte.
„Keine Ahnung“, erwiderte Peter und der Verdacht stieg in ihm auf, dass Takait ihn angelogen hatte, als sie versichert hatte, dass sie den Br├╝dern w├Ąhrend der ganzen Reise als Dolmetscherin zur Verf├╝gung stehen w├╝rde.
„Kommt sie bald wieder?“, wollte Johann wissen und er klang ernsthaft besorgt.
Peter zuckte mit den Schultern.
„Ich wei├č auch nicht mehr als du“, musste er zugeben und er ├Ąrgerte sich dar├╝ber, dass Johann ihm an allem die Schuld gab, was auf der Reise nicht wie geplant klappte.
„Also unter einem zuverl├Ąssigen Dienstboten stelle ich mir etwas anderes vor“, protestierte Johann, „und au├čerdem was soll diese Anspielung hei├čen, die sie eben gemacht hat? Ich meine, das mit dem sich an alles erinnern?“
„Hast du denn gestern Abend gar nicht zugeh├Ârt?“, entfuhr es Peter und er bedauerte, den schlaftrunkenen Bruder, dem st├Ąndig die Augen zugefallen waren, nicht zur Aufmerksamkeit ermahnt zu haben, „Takait hat uns eingesch├Ąrft, dass wir morgen zuerst dieses Labyrinth durchqueren m├╝ssen, was angeblich weniger kompliziert ist als der Name des Baus bef├╝rchten l├Ąsst. Erst dann k├Ânnen wir im Tempel nach dem Oasenkrokus fragen.“
„Und die Mumie?“
Johann verdrehte die Augen und nur m├╝hsam zwang er sich, ruhig zu bleiben.
„Das haben wir doch schon so oft durchgesprochen: Das Grab, in dem Vater die Mumie gefunden hat, befindet sich auf der zweiten Oase. Das ist die n├Ąchste Station der Reise. Leider besucht die Karawane dann noch die dritte und letzte Oase der Sobek-Gruppe, aber sie liegt, wenn ich das richtig verstanden habe irgendwie auf den R├╝ckweg.“
„Und dann fahren wir endlich wieder nach Hause?“
Nach Hause zu der treulosen Anneliese, der ewig n├Ârgelnden Mutter und der kleinen Schwester, die ihn st├Ąndig verpetzte? Peter stie├č bei dieser unangenehmen Vorstellung einen leisen Seufzer aus.
„Selbstverst├Ąndlich“, behauptete er trotzdem, um den Bruder zu beruhigen. Dann sagte er sich, dass er keine gro├čen Pl├Ąne machen sollte, bevor sie wieder wohlbehalten nach Alexandria zur├╝ckgekehrt waren. „Ich w├╝rde gern den Ort besichtigen. Er scheint mir ein regelrechtes Freilichtmuseum zu sein. Du kommst doch hoffentlich mit?“
Es w├Ąre eine Untertreibung gewesen, dass Peter fasziniert war. Seit der R├╝ckkehr seines Vaters hatte er eine wahre Passion f├╝r das alte ├ägypten. Und hier konnte er die uralten Riten, die in zerbr├Âckelnden Papyroi beschrieben waren leibhaftig miterleben wie ein B├╝hnenst├╝ck.
„Wo wir schon einmal da sind, sollten wir uns das nicht entgehen lassen“, stimmte Johann ihm zu und so verlie├čen die Br├╝der - nachdem sie ihr Gep├Ąck im Lagerraum verstaut hatten – am sp├Ąten Nachmittag die Karawanserei.
„Ich hoffe nur, die Kiste mit der Mumie ist sicher“, bemerkte Johann als sie das Eingangstor passierten.
„Der Verwalter des Warenlagers schien mir vertrauensw├╝rdig zu sein“, versicherte Peter, „au├čerdem m├Âchte ich nicht wissen, was diese Schmuggler so alles bei ihm verstauen. Diskretion ist daher ein wichtiger Teil seines Gesch├Ąftes.“
Der hei├če Wind, der durch die Oase wehte, bewegte die Bl├Ątter der Palmen und fegte abgestorbene Zweige durch die Gassen.
„Ich wollte, es w├Ąre nicht so windig“, beschwerte sich Johann, „Dieses Wetter machte mir Kopfschmerzen.“
„Auch ich finde den Wind l├Ąstig, aber wir sollten uns wenigstens die Geb├Ąude schon mal von au├čen ansehen, bevor wir sie betreten“, erwiderte Peter, der sich fragte, warum der Bruder immer so ein Spielverderber war.
Vor ihnen lag ein eindrucksvolles Szenario: Granitstatuen von L├Âwen s├Ąumten den schnurgeraden Weg zur Pyramide eines Pharaos, dessen unaussprechlichen Namen sich keiner der Br├╝der merken konnte. Obwohl sie kaum h├Âher war als die Pylone des Tempels erschien die Pyramide Peter wie ein Fels in der Brandung der W├╝ste, der den Himmel mit der Erde verband. Ihre Verkleidungsplatten aus hellem Kalkstein reflektierten das Sonnenlicht, w├Ąhrend die Spitze der Pyramide aus schwarzem, poliertem Granit bestand.┬á
Aus der N├Ąhe betrachtet zeigte sich jedoch, dass sich die Kalksteinplatten zu lockern begannen. Einige waren bereits heruntergefallen und gaben den Blick frei auf ein Rahmenwerk aus Steinbl├Âcken, dessen Zwischenr├Ąume mit ungebrannten Lehmziegeln gef├╝llt waren. Schon begannen die Ziegel zu zerbr├Âseln. Sicherlich w├╝rde die, auf diese kostensparende Weise gebaute Pyramide der Zeit nicht solange trotzen wie die zu den Weltwundern z├Ąhlenden Pyramiden von Gizeh.
Wann mochte die Pyramide der ersten Sobek-Oase wohl errichtet sein? Wahrscheinlich war sie keinesfalls Jahrtausende alt, wie Peter zuerst vermutet hatte, denn dann w├Ąre sie bei ihrer schlampigen Bauweise bestimmt in einem noch viel beklagensw├╝rdigeren Zustand. Johann hatte Recht gehabt: Das w├╝rde ihnen zu Hause niemand glauben. Warum nur hatten sie keinen Fotoapparat auf die Reise mitgenommen? Es lag bestimmt nur an ihrem ├╝berst├╝rzten Aufbruch, dass Peter diese an und f├╝r sich nahe liegende Idee nicht in den Sinn gekommen war.┬á Ob sich die n├Ąchtliche Besucherin des Bruders wohl h├Ątte auf eine fotographische Platte bannen lassen? Bei der blo├čen Vorstellung schauderte es Peter und er versuchte, sich wieder auf seine Umgebung zu konzentrieren. ┬á
S├╝dlich der Pyramide befand sich das sogenannte Labyrinth, das dem Haupttempel vorgelagert war. Es handelte sich um einen Geb├Ąudekomplex und nicht um einen Garten, wie Peter und Johann erwartet hatten.
Auf der n├Ârdlichen Seite der Pyramide blickte ein steinerner Sphinx mit weit aufgerissenen Augen auf die Skulpturenallee hinab. Er lag da wie ein ├╝berdimensionierter L├Âwe mit Zeremonialbart, auf dem Kopf ein steinernes Kopftuch von der Form wie es der Pharao getragen hatte.
„Was mag diese Sphinx wohl bewachen?“, fragte Johann und er klang leicht belustigt. „Und wozu der Aufwand ein Labyrinth in dieses selbst von den alt├Ągyptischen G├Âttern verdammte W├╝stennest zu bauen?“┬á┬á┬á┬á
„Man sagt der Sphinx, denn in ├ägypten sind Sphingen m├Ąnnlich“, erkl├Ąrte Peter, der ├╝ber den mokanten Tonfall des Bruders ver├Ąrgert war und es sich daher nicht nehmen lie├č, diesen zu belehrte, „Takait hat gesagt, dass in der unterirdischen Grabanlage des Pharaos unermessliche Sch├Ątze liegen. Das d├╝rfte der Grund f├╝r die Errichtung der W├Ąchterskulptur gewesen sein.“
„Wahrscheinlich wird die Grabanlage von Bewaffneten bewacht“, erwiderte Johann nachdenklich, „wir sollten also morgen versuchen, ihr nicht zu nahe zu kommen.“
„Das hatte ich auch nicht vor“, stimmte Peter dem Bruder zu und dann schlenderten die Br├╝der noch eine Weile schweigend durch die schmalen Gassen des Ortes.
Nachdem Peter den ersten Schock dar├╝ber ├╝berwunden hatte, dass man in dieser Oase die alt├Ągyptischen Traditionen - einschlie├člich der heidnischen Religion - pflegte, bemerkte er einige Unterschiede zu den Darstellungen des Alltagslebens auf den ├Ągyptischen Reliefs. Dies fing damit an, dass die Bewohner der Oase das Kamel kannten, das erst die Perser in ├ägypten eingef├╝hrt hatten, weshalb man sich in Pharaonischer Zeit hatte mit Eseln behelfen m├╝ssen. Und es h├Ârte damit auf, dass einige der Bewohner Arabisch untereinander sprachen. Dieses Bild wurde noch abgerundet von der Tatsache, dass niemand Notiz von den Br├╝dern nahm. Offenbar waren die Einheimischen an den Anblick von Nomaden und Kaufleuten gew├Âhnt, die in regelm├Ą├čigen Abst├Ąnden ihre Oase besuchten.
Aber wahrscheinlich kamen sehr selten Europ├Ąer hierher? Kaum war ihm dieser Gedanke gekommen, so realisierte Peter bereits, dass sie in ihren Beduinengew├Ąndern in den Augen der Einheimischen nicht anders als die Nomaden aussahen.
Bei aller Faszination, die die Kultur der ersten Oase auf ihn aus├╝bte, fand es Peter jedoch bedauerlich, dass er sich mit dem Besuch des Tempels noch gedulden musste, da er auf einen Bescheid Takaits wartete.
 
 
Drei Tage sp├Ąter machten sich die Br├╝der dann endlich nach einem reichlichen Fr├╝hst├╝ck auf den Weg zum Labyrinth, aber Johann verstand noch immer nicht, warum sie dieses durchqueren sollten.
„Lass uns doch einfach au├čen um das Geb├Ąude herumgehen!“, schlug er daher vor, „Das ist der k├╝rzeste Weg zum Tempel und der ist doch wohl unser eigentliches Ziel.“
Peter zuckte hilflos mit den Schultern.
„Takait meint, dass es besser sei der Tradition zu folgen. Offenbar wird man in diesem Tempel nur empfangen, wenn man vorher das Labyrinth durchquert hat, was auch immer der Sinn dieser Sitte sein mag. Aber was wunderst du dich? Priester Menas hat uns ja gewarnt: In dieser Oase ist alles seltsam!“
Bei der blo├čen Nennung des Namens Takait wurde Johann w├╝tend. Zwar war sie am ersten Abend ihres Aufenthaltes gegen zehn Uhr zur Karawanserei zur├╝ckgekehrt, aber sie hatte Peter nur einige kurze Instruktionen gegeben – als ob sie die Herrin sei und er der Diener - und morgens beim Fr├╝hst├╝ck war sie schon wieder verschwunden und hatte sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Vielleicht erlaubte sie sich nur einen schlechten Scherz mit ihnen, als sie behauptet hatte, dass sie das Labyrinth durchqueren sollten? Das Labyrinth? Ganz pl├Âtzlich kam Johann ein beunruhigender Gedanke.
„Hoffentlich lauert in diesem Labyrinth kein Ungeheuer, wie der Minotaurus!“
Peter lachte.
„Minotauros hei├čt er korrekt! Du liest zuviel griechische Sagen! Und au├čerdem sind wir nicht auf Kreta.“
„Deshalb hilft uns auch keine Ariadne mit ihrem roten Faden“, erg├Ąnzte Johann, dem seine Furcht mittlerweile selbst albern vorkam. „Vielleicht sollten wir uns selbst einen Wollkn├Ąuel besorgen?“
„Ich glaube nicht, dass es den Einheimischen gefiele, wenn wir F├Ąden in ihren Geb├Ąuden herumliegen lassen w├╝rden. Au├čerdem wollen wir nicht zum Ausgangspunkt zur├╝ckkehren, sondern auf der anderen Seite wieder herauskommen. Hast du wirklich alles verstanden, was ich dir heute Morgen beim Fr├╝hst├╝ck in der Karawanserei erkl├Ąrt habe?“
Es w├Ąre eine L├╝ge gewesen, wenn Johann diese Frage bejaht h├Ątte, denn er hatte die Ausf├╝hrungen des Bruders reichlich verworren gefunden.
„Dass wir immer rechts herum gehen m├╝ssen“, antwortete er daher etwas vage.
„Genau“, best├Ątigte Peter, „wenn wir uns stets an der rechten Wand halten, aber in bereits betretene Abzweigungen nicht noch einmal hineingehen, laufen wir alle Verzweigungen nacheinander ab. Wir lassen also auf diese Weise keine Abzweigung aus und m├╝ssten so ├╝ber kurz oder lang zum Ende des Labyrinths gelangen.“
„Hast du dir das ausgedacht?“, fragte Johann, den dieses System mit gro├čem Respekt erf├╝llte.
Peter sch├╝ttelte mit einem belustigten Gesichtsausdruck den Kopf.
„Nein, Takait hat mir das erkl├Ąrt.“
Der hei├če Wind, der durch die Oase fegte, verst├Ąrkte sich und trieb den Br├╝dern Sand ins Gesicht. Peter hielt im Schritt inne und Johann h├Ârte das kl├Ągliche Miauen einer Katze. Es war ein besonders h├╝bsches, geflecktes Tier, das geschwind den Stamm einer Palme hinaufkletterte und so wirkte als ob es vor etwas Angst h├Ątte. Offenbar hatte der Bruder die Katze aus Versehen getreten, da wegen des W├╝stenwindes einen Augenblick lang nichts gesehen hatte. Es war nur eine Frage der Zeit bis alles unter Wanderd├╝nen verschwunden war: Der Sphinx, der Tempel und auch das Labyrinth.
„Ich frage mich ja ernsthaft, warum dieser Pharao sich hat in dieser trostlosen Oase begraben lassen“, sagte er zu dem Bruder, „├╝ber kurz oder lang erobert die W├╝ste diese Oase zur├╝ck.“
„Vielleicht liebte er die Einsamkeit“, schlug Peter vor, „oder er dachte, dass das Grab hier sicher vor R├Ąubern ist.“
„Was n├╝tzt ihm dies, wenn sein Grab unter Wanderd├╝nen begaben ist und das Bar seine Mumie nicht mehr finden kann“, wandte Johann ein, „In der Residenz des Pharaos, wo auch immer sie sich befunden haben mag, gab es sicher Tausende von Dienern, die den Sand h├Ątten wegschippen k├Ânnen.“
„Die Residenz war bestimmt am fruchtbaren Ufer des Nils, wo es nicht so sandig ist“, informierte ihn Peter mit einem angespannten Gesichtsausdruck, weshalb sich Johann einen Kommentar ├╝ber seine gewohnheitsm├Ą├čige Besserwisserei verkniff, der ihm schon auf der Zunge lag.
Sie n├Ąherten sich der S├Ąulenreihe, die dem Labyrinth vorgelagert war. Die Kapitelle der anschwellenden S├Ąulen glichen den Bl├╝ten der Lotosblumen im Wasserreservoir der Oase.
„Noch k├Ânnen wir umkehren“, wandte Johann ein, als er aus der N├Ąhe erst richtig realisierte wie be├Ąngstigend gro├č das Geb├Ąude war.
„Das h├Ąttest du dir vorher ├╝berlegen sollen“, erwiderte Peter enerviert. „Jetzt, nachdem wir die halbe W├╝ste durchquert haben um zu dieser Oase zu gelangen, gibt es kein Zur├╝ck mehr f├╝r uns.“
„Ich finde, dass die oder der Sphinx uns regelrecht anstarrt“, meinte Johann, der sich noch einmal umgesehen hatte, um sich die Richtung einzupr├Ągen, in der sie das Labyrinth durchqueren mussten. „Man k├Ânnte meinen, dass er lebendig ist.“
Peter musterte den Sphinx mit einem nachdenklichen Blick. „Auch ich finde ihn ziemlich unheimlich“, gab er zu. „Takait sagt, ihr Volk liebt und f├╝rchtet die Tiere wegen ihrer Stummheit, aber ich bin eigentlich dankbar daf├╝r, dass diese Kreaturen nicht sprechen k├Ânnen“, f├╝gte er hinzu und zeigte auf die L├Âwen, die rechts und links den Weg flankierten.
„Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie aus Stein sind“, erwiderte Johann, der diese Bemerkung ziemlich unlogisch fand.
Als er die Stufen hochstieg, die zur Vorhalle f├╝hrten, konnte Johann sich des Verdachtes nicht erwehren, dass er einen gro├čen Fehler machte. Vor dem Portal stand breitbeinig ein ├ägypter mittleren Alters, der sich eine Leopardenhaut mit Tatzen und Schwanz um die Brust geschlungen hatte. Der strenge Blick aus seinen, von schwarzen Strichen umrahmten Augen lie├č erkennen, dass er es nicht gewohnt war, dass man ihm widersprach. Um den Hals trug er ein breites, aus mehreren Reihen farbiger, meist blauer Perlen bestehendes Schmuckband. Kurz und gut, er sah aus wie eine lebendig gewordene Statue aus einer ├Ągyptischen Sammlung.
Als Peter und Johann den W├Ąchter erreicht hatten, hob dieser gebieterisch eine lange Standarte in die H├Âhe. Er sagte etwas auf ├ägyptisch und Peter holte aus seinem B├╝ndel eine Schriftrolle.
„Woher hast du das?“ fragte Johann leise, obwohl er die Antwort eigentlich schon kannte.
„Von Takait.“
Johann f├╝hlte sich hintergangen.
„Davon hast du mir aber nichts gesagt, und ├╝berhaupt: Warum hast du Takait nicht ├╝berredet mitzukommen, wo sie alles besser wei├č? Schlie├člich haben wir sie als Dolmetscherin angestellt.“
„Sie hat gesagt, dass wir allein das Labyrinth durchqueren m├╝ssen, wenn wir im Tempel empfangen werden wollen“, erwiderte Peter, w├Ąhrend er dem W├Ąchter die Papyrusrolle ├╝berreichte.
„Und was steht da drauf?“, wollte Johann wissen, als der ├ägypter mit wichtiger Miene zu lesen begann.
„Wei├č ich auch nicht, aber Takait hat gesagt, man w├╝rde uns einlassen, wenn wir dieses Dokument pr├Ąsentieren.“┬á┬á
„Und du hast nicht nachgefragt, was auf der Rolle steht? Wir verstehen kein Wort dieser Sprache. Der Text k├Ânnte genauso gut lauten: werft die beiden den Krokodilen zum Fra├č vor oder Sie haben eine reiche Mutter, die f├╝r ihre S├Âhne jedes L├Âsegeld zahlt.“
Peter warf Johann einen irritierten Blick zu.
„In der W├╝ste gibt es keine Krokodile.“
„Vielleicht halten sie welche im Dorfteich!“
Der Mann im Leopardenfell hatte den Text mittlerweile studiert und betrachtete nun die Fremden wie zwei besonders h├Ąssliche K├Ąfer. Johann fragte sich, ob es m├Âglich war, dass er ihrer Unterhaltung hatte folgen k├Ânnen, aber er verwarf diesen Gedanken augenblicklich wieder, denn sie hatten Deutsch gesprochen.
Mit einem missbilligenden Gesichtsausdruck gab er W├Ąchter Peter die Rolle zur├╝ck. Dabei murmelte er einige Worte, die f├╝r Johann wie „fahrt zur H├Âlle“ klangen, aber er machte ihnen den Weg frei, was Johann entt├Ąuschte, denn er hatte gehofft, dass ihm der Eintritt in das Labyrinth verwehrt werden w├╝rde.┬á┬á
Die Luft des riesigen Raums, den die beiden Br├╝der nun betraten war erf├╝llt vom bet├Ârenden Geruch der R├Ąucherst├Ąbchen, die eine Schar von fliegenden H├Ąndlern vor dem Tempel verkaufte.
„Warum sind wir allein in dieser ├Âden Steinw├╝ste?“, fragte Johann und schaute sich irritiert um. „Ich habe erwartet, dass es hier nur so vor Besuchern wimmeln w├╝rde.“
„Das Labyrinth ist heute offiziell geschlossen. Takait hat uns eine Sondererlaubnis besorgt.“
Johann verzog bei der blo├čen Nennung des Namens das Gesicht.
„Ich wei├č nicht, was man hier unter einem Labyrinth versteht“, meinte er einen Augenblick sp├Ąter, „aber f├╝r mich sieht das aus, wie ein Palast.“
„Was hast du anderes erwartet?“, fragte Peter zur├╝ck, „schon von au├čen haben wir festgestellt, dass dies kein aus Buchsbaumhecken geschnittenes barockes Labyrinth ist.“┬á┬á
Johanns Blick blieb an den feinen Reliefs haften, die die W├Ąnde bedeckten. Eine riesige Kuh war darauf zu sehen, dar├╝ber der Sternenhimmel, eine Mumie, ein Mann, der einer Frau einen Kringel vor die Nase hielt und immer wieder Menschen mit Tierk├Âpfen, sie hatten K├Âpfe von L├Âwen, K├Âpfe von Schakalen und sogar K├Âpfe von Krokodilen. Dies waren die heidnischen G├Âtter, die man hier noch immer verehrte. Was w├╝rde wohl die mittlerweile recht fromme Mutter bei diesem Anblick sagen?┬á┬á
An die Halle schloss sich ein langer Raum an, in den mehrere Reihen von dicken S├Ąulen eingestellt waren, in deren Sch├Ąften Prozessionen von tierk├Âpfigen G├Âttern eingemei├čelt waren. Auf die W├Ąnde waren Figuren mit Kreisen auf dem Kopf aufgemalt und ├╝ber ihnen R├Ąder mit vielen Speichen.
„Wenigstens besteht bisher keine Gefahr, dass wir uns verlaufen“, bemerkte Johann mit einem Anflug von Galgenhumor.
Tats├Ąchlich war die Raumabfolge klar und logisch. Hier gab es keine Seitenkammern und dunklen G├Ąnge und alles war von strenger Symmetrie und Axialit├Ąt.
Am┬á anderen Ende des langen Raumes tat sich ein schummriger langer Saal auf, von dem zu beiden Seiten Korridore durch halbhohe W├Ąnde abgetrennt waren. Wortlos betrat Peter den rechten Seitentrakt und Johann trottete ihm nach. Am Ende des Gangs gelangten sie wieder in den Hauptraum.
Es folgte ein Hof mit ├╝berdachten S├Ąuleng├Ąngen, dessen Boden mit dunklem Basalt gepflastert war. Die S├Ąulen standen sehr eng. Sie endeten in gr├╝nbemalten Kapitellen, die wie Pflanzen aussahen und die dem Raum die Erscheinung eines schilfbestandenen Flussufers gaben. Wieder durchquerten die beiden Br├╝der nicht den Hauptraum, sondern hielten sich rechts der S├Ąulen.
Dann betraten sie einen kleinen Raum, der mit flachen Reliefs geschm├╝ckt war, auf denen in mehreren ├╝bereinander geordneten Registern Alltagsszenen abgebildet waren, wie Bankettszenen und das Schlachten von Tieren. In der Mitte des Raumes stand eine kleine Barke. Von der rechten Wand zweigte ein Flur ab, an dessen Ende eine T├╝r offen stand, auf die Peter zielstrebig zuging.
„Bist du von allen guten Geistern verlassen?“, fuhr Johann Peter an. Das hatte er noch nie getan, in all den Jahren und er erschrak vor seiner eigenen Heftigkeit. „Siehst du nicht, dass diese T├╝r gewaltsam ge├Âffnet worden ist?“, f├╝gte er etwas freundlicher hinzu.
 
Peter sah es, aber dies erregte gerade seine Neugier, denn seit er bemerkt hatte, dass er quasi in die pharaonische Zeit zur├╝ckgereist ist, dreht sich seine Phantasie nur noch um die Schatz, die hier noch nicht vergraben waren und um die Kunstgegenst├Ąnde, die die Handwerker der Oase sicherlich weiterhin produzierten.
„Wer wei├č, wie lang das her ist, dass die T├╝r ge├Âffnet worden ist. In der trockenen Luft der W├╝ste bleibt alles jahrhundertelang frisch wie am ersten Tag“, erkl├Ąrte er dem Bruder, „au├čerdem hat man uns offiziell gestattet, das Labyrinth zu betreten und ich sehe an der T├╝r kein Verbotsschild.“
„Warum gehen wir nicht einfach weiter?“, dr├Ąngte Johann. „Das ist bestimmt nur der Dienstboteneingang, der zur K├╝che f├╝hrt. Wir sind schlie├člich nicht verpflichtet, st├Ąndig nach rechts zu gehen, sondern wir wollen den verfluchten Bau so schnell wie m├Âglich┬á wieder verlassen.“
Peter schreckte auf seinen Gedanken auf. Hatte Johann eben tats├Ąchlich K├╝che gesagt?
„Du denkst aber auch immer nur ans Essen“, r├╝gte er seinen Bruder. „Hier gibt es bestimmt nichts so Banales wie eine K├╝che!“
„Ich will nicht nur daran denken“, maulte Johann, „wenn wir um den Bau herumgegangen w├Ąren, so w├Ąren wir l├Ąngst am Ziel“.
Ohne auf die Bemerkung des Bruders einzugehen, durchschritt Peter so ruhig wie auf einem Abendspaziergang den Korridor, der hinter der T├╝r lag und Johann folgte ihm so nerv├Âs wie kurz vor dem Examen.
„Au├čerdem ist es wichtig, dass wir immer rechts herum gehen“, f├╝gte Peter zur Beruhigung des Bruders hinzu, „das hat Takait mir eingesch├Ąrft.“
Johann zuckte beim Klang dieses Namens sichtbar zusammen, aber er gab keinen Kommentar ab.
Der Flur endete in einer ├╝berw├Âlbten Kammer, von der rechts ein langer absch├╝ssiger Weg abzweigte, der von schlitzartigen Fenstern nur sp├Ąrlich erleuchtet wurde. Die farbigen Wandreliefs zeigen Gefangene verschiedener Nationalit├Ąt, sowie Angeh├Ârige unterworfener V├Âlker, die dem Pharao Gegenst├Ąnde pr├Ąsentierten. Wahrscheinlich handelte es sich um Tributzahlungen. Unter den W├╝rdentr├Ągern befanden sich ein Zwerg und einige Afrikaner. Obwohl sie ihn zunehmend faszinierten, warf Johann nur einen kurzen Seitenblick auf die Reliefs, denn er musste sich beeilen, um mit Peter Schritt zu halten.┬á┬á
„Mir gef├Ąllt das einfach nicht, dass wir durch diese T├╝r gegangen sind“, rief er ihm nach. „Wir haben hier nichts zu suchen.“
„Stell dich nicht so an.“ erwiderte Peter, obwohl auch er sich mittlerweile fragte, was dies f├╝r eine merkw├╝rdige Anlage war, aber er wollte dies dem Bruder gegen├╝ber nicht zugeben.
Er stieg eine Treppe hinab. In ihre W├Ąnde waren Gabentr├Ągerinnen und T├Ąnzerinnen gemei├čelt, die ebenfalls die Stufen hinunterzugehen schienen.
„Lass uns doch umkehren“, rief Johann ihm geradezu flehendlich nach.
Doch Peter lie├č sich nicht beirren. Ohne sich nach Johann umzudrehen, der wieder einmal nicht Schritt halten konnte, durchquerte er den Raum und ging dann durch einen schmalen Gang, der abrupt abknickte. Nun sah er vor sich einen erleuchteten Raum und folgte dem Weg immer weiter, immer auf das Licht zu, denn er hoffte dort einen Ausgang aus dem Labyrinth zu finden. Zunehmend erinnerte Peter die Szenerie an einem Kerker, aber er ermahnte sich selbst nicht so ├Ąngstlich zu sein.
Die Br├╝der gingen unter einem massiven Portal hindurch und gelangten in einen von Fackeln erleuchteten Gang, der so steil nach unten f├╝hrte, dass er gerade noch bequem begehbar war. Die in Pech getauchten Holzfackeln waren halb abgebrannt, woraus Peter folgerte, dass sie vielleicht momentan die einzigen lebenden Wesen in diesem Reich aus Granit und Rosenquarz waren. Peter erwog ernsthaft umzukehren, aber er konnte sich nicht ├╝berwinden, dem Bruder diesen Gefallen zu tun, der die ganze Zeit lamentierend hinter ihm hergetrottet war.
Der Schein der Fackeln warf wild flackernde, verzerrte Gebilde an die W├Ąnde und Peter meinte Schritte zu h├Âren. Mit angehaltenem Atem lauschte er, aber er h├Ârte nichts mehr. Er musste sich get├Ąuscht haben. Also folgte er weiterhin dem Gang, der kontinuierlich abw├Ąrts f├╝hrt.
Eine aberwitzige Hoffnung packte ihn. Wie von selbst stieg vor seinem inneren Auge das Bild der Grabkammer des Pharaos mit ihren unermesslichen Sch├Ątzen auf. Noch niemals war ein Grab eines Pharaos entdeckt worden, das nicht ausgeraubt worden war. Vielleicht war er der ersten, dem dies gelang? Peter verwarf diesen Gedanken wieder. Zugegeben: die erste T├╝r war eingeschlagen gewesen, aber das konnte auch der Kellermeister gewesen sein, der den Schl├╝ssel vergessen hatte und zu faul gewesen war um zur├╝ckzugehen, aber nein, hatte er nicht selbst vorhin Johann mitgeteilt, dass es sicher im Labyrinth weder K├╝che noch Weinkeller gab?
Der Gang knickte mehrmals ab und dann verzweigte er sich. Hoffentlich hatte Takait recht mit ihrer Immerrechtsrumtheorie! Nach einer Biegung weitete sich der Korridor zum doppelten seiner vorherigen Breite. In seine dicken Mauern waren Nischen eingetieft. Jede zweite von ihnen war mit einem Teppich mit der Darstellung eines ├Ągyptischen Gottes verh├Ąngt.
„Ideal um dahinter einen Liebhaber zu verstecken“, bemerkte Johann und Peter stellte erstaunt fest, dass der Bruder ganz pl├Âtzlich eher neugierig als ├Ąngstlich wirkte.
Am Ende des Korridors ├╝berstrahlte ein mit Fackeln erleuchteter Raum die Dunkelheit und wieder dachte Peter an Goldsch├Ątze und Antiquit├Ąten. Er stutzte und blieb abrupt stehen. Waren da nicht Stimmen? Er lauschte und die Vermutung wurde zur Gewissheit. Diesmal hatten ihm seine Sinne keinen Streich gespielt, aber die Stimmen waren sehr leise und Peter war auf Vermutungen angewiesen, wem sie geh├Âren mochten. Langsam wurden die Stimmen lauter. Offensichtlich kamen ihre Besitzer ihnen entgegen. Wahrscheinlich handelte es sich um Priester oder um Beamte, die hier arbeiteten. Selbst Johann hatte sich vorhin gewundert, dass sich in der ausgedehnten Anlage keine Menschenseele befand.┬á
Peter wurde j├Ąh aus seinen Gedanken gerissen, als der Bruder ihn ohne ein Wort zu sagen mit beiden H├Ąnden von hinten an den Schultern packte und ihn hinter den n├Ąchsten der Vorh├Ąnge schob. Peter war so ├╝berrascht, dass er es geschehen lie├č. Die Nische war kaum gro├č genug, um zwei Personen aufzunehmen. Peter wollte protestieren, aber Johann legte den Zeigefinger auf die Lippen und fl├╝sterte: „Lass uns warten bis diese Leute da vorn an uns vorbeigegangen sind. Es sind wahrscheinlich die M├Ąnner, die die T├╝r eingetreten haben.“
„Aber…“
„Nichts aber!“, unterbrach der Bruder, „H├Âr wenigstens einmal in deinem Leben auf mich.“
Es waren inzwischen zwar keine Stimmen mehr zu h├Âren, aber Schritte, das leise Tappen von sandalenbeschuhten F├╝├čen auf dem Steinboden des Labyrinths. Die Schritte kamen immer n├Ąher und hatten schlie├člich den Korridor erreicht.
Mit angehaltenem Atem lugte Peter vorsichtig hinter dem Spalt zwischen Vorhang und Wand hervor. Er erwartete wichtigtuerische Beamte zu sehen oder W├Ąchter, die das Labyrinth patrouillierten, aber ein ganz anderes Bild bot sich seinen Augen dar: Drei ungewaffnete ├ägypter, zwei kleine Dicke und ein langer D├╝nner schleppen eine Kiste, genauer gesagt lie├č der D├╝nne die beiden anderen schleppen. Diese Truhe war so schwer, dass sie nur langsam vorankamen.
Grabr├Ąuber!, dachte Peter. Sie kamen ihm merkw├╝rdig bekannt vor, aber er wusste nicht, wo er sie einordnen sollte.
Kurz vor der Nische, in der sich die Br├╝der versteckt hatten, blieben die M├Ąnner stehen. Sie reden alle zugleich aufeinander ein. Ihren Stimmen waren laut und ihre Gesichter von Wut verzerrt. Offensichtlich warfen sie sich gegenseitig Schimpfw├Ârter an den Kopf. Gab es schon jetzt Unstimmigkeiten beim Verteilen der Beute? Peters Puls raste und er verfluchte den Umstand, dass er kein Wort verstand. Der Streit wurde immer heftiger. Dann griff einer der beiden Tr├Ąger den H├Âhergestellten ganz unvermittelt an und es kam zu einem Handgemenge, in dem sich zeigte, dass der d├╝nne ├ägypter kr├Ąftiger war als er aussah.
Der andere Tr├Ąger kippte den Deckel der Truhe um. Er griff hinein, holte ein Alabastergef├Ą├č heraus, n├Ąherte sich von hinten den K├Ąmpfenden und erhob seinen rechten Arm. Fast h├Ątte Peter laut aufgeschrieen, um das Opfer zu waren, aber es war bereits zu sp├Ąt dazu. Mit einem dumpfen Ger├Ąusch traf der Schlag des Tr├Ągers seinen Auftraggeber hinter dem Ohr. Statt eines Schreis kam aus dessen Kehle nur ein leises Gurgeln. Dann kippte er ganz langsam nach hinten und schlug mit dem Kopf hart auf den Boden auf. Seine starren Gesichtsz├╝ge, die die Fackeln schaurig beleuchteten, lie├čen keinen Zweifel daran, dass der Mann tot war.
Die beiden dicken ├ägypter blickten einander wortlos an. Einer zuckte mit der Schulter. Der anderen machte eine wegwerfende Handbewegung. Dann hoben sie die Truhe hoch und gingen weiter als ob nichts geschehen w├Ąre. Allerdings schleppten sie nun ihre Last mit weit h├Âherer Geschwindigkeit als zuvor.
Peter war zutiefst schockiert. Er hatte tatenlos mit angesehen, wie ein Mensch heimt├╝ckisch ermordet wurde und es stand zu bef├╝rchten, dass der M├Ârder niemals f├╝r seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden w├╝rde. Sprachlos vor Schreck drehte Peter sich nach Johann um, der offensichtlich ebenfalls Zeuge des Verbrechens gewesen war, denn sein Gesicht war noch bleicher als das des Toten.
„Ich wusste doch die ganze Zeit, dass wir einen Fehler begangen haben“, fl├╝sterte Johann ihm vorwurfsvoll zu, „Wer sonst h├Ątte die Fackeln anz├╝nden sollen, au├čer Grabr├Ąubern?“
Peter ├Ąrgerte sich ├╝ber den Bruder, der dieses Argument vorher keinesfalls ins Spiel gebracht hatte. Peter jedenfalls hatte keinen Augenblick lang an Einbrecher gedacht.
„Das hast du vorhin aber nicht gesagt!“, zischte er zur├╝ck und verlie├č sein Versteck, denn er wollte den Raum in Augenschein nehmen, aus dem die R├Ąuber gekommen waren. Vielleicht hatten sie nicht die gesamte Grabausstattung gepl├╝ndert und noch einige Antiquit├Ąten f├╝r sie ├╝brig gelassen.┬á
„Komm zur├╝ck!“, rief ihm Johann ver├Ąrgert nach. „Wenn der Korridor dort weiterginge, w├Ąren die R├Ąuber nicht zur├╝ckgekommen.“
Warum musste der Bruder so ein Angsthase sein?“, dachte Peter und setzte seinen Weg unbeirrt fort. Hinter sich h├Ârte er die Schritte seines Bruders, der ihm folgte. Mit Erleichterung bemerkte Peter am Ende des Korridors eine weitere Nische mit Vorhang, hinter dem er sich im Zweifelsfall verstecken konnte.
Dann blieb er abrupt stehen, so ├╝berraschend war der Anblick, den das Innere der Kammer bot. Inmitten von M├Âbelst├╝cken mit offen stehenden T├╝ren, auf den Boden geworfenen Waffen und silbernem Geschirr lag das goldene Abbild eines Pharaos. In seinen, ├╝ber der Brust ├╝berkreuzten Armen hielt er zwei Szepter. Ein vergoldeter Thron war umgest├╝rzt, genauso wie eine Art Schrein, sowie die bemalten Holzstatuen von Tieren. Zu beiden Seiten der Schwelle lagen eine gro├če Zahl von Alabastergegenst├Ąnden und lebensechte Abbilder von Mistk├Ąfern blauem Stein. Doch ehe Peter auch nur die Schwelle des Raums ├╝berschritten hatte, packte ihn Johann erneut am Arm.
„Wir m├╝ssen uns verstecken!“, erkl├Ąrte er mit Nachdruck, „Sie kommen zur├╝ck.“
Nun h├Ârte auch Peter die herannahenden Schritte und Stimmen. Mit einem unterdr├╝ckten Fluch fl├╝chtete er sich in die n├Ąchste Nische, wo der Bruder ihm bereits den Vorhang aufhielt.
Ihn packte die Panik. Hatten die M├Ârder ihre Stimmen geh├Ârt und waren daher an den Ort ihres Verbrechens zur├╝ckgekehrt? Warum f├╝hrten sie keine Waffen mit sich? Starr vor Angst wagte es Peter diesmal nicht, hinter dem Vorhang herauszulugen, aber der leichte Schritt der beiden R├Ąuber lie├č vermuten, dass sie ihre Beute im Gang hatten liegen lassen. Wahrscheinlich hatte ihre uners├Ąttliche Gier sie in die Grabkammer zur├╝ck getrieben. Sie kamen um weitere Sch├Ątze zu rauben und Peter ├Ąrgerte sich, dass sie ihn davon abhielten, sich auch ein kleines St├╝ck des Kuchens zu sichern. Dabei hatte er es weit mehr als diese Banausen verdient, ├Ągyptische Kunstwerke zu besitzen, denn er wollte sich an ihnen erfreuen und sie nicht an den n├Ąchsten Hehler verscherbeln.
Im gleichen Augenblick begann der Boden unter seinen F├╝├čen zu wackeln. Ein Edbeben!, durchfuhr es Peter. Gab es so etwas in ├ägypten? Ausgerechnet jetzt, ich sie in einem Korridor tief unter der Erde waren!. Peter w├Ąre am liebsten weggerannt, aber dann w├╝rde er den M├Ârder in die Arme laufen! Es waren gl├╝cklicherweise nur wenige Erdst├Â├če, aber das Vibrieren des Bodens ging Peter durch Mark und Bein.
Laute Schreie drangen durch die Dunkelheit. Sie wurden ├╝bert├Ânt von einem knirschenden Ger├Ąusch, als ob ein gro├čer Stein ├╝ber den Boden gezogen w├╝rde, gefolgt von einem lauten Grollen, das an eine Lawine erinnerte. Der aufgewirbelte Staub flog bis in die Nische, in der sich die beiden Br├╝der versteckt hatten. Dann herrsche ganz pl├Âtzlich eine geradezu bedr├╝ckende Stille.
Ganz langsam und vorsichtig schob Johann den Vorhang leicht zur Seite, sodass er durch einen Spalt hinausschauen konnte. Peter stellte sich hinter dem Bruder auf die Zehenspitzen, um einen bessere Sicht in den Korridor zu haben.
„Das musst du dir ansehen!“, rief Johann entsetzt aus, den Vorhang g├Ąnzlich aufrei├čend und auf die Kammer deutend.
Nun sah auch Peter, was den Bruder zu erschreckt hatte: Der Zugang zur Kammer war geschlossen. Dort, wo sich noch vor wenigen Augenblicken ein beeindruckendes Portal mit m├Ąchtigem Sturz aus wei├čem Kalkstein befunden hatte, stand jetzt ein schwarzer Monolith. Offensichtlich war eine riesige Steinplatte nach unten geglitten, deren gr├Â├čter Teil in der Decke verborgen gewesen war. Was mochte diesen Mechanismus ausgel├Âst haben? Das Erbeben oder die R├Ąuber, die in die Kammer eingedrungen waren?
„Gut, dass sie uns verjagt haben“, murmelte Johann mit vor Schreck bebenden Lippen, „sonst w├Ąren auch wir jetzt in dieser Gruft gefangen.“
Peter nickte und ihn plagte zunehmend ein schlechtes Gewissen, dass er so leichtsinnig gewesen war.
„Wir kehren besser um, ehe uns der ganze Bau ├╝ber dem Kopf zusammenkracht“, stimmte er dem Bruder zu.
Der Gang, dem die beiden folgten, machte einen Knick und dahinter stand die Truhe, die die beiden R├Ąuber im Stich gelassen hatten, um in die Grabkammer zur├╝ckzukehren. Wie konnte ich die Schatzkiste vergessen?, dachte Peter, nun kann ich mir doch noch einige sch├Âne St├╝cke f├╝r meine Sammlung sichern. Seine Schritte beschleunigten wie von selbst bis er fast rannte. Johann folgte ihm und schaffte es, ihn zu ├╝berholen. Er stellte ihm in den Weg.
„Bis hierher und nicht weiter! Du wirst die Truhe nicht anr├╝hren. Der Krach der einst├╝rzenden Kammer war so ohrenbet├Ąubend, dass ihn oben alle geh├Ârt haben m├╝ssen. Mittlerweile hat sich bestimmt die komplette englische Armee vor dem Labyrinth versammelt. Denk dran, wir sind Fremde in einem Land, dessen Sprache und Gebr├Ąuche wir nicht verstehen.“┬á┬á┬á┬á┬á
In diesem Augenblick hasste Peter Johann geradezu. Trotzdem musste er widerwillig zugeben, dass dessen Worte nur allzu vern├╝nftig klangen. Mehr tot als lebendig lie├č er sich an der Truhe vorbeischleifen, obwohl ihm der Gedanke an deren Inhalt fast das Herz brach. Nur die Angst vor neuen Erdst├Â├čen bewirkte, dass er nicht darauf bestand, sich wenigstens die Taschen mit ein paar Skarab├Ąen zu f├╝llen.
Als er das Portal durchschritten hatte, das den Korridor mit dem n├Ąchsten Saal verband, drehte er sich um, um einen letzten, sehns├╝chtigen Blick auf die Truhe zu werfen.
„Konnte ich nicht wenigstens ein kleines….“
Der Satz blieb ihm im Halse stecken, denn im gleichen Augenblick gab es ein leichtes Nachbeben. Die Fackeln im Gang flackerten und drohten zu verl├Âschten. Ein weiteres, winziges Zittern folgte, danach war es wieder still, aber ein neuer Schrecken folgte: Vor Peters ungl├Ąubigen Augen senkte sich die Decke des Korridors langsam zum Boden hinab.
„Was, um Gottes Willen hat dies jetzt schon wieder zu bedeuten?“, entfuhr es ihm.
„Renn, so schnell du kannst!“ rief Johann entsetzt aus. „Das Labyrinth st├╝rzt ein!“
Auch Peter f├╝hlte erneut Panik in sich aufsteigen. Daher widersprach er nicht und so rannten die Br├╝der keuchend durch den langen, verzweigten Korridore, in dem ihre Schritte schaurig widerhallten. Dies war ziemlich kr├Ąftezehrend, da dieser Gang kontinuierlich anstieg. Trotz aller Eile mussten sie immer wieder innehalten, weil sich Wege abzweigten und die Br├╝der nachdenken mussten, welchen Pfad sie auf dem Hinweg gefolgt waren. Johann musste sich widerwillig eingestehen, dass sie dies ├╝berhaupt nur rekonstruieren konnten, weil sie sich auf dem Hinweg konsequent immer rechts gehalten hatten.
Schlie├člich erreichten sie den erleuchteten Saal, der sp├Ątestens h├Ątte ihren Argwohn┬á wecken sollen. Johann blieb einen Augenblick lang schwer atmend stehen und massierte mit beiden H├Ąnden die schmerzenden Knie.
„Wir m├╝ssen weiter“, wollte Peter ihm zurufen, aber er war selbst v├Âllig au├čer Atem und es gelang ihm nur mit M├╝he, den Satz zu artikulieren.
„Ich wei├č“, antworte Johann keuchend und machte sich widerwillig wieder auf den Weg.
Es folgte der schmale, mehrfach abknickend Gang und dann die lange, steile Treppe. Diesmal war Peter bei deren Anblick kurz davor aufzugeben und Johann gab ihm einen aufmunternden Klaps auf den R├╝cken. Peter sah, dass das hochrote Gesicht des Bruders fast die Farbe seines Haars angenommen hatte. Er nahm die erste Stufe und mit einem leisen Seufzer folgte Peter ihm. Sie steigerten das Tempo und st├╝rzten die Treppe hoch, zwei Stufen auf einmal nehmend, stolperten aber mehrfach vor Eile. Auf den Reliefs der W├Ąnde schritten ihnen Gabentr├Ągerinnen und T├Ąnzerinnen anmutig entgegen, in zeitloser Sch├Ânheit gebannt in den Stein. Peter musste an Takait denken und f├╝hlte sich von ihnen geradezu verspottet.┬á
Endlich folgte die ├╝berw├Âlbte Kammer, dann der letzte der schmalen Flure und die Stelle, an der sie vom Hauptweg abgekommen waren lag zum Greifen nah vor ihnen. Wahrscheinlich hatte der R├╝ckweg nur wenige Minuten gedauert, aber Peter waren sie wie Stunden erschienen.
Vor Anstrengung zitternd und um Atem ringend durchschritten die Br├╝der die gewaltsam ge├Âffnete T├╝r und w├Ąren fast mit den letzten Menschen, die Labyrinth ausgeharrt hatten, zusammen gesto├čen. Peter blieb im letzten Augenblick stehen, als er mit Schrecken realisierte, dass sich hinter der T├╝r├Âffnung sieben glatzk├Âpfige Priester breitbeinig aufgebaut hatten. Offenbar erwartete man sie. Mit versteinerten Gesichtern starrten sie die Fremden feindselig an. Peter fragte sich, ob das Labyrinth in Wahrheit eine Art Tempel war oder ob der L├Ąrm der einst├╝rzenden Kammern die Priester des benachbarten Tempels herbeigelockt hatte.
„Wir haben uns nur verlaufen“, erkl├Ąrte Johann in einem entschuldigenden Tonfall.
„Sie verstehen uns nicht“, erwiderte Peter, der sich ├╝ber sich selbst ├Ąrgerte, dass ihm nichts einfiel, was sie retten k├Ânnte.
„Gew├Âhn dir doch endlich ab, mich wie ein Kind zu behandeln“, protestierte der Bruder, „du kannst dir doch denken, dass mir dies nur so herausgerutscht ist.“
Da ihm nicht Besseres einfiel st├╝lpte Peter seine Taschen um, damit die Priester sehen konnten, dass sich nichts darin befand, was dem Labyrinth, dem Tempel, den Priestern oder irgendeinem toten Pharao geh├Ârte.
„Jetzt siehst du, dass ich Recht hatte! Wenn du etwas mitgenommen h├Ąttest, bek├Ąmen wir jetzt einen riesigen ├ärger“, meinte Johann und tat es ihm gleich.
Er hat mir das Leben gerettet, durchfuhr es Peter und er fragte sich, warum die Priester offenbar nicht von dem Erdbeben
 beunruhigt waren. Statt sich in Sicherheit zu bringen, durchbohrten sie die Brüder noch immer schweigend mit Blicken, was Peter noch bedrohlicher fand als ihren Zorn.
Ein griesgr├Ąmiger, hagerer Priester, der trotz seines fortgeschrittenen Alters kein Leopardenfell trug musterte die beiden Eindringlinge mit gerunzelter Stirn. Dann brach er endlich das Schweigen. Er hatte eine tiefe, wohlklingende Stimme, aber dies trug auch nichts dazu bei, dass die Br├╝der sie verstanden.
Wieder versuchten beide mit Gesten zu demonstrieren, dass sie nichts mitgenommen hatten, aber der Priester gab nicht zu erkennen, ob er sie verstand, sondern redete noch eine Weile mit ernster Miene auf sie ein. Dann endlich erkannte er, dass dies nichts fruchtete und er bedeutete den Br├╝dern, dass sie ihm folgen sollten. Sie durchquerten weitere Raumfluchten und Peter dachte, dass sie so wenigstens den schnellsten Weg aus dem Labyrinth gewiesen bekamen, bevor die Erde wieder zu beben begann.
Endlich verlie├čen sie den riesigen Bau und gelangten auf einen kleinen, mit quadratischen Steinen gepflasterten Hof. Er wurde hinten von der Schmalseite des Tempels begrenzt, dessen Eingang von zwei kolossalen Steinskulpturen bewacht wurde, die einander die Hand gaben, als wollte sie einen Wettbewerb im Armdr├╝cken veranstalten. In die riesigen, glatten Fl├Ąchen der Pylone waren versenkte Reliefs eingemei├čelt, auf denen eine ├╝berdimensionierte die Figur eines Pharaos zu sehen war, die mit einer Keule eine ganze Armee von Feinden bek├Ąmpfte. Winzige Figuren fl├╝chteten in wilder Panik nach allen Seiten, aber sie konnten der Allmacht ihres Gegners nicht entkommen. Diese Fassade war geschaffen um zu beeindrucken und diesen Eindruck erreichte sie auch, wie Peter neidlos zugeben musste.
Eine junge Frau kam aus dem Portal, sicherlich angelockt von dem Aufstand vor dem Tempel. Erst auf den zweiten Blick erkannte Peter Takait, die Frauengew├Ąnder und eine Langhaarper├╝cke mit Z├Âpfchenfrisur trug. Ihre gro├čen, melancholischen Augen waren mit schwarzer Farbe umrahmt. Auch die Augenbrauen waren mit schwarzen Strichen nachgezogen. Reichgegliederter Hals- und Brustschmuck zeugte vom Reichtum des Tempels und unterstrich die Sch├Ânheit seiner Tr├Ągerin. Peter w├Ąre ihr vor Erleichterung am liebsten um den Hals gefallen, denn wenn irgendjemand sie noch retten konnte, so war dies Takait. Trotzdem war Peter ├╝ber ihre exotische Aufmachung befremdet. Warum hatte sie niemals gesagt, dass sie Priesterin war?
Takait ging l├Ąchelnd auf die Priester zu und richtete einige Worte an sie. Doch die ├ägypter widersprachen ihr heftig und zeigten dabei anklagend sie auf die beiden Fremden. Takaits Gesicht wurde ganz pl├Âtzlich hart und ihr Blick musterte die Br├╝der kritisch.┬á
„Habt ihr das Grab des verehrten Pharaos beraubt?“, fragte sie schlie├člich mit ernster Stimme.
Peter schrak zusammen, nicht weil er ein schlechtes Gewissen hatte, sondern weil er vor lauter Aufregung v├Âllig vergessen hatte, dass Takait Deutsch sprach.
„Nein, nat├╝rlich nicht!“, beteuerten Peter und Johann wie aus einem Munde.
„Wir haben nichts gestohlen“, pr├Ązisierte Johann, „wir haben uns verlaufen und sind zuf├Ąllig in der Grabkammer gelandet, weil jemand die T├╝r hat offen stehen lassen.“
Takait ├╝bersetzte und Peter wartete innerlich darauf, dass die Priester fragten, warum sie nicht drau├čen geblieben waren.
„Sie haben ihre gerechte Strafe erhalten“, f├╝gte er daher hinzu, um die Priester von dieser Frage abzulenken. „Zuerst haben die beiden Tr├Ąger ihren Auftraggeber erschlagen und dann ist die Grabkammer eingest├╝rzt und hat die beiden anderen R├Ąuber unter sich begraben.“
Takait nickte nachdenklich, w├Ąhrend die Priester weiterhin mit zornigen Gesichtern auf sie einredeten. Mit sanftem Gesichtsausdruck antwortete das M├Ądchen und Peter bedauerte au├čerordentlich, dass er nicht verstand, was sie sagte, denn langsam begriff er, warum der Bruder ihr nicht ├╝ber den Weg traute. Er hatte bisher angenommen, dass Johann eifers├╝chtig war, weil er nicht mehr Peters ungeteilte Aufmerksamkeit besa├č. ┬á
„Hoffentlich schl├Ągt sie nicht vor, dass man uns den alt├Ągyptischen G├Âttern opfert“, fl├╝sterte Johann ihm zu und Peter vermochte nicht zu sagen, ob dies ein Scherz sein sollte.┬á
Noch immer schimpften die Priester, die von gleichem Rang zu sein schienen, denn sie sprachen alle auf einmal. Wild gestikulierend argumentierten sie mit Takait und warfen dabei von Zeit zu Zeit den Br├╝dern vielsagende Blicke zu. Takait antwortete stets mit einer ruhigen, geradezu hypnotischen Stimme. Schlie├člich hatte sie die Priester ├╝berzeugt oder ihnen fiel zumindest nichts mehr ein. Jedenfalls verstummten sie ganz pl├Âtzlich, standen auf weiterhin in der Pose unverhohlender Ablehnung vor dem Portal.
Takait machte eine einladende Handbewegung in Richtung Tempel.
„Tretet ein!“, sagte sie mit einem etwas einstudiert wirkenden L├Ącheln. „Ich habe mich schon gefragt, warum ihr solange gebraucht habt und was das f├╝r ein Aufruhr im Labyrinth war.“
Dann drehte sich um und durchschritt mit langsamen, gemessenen Bewegungen das Tempelportal.
Die Priester starrten Takait zornig nach, aber sie schienen vor soviel Hartn├Ąckigkeit resigniert zu haben, denn sie lie├čen die Br├╝der ungehindert eintreten. Peter hatte erwartet, dass sie ihnen folgen w├╝rden, aber die Priester blieben wie angewurzelt vor dem Eingang des Labyrinths stehen. Durften sie ihre Wirkungsst├Ątte nicht verlassen oder lauerten im Tempel neue Gefahren auf sie?
 
Durch die W├╝ste
11. Durch die W├╝ste
Schon seit ├╝ber einer Stunde schaute Johann angestrengt aus dem einzigen Fenster des Hauses, von dem aus man die Gasse ├╝berblicken konnte. Es beunruhigte ihn zutiefst, dass der Bruder und Priester Menas noch immer nicht aus diesem obskuren Schmugglernest zur├╝ckgekehrt waren, obwohl sie versprochen hatten bei Anbruch der D├Ąmmerung wieder da zu sein. Johann malte es sich mittlerweile bereits In den schw├Ąrzesten Farben aus, wie man sie ermordet hatte oder als Geiseln in einer ├╝blen Spelunke festhielt. Sicherlich verlangte bald irgendein Schurke ein astronomisch hohes L├Âsegeld f├╝r sie. Schon machte sich Johann mit dem Gedanken vertraut, dass er am Morgen das deutschen Konsulat einschalten w├╝rde, als der Schein von drei Fackeln ank├╝ndigte, dass jemand in die Gasse eingebogen war, aber leider kam im gleichen Augenblick ein Gruppe junger M├Ąnner aus dem Nachbarhaus, sodass Johann die Gesichter der drei Neuank├Âmmlingen nicht erkennen konnte, zumal diese nahe an den Mauern entlanggingen. ┬á
Die Haust├╝r wurde aufgeschlossen und einen Augenblick lang erwog Johann die M├Âglichkeit, dass man dem alten Priester seine Schl├╝ssel geraubt hatte. Dann atmete er erleichtert auf, denn durch die T├╝r├Âffnung schoben sich keine Piraten mit Augenbinde, Holzbein und Papagei auf der Schulter, sondern die massige Gestalt des Priesters, die schlankere des Bruders und ein Junge von etwa sechzehn Jahren. Er trug das helle Gewand der Beduinen, das sich von der farbigen Kleidung der St├Ądter unterschied, aber nach seiner dunklen Hautfarbe zu schlie├čen schien er kein Beduine, sondern ├ägypter zu sein. Das Auff├Ąlligste an ihm war sein h├╝bsches, fein geschnittenes Gesicht. Johann fragte sich, ob diese halbe Kind tats├Ąchlich eine europ├Ąische Sprache beherrschte.
„Das ist Takait“, sagte Peter, auf den Jungen zeigend. „Er wird uns als Diener und Dolmetscher begleiten. Er spricht unsere Sprache, da sein Vater Deutscher ist.“
„Wie hat es denn seinen Vater hierher verschlagen?“, wollte Johann wissen und er vermutete, dass dieser wie der eigene Vater ein Abenteurer war, ein Rumtreiber, um ein Lieblingswort der Mutter aufzugreifen.
„Das Schiff, auf dem er gereist ist, wurde von Seer├Ąubern ├╝berfallen und man hat ihn als Sklaven nach ├ägypten verkauft“, erkl├Ąrte der Bruder und Johann hatte f├╝r einen Augenblick Mitleid mit dem Jungen, gegen den er ansonsten eine Abneigung auf den ersten Blick empfand.
Es war seltsam, dass der Bruder statt seiner geantwortet hatte, aber vielleicht war es in ├ägypten den Dienern verboten mit Fremden zu sprechen? Doch das war keine Entschuldigung, denn schlie├člich war Johann kein Fremder, sondern der Bruder seines Herrn. Johann ├Ąrgerte sich dar├╝ber, dass der Priester den Jungen bereits mitgebracht hatte. Sollten sie sich nun wochenlang anschweigen, bis endlich die Karawane aufbrach?
„Ich habe einen Hunger wie ein L├Âwe!“, erkl├Ąrte der Priester, der gerade damit besch├Ąftigt war, sich den Staub von der Kleidung zu b├╝rsten und Johann dachte, dass dessen schwarze Gew├Ąnder bei diesem Klima extrem unpraktisch waren.
Als er damit fertig war, ├╝berreichte er Peter die Kleiderb├╝rste und ging in die K├╝che. Takait folgte ihm unaufgefordert. Wahrscheinlich hatte man ihn dar├╝ber informiert, dass der Diener des Hausherrn diese Nacht bei seiner Familie schlief. Dies war eine Vorsichtsma├čnahme gewesen, damit dieser m├Âglichst wenig von den seltsamen Geschehnissen im Haus mitbekam.
Johann sah den beiden nach und er fragte sich, was dieser Junge mit dem unaussprechlichen Namen wohl ausgefressen haben mochte, dass er in den abgelegensten Oasen Ägyptens Zuflucht suchte.
„Der ist bestimmt von zu Hause ausgerissen!“, sagte er daher schlie├člich zu seinem Bruder, als sich die K├╝chent├╝r geschlossen hatte.
„Das glaube ich auch“, stimmte ihm Peter zu, „aber ich bin froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich dachte schon, wir finden niemanden, der bereit ist, mit uns zu diesen Oasen zu reisen. Der Junge sagt, nach den Gesetzen des Landes sei er vollj├Ąhrig. Also habe ich ihm keine weiteren Fragen gestellt.“┬á
„Trotzdem stimmt mit dem Jungen etwas nicht“, insistierte Johann. „Warum vermummt er sich sonst mit dieser Beduinenkleidung? Wir tragen sie, weil wir nicht als Fremde erkannt werden wollen, aber was hat der Junge zu verbergen?“
„Keine Ahnung“, erwiderte Peter ungeduldig, „aber nun lass uns zu den anderen in die K├╝che gehen. Auch ich bin schrecklich hungrig.“ ┬á
„Nicht, dass wir seinetwegen ├ärger bekommen“, gab Johann zu bedenken, da er lieber nicht gegen die Gesetze des Landes zu versto├čen wollte, dessen Gastfreundschaft sie in Anspruch nahmen.
Peter, der bereits die K├╝chent├╝r ge├Âffnet hatte blieb stehen und drehte sich um.
„Johann, wir haben vorhin mit Hehlern verhandelt. Die Kaufleute, denen wir uns anschlie├čen sind Schmuggler und wir wollen eine Oase besuchen, die offiziell gar nicht existiert. Wenn wir uns dabei erwischen lassen, dann ist der Junge unser geringstes Problem!“ Er sch├╝ttelte mit einem freundlosen L├Ącheln den Kopf. „Und wir machen all das nur, um die Mumie zur├╝ckzubringen, damit du keine Alptr├Ąume mehr bekommst.“
„Und um uns dieses komische Kraut zu besorgen, das du Moritz mitbringen willst“, erg├Ąnzte Johann.
„Der Oasenkrokus ist kein Kraut, sondern eine Blume. Sie sieht so ├Ąhnlich aus wie ein normaler Krokus, hat aber fleischrote Wurzeln“, rief Priester Menas ihnen aus der K├╝che zu, „aber jetzt kommt endlich zu Tisch oder wir lassen euch nichts ├╝brig.“┬á
„Wir kommen gleich!“, rief Peter zur├╝ck und senkte dann seine Stimme. „Wei├čt du, was mir heute mitten in der Nacht eingefallen ist? Es gibt noch mindestens zwei Menschen, die mit der Mumie Kontakt gehabt haben, n├Ąmlich der Onkel und sein Lehrling.“
„Du hast v├Âllig recht“, erwiderte Johann, „an die habe ich gar nicht gedacht.“
W├Ąhrend des Essens erfuhr Johann, dass er das zweifelhafte Gl├╝ck hatte, schon wenige Tage sp├Ąter Alexandria verlassen zu d├╝rfen, da bald eine Karawane zu den verborgenen Oasen aufbrach.
Das ist meine Henkersmalzeit, dachte er und schaufelte gierig alles in sich hinein, was man ihm vorsetzte. Am folgenden Morgen h├Ątte er nicht mehr zu sagen vermocht, was er alles gegessen hatte, aber er erinnerte sich an den schweren Wein des Priesters, dem er allzu reichlich zugesprochen hatte, wobei er der Schmuggler im Nildelta gedacht hatte, bei denen der Hausherr den Rebensaft bezog.
So vergingen noch einige Tage mit tr├╝bsinnigem Warten, in denen Johann den schweigsamen Jungen nur zu den Malzeiten zu Gesicht bekam. Dann war der Zeitpunkt gekommen, um in aller Herrgottsfr├╝he Priester Menas Lebwohl zu sagen und sich zum Sammelplatz der Karawane zu begeben.
„Ich werde jeden Tag f├╝r euch beten“, versprach der alte Priester zum Abschied und sein Blick wanderte von Peter zu Johann in einer Art und Weise, die vermuten lie├č, dass er bef├╝rchtete keinen der Br├╝der jemals wieder lebend zu sehen.
Johann fand, er h├Ątte ihnen lieber Mut zusprechen sollen, aber ehe er sich beschweren konnte gab der Bruder ihm den Auftrag, Takait beim Transport der gro├čen Versandkiste, die die Mumie enthielt zu helfen. Sie befestigten diese auf einem der Kamele, die Takait f├╝r sie gemietet hatte. Dann brachen sie unverz├╝glich auf, um mit ihren Dromedaren nicht zuviel Aufsehen in der schmalen Gasse zu erregen, in der sich das Haus des Priesters befand.
Nur einer von ihnen kannte den Weg, n├Ąmlich Takait und als die Br├╝der dem Jungen nachritten, fragte Johann sich, ob dieser nicht der Lockvogel von Wegelagerern war. Zu allem ├ťberfluss wurde es ihm auf dem schwankenden R├╝cken des Dromedars augenblicklich schwindlig und er hoffte inst├Ąndig, dass er sich im Laufe der Reise daran gew├Âhnen w├╝rde, dass Kamele stets Vorder- und Hinterbeine derselben Seite in einer schaukelnden Bewegung gemeinsam vorw├Ąrts setzten. Diese Fortbewegungsart wurde Passgang genannt und mochte f├╝r das Dromedar komfortabel sein, aber Johann h├Ątte den gleichm├Ą├čigen Trab eines Pferdes vorgezogen.
„Wir sind am Ziel“, verk├╝ndete Peter einige Stunden sp├Ąter, auf eine Ortschaft deutend, deren Namen Johann sich gar nicht erst zu merken versuchte, da er ihn unaussprechlich fand.
Der Anblick des trostlosen Marktfleckens am Rand der Sahara gen├╝gte und er hatte genug von der W├╝ste. ├ärmliche, wei├čget├╝nchte H├Ąuser standen ohne erkennbare Ordnung so dich beieinander, dass sie ineinander ├╝bergingen. Wahrscheinlich h├Ątten ihre Besitzer selbst nicht zu sagen vermocht, wem dieser mit S├Ącken vollgestellte H├╝hnerstall oder jener morsche Schuppen eigentlich geh├Ârte. Ein Wanderer h├Ątte kaum seinen Weg durch den Ort zubahnen vermocht, denn so gut wie jeder Zwischenraum war mit Schilfgeflecht, T├╝chern oder Holzbrettern verstellt.
Von hier aus brach also die Karawane zu den Sobek-Oasen auf. Es war ein j├Ąmmerlicher Zug von f├╝nfzehn abgerissenen H├Ąndlern mit doppelt so vielen Kamelen. Dazu kamen Peter, Johann, Takait und weitere vier Kamele, eines von ihnen trug das Gep├Ąck und die gro├če Kiste mit der Mumie.
Ein m├╝rrischer, ├Ąlterer Mann, der wohl f├╝r die H├Ąndler sprach gab ein Kommando und der Junge, den Peter als Dolmetscher angeheuert hatte hielt es nicht f├╝r n├Âtig zu ├╝bersetzen, aber offensichtlich war dies der Befehl zum baldigen Aufbruch.
Die Fracht und ihre Begleiter standen unter dem Schutz von zwei bewaffneten Beduinen, die auch die Karawanenf├╝hrer waren. Johann musterte die gef├Ąhrlich aussehenden Nomaden mit ihren weiten Umh├Ąngen und ihren langen Messern, die in ihren G├╝rtel steckten. Bestimmt geh├Ârten sie zu einem Stamm, der gew├Âhnlich die H├Ąndler ausraubte und nun lie├čen sie sich daf├╝r bezahlen, dass sie diesmal davon Abstand nahmen.
Unter ihren weiten Umh├Ąngen aus naturfarbener Wolle sahen sie alle gleich aus: H├Ąndler, Beduinen und die beiden Fremden. Trotzdem starrten die Einheimischen sie mit unverhohlener Neugier an. Johann fragte sich, was man ihnen erz├Ąhlt hatte, wer sie seien und was sie in den Sobek-Oasen zu suchen hatten.
„Stell dir nur vor, zwei Beduinen st├╝nden bei uns auf dem Marktplatz“, sagte Peter, der offenbar bemerkt hatte, dass sein Bruder ├╝ber die Aufmerksamkeit irritiert war, die man ihm entgegenbrachte. „Wir w├╝rden sie ebenfalls bestaunen.“
„Ich w├╝rde sie nicht so anglotzen!“, beharrte Johann. „Das geh├Ârt sich einfach nicht!“
„Du bist eben aus gutem Hause und dies sind nur einfache Kaufleute und Nomaden“, erwiderte der Bruder lachend.
Als Takait, der kurz abgesessen war an einem der Kaufleute vorbeikam, packte dieser ihn am Ärmel und sagte etwas, was den Jungen wütend machte. Der Kaufmann machte eine mokante Bemerkung und Takait riss sich wieder los. Ohne den Kaufmann eines Blickes zu würdigen bestieg er sein Dromedar und schaute demonstrativ in eine andere Richtung.
„Hast du das gesehen?“, entfuhr es Johann und er suchte Blickkontakt mit dem Bruder.
„Das geht uns nichts an!“ Dies sagte Peter immer, wenn ihm nichts mehr einfiel, aber Johann war ├╝ber die Streitigkeit beunruhigt. Hatte der Kaufmann Takait beschuldigt, ein Handlanger von Wegelagerern zu sein?
Als alle Reisenden ihre Dromedare bestiegen hatten, setzte der Zug sich in Bewegung, angef├╝hrt von den beiden Bewaffneten. Vor Johann ritt ein Kaufmann, hinter ihm Peter, gefolgt von Takait. Johann wunderte sich dar├╝ber, dass zwei Kamele keine Last trugen. Wer wei├č, was die Kaufleute aus von den Oasen zur├╝ckschleppen wollten, Geht mich diesmal wirklich nichts an, dachte er sich, solange es keine Mumien waren. Johann schaute sich – wie er hoffte – unauff├Ąllig nach der angeblichen Kiste mit Lebensmitteln um. Zu seiner Beruhigung fand er sie unversehrt auf dem R├╝cken ihres Lastkamels wieder.
Der Zug folgte einem schmalen Pfad durch die schier endlose W├╝ste, der streckenweise vom Sand verweht und kaum sichtbar war. Die Karawanenf├╝hrer mussten sich am Sonnenstand, an den Strukturen des Sandes und an den Spuren fr├╝herer Karawanen orientieren, da Landmarken in der W├╝ste fast v├Âllig fehlten.
Stoisch setzten die Kamele einen Fu├č vor den anderen. Sie mussten nicht jeden Tag trinken, aber trotzdem bedeutete dies, dass die Karawane auf keinen Fall vom Weg abkommen durften, denn wenn die Kamele verdursteten, dann waren auch die Menschen verloren. Daher mussten in Gewaltm├Ąrschen die wenigen Brunnen erreicht werden, die den Weg s├Ąumten. Der R├╝ckmarsch w├╝rde noch schlimmer werden, denn die vom Hinmarsch bereits geschw├Ąchten Kamele trugen dann als Schmuggelware schwere S├Ącke von Salz zur├╝ck.
Die Sonne brannte ihm gnadenlos auf den Kopf und Johann verstand nun, warum man sich hier in diese weiten Gew├Ąnder h├╝llte. Schon bald war seine Kleidung v├Âllig verschwitzt. Der verdunstete Schwei├č lie├č Salz auf seiner Haut zur├╝ck, und brannte in den Augen. Johann w├Ąre lieber nachts gereist, aber er wagte es nicht sich zu beschweren, zumal er dazu die Hilfe Takaits ben├Âtigt h├Ątte, der offensichtlich ein Schweigegel├╝bte abgelegt hatte. Und noch immer hasste er den schwankenden Gang seines Dromedare, das mit seinem kleinen Kopf auf dem langen Hals hochn├Ąsig auf ihn herabsah, als ob es in seinen Gedanken lesen k├Ânnte, dass er es hasste. Er hatte sich daher noch nicht einmal nach seinem Namen erkundigt.
Johann hatte sich die W├╝ste als ebene Sandfl├Ąche vorgestellt, aber es gab auch ganze Landstriche, die von Ger├Âll bedeckt waren. Gl├╝cklicherweise gaben die mit Schwielen gepolsterten F├╝├če der Kamele sicheren Halt auf schwierigen B├Âden, die den schnelleren Pferden gro├če Schwierigkeiten bereitet h├Ątten.
Dann wieder passierten sie steile Felsen, die aus Schichten unterschiedlicher Farbe bestanden, die Johann an Marmorkuchen erinnerten. Tierisches und pflanzliches Leben schien hier nicht zu existieren. Immer noch ritt Peter hinter ihm und Johann h├Ątte gern mit ihm gesprochen, egal wor├╝ber, aber die Zunge klebte ihm am Gaumen. Auch die anderen Reisenden sagten kein Wort und die Schweigsamkeit Takaits fiel so niemandem auf. In der grenzenlosen Stille schwollen die Ger├Ąusche in den eigenen Ohren zum st├Ârenden Rauschen an.
Manchmal durchquerten sie aber auch D├╝nenlandschaften auf verwehten Pfaden, die nur f├╝r die Beduinen wahrnehmbar waren. Wie das Meer schien sich der Sand in Wellen zu bewegen, aber dies war nur eine Illusion. Die D├╝nen bewegten sich nicht. Sie waren festgefroren wie ein im Eis erstarrter Seegang. Ab und zu durchstie├čen Steine die Oberfl├Ąche, wie Felsen eine gelbe Brandung. An den Abh├Ąngen mancher steiler H├╝gel wuchsen mickrige Palmen. Vertrocknete B├╝sche mit kleinen harten Bl├Ąttern schienen im Sand zu ertrinken.
Endlich kam der Abend des anstrengenden Tages. Schon l├Âste sich der Mond vom Horizont. Es d├Ąmmerte in ├ägypten erschreckend schnell, viel schneller als zuhause. Bald herrschte dunkle Nacht. Auf dem tiefblauen Firmament leuchteten die Sterne mit einer Strahlkraft wie sie Johann niemals zuvor gekannt hatte. Bald war der Mond v├Âllig aufgegangen und in seinem Licht h├Ątte man den Pfad genauso gut oder schlecht finden k├Ânnen wie am Tag. Warum nur setzten sie sich den alles versengenden Strahlen der Sonne aus?
Nachts wurde es unangenehm frisch. Johann hatte auf K├╝hlung gehofft, aber auf diese schneidende K├Ąlte war er nicht vorbereitet. Wieder erwiesen sich die dicken Wollt├╝cher, in die er sich gewickelt hatte als ├Ąu├čerst praktisch. Mittlerweile war es ihm egal, dass sie durchschwitzt waren und stanken.
Endlich gab der Nomade, der den Zug anf├╝hrte das Kommando zum Anhalten. Johann erkannte schnell, warum der Karawanenf├╝hrer sich f├╝r diesen Platz entschieden hatte, denn es gab hier einen Brunnen, der zwischen vertrockneten B├╝schen versteckt war. Johann sa├č mit steifen Beinen von seinem Kamel herab und er h├Ątte schw├Âren k├Ânnen, dass der Boden schwankte. Er konnte jeden einzelnen Knochen in seinem K├Ârper sp├╝ren und die Innenseiten seiner Schenkel brannten wie Feuer.
Peter stand neben ihm, doch keiner von beiden bekam ein Wort heraus, so ersch├Âpft waren sie. Dann gestellte sich Takait zu ihnen und Johann fand, dass der Junge noch viel mitgenommener aussah als Peter. Zwar war Takait zwar relativ gro├č, doch selbst f├╝r einen ├ägypter recht schm├Ąchtig. Er w├╝rde sicherlich keinen sehr brauchbaren Diener abgeben.
Die Kaufleute sprachen offenbar ├╝ber die Fremden, die etwas abseits von ihnen rasteten, denn sie drehten sich immer wieder nach ihnen um, doch wenn sie die Blicke Johanns trafen schauten sie sofort wieder weg. Johann beschloss, sie zu ignorieren, sie mit Verachtung zu strafen, nicht mehr an sie zu denken, doch er war ├╝ber ihr Verhalten verstimmt.
Peter l├Âste den Knoten des Lederriemens, mit dem Decke auf dem R├╝cken seines Reittiers befestigt war, zumindest versuchte er dies, aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Wortlos ging ihm Takait zur Hand. Johann ├Ąrgerte sich zunehmend ├╝ber die Maulfaulheit des angeblichen Dolmetschers, aber Peter schien dies nicht zu st├Âren. Auch war Takait offensichtlich nur der Diener des Bruders, w├Ąhrend er Johann geflissentlich ignorierte.
Die Kaufleute setzen sich in den Windschatten ihrer rastenden Kamele und die beiden Br├╝der taten es ihnen gleich. Johann lie├č sich in den Sand fallen, aber seine wundgescheuerten Beine schmerzten bei jeder Bewegung so stark, dass er das Gesicht verzog.
„Ich habe eine schmerzlindernde Salbe!“, verk├╝ndete eine Knabenstimme.
Johann traute seinen Ohren nicht. Hatte Takait ihn tats├Ąchlich angesprochen? Der Junge kramte eine kleines Messinggef├Ą├č aus seinem Beutel und pr├Ąsentierte es auf der ausgestreckten Hand. Johann massierte sich etwas von der darin enthaltenden wohlriechenden wei├čen Salbe auf die wundgeriebene Haut. Augenblicklich durchstr├Âmte ihn wohlige W├Ąrme, gefolgt von einem Gef├╝hl der Taubheit.
„Danke! Das ist ja das reinste Wundermittel!“, entfuhr es ihm spontan.
Takait err├Âtete, nur ganz leicht, aber Johann entging es nicht. Sofort schaute der Junge in eine andere Richtung.
Einer der Nomaden vergrub neben dem Brunnen Futterreste f├╝r den R├╝ckweg. Dann entz├╝ndeten die Kaufleute ein Lagerfeuer. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit bauten sie einen Ofen aus Glut und Sand, um fladenf├Ârmige Brote zu backen. Der Wind trug den k├Âstlichen Geruch des frischen Backwerkes durch das Lager. Erst jetzt bemerkte Johann, wie hungrig er war.
„Sie werden uns doch wohl etwas abgeben?“, sagte Peter zu Takait. Er war un├╝berh├Ârbar, dass er ver├Ąrgert war. „Schlie├člich haben wir f├╝r unsere Verpflegung gezahlt.“
Takait nickte und ginge zu den H├Ąndlern. Einer von ihnen redete heftig auf den Jungen ein. Dieser machte eine abwehrende Handbewegung. Was hatte dies zu bedeuten? Wollte man sie kaltbl├╝tig verhungern lassen?
Der ├Ąltere Beduine stand auf und sprach ein Machtwort. Mit sichtbaren Widerwillen lie├čen die H├Ąndler zu, dass Takait drei Teller mit Brot und Gem├╝se belud. Mit vorsichtigen Schritten und erstaunlich behenden Bewegungen trug der Junge die Teller zu den Reisegef├Ąhrten.
„Die Kaufleute sagen, dass man ihnen nichts f├╝r unsere Verpflegung bezahlt hat“, erkl├Ąrte Takait mit bedauerndem Gesichtsausdruck.
„Aber…“
„Der Wirt, der euch abkassiert hat, hat euch offensichtlich betrogen“, unterbrach Takait Peter, der emp├Ârt aufgesprungen war, „der Karawanenf├╝hrer hat den Kaufleuten befohlen, mit uns zu teilen, aber ihr m├╝sst ihnen als Gegenleistung einige Denare geben.“
„Wir haben keine andere Wahl“, sagte Johann beschwichtigend zu dem sichtlich w├╝tenden Peter, denn er bef├╝rchtete, der Br├╝der k├Ânnte ihn aus Prinzipienreiterei hungern lassen. „Wir m├╝ssen ihnen daf├╝r dankbar sein, dass sie uns etwas abgeben. Schlie├člich waren wir nicht eingeplant und die Ration ist ohnehin schon knapp.“
„Wahrscheinlich hast du Recht, aber….“
Der Satz blieb unbeendet, da Peter herzhaft in ein St├╝ck Brot biss, das Takait ihm in die Hand gedr├╝ckt hatte. Auch der Junge und Johann machten sich mit gro├čem Appetit ├╝ber das karge Essen her. Die drei verschlangen in kurzer Zeit alles, was man f├╝r sie abgezweigt hatte.
„Ich will mich nicht jeden Abend herumzanken m├╝ssen“, sagte Peter, w├Ąhrend er sich den Mund am ├ärmel seines Gewandes abwischte und er gab Takait eine Handvoll M├╝nzen. „Das sollte f├╝r den Rest der Reise reichen!“
Takait ging zu den anderen zur├╝ck und ├╝berreichte dem Anf├╝hrer der Kaufleute das Geld. Johann registrierte mit Missfallen, dass der Junge anschlie├čend nicht zu ihnen zur├╝ckkehrte, sondern den H├Ąndlern Gesellschaft leistete. Wieder stritt er sich mit einem der Kaufleute – Johann vermochte nicht zu sagen, ob es wieder derselbe war, denn er konnte sie nicht unterscheiden - aber diesmal einigten sie sich. Jedenfalls herrschte nach kurzer Zeit wieder Ruhe.
Noch immer Johann traute Johann Takait nicht ├╝ber den Weg. Er beobachtete den Jungen noch eine Weile aus dem Augenwinkel, konnte aber nichts Verd├Ąchtiges feststellen. Schlie├člich gab er auf und legte sich hin, in der Hoffnung etwas Schlaf zu finden. Vom anderen Ende des Lagers drang eine leise Unterhaltung mit ged├Ąmpfter Stimme zu ihm, aber Johann konnte zu seinem Bedauern nicht heraush├Âren, ob Takait darin verwickelt war.
In der Nacht kam ein scharfer Wind auf, der die n├Ąchtliche K├Ąlte noch unertr├Ąglicher machte. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht waren in der Sahara sehr gro├č, was daran lag, dass es keinerlei Vegetation oder Geb├Ąude gab, die die W├Ąrme speicherten. Zitternd erwartete Johann den Morgen, v├Âllig ersch├Âpft, doch zu aufgew├╝hlt um zu schlafen. Er verfluchte die K├Ąlte und wusste doch, dass er bald wieder unter der Hitze leiden w├╝rde. Rauch stieg in der Ferne auf. Offensichtlich befand sich dort ein Lager der Beduinen und Johann hoffte, dass sie keine R├Ąuber waren.
Als endlich der Sonnenaufgang die erste Nacht in der W├╝ste beendete, war der Karawanenpfad v├Âllig verweht, aber der Nomade, der den Zug anf├╝hrte ritt ohne das geringste Zeichen von Unsicherheit voran. Von Zeit zu Weit erkannte Johann im Sand den Abdruck eines Hufs. Dies waren die einzigen Hinweise darauf, dass sie nicht ziellos durch das Sandmeer irrten.
Eine bleierne M├╝digkeit ├╝berfiel ihn, die im Lauf des Tages immer st├Ąrker wurde. Die schlaflose Nacht forderte unerbittlich ihren Tribut. Langsam verschwommen der Sand und die glei├čende Sonne am Himmel zu einem einzigen, blassen Licht.
Sein Dromedar stolperte ├╝ber etwas halb vom Sand Bedecktes und Johann w├Ąre vor Schreck fast aus dem Sattel gefallen, zumal er vor sich hinged├Ąmmert hatte und der Sto├č ihn unsanft in die raue Realit├Ąt zur├╝cktransportiert hatte. Er sa├č ab, da er hoffte einen vergrabenen Schatz gefunden zu haben, aber er musste feststellen, dass es nur der von der Sonne gebleichte Sch├Ądel eines gro├čen Tieres war, wohl eines B├╝ffels oder eines Kamels.
Der Karawanenf├╝hrer rief ihm aus der Ferne einige unfreundliche Worte zu und Johann musste sich nicht an Takait wenden, um zu verstehen, dass er daf├╝r ger├╝gt wurde, dass er abgesessen war. Mit einem leisen Fluch hievte er sich wieder auf sein Dromedar.
Das von hohen Felsw├Ąnden begrenzte Tal, dem die Karawane schon seit einer Stunde folgte wurde immer enger. Hoffentlich besa├č diese Schlucht einen Ausgang und, wenn ja: Hoffentlich lauerten dort nicht die Wegelagerer, denen die Karawanenf├╝hrer zuarbeiteten! Johann jedenfalls erschien das zunehmend schmaler werdende Tal mittlerweile als t├Âdliche Falle.
Einer der Kaufleute rief den anderen etwas zu. Seine Worte wurden verst├Ąrkt und verzerrt von den Felsw├Ąnden als schauriges Echo zur├╝ckgeworfen. Dann h├Ârte Johann aus dem Ende des Tals ein lautes Brummen. Die T├Âne waren so tief, dass sie das Zwerchfell vibrieren lie├čen. Wie auf Kommando z├╝gelten die Kaufleute ihre Kamele und die ungeduldigen Beduinen mussten sich f├╝gen. Johann schaute sich nach allen Richtungen um, konnte aber den Ursprung der ihn beunruhigenden Ger├Ąusche nicht ausmachen.
„Was um Gottes Willen ist das?“, rief er Takait zu.
Obwohl das Kamel des Jungen nicht weit von seinem eigenen Reittier entfernt hochm├╝tig ├╝ber die K├Âpfe der Kaufleute hinwegschaute, musste Johanns schreien um sich verst├Ąndlich zu machen, da die Ger├Ąusche mittlerweile zu einem Brummen angeschwollen waren, das vage an ein Nebelhorn erinnerte. Ein Brausen, ein St├Âhnen und ├ächzen, ein unbeschreibliches Gemisch aus Lauten bet├Ąubte die Ohren.
Takait ritt zu Peter und fl├╝stert ihm etwas ins Ohr. Trotz der flimmernden Luft war es un├╝bersehbar, dass Peter ihn zuerst sorgenvoll anschaute. Dann hellte sich sein Gesicht auf und er schmunzelte und sch├╝ttelte schlie├člich lachend den Kopf.
„Das sind angeblich die W├╝stend├Ąmonen. Ihretwegen wagt sich niemand allein in die W├╝ste“, rief er dem Bruder zu, „Es ist so selten, dass man sie h├Ârt, dass man ihrem Erscheinen eine besondere Bedeutung beimisst. Die Kaufleute f├╝rchten jetzt, dass bald etwas Schreckliches passiert.“
„Warum bin ich nicht zu Hause geblieben!“, entfuhr es Johann, der diese Prophezeiung gar nicht gern h├Ârte.
Peter verdrehte enerviert die Augen.
„Denk dran: Du hattest diese schrecklichen Alptr├Ąume! Anderenfalls s├Ą├čen wir jetzt gem├╝tlich zu Hause und w├╝rden darauf warten, dass Wilhelm aus K├Ânigsberg zur├╝ckkehrt!“
Das Brummen verwandelte sich in ein St├Âhnen, das ├╝ber sie hinwegfegte. Johann zog automatisch den Kopf ein, aber er versp├╝rte nicht den geringsten Hauch. Ihm schauderte vor dem unerkl├Ąrlichen Ph├Ąnomen. Auch die Kaufleute wirkten aufgebracht und ├Ąngstlich. Sie steckten die K├Âpfe zusammen und tuschelte leise miteinander. Einer von ihnen redete heftig gestikulierend auf die anderen ein. Dann drehten sie sich alle nach den Fremden um. Der ├Ąltere der beiden Beduinen, die bisher unger├╝hrt etwas abseits gewartet hatten, gab das Zeichen zum Aufbruch und die Karawane machte sich etwas z├Âgerlich wieder auf den Weg.┬á
Wenige Minuten sp├Ąter sah Johann auf einer Steinwand die blassen Umrisse von schemenhaften Tieren mit langen H├Ąlsen, die wie Giraffen aussahen und von Menschen, die in einem See schwammen. Was hatte das zu bedeuten? Auch die ├ägypter wunderten sich ├╝ber die Bilder. Jedenfalls blieben die Kaufleute vor den eingeritzten Zeichnungen erneut stehen und diskutierten laut untereinander. Die Beduinen hingegen straften diesmal sowohl die Zeichnungen als auch die aufgeregten Kaufleute mit Missachtung und ritten weiter durch die Schlucht.
Takait tuschelte schon wieder mit Peter.
„Diese Bilder haben die D├Ąmonen hinterlassen“, sagte dieser dann mit einem am├╝sierten L├Ącheln zu seinem Bruder.
Auch Johann fand diese Erkl├Ąrung ziemlich kurios. Offenbar machten die Einheimische die armen D├Ąmonen f├╝r alles verantwortlich, f├╝r das man keine andere Erkl├Ąrung fand.
„Kultivierte D├Ąmonen gibt es hier“, rief er dem Bruder zu, „sie musizieren und malen, nur seltsam, dass sie sich nicht sehen lassen!“
Takait sah ihn erschrocken an und sch├╝ttelte dann missbilligend den Kopf.
„Wahrscheinlich solltest du mit deinen l├Ąsterlichen Kommentaren nicht das Schicksal herausforderst“, erkl├Ąrte Peter, aber Johann bezweifelte, dass der Bruder dies ernst meinte.
Endlich setzte die Karawane ihren Weg fort und die Kamelreiter mussten sich beeilen, um die Beduinen wieder einzuholen, die einen gro├čen Abstand von der restlichen Karawane gewonnen hatte.
Nach circa einer halben Stunde war der Spuk endlich vorbei. Die D├Ąmonen haben sich heiser gebr├╝llt, dachte Johann als wieder Stille herrschte.
Langsam weitete sich das enge Tal: Die Felsen wurden niedriger und ihr Abstand voreinander gr├Â├čer, aber dies machte den Ritt auch nicht komfortabler, denn der Wind, der den Reisenden schon Beginn der Reise zugesetzt hatte, nahm kontinuierlich zu. Johann zog sich einen Zipfel seines Umhanges ├╝ber das Gesicht, sodass nur noch die Augen herausschauten. Er bek├Ąmpfte den Impuls die Lider zu schlie├čen, so qu├Ąlend war der hei├če Wind, der ihm Sand in die Augen wehte.
Dann waren vom Felsmassiv nur noch einzelne Gesteinsbrocken ├╝brig geblieben. Den Pfad s├Ąumten riesige Sandsteins├Ąulen, -bogen und bizarre Formen aus Stein, manche erinnerten an Tiere, Johann bemerkte kaum noch, da seine nunmehr schon chronische Ersch├Âpfung ihn apathisch gemacht hatte.
Abends erfuhr er von Peter, dass man am n├Ąchsten Tag eine kleine Oase erreichen w├╝rde, aber leider keine der Oasengruppe mit dem komischen Namen, die ihr Ziel war. Johann ├Ąrgerte sich, dass Takait diese Neuigkeiten nur an Peter weitergegeben hatte.
Nach einer eisigen Nacht machten am folgenden Morgen selbst die Kamele einen ziemlich abgek├Ąmpften Eindruck. Apathisch und mit gesenktem Kopf setzen sie einen Fu├č vor den anderen. Nur mit letzter Kraft erreichten sie die rettenden Weiden.
Als die Karawane in Sichtweite der Oase gelangte, erklangen Rufe vom Rand der Ansiedlung her. Alle Torfl├╝gel wurden ge├Âffnet. In T├╝cher geh├╝llte Jungen liefen ihnen entgegen, denn die Bewohner hatten bereits ungeduldig das Eintreffen der Kaufleute erwartet, da sie auf das mitgef├╝hrte Getreide lebensnotwendig angewiesen waren.
Den Kindern folgten der Dorf├Ąlteste und sein Sohn. Sie waren beide schwarzhaarig, der eine gro├č und schlank, der andere untersetzt und etwas kleiner. Der Vater st├╝tzte sich auf einen langen Stab, der aber eher Hoheitszeichen als Gehhilfe war.
Der Dorf├Ąlteste begr├╝├čte die Karawanenf├╝hrer und die Kaufleute folgten ihm in die Oase. Dabei warfen sie den beiden Br├╝dern von Zeit zu Zeit skeptische Seitenblicke zu.┬á Einer der Nomaden blieb stehen und blickte mit zusammengekniffenen Augen in die W├╝ste. Johann versuchte zu erkennen, was sein Interesse erregt hatte, aber zuerst sah er nur Sand, der vom Wind aufgewirbelt wurde: Eine Staubwolke n├Ąherte sich rasch aus der Ferne. Umrisse sch├Ąlten sich aus der flimmernden Luft, formten sich zu einem wei├čen Pferd, dessen Reiter in feinere Gew├Ąnder geh├╝llt war als sie die Dorfbewohner trugen. Er hatte eine Gazelle erbeutet, die quer ├╝ber den R├╝cken seines Pferdes gelegt war. Der Reiter ┬ásteuerte das gr├Â├čte Anwesen des Dorfes an und w├╝rdigte Kaufleute, Beduinen und Fremde im Vorbeireiten keines Blickes. Mit einem lauten Knall schloss sich das messingbeschlagene Hoftor hinter ihnen.
Die restliche Siedlung bestand aus Lehmbauten, von denen kein anderes auch nur ann├Ąhernd die Gr├Â├če des Anwesens erreichte, in dem der Scheich – oder was auch immer der korrekte Titel des J├Ągers sein mochte - verschwunden war. Fast fensterlose H├Ąuser s├Ąumten einen winzigen Platz, ├╝ber den man, als Schutz gegen die Hitze Palmwedel gelegt hatte. Wieder gab es fast keine Freifl├Ąchen, da die Geb├Ąude ineinander ├╝bergingen, wenn auch der Gesamteindruck nicht ganz so chaotisch war wie in dem Kaff, aus dem die Karawane aufgebrochen war. Dies lag aber auch daran, dass das Dorf noch kleiner war.
Wenigstens gab es einen kleinen Bau mit Innenhof, der als Karawanserei diente und Johann erschien die Aussicht unter einem Dach zu schlafen, als schierer Luxus. Nachdem die Kamele versorgt waren, tauschten die Bauern das Getreide, das die H├Ąndler hertransportiert hatten gegen Oliven, Datteln und Salz ein, das sie aus komplizierten Salinen gewonnen hatten. Auch im Ackerbau nutzten sie geschickt jede Elle des fruchtbaren Bodens, indem sie die Pflanzen in mehreren Stockwerken ├╝bereinander angebauten. In der untersten Ebene wuchs Gem├╝se, in der zweiten Feigen und in der dritten die alles ├╝berragenden Dattelpalmen, deren Fr├╝chte das Grundnahrungsmittel der Bauern waren.
W├Ąhrend Johann dem Tauschhandel zusah, lie├č er Takait nicht aus den Augen, da er den Eindruck hatte, dass der Junge mit den Kaufleuten etwas ausheckte, doch da die Worte der fremden Sprache an ihm vorbeirauschten wie ein Sommerregen blieb es bei einem vagen Verdacht. Peter w├╝rde ihn auslachen, wenn er ihn darauf anspr├Ąche. Also verlor Johann kein Wort ├╝ber den verd├Ąchtigen Dolmetscher.
Leider blieben sie nur eine Nacht in der Oase. Wahrscheinlich konnten deren Bewohner nicht l├Ąnger neunzehn hungrige M├Ąnner bewirten und ihre Dromedare mit Wasser und Heu versorgen.
Die sechste Nacht der Reise war halb vorbei als Johann von leisen Stimmen und halb unterdr├╝ckten Gel├Ąchter erwachte. Er rollte sich zur Seite und zog die Decke ├╝ber sich. Seine Augen taten ihm weh und er hatte Kopfschmerzen, seine Kehle f├╝hlte sich trocken an. Er erinnerte sich, dass er schon wieder von der Unterwelt getr├Ąumt hatte, aber gl├╝cklicherweise erinnerte er sich nicht an mordl├╝sterne Schatten. In der Hoffnung, wieder einzuschlafen drehte er sich auf seinem harten Lager um.
Der Morgen tauchte die W├╝ste in eine ganze Palette von Rosat├Âne und die Karawane brach trotzt starken Windes in aller Herrgottsfr├╝he auf. Gegen Mittag wurde am Horizont eine hohe Sands├Ąule sichtbar. Sie drehte sich gro├čer Geschwindigkeit um ihre eigene Achse und Johann meinte ein finsteres Gesicht mit einer Kapuze im wirbelnden Sand zu sehen, dann eine Hand, die ein riesiges Schwert schwang. Unerbittlich kam der Sand┬á immer n├Ąher. Es gab keine M├Âglichkeit, dem Sturm auszuweichen ohne vom Pfad abzukommen. Tatenlos mussten die M├Ąnner zusehen wie die Sands├Ąule mit rasender Geschwindigkeit herankam. Der aufgewirbelte Sand verdunkelte bald die Sonne und die Zeit schien stillzustehen. Peter rief Johann etwas zu, doch es ging im Brausen des Sturmes unter. Takait schwieg wie immer, aber es war ein sehr beredtes Schweigen, denn seine Augen verrieten seine Angst.
Alle, Kaufleute und Nomaden sprangen von ihren Reittieren und warfen sich auf den Boden. Ein Dromedar legte seinen Kopf in den Nacken und stie├č einen klagenden Schrei aus. Ein anderes Tier antwortete vom anderen Ende des provisorischen Lagers ├╝ber die kleine Reisegruppe hinweg und Johann hoffte inst├Ąndig, dass die Kamele nicht von der Panik ergriffen wurden und in die W├╝ste davonliefen.
Wie eine Feuerwalze zog der wirbelnde Sand bald ├╝ber die am Boden Liegenden hinweg. Die Sandk├Ârner drangen durch die Begrenzungen ihrer Kleidung, sie legten sich auf ihre Kopfhaut und Johann hoffte, dass er nicht lebendig begraben w├╝rde. Niemand w├╝rde jemals hier nach ihnen suchen und die Sahara w├Ąre ihr Grab.
Gl├╝cklicherweise war der ganze Spuk aber schon nach wenigen Minuten wieder vorbei. Die M├Ąnner waren von einer zentimeterdicken Sandschicht bedeckt, aber sie konnten sich - wenn auch m├╝hsam - wieder aus dem Sand befreien. Die W├╝ste lag vor ihnen in zeitloser Majest├Ąt, als ob es niemals gest├╝rmt h├Ątte. ├ťber ihnen w├Âlbte sich der azurblaue Himmel, vor ihnen durchbrachen einzelne Steine die Sandfl├Ąche, wie Felder einer K├╝ste ohne Meer.
Johann sch├╝ttelte den Sand von seinem Gewand, aber er f├╝hlte sich noch immer, als bef├Ąnde sich die halbe Sahara in seiner W├Ąsche und seinen Schuhen. Dann schaute er sich nach seinen Reisegef├Ąhrten um. Erleichtert sah er seinen Bruder, der sich die Augen rieb und da war auch Takait, dessen Gewand der Sturm zerrissen hatte, aber der Junge schien wohlauf zu sein. Johann stutzte einen Augenblick, so erstaunt war er dar├╝ber, was er sah. Zuerst traute er seinen Augen nicht. Dann war ihm alles klar.
„Du bist ein M├Ądchen!“, entfuhr es ihm v├Âllig verbl├╝fft.
Takait stie├č einen nur m├╝hsam unterdr├╝cken Schrei aus und drehte sich augenblicklich um, wie ein Kind, das glaubt, dass es unsichtbar ist, wenn es die Augen schlie├čt.┬á
„Sprich nicht so laut“, tadelte ihn Peter. „Selbstverst├Ąndlich ist Takait ein M├Ądchen. Mich hat ziemlich gewundert, dass du dies nicht gleich auf den ersten Blick bemerkt hast.“
„Warum …?“
┬á„Ich hielt es f├╝r sicherer, sie w├Ąhrend der Reise in M├Ąnnerkleider zu stecken.“
Johann ├Ąrgerte sich ├╝ber die Geheimniskr├Ąmerei des Bruders.
„Aber mich h├Ąttest du doch wenigstens einweihen k├Ânnen!“, protestierte er.
„Je weniger ein Geheimnis kennen, desto besser ist es geh├╝tet“, erwiderte der Bruder in einem entschuldigenden Tonfall. „Ich hatte Angst, du k├Ânntest dich verplaudern!“
Johann verstand gar nichts mehr. Sein Bruder konnte doch nicht allen Ernstes vermuten, dass einer dieser zwielichtigen H├Ąndler oder gar einer der Beduinen deutsch sprach?
„Niemand spricht hier unsere Sprache!“, fuhr er den Bruder an, „Wem, um Gottes Willen sollte ich etwas Falsches erz├Ąhlen k├Ânnen?“
Peter sah ihn skeptisch von der Seite an.
Johann sp├╝rte, wie ├ärger in ihm aufstieg. Hatte Peter bef├╝rchtet, er w├╝rde versuchen mit dem M├Ądchen anzubandeln? Wohl kaum, denn er behandelte ihn immer als ob er ein Kind sei. Das traute er ihm bestimmt nicht zu. Johann schob diesen unangenehmen Gedanken beiseite und rappelte sich auf, da die Kaufleute bereits damit besch├Ąftigt waren, ihre Ware auf Sch├Ąden zu ├╝berpr├╝fen.
Auch Takait hatte sich wieder gesammelt und vor allem hatte sie sich wieder verh├╝llt. Offensichtlich hatte sie mehrere Gew├Ąnder in ihrem Gep├Ąck. Johann ging zu ihr und als er sie aus der N├Ąhe sah ├Ąrgerte er sich ├╝ber sich selbst, dass er ein so schlechter Beobachter gewesen war. Wie konnte er Takait nur die ganze Zeit f├╝r einen Jungen gehalten haben? Es war doch ganz offensichtlich, dass ein M├Ądchen vor ihm stand, ein ziemlich h├╝bsches obendrein. Die einzige Entschuldigung f├╝r dieses ansonsten unverzeihliche Malheur war, dass Takait ihr Haar kurz geschoren trug.
„Warum du dich uns angeschlossen?“, fragte er sie, „du bist doch bestimmt von zu Hause ausgerissen!“
Takait schaute ihn mit einem schwer zu deutenden Gesichtsausdruck an und Johann stellte fest, dass sie ├Ąlter war als er sie - in der Annahm, dass sie ein Jungen sei - eingesch├Ątzt hatte. Sie musste mindestens achtzehn Jahre alt sein.
„Meine Familie wollte mich wider meinen Willen verheiraten.“
„Habe ich es nicht gesagt!“, sagte Johann triumphierend und drehte sich zu Peter um.
„Ich glaube, das geht uns nicht an“, erwiderte der Bruder, aber sein Gesichtsausdruck strafte seine Worte L├╝gen, „au├čerdem sind wir selbst doch in gewisser Weise von zu Hause ausgerissen.“
Bestimmt reist sie unter einem falschen Namen!, durchfuhr es Johann einen Augenblick sp├Ąter.
„Wie hei├čt du eigentlich wirklich?“, fragte er Takait daher. ┬áAm liebsten h├Ątte er sie nach ihren Papieren gefragt.
„Takait“, antwortete das M├Ądchen mit einem unwiderstehlichen L├Ącheln, „das ist ein Frauenname.“┬á
„Und was bedeutet er?“, wollte Johann wissen, dem spontan das lateinische Zitat nomen es omen in den Sinn kam, aber einer der Nomaden fuhr das M├Ądchen im gleichen Augenblick unfreundlich an.
„Er sagt, wir sollen uns gef├Ąlligst etwas beeilen. Der Marsch geht gleich weiter“, ├╝bersetzte Takait.
„Das habe ich auch so verstanden“, brummte Johann und m├╝hsam, wie ein alter Mann erklomm erhob er sich vom Boden.
„Mein Name bedeutet ├╝brigens die Hochgewachsene. Ich trage ihn, weil ich gr├Â├čer als die meisten ├ägypterinnen bin“, erkl├Ąrte Takait, bevor sie ihre Aufmerksamkeit ihrem Kamel zuwandte.
Ein dicker Kaufmann beobachtete sie von hinten mit einem h├Ąmischen Gesicht. Ob auch er hinter ihr Geheimnis gekommen war? Er machte eine abf├Ąllige Bemerkung und sie reagierte ziemlich unfreundlich, aber dies war nichts gegen den Tonfall des Nomaden, als er beide nochmals zum Aufbruch aufforderte.
Die Karawane setzte sich also wieder in Bewegung und noch zwei Tage vergingen wie gewohnt: Gewaltm├Ąrsche in der brennenden Sonne wechselten sich ab mit bitterkalten N├Ąchten. Immer wieder suchte Johanns Blick Takait, die sich offenbar hinter Peter zu verstecken suchte. Jedenfalls folgte sie ihm stets wie ein Schatten, w├Ąhrend sie Johann konsequent ignorierte und jeden Blickkontakt mit ihm vermied.
Wieder sah Johann nachts in der Ferne Lagerfeuer brennen und noch immer gab jemand Signale. Von Nacht zu Nacht wurden es mehr Rauchzeichen. Johann war mittlerweile zu ersch├Âpft, um sich gro├če Gedanken zu machen, doch tief im Inneren arbeitete es in ihm: Was waren dies f├╝r Nomaden, die jeden ihrer Schritte ├╝berwachten? Ob sie die Sp├Ąher der Oasenbewohner waren? Was mochte sie wohl an ihrem Ziel, der merkw├╝rdigen ersten Sobek-Oase erwarten?┬á Und dieses seltsame M├Ądchen, auf wessen Seite mochte es stehen? Auf seiner jedenfalls nicht, soviel stand fest.
Dann kam endlich der letzte Tag der Reise. Seit dem sp├Ąten Vormittag waren sie auf ihren Kamelen ├╝ber eine Art Hochplateau geritten. Das monotone Schaukeln und Schwanken hatte Johann tr├Ąge gemacht und die Augen waren ihm vor M├╝digkeit zugefallen. Er schreckte mit einem unterdr├╝ckten Fluch aus seinem Halbschlaf auf, als sein Kamel so abrupt stehen blieb, dass er aufwachte. Er ├Âffnete die schweren Lider und war ├╝berw├Ąltigt ├╝ber den unerwarteten Anblick, der sich ihm bot: Sein Reittier stand n├Ąmlich am Rand einer mehrere hundert Fu├č tief abfallenden Felsstufe. Im Tal sah er – in sch├Ąrfstem Kontrast zum Ockergelb der umgebenen Sandw├╝ste - das saftige Gr├╝n von Palmhainen unter glasklarem Himmel.
In der Mitte der Oase befand sich eine Ansiedlung, dahinter eine niedrige Pyramide, ein breitgelagertes Geb├Ąude und ein alt├Ągyptischer Tempel. Seine hohen Umfassungsmauern und seine zwei turmartigen Pylonen, die den Haupteingang flankierten, waren weithin sichtbar. Sie waren ein Hinweis darauf, dass die erste Sobek-Oase in der Antike nicht nur ein Handelsplatz der Nomaden gewesen war, die schon damals hier einen regen Tauschhandel praktizierten, sondern auch ein religi├Âses Zentrum. Die Geb├Ąude, die aus der Pharaonenzeit stammen mochten waren verbl├╝ffend gut erhalten.
Dann sah Johann etwas, das ihn einen Augenblick lang an seinem Verstand zweifeln lie├č, denn er erkannte in der Tiefe eine Prozession die sich den Tempel zubewegte. Es mochten etwa f├╝nfzig M├Ąnner und Frauen sein und sie trugen in ihrer Mitte eine gro├če, bunt bemalte Statue. Wurde dieser ├Ągyptische Tempel am Ende noch von den Heiden benutzt? Gab es hier tats├Ąchlich noch Anh├Ąnger der ├Ągyptischen Religion? Johann war davon ausgegangen, dass die Einwohner des Landes alle Mohammedaner waren, nat├╝rlich abgesehen von den Kopten, die nur eine Minderheit waren.
„Wusstest du, dass es hier noch wie in der Antike hergeht?“, rief er v├Âllig verbl├╝fft dem Bruder zu.
„Priester Menas und Takait haben mir davon berichtet“, antwortete Peter, auch er wirkte wie vom Donner ger├╝hrt, „aber ich habe immer geglaubt, dass sie ma├člos ├╝bertreiben.“
„Wenn wir das zuhause erz├Ąhlen, dann glaubt uns das kein Mensch“, entfuhr es Johann.
 
Menas
10. Menas
Als Johann die Hotelt├╝r ├Âffnete, schlug ihm die Hitze wie ein warmes Brett entgegen. Kein vern├╝nftiger Mensch l├Ąuft freiwillig bei diesem Wetter drau├čen herum, dachte er, aber immer noch besser als allein im Hotelzimmer zu sitzen um die Mumie zu bewachen. Er versp├╝rte einen scharfen Schmerz auf der linken Hand, den der Stich einer M├╝cke verursacht hatte und schlug mit einem leisen Fluch nach dem Insekt, aber er war zu langsam um den Plagegeist zu erschlagen.
Vor dem Hotel kam ihm auf der Stra├če ein junges englisches Paar entgegen, das er vom Sehen her kannte: Ein hagerer Kaufmann und das dunkelhaarige M├Ądchen, das der Bruder auf dem Schiff immer angestarrt hatte, wenn er sich unbeobachtet w├Ąhnte. Ihnen folgte eine resolute Dame, nach der Familien├Ąhnlichkeit zu schlie├čen die Mutter des M├Ądchens. War es wirklich ein Zufall, dass sie offenbar im gleichen Hotel abgestiegen waren wie er? Vielleicht hatte Peter doch Recht mit seiner Bef├╝rchtung gehabt, dass der Geheimdienst sich f├╝r sie interessieren k├Ânnte.
Als ihre Wege sich kreuzten, erwiderte die drei ehemaligen Reisegef├Ąhrten h├Âflich Johanns Gru├č und er rief sich ins Ged├Ąchtnis, dass es - laut┬á Major Wallace - nicht viele┬á Hotels in Alexandria gab, die f├╝r Ausl├Ąnder geeignet waren. Wahrscheinlich befanden sich im Alexander the Great noch mehr bekannte Gesichte und dies machte die Frage noch dringlicher, wer w├Ąhrend ihrer Abwesenheit die Kiste mit der Mumie im Hotelzimmer verschoben hatte. Das Personal konnte man sicherlich aus dem Kreis der Verd├Ąchtigten ausschlie├čen, denn es war – bei dieser Hitze –viel zu tr├Ąge dazu.
Denk lieber nicht dar├╝ber nach, sagte sich Johann, sondern versuche den l├Ąstigen Weg zur Kirche so schnell wie m├Âglich hinter dich zu bringen, zumal es mittlerweile noch unertr├Ąglicher stinkt als zwei Stunden zuvor. Dies lag bestimmt an den vielen Kamelen, Maultieren und Eseln, die Stra├čen, Gassen und Pl├Ątze bev├Âlkerten, aber gegen diese Tiere hatte Johann eigentlich nichts, im Gegensatz zu der Schwadron von Fliegen und M├╝cken, die ihn mittlerweile umkreisten wie die Planeten die Sonne.
Johann schlug im Gehen nach ihnen, bis seine Kleidung v├Âllig verschwitzte war. Jetzt wei├č ich, warum man den Teufel hier „Herr der Fliegen“ nennt, murmelte er vor sich, dann gab er resigniert die Gegenwehr auf. Er ├╝berquerte er die Stra├če und begab sich in das Gewirr der Altstadt. Aus einem Haus drang eine exotische Musik, die filigran, aber seltsam dissonant war. Ein Saiteninstrument gab den Takt an und eine weibliche Stimme sang dazu mit klagender Stimme und obwohl Johann kein Wort verstand meinte er zu begreifen, wovon das Lied handelte. Bestimmt lamentierte die Frau dar├╝ber, dass ihr Geliebter fern von ihr als Kaufmann fremde L├Ąnder bereiste.┬á
Johann bedauerte die Stimme bald nicht mehr zu h├Âren, da er sich zu weit von dem Haus entfernt hatte, in dem musiziert wurde, aber wenigstens wurde er diesmal nur ab und zu von Bettlern bel├Ąstigt, wahrscheinlich, weil er zielstrebig und ohne nach rechts oder links zu sehen voranschritt. Ihre z├Âgerliche Gangart hatte die Br├╝der wohl bei ihrer letzten Exkursion zur Zielscheibe f├╝r s├Ąmtliche Bettler Alexandrias gemacht.
Schon hatte Johann das Portal, das von dem kriegerischen Neger bewacht wurde passiert und vor ihm lag die Kreuzung, hinter der sich die koptische Kirche befand, als er einem kleinen Hof vorbeikam, auf dem sich zahlreiche M├Ąnner versammelt hatten und er fragte sich, was da wohl los sein mochte. Beim N├Ąherkommen sah Johann, dass die Menge um einen Geschichtenerz├Ąhler versammelt war. Er thronte auf einem reich verzierten Stuhl im Schatten eines Hauses. Neben ihm sa├č auf einem einfacheren Stuhl ein Musiker, der seinen Vortrag auf einem Saiteninstrument begleitete, das Johann nicht kannte. Der Erz├Ąhler war ein alter, magerer Mann mit d├╝rrem Bart, goldenen Ohrringen und gro├čem Turban. Seine Stimme war sonor, aber er sprach so schnell, dass es Johann ganz schwindlig wurde. Auch waren die vielen Kehllaute der arabischen Sprache f├╝r seine europ├Ąischen Ohren ├Ąu├čerst gew├Âhnungsbed├╝rftig. Was mochte der alte Mann wohl erz├Ąhlen? Vielleicht ein M├Ąrchen, wie die Geschichte von Sindbad dem Seefahrer oder die Geschichte einer ungl├╝cklichen Liebe?┬á┬á┬á
Johann unternahm einen halbherzigen Versuch, den Anblick der pittoresk gewandeten Menschen zu genie├čen, denn er hatte sich in der Warteschlange vor dem Zoll geschworen, den Aufenthalt in ├ägypten als Urlaubsreise zu betrachten, falls es ihnen nur gelingen sollte, die Mumie ins Land zuschmuggeln, aber es wollte ihm nicht gelingen. Zwar hatte die Szenerie unbestreitbar etwas von Tausendundeiner Nacht, aber in Johanns Augen sahen die dunkelh├Ąutigen, vermummten Gestalten mit ihren Krummdolchen in den G├╝rteln wie Stra├čenr├Ąuber oder Raubm├Ârder aus. Wie mochte er selbst in seiner europ├Ąischen Kleidung ihnen erscheinen?
Johann sagte sich, dass mit etwas Gl├╝ck einer der Zuh├Ârer Menas kannte oder vielleicht sogar wusste, wo er sich gerade aufhielt. Schlie├člich befanden sie sich fast in Sichtweite der Himmelfahrtskirche. Einige Augenblicke lang blieb Johann z├Âgernd stehen, denn selbst zu Hause sprach er nur ungern Fremde an. Au├čerdem bezweifelte er, dass einer der ├ägypter Englisch sprach. Dann gab er sich innerlich einen Ruck, da er wusste, dass dies wahrscheinlich die einzige M├Âglichkeit war, den Priester doch noch zu finden.
„Entschuldigen Sie Sir, kennen Sie zuf├Ąllig den Priester Menas?“, fragte er einen vornehm gekleideten Mann mittleren Alters, da dieser etwas abseits von der Menschenmenge stand.
Der Mann blickte Johann einen Augenblick lang so perplex an, als ob er noch nie einen Europ├Ąer gesehen h├Ątte. Dann ├╝bersch├╝ttete er ihn mit einem von ausdrucksvollen Gesten begleiteten Redeschwall, den Johann nicht verstand, da der Mann arabisch sprach, aber er hatte nicht den Eindruck, dass das Wort „Menas“ darin vorkam. Johann zuckte mit den Schultern und sch├╝ttelte dann ganz langsam den Kopf. Immer noch starrte ihn der ├ägypter an, und Johann fragte sich warum. Da ihm nichts Besseres einfiel hielt er dem Einheimischen seinen Stadtplan vor die Nase und deutete auf die koptische Kirche, aber sein Gegen├╝ber verstand nicht, was er damit bezweckte. Wahrscheinlich konnte er die lateinischen Buchstaben nicht lesen.
„Menas?“, fragte Johann nochmals, so deutlich artikulierend wie er nur konnte.
Mehrere Zuh├Ârer des Geschichtenerz├Ąhlers drehten sich zischend um und bedeuteten ihm mit auf die Lippen gelegtem Zeigefinger, nicht zu st├Âren.
„Wer m├Âchte mit ihm sprechen?“, fragte ein kr├Ąftiger Mann zur├╝ck, den dies nicht zu k├╝mmern schien.
Tiefe Falten durchfurchten die Haut seines von der Sonne ger├Âteten Gesichts. Oder hatte auch der Alkohol seinen Beitrag dazu geleistet? Sein Haar war sch├╝tter, der Bart d├╝rr und struppig, aber beide waren aber noch gl├Ąnzend schwarz. Schwarz war auch sein Gewand, das sich von der farbigen Kleidung der Umstehenden abhob. Ansonsten sah er aus wie die anderen ├ägypter. Johann fand den Fremden wenig vertrauenserweckend, aber wenigstens sprach er Englisch.
„Mein Name ist Johann Berggruen und ich suche den Priester┬á Menas, weil ...“, begann er vorsichtig.
„Der Sohn von Bernhard Berggruen?“, unterbrach der Fremde erstaunt und musterte Johann von Kopf bis Fu├č.
Johann d├Ąmmerte es, dass er Menas gefunden hatte, aber dieser entsprach nicht gerade der Vorstellung, die er sich von einem Geistlichen gemacht hatte. Ein blasses, vergeistigtes M├Ąnnlein hatte er erwartet, keinen korpulenten Trunkenbold.
„Ja, der bin ich“, best├Ątigte er seinem Gegen├╝ber, „Mein Bruder Peter ist auch hier. Er wartet im Hotelzimmer, aber auch er w├╝rde gern mit Ihnen sprechen.“
„Die S├Âhne von Bernhard in Alexandria?“, rief der Priester so laut aus, dass die Umstehenden sich missbilligend nach ihm umblickten, aber diesmal zischte niemand. „Ich kann es gar nicht fassen!“
Wider musterte er Johann, der sich langsam in seiner Haut unwohl f├╝hlte. Stimmte etwas mit ihm nicht?
„Genauso sah dein Vater aus, als ich ihn erstmals sah“, verk├╝ndete er schlie├člich und Johann war verbl├╝fft ├╝ber diesen Kommentar, denn er selbst hatte keinerlei Familien├Ąhnlichkeit dem Mann erkennen k├Ânnen, der behauptet hatte, sein Vater zu sein. „Wie geht es ihm? Ich habe lange nichts mehr von ihm geh├Ârt?“
Johann zog sich bei dieser Frage der Magen zusammen. Damit hatte er nicht gerechnet. Aber wie konnte er nur so dumm sein, nicht zu bedenken, dass der Priester seit Vaters Abfahrt keine Nachrichten mehr von ihm erhalten hatte und daher nicht wusste, dass er tot war! Krampfhaft suchte Johann nach den richtigen Worten, aber er fand keine Formulierung, die die schrecklichen Vorkommnisse besch├Ânigt h├Ątten.
„Er ist tot“, erkl├Ąrte er schlie├člich n├╝chtern und ohne Umschweife. „Einen Tag nachdem er zu Hause zur├╝ckgekehrt ist wurde er krank und wenige Tage sp├Ąter ist er gestorben.“
Menas wurde blass, seine Augen weiteten sich und Johann fragte sich, wovor der Priester sich f├╝rchtete.
„Das ist ja schrecklich! Ich habe ihm doch gesagt, dass er h├Ątte in ├ägypten bleiben sollen!“, entfuhr es ihm. Einen Augenblick lang starrte er fassungslos auf den Boden und keiner von beiden sagte etwas. Die melodische Stimme des M├Ąrchenerz├Ąhlers und das ihn begleitende Seiteninstrument waren die einzigen Ger├Ąusche im Hof. „Aber, was stehen wir hier herum? Lass uns in meine Wohnung gehen! Dort k├Ânnen wir uns ungest├Ârt unterhalten!“
Johann nickte zustimmend, obwohl ihn die Vorsicht des Priesters erstaunte, denn es hatte sich doch eben noch gezeigt, dass hier keiner Englisch verstand. Aber Menas war hier zuhause und er wusste, sicher was er sagte. Sie verlie├čen also die Menschenansammlung. Der Priester, den der Vaters in seinen Briefen erw├Ąhnt hatte ging in Richtung der kleinen koptischen Kirche und es zeigte sich, dass f├╝r sein fortgeschrittenes Alter und seinen feisten K├Ârper sehr beh├Ąnde war.
„Warum hat Vater nur all die Jahre nichts von sich h├Âren lassen?“, fragte Johann unterwegs etwas kleinlaut.┬á
Der Priester warf ihm einen schuldbewussten Blick ├╝ber die Schulter zu und Johann sah einen Schatten der Angst ├╝ber sein Gesicht kriechen.
„Vielleicht ein andermal! Daf├╝r bist du noch zu jung!“
„Ich bin bereits einundzwanzig und“, protestierte Johann lautstark, der diesen Spruch er schon immer gehasst hatte. Wer sich dahinter verschanzte hatte entweder etwas zu verbergen oder er hatte selbst keine Ahnung. „Ich habe au├čerdem ein Recht darauf, zu erfahren, was in ├ägypten geschehen ist“, f├╝gte er nach einer Weile hinzu, aber der Priester blieb ihm weiterhin eine Erkl├Ąrung schuldig. Den restlichen Weg zu seinem Haus legte er schweigend zur├╝ck.
Es stellte sich heraus, dass Menas keinesfalls in einem der an die Kirche angrenzenden H├Ąuser wohnte, wovon die Br├╝der ganz selbstverst├Ąndlich ausgegangene waren, sondern am Ende der Gasse.┬á Das w├╝rfelf├Ârmige, wei├čget├╝nchte Haus unterschied sich in nichts von den Nachbargeb├Ąuden und Johann fand seine Meinung best├Ątigt, dass ihr Unterfangen ohne Vorank├╝ndigung die Kirche aufzusuchen aberwitzig gewesen war.
Warum hat Peter ihm keine Nachricht unter dem Kirchenportal hindurch geschoben? fragte er sich┬á und ihm wurde bewusst, dass er dies h├Ątte auch selbst tun k├Ânnen, aber er hatte die Organisation der Reise v├Âllig dem Bruder ├╝berlassen. Das muss sich dringend ├Ąndern, nahm er sich vor.
Menas schloss die Haust├╝r auf und ein junger Diener eilte herbei. Der Hausherr sagte - auf Johann deutend – zu ihm einige Worte in einer Sprache, die Johann f├╝r koptisch hielt, aber er war sich nicht ganz sicher. Er stand leicht verunsichert daneben und bewunderte den farbigen Keliml├Ąufer, der den Boden der schmalen Diele bedeckte. Der Diener erwiderte etwas und stieg dann die Treppe hinauf. Ohne ein Wort an seinen Gast zu richten, verschwand der Priester in der angrenzenden K├╝che, wo er ein Feuer auf dem Herd entz├╝ndete. Die K├╝che war bis in vier Fu├č H├Âhe mit Keramikplatten gekachelt, auf deren blauen Grund wei├če Arabesken ausgespart waren.
„In welchem Hotel seid ihr eigentlich abgestiegen?“, fragte der Priester unvermittelt.
„Im Alexander the Great“, erwiderte Johann, der sich auf einen Stuhl hatte fallen lassen alarmiert. „Stimmt etwas nicht mit dem Hotel? Es ist uns von einem englischen Major empfohlen worden.“┬á┬á
„Nein, es ist so gut oder schlecht wie jedes andere“, beruhigte Priester Menas ihn, „aber wollt ihr nicht lieber bei mir wohnen? In meinem Haus ist genug Platz f├╝r drei.“
Johann h├Ątte gern spontan zugesagt, aber er wollte diese Entscheidung nicht ohne den Bruder treffen. „Da ist sehr nett von Ihnen, dies anzubieten“, erwiderte er daher ausweichend, „aber ich w├╝rde gern Peter fragen, was er davon h├Ąlt.“
„In Alexandria ist schon mancher deiner Landsleute unter die R├Ąder gekommen. So sind viele der hier eingestr├Âmten Europ├Ąer als Hafenarbeiter geendet und es wuchs in Alexandria eine deutsche Gemeinde heran. Damit wenigstens die Kinder eine Schulausbildung erhalten hat die Generaloberin der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Karl Borrom├Ąus 1884 einige Schwestern nach Alexandria gesendet, die eine deutsche Schule gegr├╝ndet haben.“
Menas hatte wegen der Hitze den obersten Knopf seines Gewandes ge├Âffnet. Nun schloss er ihn wieder und dann wanderte sein Blick ├╝ber die Kleidung seines Gasts, „Ich hole f├╝r dich und deinen Bruder Kleidungsst├╝cke, mit denen ihr nicht mehr auffallt wie bunte Hunde. Au├čerdem schicke ich einen Boten ins Hotel zu deinem Bruder.“
Ohne eine Antwort abzuwarten verlie├č er den Raum und Johann h├Ârte durch die offenstehnde T├╝r, wie Menas mit dem jungen Diener sprach, der daraufhin das Haus verlie├č. Kurze Zeit sp├Ąter kam der Hausherr mit zwei langen Umh├Ąngen aus naturfarbener Wolle zur├╝ck, von der Art, wie sie die Beduinen trugen und er ├╝bereichte sie Johann.
„Du kannst dich umziehen, w├Ąhrend ich etwas zu Essen hole“, sagte er in einem befehlsgewohnten Ton und betrat die benachbarte Speisekammer, die bis zur Decke Lebensmittel angef├╝llt war.
Johann folgte ihm aus Neugier, das Gewand ├╝ber den Arm gelegt. Manches kannte er, anderes war ihm fremd. Von der Decke hingen ger├Ąuchertes, in Streifen geschnittenes Fleisch, Speck und Schinken. Salamiw├╝rste lagen neben Fladenbroten und einem Honigtopf auf dem Regal. Ein gro├čer Mehlsack stand neben kleinen S├Ącken mit Linsen und Bohnen in den Ecken und vor dem winzigen Fenster standen K├Ârbe mit ├äpfeln, Aprikosen und Datteln. Hinter der T├╝r, in der k├╝hlsten Ecke fanden sich K├Ąse, Butter, Milch, Eier und ein Kasten mit Weinflaschen.
Bevor ihn der Priester tadeln konnte, kehrte Johann in die K├╝che zur├╝ck und zog sich den Umhang ├╝ber. Im gleichen Augenblick kam Menas mit einem Tablett voller Lebensmittel zur├╝ck, das er auf der Anrichte abstellte. Dann legte er zwei Gedecke, Teller und Becher auf den Tisch, mischte Salat mit Oliven, Rosinen und Tomaten und schnitt einige Scheiben von einem gro├čen Schafsk├Ąse ab, legte flache, trockene Wei├čbrotfladen neben die Teller und goss aus einem Tonkrug roten Wein in beide Becher.
„Wohl bekomm’s“, sagte der Priester und nahm auf dem Stuhl gegen├╝ber Johann Platz.
Johann hatte zwar bereits im Hotel gegessen, aber das halbrohe Fleisch war ihm so zuwider gewesen, dass er die H├Ąlfte hatte zur├╝ckgehen lassen. Daher machte er sich nun mit gro├čem Appetit ├╝ber den Imbiss her. Als er einen Schluck Wein trank, goss ihm Menas sofort nach. Es was offensichtlich, dass dieser keine G├Ąste mochte, die seinen Wein verschm├Ąhten.
„Und warum seid ihr nach ├ägypten gefahren?“, fragte er nach einer Weile und warf dabei Johann einen skeptischen Seitenblick zu. „War euch das Schicksal eures Vaters keine Mahnung?“┬á
Johann begann kauend und mit vollem Mund von der R├╝ckkehr des Vaters und den darauf folgenden Ereignissen zu berichten, denn er hatte die Hoffnung, dass ihn das Mahl von den schrecklichen Erinnerungen ablenken k├Ânnte. Als er aber beim Besuch des Schattens angelangt war, verging ihm der Appetit. M├╝hsam w├╝rgte er den Bissen herunter, den er gerade im Mund hatte und sch├╝ttete ihm dann den restlichen Wein nach.
„Fr├╝her h├Ątte ich gesagt, dass dies alles finsterster Aberglauben, ja gottloses Geschw├Ątz sei“, erwiderte Menas, der Johann mit gro├čer Aufmerksamkeit zugeh├Ârt hatte, „aber inzwischen habe ich Dinge gesehen …“ Der Priester stockte einen Augenblick und es war un├╝bersehbar, dass es ihn bei der blo├čen Erinnerung an das, was er gesehen hat schauderte. Johann hoffte inst├Ąndig, dass er nicht zu sehr ins Detail gehen w├╝rde, denn er bef├╝rchtete dies k├Ânnte ihm weitere Alptr├Ąume verursachen.
„Wo ist diese Mumie eigentlich momentan, noch immer im Keller eures Hauses?“, fragte Menas nach einer Weile und er blickte Johann ernst an.
„Nein, sie ist im Hotelzimmer“, antwortete er. „Peter ist dort geblieben, damit sie niemand stielt.“
„Ihr habt sie nach ├ägypten zur├╝ckgebracht? Wenn jemand das bei der Einreise bemerkt h├Ątte, w├Ąrt ihr in Teufels K├╝che gekommen!“ Der Priester sprang mit ver├Ąrgertem Gesicht von seinem Stuhl auf. „Was habt ihr eigentlich damit vor? Ihr wollt sie wohl nicht allen ernstes in die Gruft zur├╝ckbringen?“
„Doch! Ich m├Âchte nicht riskieren, nochmals von dem Schatten heimgesucht zu werden“, insistierte Johann, „Wissen Sie woher die Mumie stammt?“
„Nein“, erwiderte der Priester etwas zu schnell f├╝r Johanns Geschmack. „Ich habe deinen Vater seit Monaten nicht gesehen. Ich wusste noch nicht einmal, dass er vorhatte, nach Hause zur├╝ckzukehren.“
Johann wurde bewusst, dass er sich niemals gefragt hatte, ob der Vater in Alexandria oder sonst wo in Ägypten einen Hausstand besessen hatte.
„Hat er denn nicht in Alexandria gelebt?“, fragte er vorsichtig nach.
Menas fuhr sich mit den kr├Ąftigen Fingern durch die dunklen Haare. Dann erhob er sich von seinem Stuhl, ging zum Herd und blies in die Glut, die er darauf entfacht hatte und stellte einen Wasserkessel darauf.
„Er ist ab und zu bei mir vorbeigekommen, hat mir aber niemals erz├Ąhlt, wo er in der Zwischenzeit gewesen ist. Vielleicht war es auch besser so“, erkl├Ąrte er nach einer Weile in einem entschuldigenden Tonfall, aber Johann konnte sich des Verdachts nicht erwehren, dass der alte Priester etwas vor ihm verheimlichte.┬á┬á
Dieser f├╝llte in aller Seelenruhe Tee in ein metallenes Teeei, h├Ąngte es in eine alte Kanne, goss kochendes Wasser dar├╝ber und nahm dann endlich wieder am K├╝chentisch Platz.
“Aber die Mumie muss bis heute Abend aus dem Hotelzimmer verschwunden sein, wegen der Diebe und weil ich nicht mit ihr in einem Raum …“, begann Johann und im gleichen Augenblick fiel ihm ein, dass der Bruder wahrscheinlich mit der Mumie auf den Weg zu dem Haus war, in dem er sich gerade befand und er beendete seinen angefangenen Satz nicht.
„Die Mumie k├Ânnt ihr in die Krypta meiner ehemaligen Kirche bringen. Das ist geweihter Boden, dort seid ihr in Sicherheit vor ihr“, sagte er nach einer Weile, aber er wirkte noch immer ver├Ąrgert.
„Das ist eine gute Idee“, erwiderte Johann und ein Stein fiel ihm vom Herzen, als ihm pl├Âtzlich ins Bewusstsein kam, dass der Priester etwas von „ehemaliger“ Kirche gesagt hatte.
„Wieso ehemalige Kirche?“, fragte er dann erstaunt, „ich dachte, Sie sind der Priester der Himmelfahrtskirche?“
Der Freund des Vaters sch├╝ttelte den Kopf.
„Nein, ich bin im Ruhestand, schon seit mehreren Monaten. Aber wir k├Ânnen uns auf den jungen Priester verlassen, der meine Stelle ├╝bernommen hat.
„Da ist noch etwas, was ich Ihnen sagen wollte“, sagte Johann einen Augenblick sp├Ąter mit leiser Stimme und ├╝berreichte Menas das Notizheft des Vaters, denn er war mittlerweile zur ├ťberzeugung gelangt, dass er dem Priester vertrauen konnte. „Das habe ich in Vaters Tasche gefunden, aber ich kann den Text nicht lesen.“
Menas riss ihm das Heft f├Ârmlich aus der Hand. Er ├Âffnete es und seine Augen wanderten schnell ├╝ber die erste Seite.
„Kein Wunder, dass du den Text nicht lesen konntest. Das liegt daran, dass er auf Koptisch verfasst ist“, bemerkte er dann mit dieser Mischung aus salbungsvollen Wohlwollen und herablassender ├ťberheblichkeit, in der Johann nun endlich den Priester wiedererkannte.
„Dann ist der Inhalt sicher sehr pers├Ânlich, wenn Vater nicht wollte, dass jeder es lesen kann“, entfuhr es Johann und er streckte die Hand nach dem Heft aus, denn er war nicht gewillt, sich die Aufzeichnungen des Vaters wegnehmen zu lassen, aber der Priester machte keine Anstalten, ihm diese zur├╝ckzugeben.
„Ich werde den Text f├╝r euch ins Englische ├╝bersetzen“, versprach er in einem v├Ąterlichen Tonfall. „So k├Ânnt ihr sowieso nichts damit anfangen.“
Johann ├Ąrgerte sich, dass er nicht auf die Ankunft des Bruders gewartet hatte, denn er wusste, dass dieser ihm sp├Ąter Vorw├╝rfe machen w├╝rde. Aber es war geschehen. Was sollte er nun tun? Dem Freund des Vaters das Heft mit Gewalt entrei├čen? Eigentlich konnte er nur hoffen, dass der Priester das Heft freiwillig wieder herausr├╝ckte. Argw├Âhnisch beobachtete er den Hausherrn, der seinerseits mit gerunzelter Stirn das Heft studierte. Seine Lippen bewegten sich, aber er sprach kein Wort. Johann wagte kaum zu atmen, so gespannt war er darauf, endlich zu erfahren, was Vater in das Heft notiert hatte. Vielleicht half es ihm zu verstehen, warum er solange in ├ägypten geblieben war, aber noch immer schwieg Menas sich aus.
„Spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter!“, beschwerte sich Johann daher nach einer Weile, „und verraten Sie mir endlich, was da drin steht!“
„Es ist leider noch zu fr├╝h, um etwas Genaueres sagen zu k├Ânnen“, vertr├Âstete ihn Menas, „es f├Ąllt mir schwer den Text zu verstehen, denn das Koptisch deines Vaters ist sehr schlecht und von der Handschrift will ich gar nicht reden.“┬á┬á
„Aber Sie haben doch sicher das eine oder andere Wort verstanden“, meinte Johann ver├Ąrgert.
Der Priester zuckte mit den Schultern und bl├Ątterte weiter in dem Heft herum, w├Ąhrend Johann tr├╝bsinnig und mit seinem Schicksal hadernd aus dem Fenster schaute. Er schreckte ganz pl├Âtzlich aus seiner melancholischen Lethargie auf, als er h├Ârte wie die Haust├╝r aufgeschlossen wurde. Aus der Diele drangen mehrere m├Ąnnliche Stimmen in die K├╝che und einen davon geh├Ârte Peter. Johann sprang von seinem Stuhl auf und eilte ihm entgegen. Menas folgte ihm bed├Ąchtig. Zwei Lasttr├Ąger waren gerade im Begriff, die Koffer und die gro├če Transportkiste durch die Wohnungst├╝r zu transportieren.
„Wie siehst du denn aus?“, fragte Peter lachend und musterte Johann von Kopf bis Fu├č.
„Priester Menas“, Johann deutete auf den Hausherrn und fragte sich im gleichen Augenblick, ob der Freund des Vaters diesen Titel noch trug, obwohl er sein hohes Amt nicht mehr innehatte, „hat mir das Gewand gegeben, damit ich auf der Stra├če nicht so auffalle. F├╝r dich liegt noch so ein Beduinen-Gewand in der K├╝che.“
„Lass mich sehen!“ Das Gesicht des Bruders strahlte vor einer fast kindlichen Begeisterung. „So ein Gewand wollte ich schon immer besitzen.“
Peter schnappte sich das Gewand und hielt es sich vor den K├Ârper. Seine Augen suchten vergebens einen Spiegel.
„Wir d├╝rfen die Mumie in die Krypta der Kirche bringen“, unterbrach Johann seine Bem├╝hungen, da es ihm gar nicht behagte, dass er sich schon wieder unter einem Dach mit der Versandkiste mit ihrem schrecklichen Inhalt befand. „Mir w├Ąre es lieb, wenn wir sie dorthin transportieren lassen, bevor er es sich anders ├╝berlegt.“
Peter warf ihm einen dieser „womit habe ich das verdient“-Blicke zu, die Johann so hasste, aber dann ├Âffnete er die Haut├╝r und rief die beiden Lasttr├Ąger zur├╝ck.
„Mein Bruder sagt, dass Sie die Mumie verstecken k├Ânnen?“, fragte der Bruder den Priester und Johann zog sich in der K├╝che zur├╝ck. Er machte keinerlei Anstalten, beim Transport zu helfen, denn er wollte weiterhin so wenig wie m├Âglich mit der Mumie zu tun haben. Durch die K├╝chent├╝r h├Ârte er, dass die Haust├╝r ge├Âffnet und wieder geschlossen wurde. Dann war Johann allein im Haus.┬á┬á┬á ┬á
 
„Du bist also Peter!“, sagte der Priester, als er den ├Ąlteren Sohn seines verstorbenen Freundes im Sonnenlicht sah und musterte ihn dabei verstohlen von der Seite, „du siehst deinem Bruder nicht sehr ├Ąhnlich.“
„Ich bin eher nach der Mutter geraten“, erwiderte Peter, der sich ├╝ber den Kommentar ├Ąrgerte. Wenigstens hatte er nicht auf die geringe Familien├Ąhnlichkeit zum Vater hingewiesen. „Genauso wie unsere kleine Schwester, die in dem selben Jahr geboren wurde, in dem Vater nach ├ägypten aufgebrochen ist.“
Hoffentlich bekam dieser vierschr├Âtige Kerl wenigstens ein schlechtes Gewissen bei der Erw├Ąhnung der armen Sophie, die vaterlos aufwachsen musste, dass er sich zehn Jahre lang mit dem Vater in ├ägypten herumgetrieben hatte, dachte Peter schlecht gelaunt, w├Ąhrend er zusah, wie die Tr├Ąger die Versandkiste die Stra├če entlangtrugen.
„Dein Bruder hat sich die Sache mit der Mumie offenbar sehr zu Herzen genommen?“, fragte der Priester vorsichtig nach.
Peter nickte.
„Ich habe gehofft, dass es ihm hilft, wenn wir die Mumie in ihre Gruft zur├╝ckbringen. Wissen Sie vielleicht woher…“
„Das ist nicht unbedingt n├Âtig“, unterbrach Menas ihn, „vielleicht kann ich euch auch so helfen.“ Er machte eine einladende Handbewegung in Richtung der orthodoxen Kirche. „Dazu muss ich mir aber die Mumie etwas genauer ansehen.“
„Aber ich m├Âchte nicht, dass sie ausgewickelte wird!“, protestierte Peter, der sich unangenehm an Moritz erinnert f├╝hlte, mit dem er nach dem Diebstahl der Mumie im Streit auseinander gegangen war, da dieser geradezu besessen von der Mumie gewesen war.
Peter hatte die ganze restliche Nacht in seiner Heimatstadt neben der Mumie wachen m├╝ssen, weil Moritz sich sonst an ihr vergriffen h├Ątte. Wenn er nur daran dachte, wie er damals im wahrsten Sinne des Wortes zwischen dem geradezu hysterischen Bruder und dem krankhaft neugierigen Freund gestanden, hatte wurde Peter von ohnm├Ąchtiger Wut ergriffen.┬á
„Ich mache nichts ohne R├╝cksprache mit dir“, versprach der Priester, „aber ich habe noch eine Frage an dich.“ Peter sah den alten Mann an und ihm schwante nichts Gutes. „Wenn ich Johann richtig verstanden habe, dann bist du ihm in der Nacht als er den Schatten gesehen haben will zu Hilfe gekommen?“ Peter nickte atemlos. „Hast auch du diese Erscheinung gesehen, die deinen Bruder so ge├Ąngstigt hat?“┬á
„Das nicht“, gab Peter zu, „aber das Phantom - oder was auch immer es war – hat Johanns Mantel mitgenommen. Ich nehme an, er hat Ihnen davon erz├Ąhlt?“
„Er hat dies erw├Ąhnt“, sagte Menas lapidar, „aber der Fall w├Ąre klarer gewesen, wenn auch du den Schatten gesehen h├Ąttest.“
W├Ąhrend dieses Wortwechsels hatten die M├Ąnner die koptische Kirche erreicht und Menas holte aus seiner Tasche einen riesigen Schl├╝ssel. Erst im dritten Anlauf gelang es ihm, das Schl├╝sselloch zu treffen und Peter fragte sich ob dies an der offensichtlichen Trunksucht des alten Mannes oder an seinen schlechten Augen lag.┬á┬á
Als die T├╝r schlie├člich den Blick auf das Kircheinnere freigab, staunte Peter ├╝ber die unerwartet pr├Ąchtigen Mosaiken, die den Obergaden des Langhauses und die Apsis zierten. Das durch die Seitenschiffsfenster einbrechende Licht entfachte ein wahres Feuer auf den goldenen Steinchen des Mosaikgrundes. Die Luft roch nach Weihrauch, Russ und Staub. Dieser charakteristische Kirchengeruch erinnerte Peter an die Mutter und er nahm sich vor, ihr endlich zu schreiben, dass sie wohlbehalten in ├ägypten angekommen waren.┬á
Die Tr├Ąger hoben die Versandkiste, die sie auf der Stra├če abgestellt hatten wieder hoch und schleppten sie durch das Kirchenportal. Der Priester wies ihnen den Weg durch das Kirchenschiff, hinter die Ikonostasis, eine steile Treppe hinunter, bis in die Krypta hinab. Dann bezahlte er die M├Ąnner und gab ihnen offenbar ein reichliches Trinkgeld, denn sie bedankten sich ├╝berschw├Ąnglich. Peter l├Ąchelte ihnen zu, da er noch nicht einmal wusste, was „danke“ auf Arabisch hie├č und sie winkten w├╝rdevoll zur├╝ck.
Dunkel war es in der Krypta, nur drei kleine Fenster kurz unter der Decke spendeten sp├Ąrliches Licht. Der unterirdische Raum mit seinen steinernen Tonnengew├Âlben erinnerte Peter an eine Gruft aus einem Schauerroman.
„Jetzt wollten wir uns doch erst einmal den Sarg betrachten“, meinte Menas und er sah Peter fragend an.
Alles in Peter str├Ąubte sich gegen diesen Vorschlag. Aber konnte er dem Priester tats├Ąchlich seine Bitte abschlagen? Wohl kaum, denn dies verstie├č gegen die elementarsten Regeln der H├Âflichkeit. Also nickte er fatalistisch, um sich nicht die Bl├Â├če zu geben, ein Verbot auszusprechen ├╝ber das Menas sich hinwegsetzen w├╝rde.
Aber Peter bef├╝rchtete, dass dieser sich nicht damit begn├╝gen w├╝rde, die Versandkiste bei sich aufzubewahren. Bestimmt w├╝rde er heimlich zur├╝ckkommen und die Mumie auspacken! Warum war Johann nicht mitgekommen? Immer, wenn er die Hilfe des Bruders brauchte, lie├č er ihn im Stich!
Zu Peters Erstaunen holte der Priester ein Stemmeisen aus seiner Tasche. Wenn es noch eines Beweises beduft h├Ątte, dass er von Anfang an vorgehabt hatte, die Mumie auszuwickeln so besa├č Peter ihn nun. Er schalt sich selbst einen Narren, dass er dem neugierigen Priester seine Mumie ausgeliefert hatte. Dieser machte sich sogleich mit der Professionalit├Ąt und Geschicklichkeit eines Steinmetzen an der Kiste zu schaffen. Bald war der Deckel der Kiste aufgehebelt und der Priester stellte sich auf die Zehenspitzen, um ├╝ber deren Rand zu schauen. In seinem Gesicht spiegelte sich die Entt├Ąuschung ├╝ber die alten Kleidungsst├╝cke wieder, die er im Inneren der Kiste erblickte. Mit einem ver├Ąchtlichen Schnauben riss er sie aus der Kiste und warf sie auf den Boden. Dann beugte er sich erneut nach vorn und diesmal huschte ein L├Ącheln ├╝ber seine feisten Z├╝ge.┬á Seine Augen glitten ├╝ber die Reihen von Hieroglyphen auf dem Bauch des menschengestaltigen Sarkophags. Dabei bewegten sich seine Lippen im stummen Gespr├Ąch, aber zu Peters Erstaunen ber├╝hrte er den Sarkophag nicht einmal.
„Das erkl├Ąrt wirklich alles“, meinte Menas schlie├člich gedehnt, Peter anblickend. „Auf dem Deckel steht ein Fluch! Ich lese ihn dir vor: Der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe meiner Mumie st├Ârt. Verweist ihn des Tempels, ihn und seine S├Âhne. Er sei ausgesto├čen. Seine Nahrung sei ihm genommen. Ausgel├Âscht sei sein Name.“
„Das ist ja schrecklich!“, entfuhr es Peter lauter als er beabsichtigt hatte und seine Stimme hallte schaurig wieder in der steinernen Gruft. Eine schleichende K├Ąlte stieg seine Arme hinab bis in die Finger. „Warum um Gottes Willen hat Vater diese Warnung nicht ernst genommen? Wie konnte er nur diese verfluchte Mumie in unser Haus bringen? Ist er nur zur├╝ckgekehrt um uns zu verderben?“
Der Priester seufzte leise. Dann sah er einen Augenblick lang nachdenklich auf die staubigen Terracottaplatten, die den Boden der Krypta bedeckten.
„Verfluch deinen Vater nicht. Er wusste nicht, was er tat, denn er konnte keine Hieroglyphen lesen. Nur sehr m├╝hsam hat er etwas koptisch gelernt, aber die heilige ├ťberlieferung der alten ├ägypter verstand er nicht.“
„Warum hat er eigentlich Koptisch gelernt, wo Sie doch flie├čend englisch sprechen?“, wollte Peter wissen, dem dies seltsam vorkam.
War der Vater nicht nach Ägypten gereist, um die Kultur der Pharaonen zu erforschen? Wozu verwandte er dann soviel Mühe darauf die Sprache einer modernen Minderheit zu erlernen?
„Vielleicht, weil er in mir einen guten Lehrer gefunden hatte“, behauptete der Priester. Dann sah er Peter ernst in die Augen. „Jede Mumie tr├Ągt mehrere Amulette. Das wichtigste von ihnen ist der Herzskarab├Ąus. Wenn wir ihn entfernen, dann sollte der Fluch auf dem Sargdeckel wirkungslos sein.“
„Haben Sie dies schon einmal getan?“, fragte Peter skeptisch und ein Blick in das versteinerte Gesicht seines Gegen├╝bers ├╝berzeugte ihm vom Gegenteil. „Nicht, dass dies die Mumie noch rachs├╝chtiger macht. Au├čerdem w├╝rde Johann nicht daran glauben. In seinem Interesse m├╝ssen wir die Mumie in ihr Grab zur├╝ckbringen!“
Zum ersten Mal in seinem Leben schob Peter die Alptr├Ąume seines Bruders als Vorwand vor, denn mittlerweile war auch ihm die Mumie nicht mehr geheuer. Je schneller sie sich ihrer entledigten desto besser!┬á
„Genau das wollte ich eigentlich vermeiden.“ Der Priester stie├č einen laut vernehmlichen Seufzer aus. „Dein Bruder hat mir ein Heft mit Notizen eures Vaters ├╝berlassen. Leider sind sie in fehlerhaftem Koptisch verfasst und ich kann seine Handschrift nur schwer entziffern, aber ich habe dem Text entnommen, dass er die Mumie in einer der Sobek-Oasen gefunden hat.“
„Dann sollten wir uns am besten so schnell wie m├Âglich dorthin auf den Weg machen“, erkl├Ąrte Peter spontan, der am liebsten sogar auf die ├ťbernachtung im Haus des Priesters verzichtet h├Ątte.
Die Miene seines Gegen├╝bers verfinsterte sich, falls dies ├╝berhaupt noch m├Âglich war.
„Das sagst du so leichthin! Um zur Nordoase zu gelangen, muss man sich weitab der ├╝blichen Handelswege in das Meer ohne Wasser wagen, in die gewaltige Sahara, die kaum je ein Mensch durchquert hat. Mich jedenfalls bekommen keine zehn Pferde dorthin. Au├čerdem hat die Karawanensaison noch nicht begonnen. Erst am Ende des Sommers sind die Kamele gest├Ąrkt und die Nomaden, denen sie geh├Âren haben Futtervorr├Ąte angelegt. Die alten ├ägypter sprachen von der Jahreszeit der ├ťberschwemmung und seitdem hat sich nicht viel ge├Ąndert, zumindest was die Sobek-Oasen betriff.“
Das w├Ąre auch zu sch├Ân gewesen, dachte Peter und er musste sich eingestehen, dass der Freund des Vaters, auf den er so gro├če Erwartungen gesetzt hatte eine Entt├Ąuschung f├╝r ihn war. Zwar konnte dieser wunderbare S├Ątze formulieren, aber offenbar war er noch weniger unternehmungslustig als der Bruder.
„Trotzdem werden wir dorthinfahren!“, erkl├Ąrte Peter trotzig.
„Vielleicht solltest du zuerst mit deinem Bruder Johann reden, bevor du eine voreilige Entscheidung triffst, die du sp├Ąter bereust.“ Der Priester warf Peter einen Seitenblick zu. „Aber vorher habe ich noch eine wichtige Frage an dich: „Wer hat die Mumienh├╝lle angefasst?“
Peters Magen zog sich zusammen. Diese Frage hatte er bisher verdr├Ąngt. Ob auch er vom Fluch getroffen war? Aber dann h├Ątte er sich l├Ąngst ge├Ąu├čert und au├čerdem weigerte er sich immer noch an diesen heidnischen Unfug zu glauben.
„Johann und ich, Vater nat├╝rlich und ein Kommilitone von mir“, Peter verschwieg, dass dies geschehen war als sie die Mumie aus der Apotheke entwendet hatten. „Meinen Sie, der Fluch wird uns alle treffen?“
„Johann ist ein Tr├Ąumer, ich wei├č nicht, ob er sich all dies nur einbildet, aber den Tod deines Vaters hat der Fluch bewirkt“, antwortete Menas und Peter fragte sich, warum der Priester versuchte, ihm Angst zu machen, wo er sich gerade wieder etwas beruhigt hatte.┬á┬á
„Solltet ihr tats├Ąchlich den Leichtsinn besitzen, zu dieser Oase aufzubrechen, wovon ich eigentlich nur abraten kann, dann besorgt euch eine Zwiebel des Oasenkrokus, der dort w├Ąchst. Die alten ├ägypter sagen, dass nur ein Aufguss von dieser Zwiebel gegen Schadenszauber zu helfen vermag“, der Priester holte den Schl├╝ssel der Kirche aus der Tasche, „aber dies ist m├Âglicherweise nur ein finsterer Aberglaube.“
Peter musste dies alles erst einmal verdauen. Die alten ├ägypter sagen h├Ârte sich fast so an, als ob Priester Menas welche kannte oder bildete Peter sich dies nur ein?
„Ich bin sicher, auch Johann m├Âchte zu dieser Oase reisen“, behauptete er, obwohl er vom Gegenteil ├╝berzeugt war, „wir werden uns also schon bald auf den Weg dortin machen.“
„Wie du willst“, meinte Menas, w├Ąhrend er Peter zum Ausgang der Kirche begleitete.
Als er die T├╝r mit seinem gro├čen Schl├╝ssel von au├čen abschloss, kam ein junger, hagerer Mann in schwarzer Kleidung auf ihn zu und Menas redete – ohne Peter den Fremden vorzustellen - eindringlich auf diesen ein. Dieser machte sich am Schloss der Kirche zu schaffen. Peter gefiel dies gar nicht. In dieser Kirche ging es ja zu wie in einem Taubenschlag. War die Mumie dort wirklich sicher?
„Das ist mein Nachfolger. Ich bin n├Ąmlich im Ruhestand“, erkl├Ąrte Menas l├Ącheln als er die beunruhigte Miene seines Gastes sah. „Ich habe ihn angewiesen, gut auf die Mumie aufzupassen.“
Schon wieder ein Mitwisser mehr, dachte Peter ver├Ąrgert. Ob auch er neugierig auf die Mumie war?
Vor sich hingr├╝belnd folgte er dem alten Priester zur├╝ck zu seinem Haus, wo Johann gerade damit besch├Ąftigt war im G├Ąstezimmer die Koffer auszupacken. Peter setzte sich auf einen Stuhl in der Ecke des karg, aber zweckdienlich eingerichteten Raums und berichtete, was der Priester ihm ├╝ber diese Zwiebel erz├Ąhlt hatte, wobei er aber den Fluch auf dem Sarkophagdeckel herunterzuspielen versuchte.
 
„Und du meint, dass ich keine Alptr├Ąume mehr bekomme, wenn ich diesen Zwiebelsaft trinke?“, fragte Johann als der Bruder geendet hatte skeptisch nach.
 
 
 
 
 
„Schaden kann es sicher nicht“, erwiderte Peter, „und wir sollten auch Moritz etwas davon geben. Schlie├člich ist es meine Schuld, dass er den Sarkophag der Mumie angefasst hat.“
„Das w├╝rde ich nicht sagen! Er hat darauf bestanden, dass wir ihn mitnehmen. Er ist selbst dran schuld“, protestierte Johann und Peter sah ihn missbilligend an.
„Trotzdem willst du doch hoffentlich nicht, dass er durch den Fluch zu Schaden kommt?“┬á
Johann musste ihm innerlich Recht geben. Seine Reaktion war unbedacht und herzlos gewesen, aber er war momentan zu beunruhigt, um an andere zu denken: Irgendetwas stimmte nicht. Warum schwieg der Bruder dar├╝ber aus, wie diese weitere Reise, die er so nebenbei erw├Ąhnt hatte aussehen w├╝rde?┬á
„Haben Sie mittlerweile herausbekommen, woher die Mumie stammt?“, fragte er daher den Hausherrn, der mit dem R├╝cken gegen die Wand gelehnt ihm Raum stand. „Doch sicher aus dem Tal der K├Ânige bei Theben?“
„Priester Menas hat in Vaters Heft gelesen, dass Vater die Mumie in einer abgelegenen Oase gefunden hat, deren Name ich noch nie geh├Ârt habe“, antwortete Peter statt seiner.
„Kein Wunder, denn die Sobek-Oasen sind auf keiner Karte verzeichnet!“, erkl├Ąrte der Freund des Vaters mit d├╝sterer Miene. „Macht euch nicht leichtsinnig dorthin auf dem Weg, denn ihr reist in eine andere Welt.“
„Vater hat es geschafft“, wandte erstaunlich heftig Peter ein, „Jetzt sagen Sie uns doch endlich, wie man zu dieser Oase gelangt? Ich nehme an, dass wir uns einer Karawane anschlie├čen m├╝ssen? Schlie├člich sprachen Sie vorhin von der Karawanensaison.“
Johann erschrak, denn er war innerlich auf eine Schifffahrt auf dem Nil gefasst gewesen, nicht auf eine Karawanentour durch die W├╝ste.
„Im Nildelta liegt ein einsames Fischerdorf. Ich kenne es nat├╝rlich nur vom H├Ârensagen, aber man sagt, dass dort Schmuggler ihre Ware verkaufen…“
„Warum sollten wir uns mit Schmugglern einlassen?“, unterbrach ihn Johann und er dachte sich, dass dieser so genannte Freund seines Vaters keine gro├če Hilfe war.
„Genau, schlie├člich haben wir nichts zu verbergen!“, stimmte ihm Peter zu, der dem Wortwechsel mit gerunzelter Stirn gefolgt war. „Wir haben g├╝ltige P├Ąsse. Au├čerdem wollten wir nichts Illegales tun. Was also soll diese Heimlichtuerei!“
Der Priester wirkte, als ob er lieber nicht antworten w├╝rde, aber da seine beiden G├Ąste ihn insistierend anblickend, gab er schlie├člich nach.
„Wie ich schon sagte: Das Grab befindet sich in der dritten Sobek-Oase“, erkl├Ąrte er schlie├člich, „aber man kann nicht einfach so zu diesen Oasen reisen. Sie sind auf keiner Karte verzeichnet. Die Schmuggler sind ihre einzige Verbindung mit der Au├čenwelt.“
Johann fand, dass der Priester auff├Ąllig gut informiert war. Ein finsterer Verdacht stieg in ihm auf.
„Woher wissen Sie das alles, wenn es angeblich so geheim ist?“, fragte er daher argw├Âhnisch nach.
„Ich bin ein alter Priester und habe schon viele Beichten abgenommen…“
Johann fragte sich, ob ihn der Priester f├╝r dumm verkaufen wollte. Er suchte nach einer h├Âflichen Formulierung f├╝r seinen Verdacht, fand aber dann, dass es nichts zu besch├Ânigen gab.
„Das erkl├Ąrt nicht, dass Sie soviel ├╝ber Schmuggler und Karawanen wissen! Schlie├člich sind sie Priester in Alexandria und nicht im Nildelta!“, entfuhr es ihm. „Ich habe eher den Eindruck, dass Sie diese Oasen aus eigener Anschauung kennen!“
Der Priester sah aus, als ob er schlechten Wein probiert h├Ątte.
„Ja, so ein oder zweimal bin ich schon dort gewesen, aber…“
Johann ├Ąrgerte sich, dass der Priester noch immer nicht mit der Wahrheit herausr├╝ckte.
„Was haben Sie bei den Schmugglern gekauft?“, unterbrach Peter.
Der Priester sah ihn an, als ob dies eine ziemlich dumme Frage w├Ąre.
„Wein nat├╝rlich, es ist teuer und schwierig sich in ├ägypten Messwein zu besorgen.“
Peter lachte.
„Und weshalb wollen Sie uns dann auf keinen Fall zu der Oase begleiten?“, wollte Peter wissen und Johann ├Ąrgerte sich, dass der Bruder offenbar ├╝ber seinen Kopf hinweg bereits beschlossen hatte, zu dieser gottverdammten Oase aufzubrechen.
Der Priester schnappte h├Ârbar nach Luft.
„Einmal ist es mir gelungen, lebend von den Sobek-Oasen zur├╝ckzukehren und ich m├Âchte mein Schicksal nicht herausfordern. Auch euch kann ich nur raten: ├╝berlegt euch, was ihr tut!“
„Vielleicht sollten wir auf ihn h├Âren“, wandte Johann ein, „schlie├člich kennt er sich hier aus.
Peter wirkte als ob er kurz davorstand, Johann anzubr├╝llen.
„Hast du mich denn nicht verstanden?“, fragte er dann mit gef├Ąhrlich ruhiger Stimme, „Auf einer dieser Oasen w├Ąchst ein Kraut, das dich von deinen Alttr├Ąumen befreit. Au├čerdem sind wir nicht soweit gefahren, um im letzten Augenblick wieder umzukehren. Die Mumie wird in ihr Grab zur├╝ckgebracht!“
Johann blickte hilfesuchend zu dem Priester, doch dieser wich seinem Blick aus.
„Jetzt stell dich nicht so an“, f├╝gte Peter etwas umg├Ąnglicher hinzu und Johann nickte wider eigenen Willen.
„Ich habe euch gewarnt!“, rief der Priester mit geradezu komischem Pathos aus und Johann fragte sich, ob er in seinem gewohnten Predigerton verfallen war.
„Es gibt aber noch ein Problem. Wir k├Ânnen doch nicht mit Beduinen durch die W├╝ste ziehen, deren Sprache wir nicht verstehen. Und wie sollen wir in dieser Oase verst├Ąndlich machen?“, wandte Johann ein, den es mittlerweile geradezu vor dem seltsamen, fremden Land graute. Er war fest davon ausgegangen, dass der Freund seines Vaters ihnen als ├ťbersetzer zur Verf├╝gung stehen w├╝rde.
„Du hast Recht. Wir m├╝ssen einen Dolmetscher suchen, der uns auf der Reise begleitet“, wandte Peter ein, offenbar etwas in seinem Optimismus gebremst. Dann schaute er den alten Priester an. „Es w├Ąre sch├Ân, wenn wir, Ihre“, Peter stockte, offenbar nach einem Wort suchend, „Gesch├Ąftsbeziehungen zu den Schmugglern ausn├╝tzen k├Ânnten.“
Noch immer stand der Hausherr mit dem R├╝cken an die Wand gelehnt und vermied jeden Blickkontakt mit seinen G├Ąsten.┬á
„Wir w├Ąres Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie uns wenigstens zu diesem Schmugglernest begleiten w├╝rden“, pr├Ązisierte Johann nach einigen Augenblicken qualvoller Stille. „Wir haben ja eigentlich gehofft, dass S i e – Johann dehnte das Wort – f├╝r uns ├╝bersetzen k├Ânnten!“
Noch lieber h├Ątte Johann den Priester gebeten allein diesen ber├╝chtigten Ort aufzusuchen, aber er wusste, dass dieser sich weigern w├╝rde. Au├čerdem war zu bef├╝rchtete, dass Priester Menas dort versumpfte, denn Johann bezweifelte, dass er bei den Schmugglern wirklich nur Wein f├╝r die Messe erwarb.
Der alte Mann stie├č einen leisen Seufzer aus.
„Wenn es denn sein muss, aber nur unter einer Bedingung“, stellte er dann mit vor der Brust verschr├Ąnkten Armen ultimativ fest, „Nur einer von euch kommt mit. Es ist mir wohler bei der Vorstellung, dass jemand nach uns Erkundigungen einziehen kann, falls wir nicht zur├╝ckkommen sollten!“
Ich bleibe hier!“, verk├╝ndete Johann, bevor sich sein Bruder zu dieser Bedingung ├Ąu├čern konnte.
Alexandria
9. Alexandria
Johann schlenderte die Erlenstra├če entlang und war im Begriff den Theaterplatz zu ├╝berqueren, als sein Blick eher zuf├Ąllig eine Litfasss├Ąule streifte. Er blieb wie angewurzelt stehen, denn er sah unvermittelt in sein eigenes Konterfei. „Johann Berggruen wird gesucht, tot oder lebendig“, stand darunter, „Auf seinen Kopf ist eine Belohung von 1000 Reichsmark ausgesetzt. Er wird gesucht wegen Einbruchs in die Schwanen-Apotheke und Diebstahls von Medikamenten. Sachdienliche Hinweise, die zu seiner Ergreifung f├╝hren, werden von jeder Polizeistation angenommen“.
Johann sp├╝rte, wie sich sein Magen zusammenzog und ein Beben durch seinen K├Ârper lief. Er las den Text nochmals und ohnm├Ąchtige Wut stieg in ihm auf: Wie konnte der Onkel ihm dies nur antun! Dabei geh├Ârte ihm die Mumie doch gar nicht, denn die Mutter hatte sie ohne die Erlaubnis der S├Âhne weggegeben!
Oder hatte Wachtmeister Dimpflhuber dieses Kopfgeld auf ihn ausgesetzt? Panisch ├╝berlegte Johann, wo er sich vor der Polizei verstecken k├Ânnte, aber ihm fiel nichts au├čer Moritzens Bude ein.
Dann gehe ich doch lieber ins Gef├Ąngnis, dachte er sich, aber im gleichen Augenblick versp├╝rte er einen heftigen Ruck unter den F├╝├čen und er wurde von einem Sog erfasst. Drau├čen heulte der Wind und ein Nebelhorn produzierte einen schrillen Pfeifton, der an einen alten Teekessel gemahnte. Schritte schienen sich zu n├Ąhern und wieder zu entfernen. Dann verebbte der Wind ganz pl├Âtzlich und die Ger├Ąusche verstummten. Johann riss die Augen auf und realisierte, dass er in einem schwankenden Bett lag. W├Ąhrend er sich g├Ąhnend r├Ąkelte, fragte er sich einen Augenblick lang, ob er wieder von der Galeere des Odysseus tr├Ąumte, die zum Hades unterwegs war. Aber was hatte der Steckbrief zu bedeuten? Der Traum war so real gewesen oder war das Schiff ein Traum in einem Traum?
Schlagartig kam die Erinnerung zurück: Johann und Peter hatten in Genua eine Passage nach Alexandria auf einem englischen Dampfboot gebucht. Im Frachtraum befand sich ihre Mumie. Sie war in der Transportkiste verstaut, in der Vater sie nach Hause gebracht hatte und Johann fragte sich, ob wohl jemals zuvor eine Mumie nach Ägypten zurücktransportiert worden war.
Wie konnte er nur die zur├╝ckliegende Schifffahrt vergessen, die eine einzige Tortur f├╝r ihn gewesen war? Das konnte nur an der Ersch├Âpfung durch chronischen Schlafmangel liegen. Johann war niemals zuvor zur See gereist, und er wusste auch warum: Die modernen Schiffe mochten als unsinkbar gelten, aber trotzdem war ihm die Seefahrerei nicht geheuer. Er w├╝rde sieben Kreuze schlagen, wenn er endlich wieder festen Boden unter den F├╝├čen haben w├╝rde.
Die Monotonie, das ewige Schwanken des Bodens, der L├Ąrm, der enge Raum, auf den er mit dem Bruder zusammengepfercht war, der sich st├Ąndig beschwerte, dass Johann schnarchte. Wie hatte all dies ihn gequ├Ąlt! Zwar verf├╝gte das Dampfschiff ├╝ber eine – wenn auch m├Ą├čig ausgestattete - Bibliothek und einen Salon erste Klasse, aber Johann hatte den Gespr├Ąchen mit den anderen Passagieren nicht viel abgewinnen k├Ânnen. Es handelte sich gr├Â├čtenteils um englische Kaufleute, Beamte und Offiziere auf dem Weg zu ihrem Einsatzort, die abends mit einem Glas Sherry auf K├Ânigin Victoria anstie├čen und sich dabei ├╝ber Pferde und Hunde unterhielten. Wenigsten hatten die Br├╝der durch die Konversation mit den Mitreisenden ihre brachliegenden Englischkenntnisse auffrischen k├Ânnen.
Ansonsten war seine einzige Abwechslung auf der Fahrt die vergeblichen Bem├╝hungen gewesen, dem Notizbuch des Vaters seine Geheimnisse zu entlocken. Als er nach zwei Tagen noch immer nicht den geringsten Ansatzpunkt gefunden hatte, hatte Johann endlich den Bruder eingeweiht, der ihn wegen seiner Heimlichtuerei gescholten hatte. Mit einem Blick hatte Peter festgestellt, dass der Text in keiner Geheimschrift abgefasst war wie Johann bisher geglaubt hatte, sondern in einer Fremdsprache, die sie beide nicht beherrschten und Johann hatte ihm schlie├člich widerwillig zugestimmt.┬á┬á
Er setzte sich auf die Bettkante und lie├č im flackernden Licht der ├ľllampe, die am Fu├č des Bettes festgebunden war, seinen Blick durch die Kabine schweifen. Seit der ├Ągyptische Schatten ihn heimgesucht hatte, bekam Johann im Dunkeln Panikattacken und daher lie├č er stets eine Lampe brennen, denn er klammerte sich verzweifelt an die ├ťberzeugung, dass der Schatten dies nicht ertrug. Diese Gewohnheit war ein st├Ąndiger Zankapfel zwischen ihm und dem Bruder, den das Licht st├Ârte.
Die Kabine war luxuri├Âs eingerichtet, mit Mahagonischrank und Sesseln, die mit rotem Leder ├╝berzogen waren, aber Johann war alarmiert, als er bemerkte, dass das Bett des Bruders leer war. Wo mochte nur Peter sein? Johann rappelte sich auf, schl├╝pfte in seine Pantoffel und ├Âffnete die Kaj├╝tent├╝r einen Spalt weit. Drau├čen graute bereits der Morgen. Hastig kleidete Johann sich an, eilte dann die Treppe hoch, die zum Touristendeck f├╝hrte und schaute sich oben angelangt nach seinem Bruder um. Er fand ihn ├╝ber die Reling gelehnt, in die Ferne blickend. Um sich zu ihm zu gesellen, musste Johann die ganze Breite des Schiffes durchqueren.
„Alexandria“, sagte Peter mit der Hand nach vorn deutend, als er den Bruder bemerkte.
„Endlich!“, entfuhr es Johann, denn er hatte die Schifffahrt gr├╝ndlich satt.
Im fahlen Licht der Morgend├Ąmmerung begann sich in der Ferne die K├╝ste abzuzeichnen, aber Johann bem├╝hte sich vergebens, eine Stadt auszumachen. Alles, was er erkennen konnte, war ein winziger wei├čer Fleck.
*
Peter war von der Vorstellung ├╝berw├Ąltigt, dass er bald in ├ägyptens sein w├╝rde, so lange hatte er von diesem Anblick getr├Ąumt und so unm├Âglich war es ihm oft erschienen, dass dieser Traum eines Tages in Erf├╝llung gehen w├╝rde. ├ägypten! Der Klang dieses Wortes ├Âffnete eine wahre Schleuse von Gef├╝hlen in ihm. Es war f├╝r Peter immer Chiffre eines anderen Lebens gewesen, von dem er ausgeschlossen war, da er zu jung gewesen war, um seinen Vater auf seiner Reise zu begleiten. Am liebsten h├Ątte er das Bild der K├╝ste in sich aufgesaugt, aber er konnte leider nicht viel erkennen, denn das diffuse Licht der D├Ąmmerung verwischte die Konturen.
Ungeduldig und voller Tatendrang ging er auf dem Passagierdeck auf und ab, bis das Linienschiff sich endlich dem Land soweit gen├Ąhert hatte, dass man Einzelheiten erkennen konnte. Peter starrte auf die K├╝ste, aber er musste sich nach einer Weile eingestehen, dass er ma├člos entt├Ąuscht war. Sollte dieses erb├Ąrmliche Fischernest tats├Ąchlich Alexandria sein? Die Stadt, die stolz den Namen Alexanders des Gro├čen trug? Die Hauptstadt der Ptolem├Ąer? Peter hatte zwar im Reisef├╝hrer gelesen, dass der Hafen von Alexandria weitgehend seine Bedeutung eingeb├╝├čt hatte und der Ort daher nur noch sechstausend Seelen beherbergte, aber so trostlos hatte er sich die erste Etappe der Reise nicht vorgestellt.
Der Hafen, den das Schiff schlie├člich anfuhr, w├Ąre f├╝r Peter eine herbe Entt├Ąuschung gewesen, wenn das Stadtpanorama nicht seine Erwartungen erheblich heruntergeschraubt h├Ątte. Das Hafengel├Ąnde mochte klein sein, aber trotzdem waren die Einreiseformalit├Ąten zeitraubender als vermutet, denn die Warteschlange vor dem Beamten der Einwanderungsbeh├Ârde bewegte sich nur sehr langsam von der Stelle vorw├Ąrts.
„Was um Gottes Willen m├Âchte der alles wissen?“, fragte Johann mit einem panischen Unterton in der Stimme.
„Keine Ahnung, aber der kann uns nichts tun. Wir haben schlie├člich g├╝ltige P├Ąsse“, erwiderte Peter, obwohl auch ihm die Gr├╝ndlichkeit des Beamten missfiel.
Er war ein kleines, d├╝nnes M├Ąnnlein mit brauner Haut und europ├Ąischer Kleidung, der genausogut h├Ątte ein braungebrannter Engl├Ąnder sein k├Ânnen.
Hei├č und stickig war es in der Baracke und die Pfeifen der Wartenden verpesteten die Luft. Die meisten kannte Peter vom Sehen, denn schlie├člich handelte es sich um die Passagiere seines Schiffs. Sein Blick blieb an einer Frau um die zwanzig h├Ąngen, die ein wei├čes Kleid trug und ihr br├╝nettes Haar zu einer eleganten Frisur hochgesteckt hatte. Sie erinnerte ihn an Anneliese und er bedauerte, dass die Fremde in Begleitung ihres Verlobten reiste.┬á┬á
„Das klappt doch nie im Leben!“, jammerte Johann und riss Peter damit aus seinen Gedanken. „Selbst wenn dieser Wichtigtuer sich herabl├Ąsst uns den verdammten Stempel zu geben, bekommen wir wegen der Mumie ├ärger mit dem Zoll.“
„Ihm ist es bestimmt viel zu viel Arbeit, die N├Ągel herauszuziehen und die Kiste aufzuhebeln“, behauptete Peter, aber er war sich mittlerweile seiner Sache nicht mehr so sicher.
„Das hat fr├╝her noch viel l├Ąnger gedauert, ich meine bevor ├ägypten britisches Protektorat geworden ist“, erkl├Ąrte Major Wallace, der offenbar erraten hatte, dass sich die Br├╝der ├╝ber den peniblen Beamten beschwerten.
„Englisches was?“, fragte Johann, der sich offenbar nicht besonders gut auf die Reise vorbereitet hatte.
„Protektorat! Offiziell untersteht ├ägypten zwar der Hohen Pforte und ist damit Teil des Osmanischen Reichs. Man zahlt weiterhin Tribut an den Sultan, aber wir Briten sind hier die wahren Herrscher. Seitdem ist hier alles viel effizienter geworden“, erkl├Ąrte Major Wallace mit h├Ârbarem Stolz. Der untersetzte Offizier, dessen Tropenhelm eine Nummer zu klein f├╝r seinen Kopf zu sein schien, musterte die beiden Zivilisten mit absch├Ątzigen Blicken. „Wissen Sie eigentlich schon, in welchem Hotel Sie zu abzusteigen gedenken?“
„Nein, wir sind so ├╝berst├╝rzt aufgebrochen, dass wir keine Zeit gehabt haben ein Zimmer zu in Alexandria reservieren“, erwiderte Peter und er fragte sich sogleich, ob er zuviel gesagt hatte. „Da wir nur wenige Tage hier bleiben werden, sind wir aber nicht besonders w├Ąhlerisch“, f├╝gte er daher hinzu, um seine Worte abzumildern.┬á┬á
„Das sollten Sie aber, mein Lieber!“, widersprach der Major und zwirbelte seinen blonden Schnurbart. Peter vermutete, dass er dies immer tat, bevor er eine l├Ąngere Erkl├Ąrung abgab. „F├╝r einen Europ├Ąer ist ein Hotel mit weniger als drei Sternen nat├╝rlich nicht zumutbar. In diesem Land sind die Standards beklagenswert niedrig. Wenn ich nur an die Kampagne von 1882 denke! Der Sommer war selbst f├╝r ├ägypten ungew├Âhnlich hei├č und wir kampierten in der W├╝ste …“
Wie Peter bef├╝rchtet hatte, schwadronierte der Offizier unerbittlich los, denn er wusste, dass seine Zuh├Ârer den Einreisestempel in ihrem Pass ben├Âtigen. Major Wallace r├╝hmte also in epischer Breite die Verdienste der britischen Armee im Allgemeinen und seine eigenen im Besonderen. Ein Blick auf das geistesabwesende Gesicht des Bruders zeigte Peter, dass dieser - wie so oft - nicht zuh├Ârte. In diesem Augenblick beneidete er Johann darum, dass er in der Lage war, l├Ąstige Zeitgenossen einfach zu ignorieren.
„Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kennen Sie sich in Alexandria gut aus“, unterbrach Peter den Redefluss des Majors nach einer Weile, da er den Eindruck hatte, dass ihm bald der Sch├Ądel platzte. „K├Ânnten Sie uns vielleicht ein Hotel in Hafenn├Ąhe empfehlen? Sie wissen schon, wir wollen nicht lang in Alexandria bleiben.“┬á
Einen Augenblick lang erstarrte der Offizier mitten in der Bewegung, wie ein Blechspielzeug, dessen Sprungfeder zur├╝ckgeschnellt war.
„In diesem Fall kommt f├╝r Sie nur das „Alexander the Great“ in Frage“, erkl├Ąrte er dann, ohne nachzudenken.
„Bestimmt kassiert er Provision f├╝r das Vermitteln von G├Ąsten“, fl├╝sterte Johann, der offenbar doch mit halbem Ohr zugeh├Ârt hatte, dem Bruder zu.
„Dort versteht man wenigstens ein richtiges englisches Fr├╝hst├╝ck zu bereiten und die Zimmer sind auch akzeptabel.“
„Siehst du, dass ich Recht habe“, kommentierte Johann und um Peters Selbstkontrolle war es geschehen. Bei der Vorstellung, wie der w├╝rdige Major an der Rezeption die Hand ausstreckt musste er laut lachen und der Offizier schaute ihn pikiert an.
Im gleichen Augenblick bedeutete der Beamte der Einwanderungsbeh├Ârde den Br├╝dern mit einer Geste, n├Ąher zu treten und Peter war dar├╝ber erstaunt, denn der Offizier stand vor ihm.
„Sind Sie nicht an der Reihe?“, fragte er Major Wallace. „Wir wollen uns nicht vordr├Ąngeln.“
„Wo denken Sie hin, mein Lieber?“, erwiderte der Angesprochene kopfsch├╝ttelnd. „Ich muss hier doch nicht Schlange stehen! Ich wollte Ihnen nur etwas Gesellschaft leisten.“┬á
Peter war einen Augenblick lang sprachlos, was bei ihm nicht oft vorkam.
„Das ist sehr nett von Ihnen“, stammelte er dann und gesellte sich zu Johann, der bereits zum Schalter gegangene war.
Der Beamte magere nahm die beiden P├Ąsse mit spitzen Fingern in Empfang und betrachtete sie mindestens eine Minute lang mit gerunzelter Stirn. Offenbar waren deutsche Papiere hier kein allt├Ąglicher Anblick.
„Was ist der Zweck Ihrer Reise?“, fragte er schlie├člich in einem Tonfall, der erkennen lie├č, dass er alle Ausl├Ąnder f├╝r potentielle Spione hielt.
Peter erkl├Ąrte, dass sie Altertumswissenschaftler seien, die die Pyramiden besichtigen wollten und der Beamte wiegte den Kopf in einer Art und Weise bed├Ąchtig hin und her, dass Peter sich an eine alte Schildkr├Âte erinnert f├╝hlte. Wahrscheinlich wunderte er sich ├╝ber das jugendlicher Alter der Touristen.
„Unser Vater hat uns soviel von ├ägypten erz├Ąhlt“, behauptete Peter, „Das wollten wir gern mit eigenen Augen sehen.“
Der Beamte nickte und endlich knallte er seinen Stempel auf die beiden P├Ąsse.
„Ich w├╝nsche Ihnen eine sch├Âne Reise“, sagte er und klappte die P├Ąsse zu. „Auf Wiedersehen.“
Peter atmete erleichtert auf, als er die Dokumente wieder in Empfang nahm.
„Freu dich nicht zu fr├╝h, denn das Schlimmste steht uns noch bevor“, warnte ihn Johann leise. „Wir m├╝ssen noch mit der Mumie den Zoll passieren.“
„Ich glaube nicht, dass man uns ├ärger macht“, versicherte Peter zum mindestens f├╝nften Mal an diesem Vormittag. „Du wei├čt, doch dass die Mitreisende gesagt haben, dass die Kontrolle bei der Einreise nach ├ägypten eher lax ist.“
„Ich glaube das erst, wenn wir den Zoll hinter uns haben.“
W├Ąhrend dieses Wortwechsels hatten die Br├╝der ihre Koffer zum Schalter des Zollbeamten geschleppt, wo bereits die gro├če Kiste stand, die zwei Gep├Ącktr├Ąger aus dem Rumpf des Schiffs hierher transportiert hatten.
„Haben Sie etwas zu verzollen?“, fragte ein Mann mittleren Alters, dessen verkniffene Gesichtsz├╝ge nichts Gutes verhie├čen.
Die Br├╝der beteuerten, dass sie weder Alkohol noch Tabak mit sich f├╝hrten.
„Und was ist in dieser Kiste?“, fragte der Beamte mit strenger Miene auf das corpus delicti deutend.
„Geschenke f├╝r den Freund unseres Vaters.“ Dies war die Erkl├Ąrung, die die Br├╝der sich zusammengebastelt hatten. „Er wird uns bewirten und wir wollen uns daher erkenntlich zeigen.“
Die Augen des Beamten wanderten ├╝ber die Kiste und zu den jungen M├Ąnnern zur├╝ck.
„Was genau ist da drinnen?“
„Kleidungsst├╝cke, B├╝cher, Lebensmittel“, behauptete Peter und langsam wurde ihm mulmig zumute. Warum hatte er nur den Major abgewimmelt? Dieser h├Ątte ihm vielleicht aus der Patsche helfen k├Ânnen.
„Da k├Ânnten genauso gut Waffen f├╝r die Aufst├Ąndischen drin sein!“, sagte ein anderer Beamter im Vorbeigehen.
Die Br├╝der verneinten vehement und Peter f├╝hlte, wie Panik in ihm hochstieg. Das Gespr├Ąch verlief v├Âllig anders, als er erwartet hatte.
„Aufmachen!“, befahl der Beamte, die Arme vor der Brust gekreuzt.
Peters Herz klopfte ihm im Hals und schien einen Augenblick lang still zu stehen. Bisher hatte er die Vorstellung systematisch verdr├Ąngt, dass der Z├Âllner tats├Ąchlich die Kiste ├Âffnen k├Ânnte. Zwar hatten sie den Sarkophag mit Kleidungsst├╝cken bedeckt, aber dies w├╝rde die Katastrophe nur verz├Âgern.
„Das ist Diplomatengep├Ąck!“, behauptete Johann mit triumphaler Stimme und ├╝berreichte zur Best├Ątigung seiner Worte dem Beamten seinen Pass.
Peter fragte sich, was der Bruder im Schilde f├╝hrte. Mit angehaltenem Atem beobachtete er, wie der Beamte missmutig den Pass ├Âffnete. Peter erschrak als er sah, dass zwischen den Seiten ein Geldschein lag. W├╝rden sie nun wegen versuchter Beamtenbestechung verhaftet?
Aber seine Bef├╝rchtungen erf├╝llten sich nicht: Ohne mit der Wimper zu zucken fischte der Beamte den Geldschein heraus und lie├č ihn unauff├Ąllig in seiner Tasche verschwinden.
„Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?“, fragte er und gab Johann den Pass zur├╝ck. „Willkommen in ├ägypten! Ich w├╝nsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.“
Peter sagte sich, dass dies ein teueres Vergn├╝gen war, falls man es ein Vergn├╝gen nennen konnte, in der tabakgeschw├Ąngerten Luft eine Baracke herumzustehen, bis man an der Reihe war. Wahrscheinlich mussten sie noch daf├╝r dankbar sein, dass der Beamten sich soweit den Landesgepflogenheiten angepasst hatte, dass er sich hatte bestechen lassen. In England h├Ątte er uns ohne gro├čes Federlesen in den Tower werfen lassen, dachte Peter schlecht gelaunt und noch immer wunderte er sich ├╝ber Johann.
„Warum hast du mich nicht in deinen Plan eingeweiht? Ich dachte, ich bekomme einen Herzanfall als ich den Geldschein gesehen habe“, protestierte er, als die Br├╝der au├čer H├Ârweite des Beamten waren. Hier spricht niemand Deutsch. Langsam f├Ąrbt Johanns Verfolgungswahn auf mich ab, dachte er im gleichen Augenblick.
„Das war eine spontane Eingebung!“ Johann zuckte mit der Schulter. „Sei froh, dass sie mir gekommen ist.“
Peter wusste, dass Johann Recht hatte und daher erwiderte er nichts. Als die Br├╝der endlich die Baracke verlie├čen, die als Zollstation diente hatte die Sonne bereits ihren h├Âchsten Stand erreicht. Von ├╝berall erklangen die Rufe der Muezzins, die zum Mittaggebet aufforderten. Alles war hier anders als zuhause: die Farben, die Gew├Ąnder, die wei├č get├╝nchten Geb├Ąude und die filigranen Schriftzeichen, die eher Zierb├Ąndern ├Ąhnelten als lateinischen Buchstaben.
„Was f├╝r eine unertr├Ągliche Hitze!“, fluchte Johann vor sich hin und wischte sich mit dem ├ärmel die Schwei├čtropfen von der Stirn.
Am Pier warteten bereits Scharen von Gep├Ącktr├Ągern, selbsternannten Cicerones und Schleppern von Restaurants und Hotels auf die Passagiere des Dampfschiffs aus Genua. Bald waren die Br├╝der von einer wild gestikulierenden Menge mehr oder weniger junger M├Ąnner umgeben, die in schlechtem Englisch auf sie einredeten.
„Unser Gep├Ąck ist zu schwer f├╝r uns“, gab Johann zu bedenken, als Peter sie abwimmeln wollte. „Wir m├╝ssen uns f├╝r einen von ihnen entscheiden.“
Peter pickte sich den erstenbesten Lasttr├Ąger heraus, da er nicht wusste, nach welchen Kriterien er sich entscheiden sollte und die M├Ąnner auf den ersten Blick in ihren langen, wei├čen Gew├Ąndern alle gleich aussahen. Der ├ägypter stutze einen Augenblick beim Anblick der gro├čen Kiste, die der Gep├Ącktr├Ąger des Schiffes vor der Baracke abgestellt hatte. Dann rief er einen Kollegen herbei, der eine Art Schubkarre besa├č. Mit vereinten Kr├Ąften schleppten sie das Gep├Ąck zum Hotel „Alexander the Great“, das sich tats├Ąchlich nur zwei H├Ąuserblocks vom Hafen entfernt befand. Unterwegs bestaunt Peter das bunte V├Âlkergemisch auf der Stra├če. Er sah nicht nur ├ägypter, sondern auch Griechen, Juden und Armenier. Ab und zu schnappte er einige franz├Âsischen Sprachfetzen auf, aber englisch drang sehr viel h├Ąufiger an sein Ohr.┬á┬á
Pl├Âtzlich wurde Peter bewusst, dass er den Tr├Ągern keine Adresse genannte hatte, aber er wollte dar├╝ber lieber nicht nachdenken.
Was mochte die Gep├Ącktr├Ąger wohl ├╝ber uns denken?, fragte sich Peter. Bestimmt halten sie uns f├╝r Kunstdiebe oder f├╝r reiche H├Ąndler. Langsam konnte er die Bedenken des Bruders verstehen. Die Reise war ein aberwitziges Unterfangen, aber nun gab es kein Zur├╝ck mehr.
Es zeigte sich, dass das Hotel neu errichtet war und daher zumindest von au├čen einen guten Eindruck machte. Peter steuerte den Hoteleingang an, um nach einem freien Zimmer zu fragen und Johann wollte ihm folgen.
„Ich glaube, es ist besser, wenn du drau├čen bleibst und das Gep├Ąck bewachst“, meinte Peter mit einem skeptischen Blick auf die Gep├Ącktr├Ąger, „ich traue den Burschen zu, dass sie sich sonst damit aus dem Staub machen.“
Johann zog ein entt├Ąuschtest Gesicht, aber er widersprach nicht.
Als Peter die sauber gefegte Hall betrat, verstummten die Gespr├Ąche im Raum und er fragte sich, ob dies an der gro├čen Kiste lag, die drau├čen auf dem B├╝rgersteig stand. Der Eingangsbereich des Hotels war gro├čz├╝giger als Peter erwartet hatte, aber hinter der Rezeption lie├č sich niemand blicken. Peter dr├╝ckte mit Handballen auf Tischklingel und kurze Zeit sp├Ąter kam ein Gep├Ącktr├Ąger in Hoteluniform durch eine T├╝r geschossen, gefolgt von einem gravit├Ątischen fetten Orientalen in traditioneller Kleidung, der akzeptabel englisch sprach, wenn auch mit einem schwer verst├Ąndlichen Akzent.
Bevor ihn Peter nach etwas fragen k├Ânnte, erkl├Ąrte dieser, dass er sich gl├╝cklich preisen k├Ânnte, dass noch ein Doppelzimmer frei w├Ąre, denn wenn ein Schiff aus Genua anlegt, sei das Hotel meist v├Âllig ausgebucht. Obwohl ihm der Preis des Zimmers unverh├Ąltnism├Ą├čig hoch erschien, erkl├Ąrte Peter nach kurzem Z├Âgern, dass er es nehmen w├╝rde.
„Nummer zw├Âlf, im ersten Stock, unser bestes Zimmer“, behauptete der Rezeptionist als er Peter den Schl├╝ssel ├╝berreichte.
Peter nahm ihn in Empfang und eilte zur Kutsche zur├╝ck, w├Ąhrend ihm der Gep├Ącktr├Ąger des Hotels mit einigem Abstand folgte.
„Hast du ein Zimmer bekommen“, fragte Johann ganz aufgeregt und Peter nickte. „Wie gro├č ist es? Hat es Blick auf das Meer?“
„Keine Ahnung! Wir haben andere Probleme“, fuhr Peter den Bruder an. „Sei froh, dass wir ├╝berhaupt etwas gefunden haben und damit zu es gleich wei├čt: Das Zimmer ist recht teuer.“
Hotelangestellte transportierten das Gep├Ąck auf das Zimmer, und Peter hoffte, dass sie sich nicht allzu viel Gedanken ├╝ber den Inhalt der gro├čen Kiste machte. Die Mumie musste so schnell wie m├Âglich das dem Hotelzimmer verschwinden, und, wenn sie diese zwischenzeitig bei Menas abstellten.
Peter fragte den Gep├Ącktr├Ąger, den er zuerst angeheuert hatte nach dem Preis seiner Dienstleistung. Die Summe, die dieser ihm nannte war dreimal so hoch, wie der Betrag, der auf dem Hinweisschild am Hafen verzeichnet war. Peter sah, dass Johann protestieren wollte, aber er hielt ihn zur├╝ck.
„Wie k├Ânnen uns das leisten“, meinte er beschwichtigend und h├Ąndigte dem Mann die geforderte Summe aus, aber er gab ihm kein Trinkgeld.
Zum Abschied dr├╝ckte der ├Ąltere der beiden Gep├Ącktr├Ąger Peter die Karte eines Lokals „mit t├Ąglichen Bauchtanzvorf├╝hrungen“ in die Hand und Peter dachte sich, dass Mutter wahrscheinlich genau diese Vorstellung von ├ägypten hatte.
Die Br├╝der stiegen eine geschwungene Steintreppe hoch, auf deren Stufen ein roter L├Ąufer lag, der das Ger├Ąusch der Schritte d├Ąmpfte. Am Treppenabsatz befand sich die T├╝r mit der Nummer zw├Âlf, die gl├╝cklicherweise mit lateinischen Buchstaben angebracht war Peter dr├╝ckte die T├╝rklinke herunter. Als er hineinsah, blieb er erstaunt im T├╝rrahmen stehen. Zwar schienen die M├Âbel ├Ąlter zu sein als das Hotelgeb├Ąude, aber das Zimmer besa├č eine hohe Decke und einen Balkon mit einem atemberaubenden Blick auf den Hafen. ├ťberall lagen Teppiche und bunt bestickte Kissen herum.
Johann lie├č sich augenblicklich wie ein Stein auf das Bett fallen, w├Ąhrend Peter misstrauisch die Kiste mit der Mumie begutachtete, die man in der Raumecke abgestellt hatte. Erleichtert stellte er fest, dass sich niemand an ihr zu schaffen gemacht hatte.
„Ich bin ja auch ziemlich fertig“, sagte er dann zu dem Bruder, der noch immer auf dem Bett lag, die Arme unter dem Nacken verschr├Ąnkt, „Aber wir sollten uns auf die Suche nach diesem Menas machen. Ich habe auf dem Stadtplan notiert, wo sich die koptische Kirche befindet, in der er Priester ist.“
„M├╝ssen wir wirklich bei dieser Hitze rausgehen? Bestimmt halten die Einheimischen alle Mittagsschlaf!“
Johann sah so blass aus, dass Peter ein schlechtes Gewissen bekam, aber er lie├č sich nicht erweichen.
„Wir sollten uns also beeilen. Je fr├╝her wir Alexandria wieder verlassen k├Ânnen, desto besser! Mir hat auch die Art und Weise nicht gefallen, in der die Hotelangestellten die Kiste mit der Mumie angestarrt haben.“
Johann fuhr hoch und ganz pl├Âtzlich war alle Schl├Ąfrigkeit von ihm abgefallen.
„Erwartest du eigentlich von mir, dass ich in einem Raum mit der Mumie schlafe?“, rief er entsetzt aus.
Peter atmete tief durch und er sagte sich, dass er den Bruder nicht anbr├╝llen durfte, denn dann w├╝rde die Situation eskalieren.
„Wie ich vorhin schon gesagt habe: Wir suchen diesen Priester Menas. So schwer kann das in diesem verdammten Kaff doch nicht sein. Ich werde ihn bitten, dass er die Mumie in seine Obhut nimmt, denn mir ist es nicht geheuer sie unbeaufsichtigt im Hotel zu lassen.“┬á
M├╝hsam rappelte Johann sich auf und die Br├╝der kehrten in die Hall zur├╝ck, gingen an der Rezeption vorbei, ohne den Zimmerschl├╝ssel abzugeben und durchschritten die T├╝r, w├Ąhrend die Blicke der Hotelangestellten und – G├Ąste ihnen folgten.
„Wir m├╝ssen dieser Stra├če folgend“, sagte Peter, als er vor dem Hoteleingang seine Karte konsultiert hatte und deutete in eine schmale, aber sehr betriebsame Seitenstra├če, aus der ihnen ein Wasserverk├Ąufer entgegenkam, der lautstark seine Ware anpries. „Offenbar halten doch nicht alle Siesta, wie du vermutet hast.“┬á
„Vielleicht wohnt dieser Menas gar nicht mehr in Alexandria oder er ist inzwischen gestorben“, sagte Johann vorwurfsvoll. Er zog Luft durch die Nase ein und verzog dann sein Gesicht, da ihm offenbar die Ger├╝che missfielen, die hier allgegenw├Ąrtig waren.
Peter hingegen war zunehmend fasziniert von der fremden Welt, die ihm umgab. Er musste sich selbst eingestehen, dass er bisher keinen Gedanken daran verschwendet hatte, wie es im zeitgen├Âssischen ├ägypten aussehen mochte, denn er hatte sich ausschlie├člich f├╝r das Reich der Pharaonen interessiert. Umso ├╝berw├Ąltigender waren nun die mannigfaltigen Ger├Ąusche und D├╝fte Alexandrias f├╝r ihn. Sto├čweise schlugen ihm Geruchswolken entgegen. Der Duft von Gew├╝rzen mischte sich mit Rauch und dem Gestank des Strohs in den St├Ąllen. Maultiere zogen Karren, deren R├Ąder ├╝ber das Pflaster polterten. In den Innenh├Âfen der H├Ąuser standen Dattelpalmen, deren zerzauste Bl├Ątter sich im Sommerwind bewegten. H├Ąndler sa├čen phlegmatisch hinter ihrer Ware und zogen bed├Ąchtig an ihren langen Wasserpfeifen. In ihren farbigen Gew├Ąndern und den wei├čen Turbanen oder den roten t├╝rkischen Fes erinnerten sie Peter an die Prinzen in den M├Ąrchen seiner Kindheit. Nur schade, dass man gar keine Frauen auf den Stra├čen sah, dachte er, zumindest ein paar verschleierte Damen hatte er anzutreffen erwartet.
„Wir h├Ątten diesem Menas schriftlich unseren Besuch ank├╝ndigen sollen“, gab Johann nach einer Weile zu bedenken.
„Das habe ich dir doch schon mindestens zehnmal w├Ąhrend der ├ťberfahrt erkl├Ąrt!“, erwiderte Peter enerviert, „Der Brief w├Ąre nicht vor uns angekommen, aber wir h├Ątten riskiert, den englischen Geheimdienst auf uns aufmerksam zu machten!“
„Also, so interessant sind wir nicht!“ Johann lachte. „Wir h├Ątten ja die Mumie in dem Brief nicht erw├Ąhnen m├╝ssen.“
Mittlerweile waren die Br├╝der von einer Schar zerlumpter, barf├╝├čiger Knaben umringt, die lautstark ihre Dienste als Stadtf├╝hrer anpriesen.
„Are you english?“, riefen sie von allen Seiten, aber dies war offenbar der einzige ausl├Ąndische Satz, den sie beherrschten, denn wenn einer der Br├╝der dies bejahte, wiederholten sie monomanisch ihre Frage. Es mangelte auch nicht an Erwachsenen, die ganz begierig darauf waren, ihre Stadt zu zeigen, aber Peter traute ihnen nicht ├╝ber den Weg. Sie hatten es nur auf das Bakschisch abgesehen und w├╝rden sie – der h├Âheren Einnahmen wegen – mutwillig im Kreise herumf├╝hren.
Die Plagegeister ignorierend, ging Peter voran. In der Hand hielt er den Stadtplan, auf dem er die Kirche mit einem Kreuz gekennzeichnet hatte. Johann folgte und schimpfte ohne Unterlass vor sich hin. Peter lie├č sich nicht hetzten, denn er wusste, dass sie nur mit M├╝he wieder zur├╝ckfinden w├╝rden, sollten sie vom Weg abkommen. Sie sprachen kein arabisch und konnten daher auch keine Hinweisschilder lesen.
„Vater hat in einem seiner Briefe berichtet, dass die Leute hier erschreckend gesch├Ąftst├╝chtig sind“, bemerkte Johann und er klang ziemlich enerviert.
Peter blieb vor einem Stand mit frischen Datteln und Feigen stehen, deren Anblick ihm ins Bewusstsein rief, dass l├Ąngst Zeit f├╝r das Mittagessen war. Der dazugeh├Ârige H├Ąndler schien ein Nickerchen zu machen. Neben ihm sa├č ein Teppichh├Ąndler im Schneidersitz auf einem Podest und zog an seiner langen Pfeife. Hinter ihm war an der Hauswand ein besonders feiner Teppich an der Hauswand aufgeh├Ąngt und Peter musste an die Mumie denken, die in einen ├Ąhnlichen Teppich eingewickelt war. Der Teppichh├Ąndler ber├╝hrte den Gem├╝seh├Ąndler mit dem Ende seiner Pfeife, dieser schreckte aus seinem Halbschlaf auf und pries lautstark seine Ware an. Als Peter nicht sofort reagiert, reichte er ihm mit einem geflissentlichen L├Ącheln eine Dattel. Schon wollte Peter danach greifen, als Johann ihm in den Arm fiel.
„Du darfst sie nichts anfassen!“, ermahnte ihn den Bruder und er klang alarmiert. „Hast du denn nicht geh├Ârt, was f├╝r Seuchen hier grassieren? Wir d├╝rfen nur abgekochte Nahrung essen!“
Musste der ├Ąngstliche Bruder immer so ein Spielverderber sein?
„Die ganze Reise lang? Wie stellst du dir das eigentlich vor“, gab Peter zu bedenken.
„Denk an Vater! Wer wei├č, was er sich hier eingefangen hat“, erwiderte Johann und zog ihn am Arm mit sich fort. „Ich bin ja auch schrecklich hungrig. Vielleicht haben wir Gl├╝ck und dieser Priester l├Ądt uns zum Essen ein.“
„Dazu m├╝ssen wir ihn erst finden“, erkl├Ąrte Peter und warf einen sehnsuchtsvollen Blick zur├╝ck auf die Fr├╝chte.
Der H├Ąndler hatte ihn bereits als hoffnungslosen Fall aufgegeben, denn er plauderte mit einem jungen Wasserverk├Ąufer.
Peter blieb stehen, um die Karte zu studieren und Johann schaute ihm von hinten ├╝ber die Schulter. Die Stra├čenjungen wurden immer l├Ąstiger. Offenbar interpretierten sie die Tatsache, dass die Fremden stehen geblieben waren als Zeichen von Hilflosigkeit. Nun boten sie nicht mehr ihre Dienste als wasauchimmer an, sondern gaben sich unverhohlen als Bettler zu erkennen. Von allen Seiten wurden die Br├╝der von kleinen H├Ąnden ber├╝hrt, die sofort wieder verschwanden, wenn man nach ihrem Besitzer Ausschau hielt.
Peter griff intuitiv nach der Brieftasche, um sich zu vergewissern, dass sie noch da war.
„Gib Ihnen blo├č nichts“, ermahnte ihn Johann, der die Geste falsch interpretiert hatte, „Sonst verzehnfacht sich ihre Anzahl!“
„Hatte ich auch nicht vor“, erwiderte Peter und wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Karte zu.
Die Bettler redeten mit entt├Ąuschten Gesichtern auf die Br├╝der ein und begleiteten ihre Worte mit ausdrucksvollen Handbewegungen. Peter ├Ąrgerte sich, dass er kein Wort der Landessprache beherrschte, denn er h├Ątte die aufdringlichen Gesellen gern zum Teufel geschickt.
Vor dem Portal eines herrschaftlichen Hauses zur linken stand schwarzer W├Ąchter mit einer langen Lanze, der ohne mit der Wimper zu zucken das Schauspiel betrachtete.
„Das war eine bl├Âdsinnige Idee, hier einfach allein auf der Stra├če herumzulaufen. Offenbar braucht man einen einheimischen Begleiter“, fluchte Johann vor sich hin, „Hoffentlich k├Ânnen wir bald wieder nach Hause fahren.“
„Wir sind fast am Ziel“, meinte Peter, den Kommentar des Bruders ignorierend und deute auf die vor ihnen liegende Kreuzung. „Da vorne m├╝sste die Kirche stehen, komisch, dass man sie nicht sieht.“
„Und was ist mit diesem freistehenden Turm, der die D├Ącher ├╝berragt?“, fragte Johann.
Auch Peter hatte den Turm schon bemerkt, aber er h├Ątte einen seltsamen Kirchturm abgegeben, wei├č get├╝ncht wie er war und mit seinem kuppelf├Ârmigem Abschluss.
„Der wird wohl zu einer Moschee geh├Âren. Er sieht f├╝r mich nach einem Minarett aus“, vermutete Peter, aber ihm fiel im gleichen Augenblick ein, dass auf dem Stadtplan in dieser Gegend keine Moschee verzeichnet war. Also sch├Âpfte er neue Hoffnung und beschleunigte seine Schritte.
Als die Br├╝der die Weggablung erreichten, zeigte sich, dass tats├Ąchlich ein kleines wei├čes Kirchlein vom pr├Ąchtigen Nachbarhaus verdeckt worden war. Sie gingen zur hohen, der Stra├če zugewandtem Schmalseite, die oben einen halbkreisf├Ârmigen Abschluss besa├č. Peter drehte am T├╝rknauf des h├Âlzernen T├╝rfl├╝gels, doch die T├╝r lie├č sich nicht ├Âffnen.
„Hallo, ist da jemand drin“, rief er so laut er konnte, aber es kam keine Antwort aus dem Inneren der Kirche.
Frustriert schlug er mit der Faust gegen die T├╝r mit ihren altert├╝mlichen Schnitzereien, aber wieder reagierte niemand.
„Er macht bestimmt Mittagsschlaf“, meinte Johann, „Wie jeder vern├╝nftige Mensch bei dieser gottverdammten Hitze.“
„Ob es hier so etwas wie ein Pfarrhaus gibt?“, fragte Peter eher sich selbst als den Bruder. „Selbst wenn Menas nicht zuhause ist, k├Ânnten wir ihm eine Nachricht hinterlassen.“
Die Br├╝der studierten die Nachbarh├Ąuser, aber eins sah aus wie das andere: wei├č get├╝ncht, schmucklos und mit flachem Dach. Auch lie├č sich leider niemand auf der Gasse blicken, den sie h├Ątten nach dem Priester fragen k├Ânnen.
„Das ist nicht gerade unser Gl├╝ckstag“, bemerkte Peter, dem es langsam reichte, resigniert. „Was um Gottes Willen machen wir jetzt?“
„Wir gehen in ein Lokal, falls es hier so etwas geben sollte. Ich sterbe n├Ąmlich mittlerweile vor Hunger“, schlug Johann vor, „Vielleicht ist diese Kirche heute Nachmittag wieder ge├Âffnet.“
Peter war erstaunte darüber, wie der Bruder oft zwischen Ängstlichkeit und Leichtsinn schwankte.
„Vorhin hast du doch selbst gesagt, dass wir vorsichtig sein sollten mit dem, was wir essen“, erwiderte er, „Wir sollten daher lieber ins Hotel zur├╝ckkehren. Es ist ja nicht weit und man bietet dort einen Mittagstisch an.“
Die Br├╝der trotteten also durch sonnendurchgl├╝hten Gassen zum Alexander the Great zur├╝ck, wo sie im Speisesaal zwei gro├če St├╝cke halbrohem Rindfleischs herunterschlangen, das ihnen als englische Spezialit├Ąt angepriesen worden war. Danach tranken sie einen Mokka, der wunderbar aromatisch war.
├ťberall huschten Dienstboten und Kellner herum und Peter hatte w├Ąhrend des gesamten Mahls den Eindruck, dass diese st├Ąndig die K├Âpfe zusammenstecken, um ├╝ber ihn und seinen Bruder zu tuscheln. Er beschloss, vor dem Aufbruch lieber nochmals im Zimmer nach dem Rechten zu sehen, nicht dass jemand die Mumie gestohlen hatte.
„Ich w├╝rde mich gern noch etwas frisch machen, bevor wir wieder aufbrechen“, schob er vor, da er Johann nicht beunruhigen wollte.
Als Peter die T├╝r des Hotelzimmers aufgeschlossen hatte und sich misstrauisch im Raum umsah, sp├╝rte er geradezu, dass etwas nicht stimmte. Er durchma├č das Zimmer mit langsamen Schritten. Dann bemerkte er, was seinen Argwohn erregt hatte.
„Jemand hat unsere Kiste verr├╝ckt!“, rief er so laut aus, dass Johann, der auf dem Balkon stand zusammenfuhr. „Nur wenige Zentimeter, aber man sieht Schleifspuren auf dem Boden.“
Anklagen deutete er auf die farbigen Keramikfliesen. Johann gesellte sich zu ihm, auch er wirkte alarmiert. Beide begutachteten die Kiste, konnten aber keine Spuren von Gewaltanwendung erkennen.
„Trotzdem sollten wir hineinschauen, ob alles in Ordnung ist“, meinte Peter.
„Ich will die Mumie aber nicht sehen“, protestiere┬á Johann augenblicklich.
„Dann schaust du eben weg“, erwiderte er und fragte sich, womit er das alles verdient hatte.
Eigentlich brauchte er zum ├ľffnen der Transportkiste eine Zange und ein Stemmeisen, aber er w├╝rde sich wohl anderweitig behelfen m├╝ssen. Peter schaute sich im Badezimmer und dann im Schlafraum um. Allenfalls die Gardinenstange war vielleicht brauchbar. Als Peter einen Stuhl zum Fenster schleppte h├Ârte er den Bruder leise schnauben.
„Mach doch bei der Hitze nicht so einen Aufwand!“, meinte er. Peter drehte sich um und sah, dass Johann die Kiste begutachtete. „Ich finde, man sieht mit einem Blick, dass das Ding nicht ge├Âffnet worden ist. Wir waren auch nur h├Âchstens eine halbe Stunde weg.“
„Und dieser Kratzer?“. Peter zeigte anklagend auf den die Vorderseite des Abdeckbrettes.
„Der war schon drin, als Vater die Kiste mitgebracht hat. Ich erinnere mich genau daran.“
Peter war kurz davor, den Bruder daf├╝r zur Rechenschaft zu ziehen, dass er dies nicht gleich gesagt hatte, aber ihm wurde bewusst, dass er ihn nicht danach gefragt hatte. Das ist bestimmt die Hitze, sagte er sich. Er lie├č sich auf das Bett fallen und starrte die frisch gekalkte Decke des Hotelzimmers an.
„Einer von uns beiden muss hier bleiben, w├Ąhrend der andere den Priester sucht“, meinte er nach einer Weile, „Wir k├Ânnen die Kiste nicht unbeaufsichtigt lassen.“
„Ich bleibe nicht allein in einem Raum mit der Mumie!“, rief Johann entsetzt aus, der zusammengesunken auf einem bombastischen Sessel in der Ecke des Raums sa├č. „Das kann keiner von mir erwarten.“
„Dann wirst du wohl zu dieser Kirche zur├╝ckgehen m├╝ssen“, erwiderte Peter, noch immer die Decke anstarrend.
„Von mir aus“, meinte Johann fatalistisch und zu Peters gro├čer ├ťberraschung st├╝tzte er sich nur Sekunden sp├Ąter mit beiden H├Ąnden von der Sitzfl├Ąche des Sessels ab und erhob sich langsam wie ein alter Mann.┬á
„Sei vorsichtig!“, ermahnte ihn Peter, aber Johann erwiderte nichts, sondern verlie├č schweigend den Raum.
 
Die Apotheke
8. Die Apotheke
Kurz nach Mitternacht verlie├čen die Br├╝der leise ihre Zimmer. Auf leisen Sohlen durchquerten sie den vom Mond nur schwach erleuchteten Flur. Im Treppenhaus war es mucksm├Ąuschenstill und die Haust├╝r bereits verriegelt. Auch auf der Stra├če war kein Mensch zu sehen. Der Himmel war von Wolken verhangen, nur die Gaslaternen spendeten etwas mattes Licht.┬á
Johann biss sich nerv├Âs auf die Unterlippe. Es graute ihm vor dem Einbruch fast so sehr wie vor der bevorstehenden Reise und er fragte sich, ob er sein Elternhaus wohl jemals wieder sehen w├╝rde. Er drehte sich um und warf einen letzten sehns├╝chtigen Blick auf die Villa und den gro├čen Garten, der sie umgab. In diesem Augenblick h├Ątte er liebend gern die Gartenarbeit erledigt, vor der er sich sonst m├Âglichst dr├╝ckte. Was mochte wohl die Mutter sagen, wenn sie ihre Betten verwaist vorfinden w├╝rde? Hoffentlich kam sie nicht auf die Idee Wilhelm zur├╝ckrufen! Johann zwang sich, an etwas anderes zu denken, bevor er in finsterster Schwermut versank.
„Warum kommt Moritz mit?“, fragte er nach einer Weile, da ihm ganz pl├Âtzlich ins Bewusstsein kam, dass Peter vorhin beil├Ąufig erw├Ąhnt hatte, sein Freund w├╝rde sie vor der Apotheke erwarten. „Irgendwie traue ich ihm nicht mehr ├╝ber den Weg.“
Peter zuckte fatalistisch mit den Schultern.
„Wie oft soll ich dir denn das noch sagen! Wir mussten das Gep├Ąck und die Versandkiste mit dem Sarkophag in seiner Bude verstecken. Anderenfalls w├Ąre er der letzte gewesen, den ich eingeweiht h├Ątte.“
„Aber musstest du ihm deshalb gleich sagen, dass wir in die Apotheke einbrechen werden?“, protestierte Johann.
„Wie h├Ątte ich ihm sonst erkl├Ąren sollen, dass wir mitten in der Nacht mit Mumie bei ihm aufkreuzen?“, fragte Peter h├Ârbar enerviert zur├╝ck. „Au├čerdem bringt er uns den Teppich mit.“
„Trotzdem gef├Ąllt mir nicht, dass Moritz heute Nacht mit dabei ist!“
„Er war ganz Feuer und Flamme als er vom dem Einbruch h├Ârte und ich dachte, wenn wir ihn mitnehmen, kann er uns sp├Ąter nicht verpfeifen. Dann h├Ąngt er in der Sache mit drin.“
„Das h├Ârt sich eher nach taktischer Kriegsf├╝hrung als nach Freundschaft an“, gab Johann zu bedenken. „Au├čerdem, wie sagt man so sch├Ân: viele K├Âche verderben den Brei.“
„Es wird schon klappen!“, behauptete Peter, aber sein Bruder merkte, dass er dies tat um ihn aufzumuntern, denn sein angespannter Gesichtsausdruck verriet, dass auch er sich Sorgen machte.
Die Wolkendecke riss auf und zwischen den Wolken leuchteten die Sterne und die Sichel des Monds.
„Auch das noch“, fluchte Peter leise vor sich hin. „Wir h├Ątten die Finsternis gut als Deckmantel gebrauchen k├Ânnen. ┬á
„Solange die Stra├čenlaternen brennen sind ist das auch egal“, meinte Johann, dem dieses Argument nicht recht einleuchten wollte.
Sie hatten das Ende der Stra├če erreicht und Johann drehte sich ein letztes Mal nach seinem Zuhause um. Die verwaiste Stra├če wurde vom Mond beschienen und in seinem sanften Licht sah die Villa aus wie ein Puppenhaus.
Pl├Âtzlich sah Johann auf der anderen Stra├čenseite einen Passanten, der ihnen entgegen kam. Obwohl er sofort demonstrativ in nach rechts schaute erkannte er ihn sofort: es war der Hausarzt, der wohl wegen eines ├Ąrztlichen Notfalls um diese sp├Ąte Stunde unterwegs war und Johann hoffte, dass dieser ihn und seinen Bruder nicht erkannt hatte.
„Achtung, der Doktor Winter, auf der anderen Seite“, fl├╝sterte er Peter zu und er hoffte inst├Ąndig, dass dieser seine Frau betrog und auch nicht gesehen werden wollte. War er ├╝berhaupt verheiratet? Johann konnte es sich nicht vorstellen, so besserwisserisch wie der Arzt war.
„Hab ihn schon gesehen!“, wisperte Peter zur├╝ck und auch er studierte nun die H├Ąuser am Stra├čenrand als ob er ein gro├čer Architekturliebhaber w├Ąre. Johann sagte sich zur Beruhigung, dass sie in einem Stadtviertel lebten, dessen distinguierte Bewohner sich f├╝r gew├Âhnlich nicht in die Angelegenheiten ihrer Nachbarn einmischten, aber er war nicht ganz sicher, ob dies auch f├╝r den Arzt zutraf. Dabei waren sie beide alt genug um niemandem f├╝r ihren n├Ąchtlichen Spaziergang Rechenschaft zu schulden. Johann lauschte mit angehaltenem Atem, ob der Arzt ihnen etwas zurief, aber nichts dergleichen geschah. Den restlichen Weg zur Apotheke legten die Br├╝der wortlos zur├╝ck.
Als Johann das schmucke Eckhaus sah, dessen helle Steinquader ihm in der Nacht entgegenleuchteten, hoffte er einen Augenblick lang, dass Moritz sie versetzt hatte. Dann sah er den massigen jungen Mann vor dem benachbarten Fachwerkhaus den geradezu r├╝hrenden Versuch unternehmen, sich unauff├Ąllig im Verborgenen zu halten. Er war von Kopf bis Fu├č schwarz gekleidet, trug aber seine Burschenschaftssch├Ąrpe und ├╝ber die Schulter hatte er den Orientteppich gelegt, in den sie die Mumie einwickeln wollten.┬á┬á┬á
Als die beiden Freunde sich begr├╝├čten, fand Johann, dass sein Bruder ein miserabler Schauspieler war, da dieser seine Ressentiments gegen├╝ber Moritz nicht zu verbergen vermochte.
Peter fragte Moritz, ob er sich an Johann erinnerte und dieser nickte, bedachte ihn aber dabei mit einem Blick, der vermuten lie├č, dass er nicht viel von ihm hielt. Was f├╝r eine seltsame Frage, dachte Johann, schlie├člich hatte Peter seinen Freund fr├╝her oft mit nach Hause gebracht. Offenbar war auch der Bruder mittlerweile ziemlich nerv├Âs.
„Dann wollen wir mal!“, sagte er unvermittelt zu Moritz. „Du wartest hier drau├čen. Wenn du irgendetwas Verd├Ąchtiges h├Ârst, dann pfeifst du laut.“
„Ich dachte, ich komme mit!“, rief Moritz entt├Ąuscht aus.
Peter schluckte und suchte dabei nach den richtigen Worten.
„Die Schwanen-Apotheke geh├Ârt unserem Onkel. Wenn er uns erwischt, dann wird er sicher ziemlich b├Âse, aber ich glaube nicht, dass er gleich die Polizei ruft“, sagte er schlie├člich. „Wenn ein Fremder dabei ist, k├Ânnte er vielleicht anders reagieren.“
Johann fand, dass sich dies vern├╝nftig anh├Ârte, auch wenn sich der Bruder dies wohl nur aus den Fingern gesaugt hatte. Trotzdem w├╝nschte er, Peter w├╝rde dem Wunsch seines Freundes entsprechen. Er selbst w├╝rde sich gern damit begn├╝gen, drau├čen Schmiere zu stehen.
Moritz f├╝gte sich – wenn auch missmutig etwas von „Gemeinheit“ und „Spielverderber“ in sich hineinbrummend - in sein Schicksal und Peter l├Âste einen riesigen Schl├╝sselbund den er am G├╝rtel getragen hatte. Er machte einen hochprofessionellen Eindruck, als habe ihn ein Einbrecher ausgeliehen.
„Wo hast du den denn her?“, wollte Johann wissen.
Der Bruder blickte ihn in sich hineinl├Ąchelnd an.
„Frag mich lieber nicht!“┬á┬á┬á
Dann machte er sich am Schloss der Apotheke zu schaffen. Die beiden anderen beobachteten je eine Stra├če. Leise klickende Ger├Ąusche drangen an ihr Ohr und Johann fragte sich erneut, woher der Bruder die Schl├╝ssel hatte. Sein┬á Blick streifte das Fenster, in dem Keramikgef├Ą├če standen. Wenigstens machte der Onkel noch nicht Reklame f├╝r frisch eingetroffenes erstklassisches Mumia.
Johann h├Ârte ein scharfes, metallisches Klicken, dann ein Knirschen und er drehte sich zu seinem Bruder um.
„Ich habe es geschafft!“
Mit triumphaler Miene ├Âffnete Peter die T├╝r, aber nur einen Spalt breit, sodass er selbst und sein Bruder hindurchschl├╝pfen konnten. Dann verriegelte er sie von innen.
Johann hatte noch nie gern die Apotheke betreten, denn sie erinnerte ihn an Siechtum und Tod, doch niemals zuvor war sie ihm so unheimlich erschienen wie in dieser Nacht. Vom bleichen Licht des Mondes beschienen wirkten die Regale voller Keramik- und Glasgef├Ą├čen, die sich nur durch ihre Beschriftung unterschieden wie das Arsenal eines Giftmischers. Hinter den Milchglast├╝ren eines bis zur Decke reichenden Schrankes erkannt Johann die verschwommenen Umrisse weiterer Beh├Ąltnisse, bestimmt enthielten sie in Alkohol eingelegte Fr├Âsche oder dergleichen gr├Ąssliche Dinge. Von der Decke hing ein Krokodil herab, das noch im getrockneten Zustand bedrohlich seine Z├Ąhne bleckte. Wo aber mochte der Onkel die Mumie versteckt haben?
„Wollen wir nicht eine Lampe anz├╝nden?“, fragte er leise seinen Bruder, der sich wie er selbst im Raum umblickte.
„Zu auff├Ąllig!“, fl├╝sterte Peter zur├╝ck. „Die Mumie ist gro├č genug. Wir sollten sie auch so finden. Es ist doch gut, dass der Mond scheint.“
Peter ging hinter die Theke, wo eine T├╝r in das Lager f├╝hrte und Johann folgte ihm. Ihre Schritte hallten durch die Dunkelheit und Johann fluchte innerlich ├╝ber den protzigen Steinboden der Apotheke.
Peter dr├╝ckte vorsichtig die Klinke herunter und ├Âffnete die T├╝r. Im gleichen Augenblick sprang ein Ungeheuer fauchend aus dem Lagerraum direkt auf Johann zu. Seine scharfen Krallen bohrten sich in den ├ärmel seiner Jacke und Johann schrie laut auf. Er wollte ausweichen, machte einen Schritt nach hinten, stolperte dabei und landete auf seinem Hosenboden.
Peter fuhr herum, seinem Bruder w├╝tende Blicke zuwerfend und Johann erkannte, dass es nur die Katze des Apothekers war, die ihn so erschreckt hatte. Sie hatte sich an seiner Jacke festgekrallt und das gr├╝ne Feuer Ihrer schr├Ągstehenden Augen funkelte ihn wild an.
Johann packte das Tier mit der freien Hand im Nacken. Die Katze schlug nach ihm mit der Tatze, aber Johann hielt sie sich mit ausgestrecktem Arm vom Leib bis sie kapitulierte und die Beine schlaff herunterh├Ąngen lie├č. Dann rappelte er sich wieder auf, die Katze durch die ge├Âffnete T├╝r in die Apotheke, h├Ârte sie gerade noch fauchend landen, dr├╝ckte aber augenblicklich die Klinke im Schloss herunter und sperrte die Katze damit aus.
„Was f├╝r eine Bestie“, murmelte er vor sich hin und wischte sich mit dem ├ärmel die Stirn ab.
Der Bruder klopfte ihm aufmunternd auf den R├╝cken und Johann grinste ihn an. Die Situation entbehrte nicht einer gewissen Komik.
„Schau!“, sagte Peter, mit dem Zeigefinger in den Raum deutend.
Nun erkannte auch Johann, dass die Mumie auf dem Tisch in der Mitte der Kammer lag und es schauderte ihn. Es war das erste Mal, dass er die Mumie sah, denn an dem schrecklichen Tag, als der Vater zur├╝ckgekehrt war, war er schon beim Anblick des Sarkophags in der Versandkiste umgekippt.
Der einbandagierte K├Ârper war von den Kn├Âcheln bis zu den Schultern mit einem Netz aus blauen Perlen bedeckt, das unter dem auf Leinen gemalten Bildnis einer jungen Frau endete. Als er n├Ąher getreten war, sah Johann, dass das Netz aus blauen R├Âhrenperlen aus Fayence zusammengesetzt war, die diagonal in Rautenform gelegt waren. Diese gr├Â├čeren Perlen waren mithilfe von kleineren zusammengef├╝gt. Auf Brusth├Âhe war zwischen den Perlen ein Skarab├Ąus aus dunkelblauer Fayence eingef├╝gt, dessen Fl├╝gel Lotosbl├╝ten ├Ąhnelten. Die Umh├╝llung sollte der Mumie offenbar gr├Â├čtm├Âglichen Schutz bieten, aber hin- und hergerissen zwischen Anziehung und Absto├čung fand Johann sie zu seinem eigenen Erstaunen sch├Ân.
Aber die Mumie mit blo├čen H├Ąnden anfassen? Johann wurde bei der blo├čen Vorstellung vom Grauen ergriffen.
„Komm, du Traumt├Ąnzer!“, tadelte ihn der Bruder. „Biet keine Maulaffen feil. Wir sollten schleunigst von hier verschwinden!“
Johanns Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, aber er beherrschte sich, denn er wusste, dass der Bruder Recht hatte. Nur h├Ątte er ihn auch etwas netter zum Gehen auffordern k├Ânnen.
Peter packte die Mumie an der Schulter und Johann streckte die H├Ąnde nach ihren F├╝├čen aus, hielt aber in der Bewegung inne, bevor seine Finger die Bandagen ber├╝hrten, so sehr widerstrebte es ihm, diese anzufassen.
„Johann!“
In der Stimme des Bruders lag ein zorniger Unterton und Johann gab sich einen inneren Ruck. Mit einer schier ├╝bermenschlichen Anstrengung legte er seine Finger auf die F├╝├če┬á der Mumie. Er versp├╝rte augenblicklich in seinen Fingerspitzen ein leichtes Kribbeln und sein Herzschlag setzte einen Moment lang aus. Es bedurfte seiner gesamten Willenskraft um die Finger um die F├╝├če zu schlie├čen. Johann brach der Schwei├č aus und er h├Ątte die Mumie fast wieder fallen lassen, denn er erwartete einen Augenblick lang, dass er zu einer Statue versteinerte oder dass ihn die Rache der Wanderseele traf.
Peter warf ihm einen tadelnden Blick zu. Johann seufzte, denn er fragte sich, ob er nun von der t├Âdlichen Krankheit befallen war, die den Vater binnen Tagen hinweggerafft hatte.
„Jetzt stell dich nicht so an!“
Johann kapitulierte. Widerstrebend hob er zusammen mit seinem Bruder die Mumie vom Tisch hoch. Vorsichtig und mit tastenden Schritten trugen die Br├╝der ihre Last durch den dunklen Hinterraum zur T├╝r.
„Hoffentlich lauert die gemeingef├Ąhrliche Katze nicht in der Apotheke auf uns!“, bemerkte Johann als Peter die T├╝r mit dem Ellbogen ├Âffnete. „Wei├čt du eigentlich, wie sie hei├čt.“
„Lotte“, erkl├Ąrte der Bruder.
Johann traute seinen Ohren nicht. Wie konnte man eine Katze schwarze Lotte nennen?
„Was f├╝r ein unpassender Name!“, bemerkte er mit ged├Ąmpfter Stimme.
„Wie h├Ąttest du sie denn genannt?“, wisperte der Bruder zur├╝ck.
„Lady Macbeth vielleicht“, ├╝berlegte er, „oder Lucrezia Borgia!“
Johann h├Ârte seinen Bruder leise lachen.
„Die beiden kennt Tante Henriette bestimmt nicht.“
Johann sp├Ąhte durch den T├╝rspalte, aber Lotte hatte sich offenbar verkrochen. Dann sah er unter der Theke zwei gr├╝ne Augen im Dunkeln gl├╝hen. Jedoch machte die Katze keinerlei Anstalten ihr Versteck zu verlassen.
Die beiden bewegten sich mit der Mumie ganz langsam auf die Ladentür zu, denn inzwischen hatten offenbar sich wieder Wolken vor den Himmel geschoben.  Jedenfalls war es stockfinster in der Apotheke.
„Verdammt!“, fluchte Peter leise und so blieb abrupt stehen, dass Johann beinahe gestolpert w├Ąre.
Er erschrak. Was mochte nun schon wieder los sein? Ob der Onkel in seine Apotheke zur├╝ckgekehrt war?
„Was hast du?“, fragte er leise den Bruder, der sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Knie mit der linken Hand massierte.
„Nichts, ich habe mich nur an diesem bl├Âden Tisch gesto├čen.“ Peter nickte in Richtung des kleinen M├Âbels, das auch Johann ├╝bersehen h├Ątte. „Lass uns weitergehen!“.
Als er auf die T├╝r zuging hinkte Peter leicht, aber sie erreichten ihr Ziel ohne weitere Kontakte mit Tieren oder M├Âbeln. Peter ├Âffnete die Ladent├╝r und sie transportierten die Mumie auf den B├╝rgersteig, wo Moritz sie bereits sehns├╝chtig erwartete.
„Wo wart ihr nur solange?“, fragte er, kaum dass er die Br├╝der sah. „Es sind schon drei M├Ąnner vorbeigekommen und haben mich seltsam angestarrt!“
„H├Âchste Zeit zu gehen!“, stimmte Peter zu. „Ihr wickelt die Mumie ein und ich schlie├če die T├╝r ab.“
Warum?, wollte Johann fragen, aber im selben Augenblick verstand er, dass anderenfalls echte Einbrecher h├Ątten in die Apotheke eindringen k├Ânnen.
Johann genoss einen Augenblick lang die k├╝hle Luft, die ein leichter Wind durch die Stra├če trieb. Er atmete sie mit geschlossenen Augen ein und wurde dabei von einer Welle der Erleichterung durchflutet: bisher hatte alles gut geklappt! Erst jetzt fiel ihm auf, dass er v├Âllig durchgeschwitzt war und, dass sein Puls raste. Trotzdem wusste er, dass es nun kein Zur├╝ck mehr gab.
„Sie ist viel sch├Âner als ich gedacht habe“, stammelte Moritz, der die Mumie mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. „Darf ich sie anfassen?“
„Sp├Ąter“, erwiderte Peter, der noch immer im Schloss herumstocherte mit h├Ârbar angespannter Stimme, „jetzt wickelt sie doch endlich ein!“
„Wir drehen besser die Innenseite nach au├čen. Dann f├Ąllt der Teppich nicht so auf“, schlug Johann vor, um den Bann zu brechen, denn noch immer blickte Moritz wie hypnotisiert auf die Mumie, doch er sagte sich im gleichen Augenblick, dass man den Teppich auch so als solchen erkannte.
Moritz schrak zusammen, wie jemand, dem man von hinten auf die Schulter klopft. Dann nickte er - noch immer etwas gedankenverloren - und drehte den Teppich um. Bevor die beiden die Mumie eingewickelt hatten, gesellte sich Peter zu ihnen, der in der Zwischenzeit den richtigen Schl├╝ssel gefunden und die T├╝r abgeschlossen hatte. Sein strenger Blick irritierte Johann.
„Wir sind schon fertig“, meinte er in einem entschuldigenden Tonfall und ├Ąrgerte sich im gleichen Augenblick ├╝ber sich selbst. Warum brachte er es nicht fertig dem Bruder Paroli zu bieten?
Johann war froh, dass er die eingepackte Mumie nun nicht mehr ansehen musste. Zusammen mit Moritz schulterten er die Mumie, w├Ąhrend Peter mit einigem Abstand voranging um die Lage zu sondieren. Johann hatte es derart vor dem Einbruch gegraut, dass er bisher keinen Gedanken an den Transport der Mumie in Moritzens┬á Bude verschwendet hatte. Nun wurde ihm schlagartig bewusst, dass die Strecke dorthin viel l├Ąnger war als der Heimweg, denn der Freund seines Bruders wohnte am Stadtrand. Und wenn sie jemandem begegnen sollten, der sie kannte? Wie sollten sie ihr n├Ąchtliches Treiben erkl├Ąren? Innerlich vor sich hinfluchend schleppte Johann seinem Bruder nach. Die Stra├čen waren leer, die Fenster der H├Ąuser dunkel, die einzigen Lichtquellen waren die Gaslaternen und der gestirnte Himmel. Au├čer ihnen schlief offenbar die ganze Stadt. Wie Johann die Gl├╝cklichen beneidete!
Aus der Ferne verk├╝ndeten die Glocken des Doms die erste Stunde. Schon so sp├Ąt! Und immer noch trugen Johann und Moritz die Mumie durch die leeren Stra├čen, w├Ąhrend Peter voraneilte und sich umsah. Es war so ruhig, dass ihre Schritte auf dem Kopfsteinpflaster des B├╝rgersteigs ihnen so laut wie trabende Pferde erschienen.
Einige H├Ąuserblocks weiter drang aus einem Eckhaus Stimmengewirr und Gel├Ąchter. Im N├Ąherkommen erkannte Johann, dass es sich um eine sicherlich ├╝bel beleumundete Gastwirtschaft handelte, deren G├Ąste wohl regelm├Ą├čig die ├ťberhockersteuer zahlten. Sie begannen „gaudeamus igitur“ zu singen und Johann realisierte nicht ohne Neid, dass die Wirtshausbesucher Studenten waren.
Es folgten einige Wohnblocks mit Mietsh├Ąusern, dann zeichnete sich gegen den schwarzen Himmel die Silhouette einer gotischen Kirche mit gro├čen Ma├čwerkfenstern ab. Es war eine ehemalige Bettelordenskirche mit einem - von einer niedrigen Mauer umgebenen - Kirchhof, an den sich ein Friedhof anschloss. Nun war es nicht mehr weit! Johann fragte sich, warum er noch immer die Mumie schleppte. H├Âchste Zeit um sich mit der Arbeit abzuwechseln.
„Versteckt Euch sofort im Friedhof!“, rief Peter seinen Kameraden zu, bevor Johann sein Anliegen ├Ąu├čern konnte.
Einen Augenblick lang standen Johann und Moriz unschl├╝ssig vor der Mauer, die etwas mehr als vier Fu├č hoch war. Dann legten sie die Mumie vorsichtig auf den Mauerabschluss. Moritz machte eine Diebesleiter und Johann stieg hinauf. Oben angelangt half er Moritz, der wesentlich kr├Ąftiger war als er selbst die Mauer zu erklimmen und beide sprangen in den Hof.
Johann lauschte. Gespr├Ąchsfetzen drangen von der Stra├če. Peter sprach mit einem fremden Mannen.
„Verdammt!“, entfuhr es Moritz. „Wachtmeister Dimpflhuber! Er will unbedingt Karriere machen und patrouilliert daher manchmal sogar nachts die Stra├čen dieses Viertels.“
„Dann sollten wir uns besser auf dem Friedhof verstecken!“, dr├Ąnge Johann. „Nicht, dass er uns hat ├╝ber die Mauer klettern sehen!“
„Ja, wir d├╝rfen auf keinen Fall riskieren, dass Wachtmeister Dimpflhuber uns die Mumie wegnimmt“, stammelte Moritz panisch und Johann versp├╝rte den starken Wunsch, ihn zu erschlagen und auf dem einsamen Friedhof zu verscharren. Im gleichen Augenblick war er entsetzt ├╝ber seine eigenen Gedanken. Was war nur in ihn gefahren? Das konnte nur der verderbliche Einfluss der Mumie sein!
Als er das in den Teppich gewickelte B├╝ndel von der Mauer hob, versuchte Johann den Gedanken zu verdr├Ąngen, dass sich darin die Mumie befand. Moritz warnte ihn, dass er vorsichtig sein musste, um nicht im Dunkeln zu stolpern, damit der Mumie nichts passierte und Johann erwiderte, dass ihm auch seine eigenen Knochen einiges wert seien. Dann hoben sie die Mumie von der Mauer und durchquerten mit schnellen Schritten den kleinen Kirchhof mit seinem Kopfsteinpflaster. Gl├╝cklicherweise war die Friedhofpforte nicht abgeschlossen. Sie huschten hindurch und vor ihnen lag der leicht verwahrloste Friedhof mit seinen moosbewachsenen Grabsteinen, von denen viele schon halb in den Boden versunken oder sogar umgefallen waren. Vorsichtig tappten die beiden den baumbestandenen Hauptpfad entlang, bis sie ein Mausoleum erreichten, das auch schon bessere Zeiten gesehen hatte, denn der ehemals wei├če Marmor war schon morsch und fleckig. Trotzdem wirkte der herrschaftliche Bau in dieser eher l├Ąndlichen Umgebung etwas deplaziert. Aber hinter seinen von Efeu ├╝berwucherten Mauern konnten sich die beiden Fl├╝chtlinge endlich verstecken.
Johann lauschte angestrengt in die Dunkelheit, ob der Bruder noch immer mit dem Wachtmeister sprach, aber alles was er h├Ârte war das Rauschen der Bl├Ątter und sein eigener Herzschlag, der in den Ohren pochte. Er realisierte, dass er beim Lauschen vergessen hatte zu atmen und schnappte nach Luft. Dann lie├č er seinen Blick ├╝ber den Friedhof schweifen. Dies war ein unheimlicher Ort, den Johann normalerweise noch nicht einmal am hellen Tag betreten h├Ątte und nun wartete er hier mit einer Mumie!
Fasrige Wolken trieben ├╝ber die Mondscheibe hinweg, deren mattes Licht die Gr├Ąber beleuchtete. Obwohl die Hitze des Tages noch immer anhielt, fr├Âstelte es Johann und er musterte Moritz aus den Augenwinkeln, aber es war zu dunkel um den Ausdruck seines Gesichtes zu deuten.
Johann fragte sich, wie es wohl dem Bruder in der Zwischenzeit ergangen war. Eigentlich konnte der Wachtmeister ihm nichts anhaben, zumindest falls er nicht bemerkt haben sollte, dass ihm nicht nur ein junger Mann, sondern deren drei entgegen gekommen waren. Johann rieb seine klammen H├Ąnde aneinander, aber sie wollten nicht warm werden und noch immer zitterte er.
Der Ruf einer Eule hallt schaurig durch die Nacht. Er war aus der unmittelbaren N├Ąhe gekommen. Johann schrak instinktiv zusammen. Dann schaute er sich vorsichtig um, aber er konnte den Vogel nicht sehen. Wieder dachte er an diese seltsame ├Ągyptische Freiseele, wie hie├č sie nochmal? Bar? Konnte die Eule …. Johann verdr├Ąngte den Gedanken, den er nicht einmal innerlich zu formulieren wagte. Schlie├člich erschien den alten Griechen Athene in Eulengestalt. Trotzdem war es komisch, dass die ├ägypter sich die Seele als Vogel vorstellten.
„Ich sehe mal nach, wo Peter bleibt“, fl├╝sterte Moritz, Johann aus seinen finsteren Gedanken rei├čend.
„Du kannst mich doch nicht allein auf diesem Friedhof zur├╝cklassen!“, erwiderte Johann panisch, im letzten Augenblick das Wort „unheimlich“ weglassend.
„Sei doch nicht immer so ein Angsthase!“, kommentierte Moritz etwas herablassend.
Johann ├Ąrgerte sich ├╝ber den Freund seines Bruders, vor allem, weil er „immer“ gesagt hatte. Was mochte Peter alles ├╝ber ihn verbreitet haben?
„Du willst doch nur gehen, weil du dich selbst f├╝rchtest!“, konterte er und h├Ątte fast hinzugef├╝gt, dass Moritz diese bl├Âden Burschenschaftsinsignien brauchte, um sich stark zu f├╝hlen, aber es war sicher keine gute Idee, sich auf dem Friedhof herumzustreiten, „entweder wir schauen beide nach Peter oder du bleibst auch hier.“
„Wie du willst“, sagte Moritz etwas gedehnt und b├╝ckte sich nach der Mumie.┬á
Johann tat es ihm gleich und sie verlie├čen ihr Versteck. Bei jedem Zweig, der unter seinen F├╝├čen knackte fuhr Johann innerlich zusammen und er hoffte, dass hier niemand war, der dies geh├Ârt haben k├Ânnte.
Trotz aller Bedenken erreichten sie das Friedhofportal, ohne dass jemand ├╝ber eine Wurzel stolperte oder mit einem Baumstamm kollidierte. Sie durchquerten den Kirchhof und lauschten an der Mauer, aber sie h├Ârte weder Peter noch den Schutzmann. Sie stiegen mit der Mumie ├╝ber die Mauer und schauten sich um. Keine Spur von Peter.
„Wir m├╝ssen Ihn suchen“, meinte Johann.
Moritz sch├╝ttelte den Kopf.
„Lass uns lieber zuerst die Mumie in Sicherheit bringen.“
Dieser Kommentar war wieder einmal typisch f├╝r Moritz! Aber trotzdem hatte er recht, denn wo sollten sie den Bruder suchen? Sie hatten nicht den geringsten Anhaltspunkt, wohin er gegangen sein sollte.
Hoffentlich hat man ihn nicht verhaftet, durchfuhr es Johann.
„Komm schon“, ermahnte ihn Moritz.
Mit einem leisen Seufzer griff Johann auf dem Teppich auf der Kirchhofmauer. Dann machten sie sich auf dem Weg zu dem Haus, in dem Moritz eine Mansarde gemietet hatte.
Schon sahen sie das Haus am Ende der Stra├če, als eine finstere Gestalt ihnen entgegenkam.
„Nicht schon wieder dieser idiotische Wachtmeister!“, entfuhr es Johann, aber dann sah er, dass es der Bruder war.
Am liebsten w├Ąre er ihm vor Freude um den Hals gefallen, aber dies war ihm im Beisein von Moritz peinlich.
„Wo hast du nur gesteckt?“, fragte er.
Peter l├Ąchelte ├╝ber die aufgeregte Miene des Bruders.
„Ich habe behauptet, dass ich mich verlaufen h├Ątte und nach dem Weg zum Marktplatz gefragt. Leider hat der ├╝bereifrige Wachtmeister darauf bestanden, mich dorthin zu begleiten, da er selbst in der Gegend wohnt. Anschlie├čend konnte ich dann den ganzen Weg wieder zur├╝cklaufen.
Johann lachte.
„Und dann sagt man, dass L├╝gen kurze Beine haben.“
 
Sonntag
7. Sonntag
Als Peter von einem geradezu schmerzhaft lauten Brummger├Ąusch geweckt wurde war er etwas verwirrt und es dauerte einen Augenblick lang, bis er realisierte, dass der L├Ąrm aus dem Inneren seines Sch├Ądels kam. Die Sonnenstrahlen, die durch die schmalen L├╝cken zwischen den geschlossenen Vorh├Ąngen schienen schmerzten ihm in den Augen und er lege sich das Kissen auf den Kopf, aber jede noch so fl├╝chtige Ber├╝hrung am Kopf war ihm unangenehm.
Kein Wunder, nach diesem n├Ąchtlichen Bes├Ąufnis in der K├╝che! Hoffentlich erinnerte sich Johann ├╝berhaupt noch daran, dass er endlich eingewilligt hatte mit ihm nach ├ägypten zu fahren! Aber eigentlich blieb ihm keine andere Wahl nach diesem schrecklichen Alptraum. Oder war es vielleicht doch kein Traum? Unm├Âglich!, dachte Peter, ich glaube nicht an Gespenster! Aber er wollte lieber nicht dar├╝ber nachdenken, denn das Gr├╝beln verst├Ąrkte seinen ohnehin schon bohrenden Kopfschmerz.
Peter drehte sich um und griff nach seiner Taschenuhr, die auf dem Nachttisch lag. Er hielt sie in Richtung des Lichtkegels. Schon zehn Uhr morgens! H├Âchste Zeit um aufzustehen. Aber eine neue Welle der M├╝digkeit ├╝berkam ihn und er g├Ąhnte herzhaft. Noch immer etwas tr├Ąge rieb er sich die Augen, r├Ąkelte und streckte sich. Dann setzte er sich auf und schl├╝pfte in seine Pantoffeln. Wenigstens w├╝rde er in der K├╝che nicht mit vorwurfsvollen Blicken empfangen werden, denn es war Sonntag. Mutter, Hausm├Ądchen und Gouvernante besuchten gerade die Messe.
„Nur durch den allzu weltlich eingestellten Wilhelm haben sich diese laschen Sitten eingeschlichen“, pflegte die Mutter – mit einem pikierten Seitenblick auf ihre S├Âhne - zu sagen, bevor sie sich an den Kopf der kleinen Truppe setzte und das Haus in Richtung Kirche verlie├č.
Schon hatte Peter die T├╝rklinke heruntergedr├╝ckt, aber er besann sich eines Besseren, denn hatte vor, den Kasten der Mumie zu vermessen. Da es sicher nicht empfehlenswert war, im Nachthemd im Keller herumzuschlurfen, wechselte Peter schnell die Kleider.
Wieder konsultierte er seine Taschenuhr. Schon Viertel nach zehn! H├Âchste Zeit ans Werk zu gehen! Im Vorbeigehen ├Âffnete er vorsichtig die T├╝r von Johanns Zimmer. Peter war beruhigt, dass sein Bruder noch immer leise schnarchend im Bett lag, denn er wollte ihn lieber nicht auf seine Exkursion in den Keller mitnehmen. Genauso ger├Ąuschlos wie er sie ge├Âffnet hatte schloss Peter die T├╝r.
Er tappte die Treppe hinunter, steckte die Nase in die K├╝che und bemerkte erleichtert, dass eine Kaffeekanne auf dem Tisch stand. Anderenfalls h├Ątte er auf sein Fr├╝hst├╝ck verzichten m├╝ssen, denn er wollte seine Arbeit im Keller erledigt haben, bevor der Bruder erwachte oder gar die Frauen aus der Kirche zur├╝ckkehrten. Er legte die Hand auf das Porzellan der Kanne. Erwartungsgem├Ą├č war es war eiskalt, aber dies d├╝rfte der Wirkung des Koffeins keinen Abbruch tun. Peter schnitt sich nur eine Brotkante ab, die er hastig verschlang. Dann kippte er einen halben Becher des kalten Kaffees herunter und erkl├Ąrte damit das Fr├╝hst├╝ck f├╝r beendet.
In der Diele lauschte er einen Augenblick, aber er h├Ârte keine Schritte im Haus. Dann holte er aus der Vorratskammer eine Petroleumlampe und einen Zollstock in kehrte in die Diele zur├╝ck.
Die Kellert├╝r ging schwerer auf als Peter vermutet hatte und sie quietschte markersch├╝tternd. Warum hatte er dies niemals zuvor registriert? Peter fluchte innerlich vor sich hin, denn er hatte vorgehabt die Mumie nachts heimlich aus dem Keller zu transportieren, aber dies war unter diesen Umst├Ąnden zu riskant. Notgedrungen musste, er warten bis er allein im Haus war, also bis n├Ąchsten Sonntag. Eine ganze Woche verplempert bis zum Aufbruch!
Mit der Lampe in der Hand stieg Peter die Treppe herunter. Unten angelangt bemerkte er sofort mit Schrecken, dass jemand in der Zwischenzeit im Keller herumgest├Âbert hatte. Das Regal zur Rechten stand leicht schief und auf dem Boden lagen kleine H├Ąufchen von S├Ągemehl. Was hatte das zu bedeuten? Au├čer ihm selbst hatte sich bisher nur der Hauslehrer f├╝r die ├Ągyptischen Altert├╝mer interessiert und dieser weilte inzwischen im fernen K├Ânigsberg. Wer sonst war im Keller gewesen und vor allen Dingen: warum? Peter wurde von einer unangenehmen Vorahnung ergriffen.
Wenigstens stand die gro├če Kiste, in der sich die Mumie befand noch an ihrem Platz. Um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war hob Peter den Deckel der Versandkiste einen Spalt hoch und lie├č ihn sofort wieder mit einem halbunterdr├╝cktem Schmerzenschrei fallen, denn er hatte sich einen Splitter in die Handfl├Ąche getrieben. Der Aufprall auf die Kiste verursachte einen dumpfen Schlag, der im Keller widerhallte. Hoffentlich hatte er Johann nicht geweckt! Mit den Z├Ąhnen knabberte Peter solange an der Hornhaut seiner Handfl├Ąche herum bis er den Splitter endlich herausgezogen hatte.
Ein zweites Mal hob er, den Zollstock unter den Arm geklemmt, den Deckel der Kiste hoch und stellte ihn gegen die Wand auf den Boden. Mit der Lampe leuchtete er in die Kiste hinein und seine Augen wanderten staunend ├╝ber den farbigen h├Âlzernen Sarkophag, den er enthielt. Er hatte die vereinfachte Form eines Menschen mit realistisch gestalteten Gesichtsz├╝gen und stilisierten F├╝├čen. Auf den K├Ârper waren gefl├╝gelte Wesen aufgemalten.
Um die H├Ąnde frei zu haben, deponierte Peter die flackernde Lampe und den Zollstock auf das oberste Brett des Regals. Dann streckte er die H├Ąnde aus und legte sie auf den Sarkophag. Er f├╝hlte sich k├╝hl und glatt an, nicht lebendig und vibrierend, wie sein Bruder behauptet hatte. Peters Finger wanderten ├╝ber den Sarkophagdeckel und suchten ganz vorsichtig, um das kostbare St├╝ck nicht zu besch├Ądigen den Spalt zwischen Deckel und Unterteil. Als er ihn gefunden hatte atmete er tief ein und hob endlich den Deckel mit einem entschlossenen Ruck an. Als dieser sich vom Unterteil zu l├Âsen begann, glitt ein prickelndes Gef├╝hl Peters Fingers hinab.
Er lugte neugierig in den Sarkophag und h├Ątte vor Schreck fast auch diesen Deckel herunterfallen lassen, denn im Innerem des h├Âlzernen Sargs lagen nur kleinen Fetzen eines wei├čen Gewebes. Die Mumie hingegen war verschwunden!
„Verdammt, was ist da schon wieder schief gegangen!“, fluchte er laut los, obwohl er v├Âllig allein im Keller war.
Pl├Âtzlich durchfuhr ihn der wahnsinnige Gedanke, dass nicht nur der Schatten der ├ägypterin im Haus umherging, sondern auch ihre Mumie. Jetzt steckt dich Johann schon an mit seinem Verfolgungswahn, dachte er schlecht gelaunt.
Dann traf ihn die Erkenntnis wie ein Fausthieb in den Magen: Das hatte also der Onkel am hellerlichten Tag in der Nachbarschaft zu tun gehabt! Mutter hatte hinter seinem R├╝cken die Mumie an Onkel August verschachert! Bestimmt hatte der Apotheker vor, sie zu Pulver zu zermahlen, um sie als Heilmittel zu verkaufen. Bei der blo├čen Vorstellung bekam Peter einen Brechreiz.┬á┬á┬á┬á┬á┬á
Fast h├Ątte er die Mutter in flagranti erwischt, aber sie hatte ihn zur Post geschickt, damit er keinen Einspruch gegen den gr├Ąsslichen Handel erheben konnte! Peter f├╝hlte sich hintergangen. Eine ohnm├Ąchtige Wut stieg in ihm auf. Am liebsten h├Ątte er laut geschrieen.
M├╝hsam zwang er sich dazu tief durchzuatmen, denn er musste sich ├╝berlegen, wie er die Mumie retten konnte. Als er seine Fassung zur├╝ckerlangt hatte, sagte er sich, dass noch nicht alles verloren war. Schlie├člich hatte man die Mumie erst seit kurzem entf├╝hrt. Peter z├Ąhlte die Tage an den Fingern ab und er atmete erleichtert auf: nur drei Tage waren verstrichen, seit er die Kutsche des Apothekers auf der Stra├če gesehen hatte! Wahrscheinlich hatte der lethargische Onkel die Mumie noch nicht einmal ausgewickelt. Trotzdem musste Peter so bald wie m├Âglich handeln. Wie gut, dass er bereits die P├Ąsse abgeholt und Geld von der Bank abgehoben und zwischen seinen B├╝chern versteckt hatte.
Noch immer innerlich vor Wut kochend, klappte er den Sarkophagdeckel wieder zu und verschloss sorgf├Ąltig die Versandkiste. Mutter brauchte nicht zu wissen, dass er ihr auf die Schliche gekommen war.
W├Ąhrend er ganz langsam, als tr├╝ge er eine schwere Last, die Treppe hochstieg zermarterte sich Peter das Hirn dar├╝ber, wo er die Mumie lagern k├Ânnte, wenn er sie wiederbesorgt hatte. Er kam immer wieder zu demselben Ergebnis und dies gefiel im ├╝berhaupt nicht: Sosehr es ihm widerstrebte kam nur die Bude von Moritz in Frage, denn die Eltern der anderen w├╝rden ihn sofort bei der Mutter verraten. Warum besa├č nur Johann sowenig Freunde?
Immer noch mit seinem Schicksal hadernd, dass wieder einmal alles an ihm h├Ąngen blieb l├Âschte Peter oben angelangt die Lampe und schloss die Kellert├╝r hinter sich zu. Wieder drang ein lautes Quietschen durch die Diele. Wenigstens hatte er mittlerweile einen Schlachtplan entworfen.
„Da bist du ja!“, rief ihn Johann durch die K├╝chent├╝r zu. „Ich habe mich schon gefragt, wo du steckst.“
Peter betrat die K├╝che und lie├č sich ersch├Âpft vom Schlafmangel und frustriert ├╝ber das Verschwinden der Mumie auf einen Stuhl fallen. Das Fenster stand offen, sodass eine leichte Brise durch den Raum wehte und Peter wischte sich die verschwitzte Stirn mit dem ├ärmel ab.┬á
Mit einem Seitenblick musterte er den Bruder, der ohne gro├če Begeisterung an einem St├╝ck Brot nagte. Er war etwas blass, wirkte aber sonst guter Dinge, jedenfalls im Vergleich zu seiner Stimmung in der vergangenen Nacht.
„Ich bin ├╝brigens fr├╝h um f├╝nf in die K├╝che gegangen und habe die Schnapsflasche geholt und in meinem Zimmer versteckt“, erkl├Ąrte Johann und erhob sich um Kaffee nachzuschenken.
„Das war eine sehr gute Idee“, gab Peter neidlos zu. Er selbst war viel zu betrunken gewesen, um auch nur einen einzigen Gedanken an die verr├Ąterische Flasche zu verschwenden. „Jetzt k├Ânnen wir behaupten, dass es eine Flasche Lik├Âr war, die wir geleert haben.“
Immer wieder staunte Peter ├╝ber das Talent seines Bruders, Ausreden zu erfinden, w├Ąhrend er selbst es eher auf einen Streit ankommen lie├č.
Wenn du w├╝sstest, wie gleichg├╝ltig mir die Flasche mittlerweile ist, dachte er im gleichen Augenblick. Es lag ihm schwer im Magen, dass er Johann schonend beibringen musste, dass die Mumie aus dem Keller verschwunden war.
„Wir m├╝ssen fr├╝her nach ├ägypten aufbrechen, als ich gedacht habe“, begann er vorsichtig.
Johann schaute alarmiert von seinem Teller auf.
„Warum diese pl├Âtzliche Eile? Stimmt etwas nicht?“
Peter nickte und wollte etwas erwidern, aber im gleichen Augenblick wurde die Wohnungst├╝r von au├čen aufgeschlossen. Das ist ein Wink des Schicksals, dachte Peter. Nun hatte er einen Vorwand, um dem Bruder ohne Umschweife von der Katastrophe zu berichten.
„Mutter hat die Mumie an Onkel August verkauft, aber das lassen wir uns nicht gefallen! Wir werden sie uns zur├╝ckholen“, fl├╝sterte er Johann zu und lie├č den v├Âllig fassungslosen Bruder am Fr├╝hst├╝ckstisch sitzen.
„Aber wir k├Ânnen doch nicht einfach … “, protestierte Johann, aber Peter brachte ihn mit einer abwehrenden Handbewegung zum Schweigen.
Elise trat in die Diele und Peter atmete erleichtert auf, als er sah, dass sie allein war.
„Ihre Mutter schickt mich“, erkl├Ąrte das M├Ądchen und machte einen Knicks. „Ich soll ein Buch holen, das sie vergessen hat. Au├čerdem soll ich ausrichten, dass Sie bei Ihrer Tante Henriette an die Mittagstafel eingeladen sind.“
Peter suchte panisch nach einem Vorwand, um sich vor der l├Ąstigen Einladung zu dr├╝cken. Schlie├člich musste er den Raub der Mumie planen.
„Richte ihr bitte aus, dass sie nicht auf uns warten braucht, denn …“
„Mein Bruder hilft mir bei einer Seminararbeit, die ich am Montag abgeben muss“, mischte sich Johann ein, der Peter gefolgt war. „Wir werden leider daf├╝r noch den ganzen Nachmittag ben├Âtigen.“
Peter war etwas irritiert dar├╝ber, wie glatt dem Bruder diese L├╝ge ├╝ber die Lippen ging. Vielleicht war es kein Zufall, dass er selbst Jurisprudenz studierte, w├Ąhrend Johann sich zur Literatur hingezogen f├╝hlte.
„Ich werde es Ihrer Mutter ausrichten!“, brummte das M├Ądchen finster.
Dann verschwand sie im Bibliothekszimmer, kam mit einer alten, zerfledderten Schwarte - nach ihrem Einband zu schlie├čen religi├Âsen Inhalts - zur├╝ck und schlug gru├člos die T├╝r hinter sich zu.
„Welche Laus ist der denn ├╝ber die Leber gelaufen?“, sagte Peter, mehr zu sich selbst, denn gew├Âhnlich strahle Elise, wenn sie ihn sah.
„Sie hat Angst, dass Mutter ihr Vorw├╝rfe macht, weil sie uns nicht zur Tante mitbringt“, erkl├Ąrte Johann und schaute seinen Bruder fragend an. Dann setzte er sich, schob seinen Stuhl zurecht und r├Ąusperte sich verlegen.
„Und was machen wir jetzt?“
Er klang ziemlich ratlos.
Warum half Johann nicht bei der Planung des Einbruchs? Peter ├Ąrgerte sich, dass der Bruder – wie immer – gar keine eigene Initiative zeigte.
Eine Kutsch bretterte drau├čen vor bei und Peter dachte an den Apotheker. Er ├Ąrgerte sich ├╝ber sich selbst. Warum hatte er sich wider besseres Wissen zur Post schicken lassen? Er h├Ątte seinem Instinkt folgen sollen!
„Du packst unsere Sachen, aber bitte nicht nur B├╝cher! Wir brauchen wetterfeste Kleidung, Leibw├Ąsche, zwei Schlafs├Ącke und Lebensmittel … „begann er, dann z├Âgerte er einen Augenblick, weil er auf den Widerspruch den Bruders wartete, aber dieser blieb aus. „In der Zwischenzeit besorge ich eine Mietkutsche und ich fahre bei Moritz vorbei, um zu sehen, ob er zuhause ist.“
„Warum?“
„Wir werden unser Gep├Ąck bei ihm verstecken … und auch die Kiste, in der wir die Mumie transportieren k├Ânnen ….┬á wir sollten die Zeit n├╝tzen. Bald sind wir nicht mehr allein im Haus.“
„Und, wenn Mutter bemerkt, dass die Kiste verschwunden ist?“
„Ich glaube nicht, dass sie heute noch in den Keller geht ….“
Peter sprach lieber nicht aus, dass sie in der folgenden Nacht bereits in der Apotheke einbrechen mussten, wenn sie verhindern wollten, dass der Onkel die Mumie besch├Ądigte.
Johann sah ihn skeptisch an.
„Warum bringen wir die Sachen ausgerechnet zu Moritz? Ich denke du hast etwas gegen seine neuen Freunde von der Burschenschaft …“
Peter nickte und verzog das Gesicht.
„Wem sagst du das! Aber ich kenne sonst niemanden mit einer sturmfreien Bude.“
Er sah seinen Bruder scharf an. Dieser zuckte mit den Schultern.
„Ich leider auch nicht, aber …“
„Moritz mag sensationsgierig sein, aber er ist kein Dieb. Die Sachen sind bei ihm sicher“, unterbrach Peter, der den Eindruck hatte, dass „aber“ das Lieblingswort seines Bruders sei. „Ist ja auch nur f├╝r kurze Zeit.“
„Also ob es hier die Hitze nicht schon unertr├Ąglich genug w├Ąre“, beklagte sich Johann und f├Ącherte sich mit einer Zeitung k├╝hle Luft zu, „Wir m├╝ssen wahnsinnig sein, in die W├╝ste zu fahren!“
Hoffentlich ├Ąu├čerte Johann jetzt keine weiteren Einw├Ąnde!
„Und wir brauchen auch einen Teppich von mindestens f├╝nf Fu├č L├Ąnge, Vater hat einen ganzen Sto├č Teppiche mitgebracht! Da wird sich sicher etwas Passendes finden“, sagte Peter daher, um dem Bruder zuvor zu kommen. „Aber genug geredet, wir sollten uns beeilen!“
Peter machte Anstalten zu gehen, blieb aber vor der T├╝r stehen, weil er noch etwas vergessen hatte.
„Johann!“ Der Bruder drehte sich um. „H├Âr mir bitte genau zu, das ist ganz wichtig.“
„Ich h├Âr dir immer zu“, maulte der Angesprochene.
„Wenn es der Deifel will und die Frauen vor mir zur├╝ckkommen, dann stell bitte auf das Fensterbrett im Bibliothekszimmer irgendein m├Âglichst gro├čes Buch!“┬á
Johanns Gesicht spiegelte sein Erstaunen wieder. Bestimmte fragte er schon wieder nach, warum er dies tun sollte!
„Gute Idee!“
Peter blickte seinen Bruder ernst in die Augen.
„Kann ich mich darauf verlassen?“
„Ja, klar!“
Peter war davon nicht v├Âllig ├╝berzeugt, denn der Bruder war ein rechter Traumt├Ąnzer, der oft genug seine Aufgaben verga├č.
Ich muss mich nur noch einen Tag gedulden, sagte er sich zur Beruhigung. Hoffentlich verl├Ąuft alles nach Plan.
 
Als der Bruder aus der Wohnung gest├╝rmt war, blieb Johann einen Augenblick lang unschl├╝ssig in der Diele stehen, denn er war noch immer ziemlich mitgenommen vom n├Ąchtlichen Besuch des Schattens. Au├čerdem musste er diese unerwartete neue Wendung - n├Ąmlich, dass die Mumie aus dem Keller verschwunden war - erst noch verarbeiten und zu allem ├ťberfluss qu├Ąlte ihn ein schrecklicher Kater. Trotzdem f├╝hle er sich besser als in den vergangenen Wochen, denn wenigstens wusste er nun, warum er von Alptr├Ąumen geplagt wurde.┬á
Wenn nur dieser Durst nicht w├Ąre! Johann ging in die K├╝che, drehte den Wasserhahn auf, lie├č sein Glas nun schon zum dritten Mal an diesem Morgen randvoll mit Wasser laufen und trank es hastig aus.
Er seufzte leise, denn im graute vor der bevorstehenden Expedition. Was hatte er eigentlich verbrochen, dass er nun in die W├╝ste geschickt wurde? Und wenn man sie beim Einbrechen in der Apotheke erwischte? Und ├╝berhaupt: Warum sollten sie eigentlich die Mumie stehlen? Wenn sie in der Apotheke blieb, w├╝rde vielleicht ihr neuer Besitzer von schrecklichen Tr├Ąumen verfolgt! Aber sie sind doch meine Tante und mein Onkel, rief Johann sich ins Ged├Ąchtnis zur├╝ck. Also w├╝rde er sich opfern m├╝ssen. F├╝r Peter hingegen war diese gef├Ąhrliche Reise ein willkommener Vorwand, sich aus dem Staub zu machen.
Als er an seinen Bruder dachte, fiel Johann ein, dass er die B├╝ndel f├╝r die Reise schn├╝ren sollte. Schon bald w├╝rden sie nach ├ägypten aufbrechen! Momentan ging Johann alles viel zu schnell. Lustlos schlenderte er ins Elternschlafzimmer und ├Âffnete die W├Ąschetruhe. Bald hatte einen Sto├č Leibw├Ąsche, Nachthemden und Str├╝mpfe auf das Bett geworfen. Aber woher einen Schlafsack nehmen? Dieses seltsame Wort hatte Peter sicherlich aus einem Abenteuer-Roman. Johann kramte zwei Decken aus dem Schrank, in die er die W├Ąsche einschlug. Er ├╝berlegte, in welchen Koffer er all dies verstauen sollte, aber dies war eigentlich egal, denn die Mutter w├╝rde jeden von ihnen vermissen, wenn er nicht am Platz war.┬á
Pl├Âtzlich kam Johann eine Idee: Es gab noch einen weiteren Koffer in diesem Haus, n├Ąmlich den von Vater. Mutter hatte ihn auf den Dachboden verbannt, weil sein Anblick sie traurig machte.┬á
Johann schleppte die beiden B├╝ndel in sein Zimmer und warf sie auf das Bett. Dann ging er durch den Flur zum Treppenhaus und stieg die Stufen zum Speicher hinauf, den er schon seit Jahren nicht mehr betreten hatte. Oben angelangt blieb er verbl├╝fft stehen, denn er hatte eine Rumpelkammer mit Staubm├Ąusen und Spinnwebe erwartet, aber keinen sauber gefegten leeren Innenraum, in dem W├Ąscheleinen aufgespannt waren, an denen Bettw├Ąsche hing.
Johann lie├č seinen Blick schweifen: Die T├╝r zur linken f├╝hrte wahrscheinlich in Elises Kammer, daneben stand ein prall gef├╝llter W├Ąschekorb und ganz dahinten in der rechten Ecke stand der alte Lederkoffer, den Vater aus ├ägypten mitgebracht hatte.
Als Johann den Speicher durchquerte knarrten die Dielen unter seinen F├╝├čen, aber dies war ihm egal, denn er war allein im Haus. Er hob den Koffer vom Boden und war erstaunt ├╝ber dessen Gewicht. Man hat ihn nicht einmal ausgepackt, durchfuhr es Johann. Sein Herz klopfte und er war ganz aufgeregt: Was mochte sich in diesem Koffer befinden?
Nur mit M├╝he konnte sich Johann beherrschen, nicht augenblicklich den Koffer zu ├Âffnen. Mit M├╝he schleppte er ihn die Treppe hinab in sein Zimmer und lie├č ihn auf sein Bett fallen, direkt neben die beiden B├╝ndel. Voller freudiger Erwartung ├Âffnete er die Schnallen der beiden Gurte, die den Koffer umgaben. Er z├Âgerte einen Augenblick, dann klappte er den Deckel auf. Eine Staubwolke explodierte in sein Gesicht. Johann nieste dreimal. Vielleicht h├Ątte er den Koffer doch nicht auf das Bett legen sollen? Aber zu Sp├Ąt! Johann musterte den Inhalt des Koffers. Er h├Ątte nicht sagen k├Ânnen, was er zu finden gehofft hatte, vielleicht Juwelen, Goldm├╝nzen oder die Karte, die ihn zu einem Schatz f├╝hren w├╝rde, aber nicht alte Kleidung!
Entt├Ąuscht lie├č Johann sich auf das Bett fallen und eine Staubwolke flog auf. Er schalt sich selbst einen Toren, dass er so hochgesteckte Erwartungen gehabt hatte. Dann st├Âberte er im Koffer herum. Unter der W├Ąsche lagen ein Tropenhelm und eine sandfarbene Jacke. Sie k├Ânnte sich als n├╝tzlich erweisen, denn Johann besa├č keine Kleidung, die f├╝r eine Expedition tauglich war.
Er erhob sich vom Bett und schl├╝pfte in die Jacke, die ihm zu gro├č war. Die Mutter w├╝rde bestimmt sagen: da passt noch ein Pullover drunter und manchmal hatte sie auch recht. Sagte man nicht, dass die N├Ąchte in der W├╝ste bitterlich kalt seien? Als er zum Spiegel ging, ├╝berflutete Johann eine Welle des Selbstmitleids, denn er dachte an die Sahara mit all ihrem Schrecken.
Mit skeptischen Blicken musterte er sein Spiegelbild, denn die Jacke stand ihm nicht besonders gut. Als er seine Schultern straffte, um imposanter zu wirken, bemerkte er, dass der Stoff an der Brust spannte. Da war irgendein Widerstand! Johann betastete die  Jacke und fand eine Innentasche. Er griff hinein und zog ein Notizbuch heraus. Es war ein abgegriffenes, ledergebundenes Buch im Quartformat. Johann war ganz aufgeregt über diese Entdeckung. Vielleicht enthielten die Aufzeichnungen einen Hinweis darauf, woher die Mumie stammte. 
Mit vor Ungeduld zitternden Fingern schlug er das Notizbuch auf und sah, dass die Schrift der Eintragungen winzig war. Er kniff die Augen vor Anstrengung zusammen und studierte den Text auf der ersten Seite, aber zu seiner grenzenlosen Entt├Ąuschung konnte er ihn nicht lesen. Er war in einer sch├Ânen, gleichm├Ą├čigen Handschrift verfasst, aber die Worte ergaben einfach keinen Sinn. Johann bl├Ątterte weiter, konnte aber auch die folgenden Seiten nicht entziffern. Was nicht ist, kann ja noch werden, dachte er und steckte das Notizbuch in die Tasche seiner eigenen Jacke.┬á
Dann holte er aus dem Schlafzimmer einen Koffer, der gro├č genug war um den Inhalt des anderen Koffers darin zu verstauen und legte St├╝ck f├╝r St├╝ck alles hinein, was er nicht brauchte.
Aber wir k├Ânnen doch nicht einfach verschwinden, ohne der Mutter eine Nachricht zu hinterlassen, durchfuhr es ihn pl├Âtzlich. Sie gr├Ąmt sich sonst zu Tode.
Mit klopfendem Herzen setzte er sich an seinen Schreibtisch und tauchte seine Feder in das Tintenfass.
Liebe Mutter, schrieb er, aber dann fiel ihm nichts mehr ein.
Vielleicht suche ich doch lieber zuerst einen Teppich aus, dachte er und machte sich wieder an die Arbeit.
 
Peter erreichte den Marktplatz, wo die Mietdroschken standen. Unter einer Linde l├╝mmelten die dazugeh├Ârigen Kutscher herum und warteten zigarettenrauchend auf Fahrg├Ąste. Bevor sich Peter f├╝r einen der finster drein blickenden Gesellen entschieden hatte, winkte ihm ein langer, d├╝rrer Mann mit wei├čen Bartstoppeln im wettergegerbten Gesicht zu seiner Kutsche. Da seine Kollegen nicht protestierten, vermutete Peter, dass dieser auch ihrer Meinung nach an der Reihe war.
Er nannte das Fahrziel und ├Âffnete die Kabinent├╝r, aber der Kutscher stand noch immer auf dem Platz, ihn absch├Ątzig musternd, als ob er bef├╝rchtete, dass sein Gast nicht zahlen k├Ânnte. Peter verkniff sich einen Kommentar, stieg ein und schaute gelangweilt aus dem Fenster heraus.
Der Kutscher bestieg einige unverst├Ąndliche Worte vor sich hinbrummend den Bock und knallte mit der Peitsche. Das Pferd trabte los und die Droschke polterte ├╝ber das Kopfsteinpflaster der sonnt├Ąglich ruhigen Stra├čen.
Das darf doch wohl nicht wahr sein, dachte Peter als sie in die Marktstra├če einbogen, in der der Apotheker wohnte. Vielleicht h├Ątte er sich einen anderen Weg ausbedingen sollen, aber dies h├Ątte nur den Argwohn des Kutschers verst├Ąrkt. Niemand vermutet mich in einer Droschke, sagte er sich zur eigenen Beruhigung, aber vorsichtshalber schaute er doch lieber mit gesenktem Kopf auf den Boden. Man konnte ja nie wissen, ob nicht eine der Nichten auf der Stra├če herumlief.
Gl├╝cklicherweise war die Stra├če nicht lang und Peter konnte den Kopf wieder heben und sich entspannt auf dem Sitz zur├╝cklehnen. Die H├Ąuser flogen an ihm vorbei und bald hatten sie die Schillerstra├če erreicht, in sich das Zimmer von Moritz befand.
Peter schreckte auf seinen Gedanken auf, denn er sah in der Ferne die kr├Ąftige Figur seines Freundes, der ihnen auf dem B├╝rgersteig entgegentrottete, noch immer mit Studentenm├╝tze und Burschenschaftssch├Ąrpe.
„Bitte halten Sie sofort!“, rief Peter dem Kutscher zu.┬á┬á
Dieser z├╝gelte augenblicklich das Pferd, die Bremsen quietschten und die Droschke kam mit einem derartig heftigen Ruck zu stehen, dass Peter sich fast den Kopf an der Wand der Fahrgastkabine stie├č. Peter konnte sich des Verdachtes nicht erwehren, dass der Kutscher dies absichtlich getan hatte.
Der heimt├╝ckische Geselle beugte sich vom Bock herunter und grinste ihn breit an.
„Bitte warten Sie einen Augenblick!“, sagte Peter, sich m├╝hsam seinen Protest verkneifend. „Ich m├Âchte kurz mit diesem Herrn sprechen.“
„Wenn Sie meinen, Sie k├Ânnen …“, begann der Kutscher zu schimpfen.
„Schon gut“, unterbrach Peter. Er stieg aus und dr├╝ckte dem Mann eine Silberm├╝nze in die Hand. „Ich bin gleich wieder da.“
Mit schnellen Schritten ging er Moritz entgegen, der von seinen dramatischen Auftritt sichtbar beeindruckt war.
„Was ist denn in dich gefahren?“, rief er ihm zu. „Hast du in der Lotterie gewonnen?“
„Das erz├Ąhle ich dir sp├Ąter. Ich habe es schrecklich eilig.“ Peter zwang sich ein L├Ącheln ab. Er┬á schluckte, bevor sein Anliegen formulierte, sosehr widerstrebte es ihm, Moritz um etwas zu bitten, da dieser sich in der letzten Zeit als hochgradig unsensibel erwiesen hatte. „Kann du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich w├╝rde gern einige Gep├Ąckst├╝cke in deinem Zimmer lagern, nur f├╝r ein, zwei Tage …“
„Warum nicht? Bring sie Morgen vorbei.“ Der skeptische Gesichtsausdruck seines Freundes sprach B├Ąnde. „Hast du ├ärger mit deiner Mutter?“
„Nicht Morgen, sondern sofort!“, pr├Ązisierte Peter, ohne auf die Frage einzugehen, die Moritz ihm gestellt hatte.
Dieser runzelte missbilligend die Stirn. Dann sch├╝rzte er die Lippen.
„Ich war gerade auf dem Weg zum Lokal der Burschenschaft. Du wei├čt sonntags werden dort die Mensuren abgehalten!“
Sein Tonfall war anklagend und Peter unterdr├╝ckte nur m├╝hsam seine Wut auf den so genannten Freund und seine neuen Kameraden. Nimm dich zusammen, ermahnte er sich, sonst hilft er dir nicht.
„Es dauert nur eine Viertelstunde“, erkl├Ąrte er mit einer einladenden Geste in Richtung Kutsche, „wir fahren zu mir und unterwegs erz├Ąhle ich dir alles.“
„Nur, wenn ich endlich die Mumie sehen darf!“, sagte Moritz mit einem widerwilligen Nicken.
Peter zog sich der Magen zusammen. Am liebsten h├Ątte er Moritz einen gemeinen Erpresser genannt, aber er konnte es sich nicht leisten, es mit ihm zu verderben.
„Ja, noch heute Nacht!“, versprach er in einem feierlichen Tonfall und die beiden jungen M├Ąnner gingen zur am Stra├čenrand wartenden Droschke, deren Kutscher sie schon misstrauisch be├Ąugend auf der Stra├če erwartete und dabei den Kopf seines Pferdes t├Ątschelte.
„Wie aufregend! Hast du es dir anders ├╝berlegt, ich meine, was die Mumien-Party betrifft“, meinte Moritz, als sich die Kutsche in Bewegung setzte und zwinkerte Peter verschw├Ârerisch zu.
„Nein! Das hast du falsch verstanden“, entfuhr es Peter und sein Blick verd├╝sterte sich. Dann begann er widerwillig seinen Bericht.