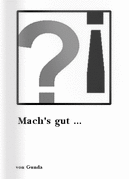„Ein paar Stunden noch“, hat sie gesagt.
„Vielleicht auch ein paar Tage, sagen die Ärzte. Dann wird es vorbei sein.“
Wir glauben es nicht.
Können es nicht glauben, wollen es nicht.
Sein Brustkorb hebt und senkt sich. Hebt sich. Senkt sich. Hebt. Senkt.
Seine Augen sind geschlossen.
„Eine halbe Stunde ohne Sauerstoff. Er spürt nichts mehr ...“, hat sie gesagt und geweint. „Und ihr wisst ja … die Nieren ...“
Betroffen haben wir sie angesehen.
Wir kennen die Vorgeschichte, ja.
Und natürlich haben wir geahnt, dass es früher oder später zu Ende gehen würde.
Aber warum dann früher?
Warum jetzt?
Er hatte doch noch Pläne.
Sie hatten, wir hatten doch noch Pläne.
Ich umfasse seinen Arm. Er fühlt sich an wie immer. Warum auch nicht. Ein ganz normaler Arm, warm und trocken.
Keine Reaktion.
Vorsichtig streichele ich seine Wange, die paar Quadratzentimeter Haut, die man gefahrlos berühren kann, ohne an die Schläuche zu stoßen, die ihm aus Mund und Nase hängen und ihn mit der medizinischen Apparatur am Kopfende des Bettes verbinden.
Wieder wird eine Tür im Leben zufallen, die nicht wieder geöffnet werden kann.
Haben wir nicht gestern noch über „die Alten“ gelächelt, wenn sie seufzten, die Einschläge kämen immer näher?
Ein seltsames Gefühl, hier zu stehen und zu wissen, es gibt kein Erwachen mehr, es ist ein Abschied für immer.
Hebt sich. Senkt sich.
Hilflos sehen wir uns an, mit brennenden Augen.
Was sagt man in einem solchen Moment?
Mach' gut, mein Freund …?
Ein letzter Blick.
Mach's gut.
Das Warten beginnt.