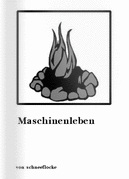Ich bin es leid.
Ich bin es leid, eine Nummer zu sein, eine unter vielen, bedeutungslos, verloren, vergessen. Eine Nummer, die kein Gesicht haben darf, keine Vergangenheit, keine Gefühle, kein Herz. Eine Nummer in einem Zahlenstrang, eine Nummer in einer Liste. Eine Nummer, die an das Etikett auf einer leblosen Maschine erinnert. Und bin ich ihr nicht so unglaublich ähnlich, dieser leblosen kleinen Maschine?
Eine Maschine, die tagein, tagaus vor sich hin rattert, ihre Arbeit tut. Mehr wird von ihr nicht erwartet. Sie muss funktionieren, die Maschine. Ausnahmslos. Beim ersten Fehler wird sie ausgewechselt. Ersetzt. Fehler sind nicht erlaubt.
Neben mir rattern meine Kollegen. Unermüdlich, tagein, tagaus. Sie rattern und rattern, und ich bin mir sicher, dass es vielen ähnlich geht wie mir. Und doch machen wir weiter. Die Angst ist zu groß, eines Tages ersetzt zu werden. Es ist so einfach, jemanden zu ersetzen, der immer dieselbe Arbeit macht. Tagein, tagaus, immer dasselbe. Stupide, langweilig, öde, einsam.
Ich bin stumpf geworden mit den Jahren. Meine Bewegungen sind träger geworden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Doch die Angst treibt mich, spornt mich zu immer neuen Höchstleistungen an. Die Angst, zu langsam zu werden. Die Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst, ersetzt zu werden. Denn das kann passieren. Jederzeit. Ein einziger Fehler...
Ich bin es leid.
Ich bin es so leid, so kalt sein zu müssen. So unberührt. So erstarrt. Manchmal frage ich mich, ob dieses...existieren...dem Tod nicht ähnlicher ist als dem Leben. Es entspricht mehr meiner persönlichen Vorstellung der Hölle. Die Menschen im Mittelalter empfanden das Leben als eine Art Vorstufe zur Hölle. Es erscheint mir irgendwie passend.
Ich bin es leid. Ich bin es so leid.
Wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist, erlaube ich mir eine Flucht in Gedanken. Eine Flucht an einen Ort, der mir schon seit meiner Kindheit vertraut ist. Über die Jahre ist er eine Art zweite Heimat geworden.
Es ist keine blühende Blumenwiese, kein stiller Wald, kein Strand am Meer. Nichts von alledem. Ich kann schon lange keine Farben mehr sehen. Es gibt nur das graue Dämmerlicht der Fabrikhalle und die tiefschwarze Dunkelheit der Nacht, und ich ziehe die Dunkelheit vor. Hier kann ich mich verstecken. Hier kann ich unsichtbar werden. Hier fordert niemand etwas von mir ein, hier gibt es nur mich und die Schatten. Hier bin ich alleine.
„Ich kann nicht mehr.“ Leise, resigniert klingt meine Stimme. So hoch, so kindlich, so klein.
Als Echo wird sie zu mir zurückgeworfen, hallt wieder in dem dunklen, leeren Raum, der mich umgibt.
„Es geht nicht. Ich kann nicht mehr. Ich gebe auf.“
„Entweder, du kämpfst – oder du gehst unter“, lautet die Antwort. Sie dröhnt durch den Raum, vibriert in meinen Ohren. Es gibt kein Entkommen, nicht einmal hier.
Oh ja, ich kenne diese Stimme. Sie ist so kalt, so ungerührt, so schonungslos ehrlich. Sie führt mir vor Augen, was ich ohnehin schon wusste, irgendwo, an diesem dunkelsten Ort in meinem Inneren, an den ich verbanne, was ich nicht wissen will, was ich nicht wahrhaben will.
„Ich brauche eine Pause. Nur eine kleine Pause“, flehe ich verzweifelt, und weiß doch, dass es nichts nutzen wird. Es gibt keine Gnade, keine Barmherzigkeit, nicht in der Welt, in der ich lebe.
Die Antwort ist dieselbe wie immer. Ich wusste, wie sie lauten würde, noch ehe sie ausgesprochen wird, und doch reißt sie mir wieder einmal den Boden unter den Füßen weg, trifft mich wie eine Messer in mein totes, kaltes Herz. Mein totes, kaltes Herz, so verloren und so trostlos wie dieser dunkle Ort, und doch scheint es noch Schmerz empfinden zu können.
„Wenn du gehst, nimmt ein anderer deinen Platz ein. Du hast die Wahl – aber du kannst nur ein einziges Mal falsch entscheiden. Kämpf weiter – oder geh unter.“
(c) by Schneeflocke