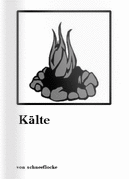Kurzgeschichte
Kälte
0
Über den Autor
Es tut mir leid, dass ich \\\"Restrisiko\\\" löschen musste, aber es ist jetzt in einer Kurzgeschichtensammlung namens \"Das Unfassbare\" vom ipm-verlag veröffentlicht worden.Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
Unter www.bookrix.de/-schneeflocke kann "Restrisiko" nach wir vor noch lesen.
LG Flocke
Leser-Statistik
48
Leser
Quelle
Veröffentlicht am
Kommentare
Senden
| schneeflocke Re: Das - Zitat: (Original von Luzifer am 09.10.2010 - 02:03 Uhr) ist wirklich traurig. Zu Anfang dachte ich noch an einen Obdachlosen und vielleicht habe ich auch recht, was aber nicht zwingend ist, aber der Schluss ist fast schon herzerweichend. Ruhe, Frieden, Geborgenheit, dies alles hat er nun gefunden. Einzig in einer kleinen Aufgabe und doch der größten, die man machen kann. Auch wenn ich mir den Mittelteil mit der Gleichgültigkeit der Menschen um einen herum etwas ausführlicher gewünscht hätte, ist es dennoch nicht zu kurz und in sich alles passend. LG Luzifer Hallo Luzifer! Danke für deinen Kommentar! Freut mich, dass dir die Geschichte gefallen hat. Ja, sie ist traurig. Der Schluss kann jedoch unterschiedlich interpretiert werden - vielleicht ist er oder sie ja wirklich gerettet worden? Übrigens fand ich es sehr interessant, dass du den Ich-Erzähler zu einem Mann gemacht hast. Ich hatte nämlich eine Frau im Kopf...aber es stimmt, ich hab es offen gelassen. Und du hast recht, der Mittelteil ist etwas kurz geraten - vielleicht werd ich die Geschichte irgendwann nochmal überarbeiten, danke für den Tipp. Liebe Grüße, Tina |
Vor langer Zeit - Antworten
| Luzifer Das - ist wirklich traurig. Zu Anfang dachte ich noch an einen Obdachlosen und vielleicht habe ich auch recht, was aber nicht zwingend ist, aber der Schluss ist fast schon herzerweichend. Ruhe, Frieden, Geborgenheit, dies alles hat er nun gefunden. Einzig in einer kleinen Aufgabe und doch der größten, die man machen kann. Auch wenn ich mir den Mittelteil mit der Gleichgültigkeit der Menschen um einen herum etwas ausführlicher gewünscht hätte, ist es dennoch nicht zu kurz und in sich alles passend. LG Luzifer |
Vor langer Zeit - Antworten
10
2
0
Senden
41972