Fantasy & Horror
Mondstrahlen Teil 11 - Kapitel 13
Kategorie Fantasy & Horror
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Es tut mir leid, dass ich \\\"Restrisiko\\\" löschen musste, aber es ist jetzt in einer Kurzgeschichtensammlung namens \"Das Unfassbare\" vom ipm-verlag veröffentlicht worden. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Unter www.bookrix.de/-schneeflocke kann "Restrisiko" nach wir vor noch lesen. LG Flocke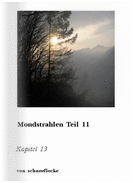
Mondstrahlen Teil 11 - Kapitel 13
Beschreibung
Fortsetzung Caitlin wächst in dem Glauben, dass die Vampire, die die nahen Wälder bevölkern, ihre größten Feinde sind. Bis ihr von einem dieser Vampire das Leben gerettet wird. Ray hat der Liebe abgeschworen. Bis er einem Mädchen begegnet, das sein Leben verändert. Doch die Gesetze des Dorfes fordern den Tod eines Jeden, der mit einem Vampir gesehen wird...
13. Ein Funke in der Dämmerung
Caitlin
Mit dem Frühjahr kam auch die Zeit, in der die Äcker umgegraben und neu bepflanzt werden mussten. Ein gut vier Steinwürfe breiter Streifen Felder umgab das Dorf. Jede Familie besaß einen gewissen Anteil an dem Land, das sie das Jahr über bewirtschaftete und auf dem sie Getreide und Kartoffeln anbaute, welche unsere Hauptnahrungsmittel darstellten. Jetzt im Frühjahr musste die Wintersaat zur Bodendüngung untergepflügt werden, eine schwere, schweißtreibende Arbeit, die vor allem den Männern überlassen wurde. Aufgabe der Frauen war es, auf dem frisch gepflügten Acker die gröbsten Steine aufzulesen, die gemeinsam mit dem tieferen Erdreich nach oben befördert worden waren, und dann in den Furchen die neuen Samen auszusäen und mit einer dünnen Schicht Erde zu bedecken. Auch die Kartoffeln wurden jetzt gepflanzt, und das war heute meine Aufgabe. Mit zusammengebissenen Zähnen schleppte ich den schweren Sack Kartoffeln vom vergangenen Jahr hinter mir her und vergrub im Abstand von einer Elle die Knollen in den von meinen Brüdern aufgeschütteten Dämmen.
Es war früher Abend, und die Sonne näherte sich allmählich dem Horizont. Langsam richtete ich mich auf und reckte mich. Die Arbeit auf dem Feld war mühsam, und heute war ich besonders erschöpft, da am Morgen meine monatliche Blutung eingesetzt hatte. Mein Magen verknotete sich an solchen Tagen verlässlich zu einem schmerzenden, harten Ball, und in regelmäßigen Abständen fuhr mir ein stechender Schmerz in den unteren Rücken, der sich anfühlte, als bohre mir jemand ganz langsam und genüsslich ein Messer in die Wirbelsäule. Es war ein Wunder, dass ich nicht jedes Mal in die Knie ging, wenn wieder einmal eine Welle der Pein durch mich hindurch jagte.
Der Tag, der sich endlos in die Länge gezogen hatte, schien sich also endlich dem Ende zuzuneigen. Ich atmete erleichtert auf. Doch in eben diesem Moment fuhr mir wieder einmal das Messer in den Rücken, und ich formte meinen Mund zu einem lautlosen Stöhnen und krümmte mich. Die Fingerknöchel der rechten Hand, die den inzwischen zur Hälfte geleerten Kartoffelsack umklammerte, färbten sich weiß, und ich grub meine Schneidezähne so tief in meine Unterlippe, dass ich den metallischen Geschmack von Blut auf der Zunge spürte. Es geht vorüber, beschwor ich mich, es geht vorüber.
Als ich nach geraumer Zeit wieder aufblickte, war ich fast alleine auf dem Feld.
„Ist alles in Ordnung, Caiti?“, fragte Kian leise.
Ich hatte nicht gehört, wie er sich mir näherte, und zuckte deswegen ein wenig zusammen, als seine Stimme so dicht neben meinem Ohr erklang. Mein älterer Bruder stand neben mir und betrachtete mich besorgt.
Ich nickte als Antwort auf seine Frage und brachte tatsächlich ein zittriges Lächeln zustande. „Ja, es ist nur diese Frauengeschichte – es geht schon“, murmelte ich verlegen.
„Wir sollten jetzt zurück zum Dorf gehen, es ist schon spät. Meinst du, du schaffst das?“
Ich nickte stumm. Vertraute Hände entwanden vorsichtig den groben Leinensack aus meinem starren Griff, und ich warf meinem Bruder einen dankbaren Blick zu. Er antwortete mit einem Lächeln und einem Schulterzucken. Dann zog ich ein altes, zerschlissenes Tuch aus meiner Schürzentasche und wischte mir den Schweiß von der Stirn und die Erde von den Fingern. Nichts hasste ich mehr als das Gefühl trocknenden Schlammes auf der Haut.
Allmählich ließ der stechende Schmerz nach und wich auf ein erträgliches Maß zurück. Ich atmete tief ein, dann richtete ich mich vorsichtig auf und straffte entschlossen die Schultern.
Langsam gingen wir zum Dorf zurück, das stete, quatschende Geräusch unserer Schritte seltsam laut in der Stille des anbrechenden Abends. Kian wirkte unruhig, immer wieder warf er einen Blick hinüber zum Waldrand. Ich wusste, was ihm Sorgen bereitete. Es wurde allmählich dunkel. Die Dämmerung war nicht mehr fern.
Wir waren schon fast am Tor angelangt, als ich auf einmal erschrocken bemerkte, dass das Gewicht meines hölzernes Kreuz nicht wie gewohnt um meinen Hals hing und mit jedem Schritt über meiner Brust leicht hin und her schwang. Hastig suchte ich sämtliche Taschen an meinem Rock ab, ohne das Erbstück zu finden. Und ich war mir sicher, dass es heute morgen noch da gewesen war. Ich legte es niemals ab, nicht einmal zum Schlafen, und ich konnte mich erinnern, dass ich heute während der kurzen Mittagspause einen Blick zum Waldrand hinüber geworfen hatte und dabei mit der Rechten nach dem Kreuz gegriffen hatte, das dann für einen Moment warm und glatt und beruhigend in meiner Handfläche geruht hatte. Es musste mir wohl bei der Arbeit unbemerkt über den Kopf gerutscht sein! Ich hielt inne, und Kian sah fragend zu mir hinunter.
„Kian, ich habe mein Kreuz auf dem Feld verloren!“
„Lass es dort liegen, es wird morgen auch noch da sein...“, setzte Kian an, doch ich hatte mich bereits umgewandt und eilte zum Feld zurück. Es war das Kreuz meiner Mutter, meine letzte Erinnerung an sie. Ich konnte es einfach nicht über Nacht hier liegen lassen!
„Verdammt, Caiti, es ist schon zu spät!“, brüllte Kian mir hinterher.
„Ich bin gleich wieder da!“, rief ich und zwang meine Beine in einen noch schnelleren Schritt. Schon bald ging mein Atem unregelmäßig, und meine Lungen brannten von der kühlen Luft, die ich in japsenden Atemzügen einsog.
Hektisch suchend lief ich den ganzen Teil des Feldes ab, den ich heute bearbeitet hatte, eine Hand an meine Taille gepresst in dem Versuch, den stechenden Schmerz zu verdrängen, der mich erneut durchfuhr. Manchmal war es so verdammt lästig, eine Frau zu sein! Doch von meinem Kreuz fehlte jede Spur.
Dann verblasste der letzte Sonnenstrahl hinter dem Horizont, und die Dämmerung senkte sich einem rötlichen Schimmer gleich über das Feld. Das Licht schwand zusehends, die Schatten der Wälder rücken näher, dürren Fingern gleich schienen sie nach mir greifen zu wollen. Der Waldrand ragte plötzlich bedrohlich nahe vor mir auf. Mir stockte der Atem, Angst bemächtigte sich meiner und lähmte mich für einige Herzschläge. Ganz langsam richteten sich die feinen Härchen in meinem Nacken auf. Ich fühlte mich beobachtet. Ich war nicht allein! Woher diese Wissen kam, vermochte ich nicht zu sagen, aber ich hätte schwören können, das ein Blick auf mir ruhte. Und dasselbe unheimliche Wissen sagte mir auch, dass dieser Jemand, der mich beobachtete, sich dort in den Schatten des Waldes verbarg. Ich wandte mich um und starrte in die Dunkelheit zwischen den noch immer kahlen Bäumen, deren Äste im schwindenden Licht bleichen Knochen ähnelten, die in den schieferfarbenen Himmel ragten. Doch seltsamerweise wirkte der Wald auf einmal auch merkwürdig anziehend auf mich, und die dürren Finger der Äste schienen mich zu locken, nach mir zu rufen. War ich verrückt geworden? Sehnte ich mich bereits nach dem Tod? Dennoch ließ sich das Gefühl einfach nicht abschütteln. Wie gebannt starrte ich in die dunkleren Schatten des Waldes, unfähig, den Blick abzuwenden.
Ray
Die letzten Sonnenstrahlen brachen sich in glühendem Rubinrot in den Wassertropfen, die die Rinde der noch immer kahlen Bäume hinunter rannen. Die Nässe war überall, selbst die Luft schien schwerer zu sein als sonst, gesättigt von der allgegenwärtigen Feuchtigkeit. Ich hasste diese Übergangszeit zwischen Winter und Frühling, wenn die Kälte mit klammen Fingern überall Einlass fand und das Land noch in der Totenstarre des Winters gefangen war. War das Weiß im Winter die vorherrschende Farbe, dann war es zu Beginn des Frühjahrs dieses allgegenwärtige, schlammige Braun, trist, öde, trostlos.
Ein Eichhörnchen schimpfte auf einem Ast über mir keckernd nach einem Raben, und verstummte dann augenblicklich, als es meiner gewahr wurde. Ein leises Flüstern von weichen Pfoten, die über die feuchte Baumrinde huschten, und es war mit einem letzten Aufblitzen rostroten Pelzes hinter dem Stamm einer entfernten Buche verschwunden. Eine gespenstische Stille herrschte im Wald, und ich fragte mich unwillkürlich, ob ich alleiniger Urheber dieser Stille war, oder ob noch vor mir jemand durch das Unterholz geeilt war...doch der hätte im Schlamm sicherlich Spuren hinterlassen, und ich fand keine. Aber vielleicht war er ja auch einen anderen Weg gekommen...
Ich war auf dem Weg zum Dorf, wie fast jede Nacht, doch heute war ich tief in Gedanken versunken. Das Gespräch, das ich am Tag zuvor mit Jaro gehabt hatte, wollte mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. War es tatsächlich so? War ich schon in sie verliebt? War mein Versuch, mich von ihr fern zu halten, schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen? Und was sollte ich nun mit diesem Wissen anfangen? Sollte ich mich ihr zeigen? Einfach so, nach Monden des Schweigens? Würde sie mich einfach so in ihrem Leben willkommen heißen? Sie sollte es nicht tun. Ich wusste, dass es nicht gut enden konnte. Liebe endete niemals gut. Denn alles, was gut und schön ist im Leben, endet irgendwann. Und irgendwann kommt immer zu früh, hatte ich feststellen müssen.
Und doch...seit letzter Nacht wusste ich, dass es hoffnungslos war, dass der Versuch, mich von ihr fernzuhalten, zum Scheitern verurteilt war. Es hatte regelrecht geschmerzt, meine Hand aus der ihren zu lösen, als sich die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont getastet hatten und ich hatte gehen müssen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Sie hatte leise geseufzt, als ich mich vorsichtig aus ihrer Umklammerung gelöst hatte, und dann hatte sich ihre nun leere Hand zur Faust geballt, so, als versuche sie unbewusst, meine Wärme und das Gefühl der Berührung zu behalten. Ich hatte geschluckt und mich dazu gezwungen, mich von ihr abzuwenden. Jeder Schritt, den ich mich weiter von ihr entfernte, schien unendlich mühsam zu sein, so, als wate ich durch tiefes, reißendes Wasser, das an meinen Hosenbeinen zerrte und dessen Strömung stets in ihre Richtung zu fließen schien. Es wäre so einfach, nachzugeben, zu ihr zurückzukehren.
Und doch musste ich fortgehen. Für ihre Sicherheit, aber auch, weil ich zu nahe am Abgrund taumelte. Ein falscher Schritt, und ich wäre verloren. Und irgendwie wusste ich, dass es kein Zurück mehr geben würde, wenn ich einmal fiel.
Doch je weiter ich mich von ihr entfernte, von dem schlafenden Mädchen, um dessen Mund noch immer ein so bezauberndes Lächeln spielte, desto unwohler fühlte ich mich. Meine Hand schien noch immer leicht zu glühen, und ihre Wärme, die ich noch immer auf meiner Haut zu spüren glaubte, schien einen Weg bis tief in mein Innerstes gefunden zu haben. Das erste Mal seit dem Tod meiner Eltern hatte ich mich nicht alleine gefühlt. Es war gewesen, als sei eine schwere Last von meinen Schultern genommen worden, eine Last, die ich nie bewusst wahrgenommen hatte. Und nun war sie wieder da, die unsichtbare Last, drückte mich mit jedem Schritt, den ich mich von Caitlin entfernte, und damit auch von dem Frieden, den ich für kurze Zeit bei ihr gefunden hatte, ein wenig mehr nieder. Die Kälte schlich sich auf verborgenen Pfaden wieder in mein Herz, und mit ihr kehrte die Einsamkeit zurück.
Ich hätte mich nie als einsam bezeichnet. Doch das schale Gefühl, das mich nun erfüllte, konnte ich mir nicht anders erklären. Ich hatte immer geglaubt, dass ich es vorzog, alleine zu sein, doch dieser Morgen schien mich eines Besseren belehrt zu haben, denn ich hätte alles dafür gegeben, um nur ein wenig länger bei ihr bleiben zu können. Nur noch ein einziges Mal dieses Lächeln zu sehen, nur noch ein einziges Mal die Wärme ihrer Haut auf der meinen zu spüren. Und da wusste ich es. Ich wusste, dass ich dagegen ankämpfen konnte, doch eines Tages würde ich unterliegen. Ich war nicht so stark, wie ich geglaubt hatte, und sie hatte mehr Macht über mich, als ich mir hatte eingestehen wollen. Es war nicht mehr die Frage, ob ich nachgeben würde, sondern wann.
Es wäre so passend, wenn sie jetzt sterben würde, dachte ich bitter, während ich lautlos durch das Unterholz des Waldes huschte, auf dem Weg zu ihr, in der Hoffnung, dass es nicht bereits zu spät war. Jetzt, da ich endlich bereit war, mich ihr zu zeigen. Doch die Angst siegte rasch über die Bitterkeit.
Heute war ich früher aufgebrochen als sonst, da die Grenzwachen einen Boten geschickt hatten, der erst am frühen Abend eingetroffen war. Sie vermuteten, dass ein Vampir des Schattenclans unsere Grenzen überschritten hatte, sie hatten Spuren gefunden, hatten ihn allerdings nicht mehr einholen können. Die Spuren hatten in Richtung Nordosten gewiesen, ehe sie sich in den steinigen Hängen des Vorgebirges verloren hatten. In dieser Richtung lagen, von der Grenze aus gesehen, sowohl unsere Siedlung als auch das Dorf Gwenara.
Es konnte ein einzelner Vampir auf der Jagd sein, so etwas kam vor, wenn auch selten. Und dennoch hatten seine Spuren in direkter Linie nach Nordosten gewiesen, so, als verfolgte er ein Ziel, als wüsste er genau, wohin er wollte. Auf der Jagd gingen wir jedoch selten zielstrebig vor, wir ließen uns treiben, überließen es unserem Instinkt und unserem Geruchssinn, eine geeignete Beute aufzustöbern. Dieser Vampir hatte allerdings allem Anschein nach genau gewusst, wohin er wollte. Und das ließ genau zwei Schlüsse zu: er hatte vor, unsere Siedlung auszuspähen und zu beobachten, oder er interessierte sich für unsere Gewohnheiten, für die Menschendörfer, die wir bewachten, und deren Verteidigung. Alles wies darauf hin, dass er ein Späher war, das war zumindest der Schluss, zu dem Jaro gelangt war. Und er stellte auf jeden Fall eine Gefahr da. Sollte er jemals in die Nähe des Dorfes oder unserer Siedlung gelangen, dann mussten wir um jeden Preis verhindern, dass er seine Aufgabe zu Ende bringen konnte und etwas herausfand, das dem Schattenclan dienlich sein würde.
Jaro hatte die Wachen um die Siedlung herum verdoppelt, kaum das der Bote eingetroffen war, und sie angewiesen, die Verfolgung aufzunehmen, sollten sie des Spähers gewahr werden. Auch die Grenzwachen wurden angewiesen, aufmerksam zu beobachten, was jenseits der Grenzen vorging, denn ein Späher war immer der Vorbote eines Angriffes. Es war schon lange nicht mehr vorgekommen, dass Elenzar einen Vorstoß gegen uns gewagt hatte. Natürlich hatte es den ein oder anderen Überfall auf ein Menschendorf gegeben, aber niemals war ein Angriff auf unsere Siedlung oder die Dörfer, die uns am nächsten lagen, erfolgt. Manod war bereits näher gewesen, als er sich die letzten Jahre gewagt hatte, und seither war die Grenze öfter überschritten worden, als uns lieb war. Unsere Grenzen erstreckte sich über viele Tagesmärsche, es war so gut wie unmöglich, alles im Auge zu behalten. Dennoch war es uns in all der Zeit immer gelungen, unsere Feinde davon abzuhalten, in unser Gebiet vorzudringen. Doch diesmal war etwas anders. Die Vampire schienen genau zu wissen, wann die Wachen wo patrouillierten. Und sie übertraten die Grenzen mit einer Regelmäßigkeit, die Anlass zur Besorgnis war. Für gewöhnlich spürten die Grenzwachen die feindlichen Vampire jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder auf und stellten ihn. Dies war unseres Wissens der erste, dem es gelungen war, so weit vorzudringen.
Ich fragte mich, ob diese Spuren dieselben Spuren waren wie diejenigen, die ich vor Caitlins Fenster gesehen hatte. Ich hoffte, dass ich mich irrte, dass der Unbekannte vor Caitlins Fenster ein Mensch gewesen war und kein Vampir, denn sollte es ein Vampir gewesen sein...dann hatte er an meinem Geruch erkannt, dass ich bei ihr war. Und wusste daher bereits, dass ich nach wie vor über ihr wachte. Dass sie mir demnach sehr viel bedeuten musste. Zu viel. Denn meine größte Sorge war, dass Jaro und die Grenzwachen irrten und es kein Späher war, sondern ein Vampir, geschickt von Elenzar, mit einem Auftrag. Einem Auftrag zu einem Mord.
Das Mädchen, dass mir, wie ich hatte feststellen müssen, mehr bedeutete, als ich mir jemals hatte eingestehen wollen, als ich jemals zulassen wollte, befand sich möglicherweise in großer Gefahr.
Und wenn der Vampir bereits in der letzten Nacht die Grenzen überquert hatte, hatte er einen bedeutenden Vorsprung. Er konnte inzwischen überall sein, hatte vielleicht sein Ziel bereits erreicht. Bei diesem Gedanken trieb ich mich zu noch größerer Eile an.
Caitlin
Aus den Augenwinkeln sah ich noch einen verschwommenen Schatten, der in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf mich zueilte. Im nächsten Augenblick verlor ich den Boden unter den Füßen und fand mich wenig später an den dicken Stamm einer alten Eiche gepresst.
Ich wurde so eng an den Baum gedrückt, dass ich mich nicht mehr rühren konnte. Kräftige Arme fesselten meine Hände über meinem Kopf. Der Griff war beinahe sanft, doch ich wusste, dass ich ihm dennoch nicht entkommen konnte – obwohl sich die breiten Hände nur locker um meine schlanken Handgelenke legten, spürte ich doch die eiserne Stärke, die ihnen innewohnte. Die raue Rinde bohrte sich in meine Handrücken, feucht, kühl und unnachgiebig.
Zu Tode erschrocken sah ich auf – und blickte in bekannte, braune Augen, die mich wütend anfunkelten, und ich glaubte, einen Schimmer von Rot in ihren Tiefen zu erkennen. Ich zuckte zusammen.
„Ray...“, hauchte ich. Mehr brachte ich nicht heraus. Er presste mich jetzt noch dichter an den Baum, und ich konnte ihn am ganzen Körper spüren, sein warmer Atem strich über meine Wangen. Mir wurde schwindelig. Noch nie war ich jemandem so nahe gewesen. Selbst mein Bruder, der mich oft in den Arm genommen hatte, um mich zu trösten, wenn ich wieder einmal aus einem meiner Alpträume geschreckt war, hatte mich nie so umarmt. Er hatte seine großen, warmen Hände auf meine Schultern gelegt und meinen Kopf an seine Brust gedrückt, aber der Rest meines Körpers war stets eine Handbreit von ihm entfernt gewesen.
„Du hast dein Wort gebrochen!“ fuhr Ray mich jetzt an. Sein Gesicht war vollkommen unbewegt, doch ich gewahrte den Zorn in seiner Stimme, den er nur mühsam beherrschte. Seine Augen schienen Funken zu sprühen.
„Was kümmert es dich? Du bist einfach aus meinem Leben verschwunden. Du hattest mich vergessen!“ Meine Stimme klang nicht so aufgebracht, wie sie es hätte sollen, doch der Schreck saß mir noch immer in den Gliedern. Und ich hatte den leisen Verdacht, dass es nicht nur die Angst war, die mir den Atem geraubt hatte. Er ragte über mir wie ein Rachegott, so nahe, wie er mir noch nie zuvor gewesen war. Ich biss die Zähne zusammen und zwang mich dazu, all das zu ignorieren. Ich fürchtete ihn nicht. Daran hatte sich nichts geändert. Und ich war...wütend. Die widersprüchlichsten Empfindungen jagten rasend schnell durch mich hindurch, und ihre Intensität verwirrte mich.
„Ich hatte dich nicht vergessen, wie kommst du denn darauf! Ich hatte dir mein Wort gegeben, auf dich acht zu geben, und ich halte mein Wort!“, zischte er. Ich schrak vor seinem eisigen Tonfall zurück, doch er half mir auch dabei, wieder in die Wirklichkeit zurückzufinden. Tief in meinem Inneren trugen nun der Zorn und der Trotz den Sieg davon. Ich wusste, dass ich ihm versprochen hatte, mich vom Wald fern zu halten. Und Herrgott, bis zum heutigen Tag hatte ich das auch wirklich getan! Ich war nur kurz umgekehrt, um nach meinem Kreuz zu suchen. Ich war nicht einmal in die Nähe des Waldrandes gekommen! Und da wagte er es, mir vorzuwerfen, ich hätte mein Wort gebrochen! Er, der ohne ein Wort des Abschiedes einfach verschwunden war!
„Vier Monde, Ray! Es waren vier Monde! Ohne eine Nachricht! Natürlich hattest du mich vergessen! Warum sonst bist du so plötzlich wieder verschwunden?“, rief ich mit vor unterdrückter Wut bebender Stimme. Was fiel ihm ein, jetzt aufzutauchen und mich zurechtzuweisen!
Er wandte den Blick ab.
„Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig!“, schleuderte ich ihm entgegen. „Du hast deine Pflicht getan und mich gewarnt, jetzt kannst du wieder verschwinden, wie du es das letzte Mal getan hast! Ich musste zurück, und so bin ich eben gegangen!“, fügte ich leise und giftig an.
„Allein?! Ohne Begleitung?! Der Wald ist gefährlich, wie oft soll ich dir das noch sagen!“, brüllte Ray, der jetzt vollends die Beherrschung zu verlieren schien. „Was zum Teufel ist mit dir los? Begreifst du die Bedeutung des Wortes Gefahr nicht?“
„Kian ist in der Nähe. Und außerdem kann ich selbst auf mich Acht geben, danke!“ erwiderte ich trotzig.
Meine Knie wurden weich unter seinem eindringlichen Blick, der bis tief in mein Innerstes zu sehen schien. Ich war dankbar, dass er mich nach wie vor fest gegen den Baum presste und mich so aufrecht hielt. Außerdem fühlte es sich unglaublich gut an, seinen warmen Körper so nahe an meinem zu spüren. Es fühlte sich richtig an. Energisch schüttelte ich den Kopf, um wieder klar denken zu können.
„Was bist du nur für ein stures Menschenmädchen, Caitlin! Willst du unbedingt sterben? Weißt du nicht, dass du in Lebensgefahr schwebst, sobald du die Palisaden verlässt? Du bist Elenzar entkommen! Er wird nicht eher ruhen, bis er dein Blut getrunken hat!“ Zornig blitzten die braunen Augen und bohrten sich in meine.
„In letzter Zeit haben sie sich so weit in unser Gebiet vorgewagt wie noch nie zuvor. Wir haben die Wachen verdoppelt, aber das heißt nicht, dass sich ein einzelner Vampir nicht unbemerkt an ihnen vorbei schleichen kann. Weißt du, wie knapp du das letzte Mal dem Tod entronnen bist? Hast du eine Vorstellung davon, was Elenzar mit dir gemacht hätte, wenn ich nicht rechtzeitig zur Stelle gewesen wäre? Er ist ein Vampir des Schattenclans! Sie ernähren sich von Euresgleichen! Muss ich noch deutlicher werden, Caitlin? Muss ich dir beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn allmählich das Leben aus dir herausrinnt? Wie du dich fühlst, wenn dir bewusst wird, dass dies das Ende ist, dass es der letzte Atemzug ist, den du jetzt tun wirst? Dann ist es vorbei, Mädchen! Wenn er dir zu viel Blut genommen hat, kann dir niemand mehr helfen!“
Ich schauderte leise. Seine Worte beschworen ein unwillkommenes Bild vor meinem inneren Auge herauf – rotglühende Augen, die mich gierig anstarrten, blitzende Zähne, die sich mir näherten, meine Kehle aufrissen, mein Blut tranken – der metallische Geschmack von Blut füllte auf einmal meinen Mund, und mir wurde übel. Die Angst, so lange zurückgedrängt, brach sich Bahn. Ich war schwach. Hilflos und schwach. Mir wurde heiß, dann kalt. Eiskalt. Ich zitterte.
„Ich kann nicht immer in der Nähe sein und dich retten, weißt du“, fuhr Ray leise fort; er löste den Griff um meine Handgelenke, umfasste meine Schultern und schüttelte mich leicht, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
„Meine Cousins sind talentierte Jäger, warum musstest du ausgerechnet heute, wenn sich dieser vermaledeite Vampir wahrscheinlich auch noch irgendwo hier in der Nähe aufhält...“, redete er sich allmählich wieder in Rage. „Merktest du nicht, in welch einer Gefahr du dich befandest? Begreifst du nicht, wie gefährlich wir sind? Ich ... es ist schon schwer genug, dich zu beschützen, musst du es mir noch schwerer machen?“, brach es schließlich aus ihm heraus.
„Warum machst du dir überhaupt die Mühe? Was kümmert es dich? Lass mich doch einfach diesem Elenzar!“
„Als ob ich das könnte! Verdammt noch mal, merkst du denn nicht... !“, rief Ray aufgebracht.
„Was soll ich denn merken? Dass ich nur ein unzulänglicher Mensch bin, der zu tollpatschig ist, auf sich acht zu geben? Dass ich zu schwach bin, eine hilflose Beute? Dass ich ständig bedroht werde und mich nirgends mehr sicher fühlen kann? Dass ich dir eine Last bin?“
„Dass ich es nicht ertragen würde, dich zu verlieren! Dass du mir zu viel bedeutest!“ flüsterte Ray und schluckte. Seine Augen wurden weich. In ihren braunen Tiefen glaubte ich noch immer ein Glühen zu erkennen, doch es war anders als zuvor. Sanfter, aber nicht weniger eindringlich, und seltsam entschlossen, so als hätte er nach reiflicher Überlegung eine Entscheidung getroffen.
Ich starrte ihn wie gebannt an. Ich brachte keinen Ton heraus. Unsere Blicke trafen sich, verfingen sich ineinander, ließen sich nicht mehr los. Meine Welt löste sich auf, die Teile trudelten eine Weile haltlos umher, bis sie sich schließlich zu einem völlig neuen Bild zusammenfügten.
Ray löste zögernd seine Hände von meinen Schultern. Vorsichtig umfasste er mein Gesicht. Die Hitze seiner Handflächen schien mich zu wärmen wie ein offenes Feuer, dem man zu nahe kommt, und ich spürte, wie mir das Blut in die Wangen schoss. Die Wärme schien einem feurigen Strom gleich durch meine Adern zu fließen und breitete sich bis in meine Zehenspitzen aus. Wie gebannt starrte ich ihn an, überwältigt von diesen mir völlig unbekannten Empfindungen, und in seinen Augen las ich dasselbe Staunen, aber auch eine Intensität und Versunkenheit, die mein Herz schneller schlagen ließen.
Er neigte den Kopf, sein Gesicht kam immer näher, bis seine glühenden Augen zu einem einzigen braunen Fleck verschwammen, und dann berührten seine Lippen vorsichtig und zaghaft die meinen.
Ein Schauer durchrieselte mich. Wie von selbst fanden meine Hände ihren Weg in seine Haare und vergruben sich in den weichen Locken in seinem Nacken. Langsam, beinahe unwillig, löste er seinen Mund von meinem und wich ein wenig zurück, um mir in die Augen sehen zu können. Sein hungriger, flammender Blick traf auf meinen, suchte mein Einverständnis und fand es. Mit einem leisen Seufzen legten sich da seine Lippen erneut auf meinen Mund, sanft und warm, aber nicht mehr ganz so zaghaft wie zuvor. Seine Arme schlangen sich fest um mich, zogen mich noch näher an ihn heran. Ich spürte ihn jetzt am ganzen Körper, seine Wärme durchdrang die Stoffschichten, die uns voneinander trennten. Seine Zungenspitze fuhr zärtlich über meine Unterlippe, öffnete behutsam meinen Mund, und meine Knie wurden weich. Er stöhnte leise, als seine Zunge die meine berührte, ein überraschter, tiefer Laut, der in meinem Mund wiederhallte, und da begann ich haltlos zu zittern. Nur seine Arme hielten mich jetzt noch aufrecht. Der Kuss wurde drängender, stürmischer.
„Caiti!“, hörte ich da meinen Bruder wie aus weiter Ferne nach mir rufen. Ich blinzelte verwirrt, es war, als hätte mich ein Kübel eiskaltes Flusswasser aus einem wunderschönen Traum gerissen. Einen Augenblick lang verschmolzen meine Augen mit Rays, dann war er verschwunden. Schmerz durchfuhr mich, und zugleich verspürte ich eine wilde, verzweifelte Freude. War das schon wieder ein Abschied? Kaum hatte ich ihn gefunden, verlor ich ihn schon wieder. Er war einfach nicht greifbar, mehr ein Traum als Realität. Doch der Kuss eben war kein Traum gewesen! Zaghaft fuhr ich mir mit den Fingern über die Lippen. Sie fühlten sich fremd an, beinahe ein wenig geschwollen.
Ray
Ich wollte eben aus dem Wald treten, als ich sie sah. Sie stand wenige Schritte vom Waldrand entfernt – und blickte mir geradewegs in die Augen. Nicht, dass ihre Augen bei der anbrechenden Dämmerung die Schatten, die mich im Wald verbargen, zu durchdringen vermocht hätten. Dennoch fuhr mir dieser Blick einem flammenden Pfeil gleich durch das Herz.
Und dann spürte ich die Wut, die sich auf einmal meiner bemächtigte. Was hatte sie hier zu suchen, so kurz vor Einbruch der Dunkelheit? Wollte sie sich absichtlich in Gefahr begeben? Bedeutete ihr ihr Leben so wenig, oder war es gar bloße Gedankenlosigkeit? Sie sollte es besser wissen! Hatte ich sie nicht erst vor vier Monden aus demselben Wald gerettet? Tat sie das absichtlich, damit ich immer und immer wieder mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ich sie nicht verlieren konnte? Brachte sie sich bewusst in Gefahr, um mich dazu zu zwingen, mir meine Gefühle für sie einzugestehen?
Ehe ich mich versah, war ich auch schon aus meiner Deckung heraus, hatte sie an mich gezogen und war mit ihr einen Steinwurf weit in den Wald gerannt, außer Hörweite ihres Bruders, der in der Nähe der Palisaden auf sie wartete. Ich presste sie gegen einen Baum, ließ ihr damit keine Chance, mir zu entkommen. Ich wollte Antworten, ich wollte eine Erklärung, und ich wollte sicherstellen, dass sie die Gefahr begriff, in der sie schwebte.
Ich konnte nicht verhindern, dass meine Augen vor Zorn blitzten, und meine Wut schien dazu zu führen, dass sie trotzig wurde wie ein kleines Kind. Sie wollte nicht über sich und ihr Leben bestimmen lassen, das erkannte ich nur zu deutlich. Ich glaube sogar, dass sie irgendwann begriff, dass sie unvernünftig gehandelt hatte – vielleicht war es ihr auch von Anfang an bewusst gewesen. Als ich ihr vor Augen führte, wie real die Gefahr war, die von Elenzar und dem Schattenclan ausging, sah ich Angst in ihren Augen. Diese Angst schien ein unglaublich starkes Bedürfnis in mir zu wecken, sie vor allem und jedem zu beschützen und niemals zuzulassen, dass ihr ein Leid geschah. Doch ich hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Ich musste ihr die Gefahr begreiflich machen, oder jeder Versuch, sie zu schützen, war zum Scheitern verurteilt.
Und als sie mich dann fragte, warum es mich kümmerte, ob sie nun starb oder nicht, und warum ich Elenzar nicht sein Werk vollenden lassen wollte, als ich das Bild vor meinem inneren Auge sah – Caitlin, todesbleich, die sanften blauen Augen bar jeden Lebens- durchfuhr mich die Erkenntnis wie ein Donnerschlag. Ich konnte sie ganz einfach nicht verlieren. Ich konnte sie genauso wenig verlieren wie den kleinen Marlon, Aiden, Elaine oder Jaro – weil sie irgendwie den Weg in mein Herz gefunden hatte. Jaro hatte recht gehabt.
Ich war verloren, und ich wusste es.
Diese großen, kornblumenblauen Augen sahen jetzt wie gebannt zu mir auf, und ich verlor mich in ihren Tiefen. Fast ohne mein Zutun senkten sich meine Lippen auf ihren weichen Mund. Zart und warm und so weich schmiegten sie sich an die meinen – wollte sie das? Mühsam zwang ich mich dazu, ein wenig zurückzuweichen, und blickte suchend in ihre Augen. Ein Feuer schien in ihnen zu brennen, so heiß und lodernd wie in den meinen. Ich spürte, wie sich ihre kleinen Hände in meinem Haar wanden, und mit einem erleichterten Seufzen, das irgendwo tief aus meinem Inneren zu kommen schien, legte ich meinen Mund erneut auf den ihren.
Meine ganzer Körper schien in Flammen zu stehen. Lodernde Flammen, die mich verzehrten. Meine Sinne waren wie benebelt, das Blut sang in meinen Adern, und ich spürte einen unwiderstehlichen Drang, sie an mich zu pressen und zu verschlingen. Immer fester pressten sich meine Lippen auf die ihren, so weich und warm und einladend, und dann öffnete sich ihr Mund unter dem meinen. Ich spürte, wie ich immer mehr die Kontrolle über mich verlor, ein tiefes Stöhnen entwischte mir, ein beinahe animalischer Laut, und ich konnte einfach nicht genug bekommen, es war, als schrie alles in mir nach Mehr, Mehr, MEHR...
„Caiti!“, schnitt der Ruf ihres Bruders einem Messer gleich durch die Stille des Waldes. Wie war er so schnell so nahe gekommen, ohne dass ich etwas bemerkt hatte? Mit einer Willensanstrengung, derer ich mich nicht mehr für fähig gehalten hatte, riss ich mich von ihr los. Gerade eben ging die Sonne unter, der unbekannte Vampir durchstreifte noch immer ungehindert unsere Wälder, die Menschen durften uns nicht gemeinsam sehen, sonst lief sie Gefahr, als Verräterin hingerichtet zu werden, ich wusste nicht, inwieweit ich ihrem Bruder trauen konnte, und ich konnte es mir jetzt nicht leisten, so abgelenkt zu sein, wenn sich Caitlin derart offensichtlich in Gefahr befand! Ich verfluchte mich innerlich für meine Unaufmerksamkeit. Was hatte sie nur mit mir gemacht? Ich hatte nicht die Absicht gehabt, sie zu küssen! Ich hatte sie zurechtweisen, sie vor der Gefahr warnen wollen, in der sie schwebte, der sie sich so völlig bedenkenlos ausgesetzt hatte. Ich war wütend gewesen. Schon dieser Zorn war eine völlig neue Erfahrung für mich.
Dieses Mädchen durchbrach sämtliche Schutzschilde, die ich so sorgsam um mein Innerstes errichtet hatte, vollkommen mühelos! Sie besaß eine gefährliche Macht über mich. Sie konnte mich zerstören, vollkommen und restlos. Und doch schlug mein Herz noch immer in einem unglaublich schnellen Rhythmus, und eine tiefe Freude und ein Gefühl des Friedens durchströmten mich, wie ich es noch nie verspürt hatte...
Irgendwo tief in meinem Inneren fragte ich mich, ob es bei meinem Vater vielleicht ähnlich gewesen war. Vielleicht gab es noch etwas anderes als den Schmerz und den Hass. Und vielleicht, nur vielleicht, gab es manchmal etwas, das es wert war, den Schmerz zu ertragen. Ich fragte mich, ob mein Vater, hätte ich ihn gefragt, nicht vielleicht sogar geantwortet hätte, dass er nichts bereute. Dass das Glück, das er bei meiner Mutter gefunden hatte, all das wert gewesen war.
Über den Autor
Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden.
Unter www.bookrix.de/-schneeflocke kann "Restrisiko" nach wir vor noch lesen.
LG Flocke
Leser-Statistik
32
Kommentare
Kommentar schreiben
| schneeflocke Re: Es - Zitat: (Original von Luzifer am 20.03.2012 - 15:46 Uhr) ist schon eine ganze Weile her, dass ich den letzten Teil gelesen hatte, und doch sind die Charaktere und die Szenerie noch immer gegenwärtig. Es macht einfach Freude die Geschichte zu lesen und sich gleichzeitig zu fragen, wie es weiter gehen wird. Sicher, ein paar kleinere Fehler sind drin und den einen oder anderen Satz könnte man überarbeiten, doch welches Buch ist schon perfekt. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, ob du diese Geschichte überhaupt noch weiter schreiben wirst. Ich würde es schade finden, wenn sie so einfach enden würde. =) Beste Grüße Luzifer Hallo Luzifer, danke für den lieben Kommentar! Ja, ich habe vor, die Geschichte irgendwann zu beenden. Der Plot steht, zumindest in meinem Kopf ;) Aber irgendwie häng ich gerade. Ich find nicht mehr so richtig in die Atmosphäre der Geschichte hinein. Ich denke, dass ich irgendwann an den Punkt komme, an dem ich dann sagen kann: jetzt hab ichs. Jetzt kanns weitergehen. Aber ich will auch nichts erzwingen. Ich kann nicht gut schreiben, wenn ich mich selbst unter Druck setze. Beste Grüße zurück, Flocke |
| Luzifer Es - ist schon eine ganze Weile her, dass ich den letzten Teil gelesen hatte, und doch sind die Charaktere und die Szenerie noch immer gegenwärtig. Es macht einfach Freude die Geschichte zu lesen und sich gleichzeitig zu fragen, wie es weiter gehen wird. Sicher, ein paar kleinere Fehler sind drin und den einen oder anderen Satz könnte man überarbeiten, doch welches Buch ist schon perfekt. Nun stellt sich mir natürlich die Frage, ob du diese Geschichte überhaupt noch weiter schreiben wirst. Ich würde es schade finden, wenn sie so einfach enden würde. =) Beste Grüße Luzifer |