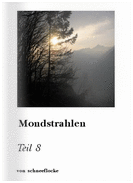10. Blutroter Schnee
Ray
Der Wald um uns herum war vollkommen still. Sämtliche Tiere waren erschrocken verstummt, als sie unsere Nähe gespürt hatten, und der kniehohe Schnee schluckte das leise Wispern und Gluckern des zur Hälfte von Eis bedeckten Baches am anderen Ende der Lichtung. Die Sonne war gerade eben über den Horizont gestiegen, und die ersten Strahlen bahnten sich zögerlich ihren Weg, durchdrangen die leichte Wolkendecke und brachen sich funkelnd auf den Eiskristallen der mit Raureif überzogenen Bäume. Die filigranen Figuren und Muster, die das gefrorene Wasser auf den Ästen und Zweigen bildete, bebten leise in der leichten, eiskalten Brise, die jetzt aufkam. Der dichte Nebel, der wie ein undurchdringlicher Vorhang über der Lichtung gehangen hatte, verwehte zu weißen Rauchschleiern, die sich wie Bänder schlangengleich um die Bäume wanden. Er hatte in der Morgendämmerung eine beinahe blutrote Färbung angenommen, die sich kontrastreich gegen das Weiß des Schnees abhob. Es war ein idyllisches Bild, die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm, dessen Vorboten sich bereits ankündigten, denn in der Ferne glaubte ich, das Stapfen von schweren Stiefeln im Schnee zu vernehmen.
Hinter uns lag der Weiler Manod, nur durch einen schmalen Streifen Wald den Blicken verborgen. Vor uns erstreckte sich ein kleines Feld – einige der Dörfler bauten hier im Sommer Getreide an, doch jetzt im Winter lag es brach und bot uns einen ebenen, freien Platz, wie geschaffen für einen Kampf. Das Menschendorf lag am Ende einer engen Schlucht, was uns die Verteidigung erleichterte. Die steilen, schroffen Felswände glänzten schiefergrau von der Nässe des in der Sonne schmelzenden Schnees, und sie warfen weite Schatten, die uns jedoch zu dieser Tageszeit noch nicht ganz erreichten. Mit dem immer näher rückenden Feind vor uns, den Felswänden zu beiden Seiten und dem Talkessel mit dem Dorf in unserem Rücken, saßen wir allerdings auch buchstäblich in der Falle. So etwas wie einen Fluchtweg gab es nicht, ein Rückzug kam nicht in Frage. Wir mussten siegen oder untergehen. Der andere entscheidende Nachteil, den dieses Schlachtfeld hatte, war die Ausrichtung nach Osten: da es noch früh am Morgen war, würde uns die Sonne bald direkt ins Gesicht scheinen, sobald sich der Nebel unter den immer kräftigeren Strahlen vollständig verflüchtigt haben würde. Doch welche Wahl hatten wir schon? Der Schattenclan war zu weit vorgedrungen, als dass wir einen anderen Ort für diese Konfrontation hätten wählen können.
Jaro stand gemeinsam mit Logan an vorderster Front. Ich sah, wie sie einen bedeutsamen Blick miteinander tauschten. Ich hatte das schon öfter beobachtet, manchmal kam es mir so vor, als bräuchten die beiden Männer keine Worte, um zu verstehen, was der andere dachte. Dann schloss mein Onkel seinen Freund fest in die Arme, und einen Augenblick später machte sich Logan auf zum anderen Ende des Schlachtfeldes. Er würde den linken Flügel befehligen, Jaro den rechten. So war es schon immer gewesen, denn während des Kampfes trug eine Stimme nicht sonderlich weit. Auch konnte es in einer Schlacht von Vorteil sein, wenn man die Männer aufteilte, denn die beiden kleineren Einheiten waren beweglicher als eine große.
Mein Onkel ging nun seine Seite ab, hielt vor jedem Krieger kurz inne, um ein paar Worte mit ihm zu wechseln oder ihm einfach nur aufmunternd auf die Schulter zu klopfen. Sein rabenschwarzes, von wenigen grauen Strähnen durchzogenes schulterlanges Haar flatterte im Wind, als er leise letzte Befehle erteilte und uns so postierte, dass wir den Weg zum Dorf vollständig versperrten.
„Jungs...“ Jaro war nun vor mir und Aiden angelangt, und er sah erst seinem Sohn, dann mir tief in die Augen. Besorgnis flackerte in den grünen Tiefen, und ich sah auch die Falten auf seiner Stirn, die ihn älter erschienen ließen, als er für gewöhnlich wirkte. „Gebt gut auf euch Acht, ja? Eure Mutter zieht mir das Fell über die Ohren, wenn ich euch nicht heil zurückbringe.“
Aiden nickte nur stumm. Er war unnatürlich blass, und sämtliche Muskeln seines Körpers schienen bis zum Zerreißen gespannt zu sein. Ich legte ihm eine beruhigende Hand auf die Schulter und rang mir dann ein schwaches Lächeln ab.
„Ich werde nicht zulassen, dass ihm etwas geschieht“, versprach ich meinem Onkel mit fester Stimme.
So, wie Aiden mir früher immer beigestanden hatte, wenn ich uns wieder einmal in Schwierigkeiten gebracht hatte, so hatte ich immer schon auf ihn Acht gegeben, wenn ernsthafte Gefahr gedroht hatte. Auch wenn Aiden mit seiner eher schlanken Statur ein wendiger und geschickter Kämpfer war, hatte die jahrelange Übung, die ich ihm voraus hatte, doch immer dazu geführt, dass ich ihm in dieser Hinsicht überlegen war. Ich war nie stolz darauf gewesen, ich hatte den Umgang mit dem Schwert meines Vaters von Kindesbeinen an perfektioniert, doch es war niemals meine Absicht gewesen, ein guter Kämpfer zu werden. Es war meine Art gewesen, mit der Vergangenheit zurechtzukommen, und wenn es mir dadurch gelang, mich und Aiden besser zu verteidigen, dann war das ein Vorteil gewesen, den ich stets zu schätzen gewusst hatte. Nicht, dass es mich sonderlich gestört hätte, wenn ich eines Tages im Kampf unterlegen wäre, doch ich wollte nicht für Aidens Tod verantwortlich sein oder ihn gar mit ansehen. Ich war es so leid, die, die ich liebte, vor meinen Augen sterben zu sehen. Und dann war da auch noch das Mädchen, das meines Schutzes bedurfte. Auch ihr hatte ich ein Versprechen gegeben, und ich hatte nicht vor, es zu brechen, indem ich heute fiel.
„Sieh nur zu, dass dir selbst nichts geschieht“, erwiderte Jaro ernst. Dann warf er uns einen letzten Blick zu und wandte sich um, um seine eigene Position einzunehmen.
Am anderen Ende des Feldes traten die Vampire des gegnerischen Clans jetzt aus der Deckung der Bäume hervor. Es waren wohl zwei Dutzend Mann, die dort den kleinen Hügel hinabstiegen, stumm und beinahe lautlos, das Knirschen des Schnees unter den gut drei Dutzend Paar Stiefeln des einzige Geräusch, das ihr Kommen ankündigte.
„Mach dich bereit“, meinte ich leise zu Aiden. „Es geht gleich los.“
Aiden nickte. Das Blut war ihm aus dem Gesicht gewichen, und er vergrub nervös die Schneidezähne in der Unterlippe.
„Es sind so...viele!“, meinte er besorgt und kniff die Augen gegen das heller werdende Licht zusammen.
„Ganz ruhig“, murmelte ich. „Sie sind uns nur um ein paar Mann überlegen. Wir waren schon weitaus schlimmer in der Unterzahl. Bleib einfach in meiner Nähe.“
Langsam zog ich nun das Schwert meines Vaters aus der ledernen Scheide an meiner Hüfte – unzählige Runen wanden sich schlangengleich um das Heft, und die blankpolierte Schneide blitzte in der bleichen Wintersonne. Der mit Leder umwickelte Griff lag glatt und beruhigend schwer in meiner Hand. Das vertraute Gewicht wurde zu einem Teil meiner selbst, eine Verlängerung meines Armes. Schon bald würde Blut die Klinge rot färben. Das leise Klirren, als einer nach dem anderen ebenfalls das Schwert zückte, schnitt laut durch die Stille. Dann warteten wir, reglos, schweigend, und beobachteten, wie die Krieger des Feindesclans mit ihren Stiefeln Muster in der zuvor makellosen Schneedecke der Lichtung hinterließen, als sie langsam auf uns zukamen. Jetzt vernahm ich auch das leise Schaben der Lederscheiden über den gewebten Mänteln, und dann wurden auf der Gegenseite mit einem metallischen Klirren ebenfalls die Schwerter gezückt.
„Halt!“ Jaro trat vor, als die Vampire des Schattenclans nur noch einen guten Steinwurf entfernt waren, und stellte sich mit gebieterisch erhobener Hand der herannahenden Truppe entgegen. „Dies ist unser Gebiet. Hiermit fordere ich euch auf, es unverzüglich zu verlassen!“
„Wir sind euch überlegen, alter Mann!“, rief Elenzar zurück, der ebenfalls vor seine Männer getreten war. Ein siegesgewisses Lächeln spielte um seine Mundwinkel. Mit dem Breitschwert, dass er mit beiden Händen umfasste, deutete er auf unsere kampfbereiten Reihen. „Versucht nicht, uns aufzuhalten. Ihr werdet unterliegen. Lasst uns vorbei und akzeptiert unsere Herrschaft über den gesamten Wald, wie es von Anbeginn bestimmt war, und euch wird nichts geschehen.“ Ich hörte den Hohn in seiner Stimme, und ich wusste, dass er nicht auch nur einen Augenblick dachte, wir würden ihn kampflos ziehen lassen. Er wollte nur noch einmal die Gelegenheit nutzen, den Hass auf beiden Seiten zu schüren, indem er uns einen scheinbaren Ausweg ließ, in Wirklichkeit aber unsere Tapferkeit in Frage stellte und uns verspottete. Das war Elenzars Art, er hatte stets nichts als Verachtung für uns übrig gehabt. Eines Tages würde ihm das zum Verhängnis werden, das hatte ich mir schon vor langer Zeit geschworen.
„Ihr befindet euch auf dem Grund, der uns rechtmäßig zugesprochen wurde, Elenzar. Wir werden ihn nicht kampflos aufgeben“, warnte mein Onkel ein letztes Mal, auch diese Warnung mehr eine Formalie. Wir wussten, dass er nicht weichen würde, nicht, wenn seine Truppen in der Überzahl waren und er einen Sieg witterte. Nicht, wenn er schon so nahe an dem Menschendorf war und seine Männer sicherlich schon Blut geleckt hatten und bereits begeistert in der Brise schnüffelten, die ab und an den schwachen Menschengeruch vom Dorf herübertrug.
„Dann soll es so sein!“
Und mit diesen Worten gab Elenzar mit erhobener Hand das Zeichen zum Angriff. Die Krieger des Schattenclans setzten sich brüllend und johlend in Bewegung. In wenigen Augenblicken würden ihre Reihen auf die unseren prallen.
Ich spürte das vertraute, leichte Brennen meiner Augen, dann fiel ein rötlicher Schleier vor mein Blickfeld, und ich wusste, dass meine Iris nun rot glühte – wie die all der anderen auch. Es war die wohlbekannte Kampfeslust, die sich nun meiner bemächtigte – ein Grund, weswegen ich den Kampf fürchtete, weswegen ich so ungern in die Schlacht zog. Ich hatte keine Angst vor dem Sterben. Ich fürchtete, jenen Teil meiner selbst, der im Kampfgetümmel verloren ging, am Ende der Schlacht nicht wieder finden zu können. Irgendein Instinkt, ein Erbe meines Vaters, schien mich zu leiten, wenn meine Augen diesen seltsamen Glanz annahmen, und ich verlor immer ein wenig die Herrschaft über meinen eigenen Körper, ein beängstigendes Gefühl.
Doch diese Gedanken entflohen mir, als sich der rote Schleier verdichtete. Ich war auf einmal vollkommen konzentriert. Es gab nur meine Klinge und mich. Ich spreizte die Beine und ging leicht in die Knie, um einen festen Stand zu haben. Der Schnee knirschte leise unter meinen Stiefeln, als ich das Gewicht verlagerte.
Mit erhobenen Schwertern rannten die Männer des Schattenclanes nun auf uns zu, die Sonne brach sich glänzend auf den blanken Klingen, und die schwarzen Haare des Mannes, der auf mich zuhielt, wehten einem dunklen Vorhang gleich im Wind. Der Anblick erinnerte mich an eine Totenflagge, die über einem frischen Grab weht. Die roten Augen den meinen so ähnlich, gab es nicht viel, das uns voneinander unterschied. Einzig der andere Schnitt seiner Kleidung, das fremde Wappen, das seine Brust zierte und ihn als Grenzwache des Schattenclanes auswies, und die Seite, auf der er kämpfte, die Einstellung, die er vertrat, machten uns zu Gegnern. Ich empfand keinen Hass ihm gegenüber, ich kannte ihn nicht, und doch würde ich gegen ihn kämpfen, wie zuvor schon gegen so viele andere. Der, den ich mit Freuden umgebracht hätte, der einzige Mann des Schattenclans, den ich so leidenschaftlich hasste, dass es mich manchmal selbst überraschte, war natürlich am anderen Ende des Feldes. Ich fragte mich kurz, warum er mir wohl noch immer aus dem Weg ging. Ich glaubte nicht, dass es Furcht war. Auch wenn Elenzar stets darauf bedacht war, nicht zu unterliegen, war er nicht so feige, wie es den Anschein hatte. Er war gerissen und hinterhältig, und mit jeder seiner Handlungen verfolgte er stets einen Plan.
Doch ich hatte keine Zeit, mir länger darüber den Kopf zu zerbrechen, denn in diesem Augenblick sah ich das Breitschwert meines Gegners durch die Luft zischen, ein grelles Aufblitzen hellen Metalls in der Morgensonne. Mein Schwert schien nun in meinen Händen ein Eigenleben zu entwickeln, als sich die Klingen mit einem donnernden Schlag das erste Mal trafen. Hieb um Hieb wehrte ich ab, mit traumwandlerischer Sicherheit wich ich aus, parierte und ging dann selbst zum Angriff über. Die scharfe Klinge schnitt durch Kleider und Haut, und es war mir auf einmal wieder egal, wie viele Männer ich tötete, nur diese mir so bekannte, kalte Entschlossenheit war da und ließ alles außer dem Vampir, dem ich gerade gegenüberstand, zu einem Gemisch aus weißen und roten Schlieren werden – weiß wie Schnee, rot wie Blut. Ich hörte und fühlte nichts mehr außer dem Sirren, mit dem meine Klinge durch die Luft pfiff.
Es war wie ein Tanz, den wir da führten, ein schrecklicher, anmutiger, tödlicher Tanz. Blutstropfen rannen an der Klinge hinab, und mit jedem Schlag lösten sich ein paar, glitzerten rötlich in der Sonne. Mit einem befriedigten Aufschrei wollte ich gerade den Vampir, gegen den ich gekämpft hatte, niederstrecken, ich hatte ihm die Spitze meines Schwertes schon auf die Brust gesetzt, es bedurfte nur noch eines kurzen, kräftigen Stoßes, als ein leiser Schrei direkt neben meinem Ohr den alles betäubenden Nebel durchdrang. Das war Aiden, der meinen Namen rief! Ein eiskalter Schauer rann meinen Rücken hinab – ich hatte mir geschworen, auf ihn Acht zu geben, ich hatte es meinem Onkel versprochen!
Und dann sah ich aus den Augenwinkeln, wie mein Cousin erstarrte, ein fremdes Schwert an der Kehle. Sein Kopf ruckte zurück, als sich eine kräftige Hand in den hellen Locken vergrub und ihn ein wenig zurückriss, damit die Klinge im richtigen Winkel auftreffen würde. Seine Lippen formten ein leises Stöhnen, das im Lärm des Kampfgetümmels jedoch unterging und deswegen meine Ohren nicht erreichte, und das Schwert entglitt seinen Fingern, verschwand im aufgeweichten Schneematsch zu seinen Füßen. Ich spürte, wie ein hasserfülltes, wütendes Knurren meinen Brustkorb erzittern ließ. Ich ließ von meinem Gegner ab und schnellte herum. Ganz langsam senkte sich das Schwert nun auf die Kehle meines Cousins hinab, ich sah, wie die ersten Blutstropfen unter dem harten Eisen hervorquollen, als die Klinge in das weiche, empfindliche Fleisch schnitt, und ich wusste, dass mir vielleicht noch ein Lidschlag Zeit blieb, ehe der feindliche Vampir Aidens Kehle durchtrennt haben würde. Mit einem einzigen Satz war ich an der Seite meines Cousins, schob mich mit einer fließenden Bewegung zwischen ihn und dessen Gegner, gleichzeitig schlug ich das Schwert zur Seite, das noch immer an Aidens Kehle lag und dort eine Blutspur hinterlassen hatte, deren Tiefe ich jetzt noch nicht abschätzen konnte. Der andere Mann stolperte unter meinem wütenden Schlag zurück, aber einen Augenblick später wurde ich von dem Vampir, dem ich noch vor einem Augenblick die Schwertspitze auf die Brust gesetzt hatte, zurückgedrängt.
Jetzt musste ich also gegen zwei Männer kämpfen. Hiebe prasselten nur so auf mich herunter, und selbst durch den betäubenden Schleier hindurch gewahrte ich, wie mein Schwertarm immer schwerer wurde und meine Reaktionen immer langsamer. Ein harter Schlag traf mich an der Schulter, und ich taumelte ein paar Schritte zurück. Den Schmerz spürte ich kaum, doch die Kraft war nun vollkommen aus meinem rechten Arm gewichen. Mit einem letzten, verzweifelten Aufbegehren umfasste ich das Heft mit beiden Händen, schlug das Schwert des Mannes, von dessen Klinge noch Aidens Blut tropfte, zur Seite und rammte ihm meine Klinge bis zum Heft in die Brust. Den Aufprall, als das harte Eisen auf einen seiner Rippenknochen traf, spürte ich bis in meine verletzte Schulter, und das Schwert vibrierte in meiner Hand. Der Vampir öffnete seinen Mund zu einem lautlosen Stöhnen, beinahe vorwurfsvoll brannten sich seine roten Augen in die meinen, schienen mich zu bannen. Ich wusste, dass ich mich am Abend fragen würde, ob er eine Familie gehabt hatte, ob ich heute einem Kind den Vater und einer Frau den Mann genommen hatte – wenn ich lange genug überlebte. Doch jetzt vernebelte noch immer der rote Schleier meine Gedanken, und ich sah beinahe emotionslos zu, wie der Blick meines Gegners glasig und unstet wurde. Dann verdrehte er die Augen, erbrach einen rubinroten Schwall Blut, der warm meinen Arm hinab rann, und sackte wie ein fallender Baumstamm gegen mich. Taumelnd kämpfte ich um mein Gleichgewicht, verbissen umklammerten meine Finger den von Blut glitschig gewordenen Ledergriff meines Schwertes, auch wenn es jetzt eigentlich egal war, ob mir die Klinge aus der Hand rutschte oder nicht, ob ich unter dem schweren Leichnam meines Gegners zu Boden sank oder nicht, ich würde so oder so sterben. Es war zu spät. Beinahe ergeben wartete ich auf den Schwertstreich, der mein Leben beenden würde, denn ich war für einen kurzen Moment ohne Deckung, hatte mich dadurch meinem zweiten Gegner ausgeliefert. Der erwartete Todesstoß blieb jedoch aus.
„Rückzug!“, hörte ich Elenzars Stimme über das Klirren der Schwerter und das Stöhnen der Verwundeten hinweg brüllen, und der zweite Mann, der mich eben noch angegriffen hatte, nahm mit einem leisen Fluch Reißaus. Ich atmete zitternd aus.
So plötzlich, wie der rote Schleier vor meine Augen gefallen war, verschwand er wieder. Ich sank mit einem Keuchen in die Knie. Jetzt erst gewahrte ich, wie schwer meine Arme waren. Schwarze Flecken tanzten vor meinen Augen. Am ganzen Körper bebend zog ich mein Schwert mit einem ekelerregenden, schmatzenden Geräusch aus dem toten Vampir, der zu meinen Füßen lag. Der Schnee auf dem Feld hatte sich in blutigen, rubinroten Matsch verwandelt. Der eisige Wind, dessen Schärfe ich zuvor nicht wahrgenommen hatte, zauste mir durch das schweißnasse Haar. Mich fröstelte.
„Danke, Cousin“, flüsterte eine heisere Stimme. Mit einem Ruck wandte ich mich um. Aiden kauerte hinter mir, den verletzten Arm dicht an den Körper gepresst, die Lippen vor Schmerz zu einem dünnen, blutleeren Strich zusammengepresst. Eine dünne Spur verwischten Blutes hob sich dunkel von der blassen Haut seiner Kehle ab, aber der Schnitt schien Gott sei Dank nicht allzu tief zu sein. Ich nickte nur schwach. Auf einmal fühlte ich mich so müde...
Dann verlor die Welt um mich herum plötzlich jegliche Farbe, und das Bild vor meinen Augen wurde unscharf und körnig. Meine Ohren vernahmen nur noch ein helles Fiepen, das jegliche Geräusche übertönte, ehe es so plötzlich wieder verschwand, wie es gekommen war. Mir wurde übel, dann verließ mich mein Sehvermögen gänzlich, und ich versank in einem Meer von Schwarz.
***
„Ray!“ Jemand schüttelte mich unsanft an der Schulter.
Ich wandte mich stöhnend ab. „Nein, nicht!“, protestierte ich schwach. Ich wollte in Ruhe weiterschlafen, es war so friedlich hier in der Dunkelheit.
Doch die Stimme gab nicht nach. „Ray! Verdammt, komm schon, wach auf!“
Mühsam gelang es mir schließlich, die schweren Lieder zu heben, und ich blickte in das besorgte Gesicht Jaros, der sich über mich beugte. Seine Augen schienen gerötet, so als hätte er geweint.
Ich zuckte zusammen, als das grelle Sonnenlicht in meine Augen stach, und meine rechte Hand hob sich unwillkürlich an meine Stirn, um meinen Blick vor dem Licht abzuschirmen. Einem Messer gleich fuhr mir da der Schmerz durch den Arm, und ich gewahrte einen notdürftigen Verband aus blutigen Hemdstreifen, der um meine Schulter gebunden worden war.
„Was“, murmelte ich verwirrt, „was ist passiert?“
„Du bist in Ohnmacht gefallen – kein Wunder: die ganzen schlaflosen Nächte, dann dieser harte Kampf, und du hast verdammt viel Blut verloren.“
Dann hielt mir mein Onkel den leblosen Arm eines Mannes unter die Nase. Blut quoll aus einer Wunde nahe dem Handgelenk. Ich musste schlucken. Blut!
„Trink!“
„Nein, ich kann nicht!“, wehrte ich mich entsetzt. Es war ein Vampir, stellte ich mit einem raschen Blick fest. Der Vampir, den ich erschlagen hatte. Sein Blut war noch warm...
Wir tranken nur in der größten Not von Unseresgleichen, da es sehr schwächte – nun, darüber musste sich dieser Vampir hier keine Gedanken mehr machen – und ich hatte es noch nie getan. Und es fühlte sich einfach nicht richtig an – man verspeiste seine Gegner nicht...
„Du kannst, und du wirst“, erwiderte Jaro bestimmt.
„Nein“, murmelte ich schwach, die Kraft wich immer mehr aus meinen Gliedern.
„Nun komm schon, Junge! Es ist in Ordnung, er ist doch schon tot. Und jetzt trink, wenn du leben willst! Du schaffst es sonst nicht bis zur Siedlung!“
„Nein, es ist nicht richtig! Ist es nicht schon schlimm genug, sie zu töten? Ich kann nicht!“, schluchzte ich. Ich war am Ende meiner Kräfte, und das Blut duftete so verdammt gut...
„Verdammt, Ray, ich kann dir den Schmerz nehmen, ich kann vielleicht auch die Wunde schließen, aber wenn du leben willst, muss Blut in deinen Adern fließen! Und jetzt trink!“
Ich gewahrte, wie mühsam und schnell und flach mein Herz schlug, um das wenige Blut durch meine Adern zu pumpen, wie kalt mein Körper bereits geworden war, und da wusste ich, dass mein Onkel recht hatte, dass dies wirklich meine einzige Chance war. Der salzige, leicht metallische Geruch stieg mir verlockend in die Nase, und ich spürte, wie etwas in mir nachgab. Mit einem leisen, tiefen Stöhnen schloss ich meine Lippen fest um die kleine Wunde, die Jaro in die Haut des Mannes gebissen hatte, und begann zu trinken. Ich konnte regelrecht fühlen, wie mit dem noch warmen Blut das Leben in mich zurückströmte.
***
Es war ein kurzer, aber heftiger Kampf gewesen. Wir hatten vier Männer verloren, der andere Clan wohl ein halbes Dutzend oder mehr – genau ließ sich das nicht feststellen, da die anderen Vampire die meisten ihrer Toten und Verletzten mitgenommen hatten, so wie wir es mit den unseren tun würden. Aber da Elenzar die Flucht ergriffen hatte, konnte man davon ausgehen, dass er befürchtet hatte, zu unterlegen. Diese Schlacht hatten wir gewonnen. Doch es würde nicht die letzte bleiben. Und mit Logan hatten wir einen schweren Verlust erlitten. Ich wusste, dass die Leben, die dieser Tag gekostet hatte, wie eine bleierne Last auf Jaros Schultern ruhten.
Ich stand auf wackligen Beinen am Rande des Schlachtfeldes und blickte auf die Fußspuren, die den Schnee in einem wirren Muster durchkreuzten. Die einstmals makellose weiße Decke war nun aufgewühlt und rot gesprenkelt, hin und wieder wies eine große, dunkelrote Lache auf einen Toten hin.
Meine Wunde war verbunden worden, doch es würde eine Weile dauern, bis ich den Arm wieder belasten konnte. Ich spürte, wie das fremde Blut heiß durch meine Adern rann, und ich fühlte keinen Triumph, kein Gefühl des Sieges. Nur eine Müdigkeit, die bis zu meinen Knochen zu dringen schien, und eine schreckliche Leere.
Selten wurden Helden in einer Schlacht geboren. Meist gab es nur Blut und Tod, und jene, die Glück hatten und überlebten. Die Bilder eines solchen Tages waren jedem Krieger tief ins Gedächtnis geprägt, und oftmals suchten sie uns noch lange später in unseren Träumen heim.
Eine warme Hand legte sich auf meine Schulter und riss mich aus meinen Grübeleien.
„Komm, Ray. Wir brechen auf“, sagte Aiden leise.
Das schelmische Funkeln war aus seinen Augen gewichen. Ich konnte nur zu gut nachempfinden, was er jetzt fühlte. Ich schenkte ihm ein schwaches Lächeln, das seine Wirkung jedoch verfehlte, denn in diesem Moment konnte ich ihm keinen Trost spenden.
Gemeinsam kehrten wir dem Tal den Rücken.
© by Schneeflocke