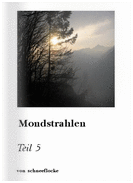7. Dunkle Erinnerungen
Ray
Die Menschen feierten bis tief in die Nacht hinein. Mittwinterfest hatte meine Mutter diesen Tag genannt, und ich kann mich erinnern, dass sie früher immer ein kleines Feuer auf unserem Hof entfacht hatte.
„Wir feiern, um den Winter zu vertreiben“, hatte sie mir damals erklärt, und ich konnte mich noch so gut daran erinnern, wie ihre dunklen Augen im Schein der Flammen begeistert geglänzt hatten, als sie mir ein paar der Tanzschritte gezeigt hatte, mit der die jungen Menschenmänner für gewöhnlich um das Feuer tanzten...hastig wischte ich den Gedanken beiseite. Ich vermied es, an meine Mutter zu denken, denn die wenigen schönen Erinnerungen wurden nur zu rasch von den schlimmen überdeckt.
Ich wusste, dass Caitlin am großen Feuer auf dem Dorfplatz sein würde, und umgeben von ihrer Familie, und in der Nähe ihres Bruders, war sie annähernd in Sicherheit, zumal ich außerhalb der Palisaden wachte. Zumindest versuchte ich mir das einzureden. Ich wusste, dass ich mich erst wieder beruhigen würde, wenn ich mit meinen eigenen Augen sah, dass sie wohlbehalten und unverletzt in ihrem Bett lag. Aber es wäre zu gefährlich, mich jetzt schon ins Dorf zu schleichen, wenn die Menschen das einzige Mal im Jahr nach Sonnenuntergang ihre Häuser verließen, das sagte ich mir immer wieder, während ich unter Aidens besorgten, silbergrauen Blicken unruhig die Holzmauer ablief und immer wieder angespannt innehielt und auf die Stimmen lauschte, die aus dem Dorf zu uns herüber klangen. Mein Cousin war wie ein Bruder für mich, und ich wusste, dass seine Sorge nicht unberechtigt war. Mehr als einmal hatte er mir in unserer Kindheit aus der Patsche geholfen, ich schien das Unglück regelrecht anzuziehen und neigte zu unüberlegtem Handeln, und er wusste das.
Das Fest schien jedoch relativ friedlich zu verlaufen, auch wenn mit der fortschreitenden Stunde und dem rege fließenden Alkohol die Männer immer zudringlicher zu werden schienen. Zum wiederholten Male fragte ich mich, warum unter den Menschen ein so rauer Umgangston herrschte, und wie sie die häufig auftretende Gewalt ihren eigenen Frauen gegenüber rechtfertigten. War es nicht die Aufgabe eines Mannes, seine Frau zu beschützen, notfalls mit dem eigenen Leben? Bei den Menschen erschien es mir häufig eher so, als wäre der eigenen Mann die größte Bedrohung für eine Frau. Wie sie so lange überlebt hatten, war mir ein Rätsel, waren es doch die Frauen, die die Kinder gebaren und so in gewisser Weise die Zukunft ihres Volkes waren. Welchen Sinn hatte ein Leben schon, das von Schmerz, Gewalt und Unterordnung beherrscht wurde? Doch ich wusste auch, dass es manchmal etwas gab, das eng auf der Grenze zwischen Leben und Tod verlief, etwas, das man eher als existieren denn als leben bezeichnen konnte. Mein Vater war lange Zeit in diesem Zustand gewesen... Wenn das alles war, was die Menschen kannten, dann taten sie mir leid.
Ich war unendlich dankbar, dass Caitlin bis jetzt nicht behelligt worden war. Doch dann vernahm ich einen Wortwechsel, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Eine männliche Stimme sprach das Mädchen an, drohte ihr beinahe schon, und ich war so kurz davor, jede Vorsicht fahren zu lassen und zu ihr zu eilen. Nur der Gedanke daran, dass dies ihren sicheren Tod bedeuten würde, hielt mich davon ab, eine Dummheit zu begehen. Ich spürte, wie der kalte Hass in mir aufstieg, als er fragte, ob sie noch zu haben sei, mit einem klaren Unterton der Lust in der Stimme. Ich glaubte, die Stimme zu erkennen, er war eine der Wachen, die des Nachts auf dem Wehrgang patrouillierten, und ich glaubte auch, schon gehört zu haben, wie er seine Schwester schlug. Was er Caitlin wohl antun würde, hätte er erst einmal seinen Willen mit ihr, das mochte ich mir nicht einmal vorstellen, und ich schwor mir, dass ich das niemals zulassen würde. Zu oft hatte ich schon die Laute vernommen, die eine Frau ausstieß, die gegen ihren Willen genommen wurde, wenn ich des Nachts durch das Dorf schlich, und jedes Mal wurden dadurch schreckliche Momente aus meiner Kindheit angerührt... Brennende Übelkeit stieg in mir auf, und ich versuchte, die Bilder aus der Vergangenheit, die an die Oberfläche aufzusteigen drohten, gewaltsam zurückzudrängen. Ich wollte mich nicht daran erinnern. Ich hatte mir verboten, mich daran zu erinnern. Ich würde niemals zulassen, dass Caitlin so etwas zustieß. Und er würde es nicht wagen, sich ihr zu nähern, wenn sie von anderen Menschen umgeben waren. Jedenfalls hoffte ich das inbrünstig, denn wenn ich in solch einem Fall eingreifen wollte, würde ich damit ihr Leben gefährden. Welche Wahl würde ich treffen, wenn mir nichts anderes übrig blieb? Tod oder Vergewaltigung? Mein Magen zog sich zusammen, und ich zwang mich, an etwas anderes zu denken, auf die Stimmen zu lauschen, herauszufinden, ob sie sich im Moment tatsächlich in Gefahr befand.
Mit versteinertem Gesicht lief ich weiter Runden um die Palisaden und ignorierte die befremdeten Blick Aidens und Rowans, dem anderen Vampir, der zur Wache vor dem Dorf eingeteilt worden war. Wir ließen das Menschendorf, das so nahe an unserer Siedlung lag, nicht eine Nacht unbewacht, auch wenn sich der Schattenclan in letzter Zeit sehr ruhig verhalten hatte.
Als ich gewahrte, dass der fremde Mann von ihr abließ und sie bei ihrem Bruder vorübergehend in Sicherheit war, stieß ich einen erleichterten Seufzer aus.
Es war schon spät in der Nacht, als ich mich endlich lautlos über die Palisaden schwingen konnte und im Schutze der Dunkelheit zu Caitlins Fenster huschte. Die letzten beiden Betrunkenen stolperten gerade laut gröhlend über den Dorfplatz nach Hause, und aus vielen der Häuser drang noch lautes Gelalle, Gegrunze oder das Brüllen eines vom Schnaps aggressiv gewordenen Mannes, der seine „Eherechte“ einfordern wollte. Ich zwang mich, wegzuhören und versuchte statt dessen, auf die sanften Atemzüge Caitlins zu lauschen. Schon immer hatte mich dieses Geräusch beruhigt, und auch jetzt verfehlte es seine Wirkung nicht. Kaum war ich dem Haus auf einen Steinwurf weit nahe gekommen, ließ meine Anspannung merklich nach, und das Bild eines friedlich schlafenden Mädchens entstand vor meinem inneren Auge und legte sich wie ein kühlender Schleier über all die aufgewühlten Gefühle, die mir den ganzen Abend keine Ruhe gelassen hatten. Obgleich ich den Anblick schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte, konnte ich mich doch noch so gut daran erinnern, als sei es gestern gewesen, und ich empfand endlich wieder so etwas wie Frieden.
Als ich schließlich vor dem mir so wohlbekannten Fenster anlangte, ein dunkles Rechteck, das sich silbergrau im Mondlicht abhob, erstarrte ich verwirrt und zog die Stirn in Falten. Ihre Läden standen weit offen, eine in Gold gefasste Einladung, die sie das Leben kosten konnte.
Zu Anfang, nachdem ich sie gerettet hatte und mich ihr anschließend das erste und wohl auch einzige Mal gezeigt hatte, hatte sie jede Nacht vor dem offenen Fenster geschlafen, und jede Nacht war ich leise in ihre Kammer geschlüpft und hatte die Läden wieder sorgsam hinter mir geschlossen. Es war zu gefährlich, sie des Nachts offen zu lassen. Jeder konnte so sehen, dass Caiti gegen die Regeln verstieß. Und die Menschen waren erbarmungslos, wenn es um ihre Regeln ging, soviel hatte ich schon gelernt in den unzähligen Nächten, die ich hier bereits verbracht hatte.
Eine ganze Weile lang waren Caitlins Fensterläden nun jedoch bereits verschlossen gewesen, wenn ich gekommen war, um an ihrer Seite zu wachen. Und ich hatte verstanden. Sie wies mich damit endgültig von sich. Sie wollte mich vergessen. Und so hatte ich unter ihrem Fenster gewacht, gewillt, ihren Wunsch zu respektieren. Ich war auch ein klein wenig erleichtert gewesen, musste ich mir eingestehen. Geschlossene Fensterläden machten es mir einfacher. Ich sah sie nicht und war nicht in Versuchung, über ihr Haar zu streichen, ihren Duft einzuatmen, ihr nahe zu sein. Oder mich ihr zu zeigen, nur noch ein einziges, letztes Mal. Ich hatte mich nie richtig verabschieden können.
Dennoch schmerzten geschlossene Fensterläden so viel mehr.
Am Schlimmsten war es in jedoch in jenen Nächten, in denen sie am Fenster auf mich gewartet hatte und dabei eingeschlafen war. Heute war also wieder eine solche Nacht. Es überraschte mich, war es doch schon eine ganze Weile her, dass ich sie so aufgefunden hatte. War heute etwas vorgefallen, das sie an mich erinnert hatte? War es die Angst gewesen, die sie in der Gegenwart des fremden Mannes zweifellos verspürt hatte, die in ihr den Wunsch nach einem Beschützer geweckt hatte?
Sie schlief auf einem Stuhl vor dem Fenster, der Kopf auf den verschränkten Armen ruhend. Blonde Locken, die im fahlen Licht des Mondes silbern schimmerten, fielen einem Wasserfall gleich ihren Rücken hinab. Die schmalen, zierlichen Schultern hoben sich ganz leicht mit jedem Atemzug. Der Anblick fuhr mir wie jedes Mal einem Messer gleich ins Herz. Sie sah so verloren aus, so hilflos und verletzlich, und ich gewahrte die enttäuschte Sehnsucht, die ihr ganzer Körper auszudrücken schien. Es war dieselbe Sehnsucht, die ich ebenfalls empfand, doch die ihre schmerzte mich weitaus mehr. Meinen Schmerz konnte ich ertragen, den ihren mit anzusehen war mir unerträglich.
Dann gewahrte ich, wie sie in der kalten Luft zitterte, die durch das Fenster drang. Atemwölkchen bildeten sich vor ihrer Nase. Es war tiefster Winter, viel zu kalt, um am offenen Fenster zu sitzen. Mit einem beinahe schon verzweifelten Seufzen beugte ich mich zu ihr hinunter – ich wusste, was die nun unvermeidbare Nähe zu ihr in mir auslösen würde. Sanft hob ich sie auf, mein Herz pochte rasend schnell, als mir der vertraute Duft nach frischem Brot und Gras in die Nase stieg, und trug sie die wenigen Schritte zu ihrem Bett hinüber. Ihr weicher, warmer Körper ruhte entspannt in meinen Armen, die sich unwillkürlich noch fester um sie schlossen. Sie seufzte leise auf und barg den Kopf an meiner Schulter. Erinnerungen stiegen auf, Erinnerungen an den Tag, an dem wir uns begegnet waren. Damals hatte sie genau so in meinen Armen gelegen. Doch aus dem zierlichen Mädchen war eine junge Frau geworden.
Ich schluckte. „Reiß dich zusammen, Ray!“, befahl ich mir. Wie jedes Mal musste ich mich beinahe gewaltsam dazu zwingen, mich wieder von ihr zu lösen. Meine Arme erschienen auf einmal so seltsam leer, und eine Kälte, die ich mir nicht erklären konnte, schlich sich in mein Herz. Ich hüllte sie fest in ihre Decke, darauf bedacht, sie möglichst nicht zu berühren, da bei jedem Kontakt mit ihrer bloßen Haut mein Herz noch ein wenig schneller zu schlagen schien, und ließ mich dann auf dem Boden nieder, an die gegenüberliegende Wand gelehnt und so weit entfernt von ihr als möglich.
Ich hatte es mir geschworen. Niemals wieder würde ich jemand anderen so nahe an mich heran lassen, dass es mich verletzen würde, ihn zu verlieren. Ich hatte mein Herz sorgfältig verschlossen und versiegelt, hatte hohe Mauern um mein Innerstes errichtet. Ich würde es niemandem erlauben, diese Mauern zu durchbrechen. Es war zu gefährlich. Ich wusste zu gut, was die unweigerliche Folge eines solchen Fehlers sein würde: Verlust, Schmerz, Verzweiflung, Zorn, Hass und schließlich der Tod. Das hatte mich das Leben gelehrt.
Warum wollte ich mich dann nicht mehr von ihr trennen? Warum konnte ich mich dann nur mit Mühe dazu zwingen, nicht mit einem Satz den Raum zu durchqueren, die Hand auszustrecken und diese sorgenvollen Falten zu glätten, die auf ihrer Stirn erschienen waren? Warum kam ich dann nach wie vor jede Nacht hierher?
So lange wachte ich bereits über sie, doch sie hatte nichts davon mitbekommen. Bis zu jenem Tag vor einem Mond. Ich vergrub leise stöhnend meinen Kopf in den Händen.
Was hatte ich nur getan! Ich war zu ihr gekommen, um sie zu warnen – sie war viel zu leichtsinnig gewesen, sich der Gefahr nicht bewusst, in der sie schwebte. Nur deswegen war ich ihrem Wunsch nachgekommen (und meinem eigenen, wie ich mir eingestehen musste) und hatte mich in ihre Kammer geschlichen. Ich hatte sie zur Vernunft bringen wollen. Mehr als ein paar Worte hatte ich nicht mit ihr wechseln wollen.
Doch dann...doch dann hatte sie mich mit diesen Augen angesehen, die die Farbe eines wolkenlosen Himmels zur Sommerzeit hatten. Und es war mir erschienen, als könne sie bis tief auf den Grund meiner Seele sehen – ich hatte mich bloßgestellt gefühlt, verletzlich. Es war lange her, seit ich mich das letzte Mal so gefühlt hatte, sehr lange. Und doch war es so seltsam befreiend gewesen, mich nicht hinter diese Mauern in meinem Inneren zurückziehen zu müssen, die so lange der einzige Ort gewesen waren, an dem ich so etwas wie Frieden gefunden hatte.
Und ich hatte gelächelt! Sie hatte vollbracht, was sonst nur meinem Cousin Aiden gelang, und das ohne die geringste Anstrengung. Selbst Aiden hatte Jahre gebraucht, um zu mir durchzudringen.
Ich war so weit von ihrem Bett entfernt, wie es in dem engen Zimmer möglich war, und konnte doch den Blick nicht von ihr lassen. Sie schlief wie ein Kind, die Hände zu beiden Seiten des Kopfes zu Fäusten geballt, und ein leises Lächeln spielte um ihre Lippen. Sie sah so unschuldig aus und - ich musste es mir eingestehen - wunderschön! Sie war kein Kind mehr. Ich schluckte.
Wenn ich an diese eindringlichen, dunkelblauen Augen dachten, wie sie mich so flehend und voller Wärme angeblickt hatten...
Ich hatte immer geglaubt, dass Blau eine kalte Farbe sei, und dennoch hatten mich ihre Augen innerlich besser gewärmt als jedes Feuer...und ich konnte ihn ihnen versinken wie in einem tiefen See ohne Grund. Wenn ich es zuließe.
Ich war sehr nahe daran, es zuzulassen. Ich war so kurz davor.
Es konnte nichts Gutes daraus erwachsen, wenn sich ein Mensch und ein Vampir ineinander verliebten, das hatte mich das Schicksal meiner Eltern gelehrt. Vor allem nicht, wenn ich dieser Vampir war. Ich hatte zu viele Feinde. Seit mein Vater seinen eigenen Bruder in einem Zweikampf erschlagen hatte, sannen dessen Söhne nach Rache, allen voran Elenzar, der nichts unversucht lassen würde, mich zu vernichten. Eine Blutfehde, ausgelöst durch den Mord an meiner Mutter. Es würde wohl erst zu Ende sein, wenn alle Mitglieder unserer Familie sich gegenseitig umgebracht hatten. Als ob das die Toten würde zurückbringen können.
Ich wollte nicht, dass Caitlin das gleiche Schicksal erleiden musste wie meine Mutter. Meine Mutter...Auf einmal standen die Bilder, die ich so sehr zu verdrängen suchte, wieder unmittelbar vor meinen Augen...
*****
Blaue Vergissmeinnicht, zu einem Kranz gewunden, lagen im dichten, roten Haar meiner Mutter und verliehen ihr eine Aura zerbrechlicher Anmut und Schönheit. Die Wahl der Blumen erschien mir rückblickend wie ein Zeichen, ein Vorbote dessen, was kommen würde. Denn ich hatte diesen einen Tag und die, die folgen würden, nie vergessen. Ich würde die Bilder für den Rest meines Lebens nicht aus meinem Gedächtnis verbannen können.
Meine Mutter war die schönste Frau der Welt, da war ich mir sicher. Wir saßen gemeinsam an dem Tisch in der Stube, sie reichte mir gerade eine Schüssel heißen, süßen Tees, und ich freute mich an dem Lächeln, das um ihre Mundwinkel spielte, als sie zu mir hinab blickte und mir sanft über das Haar strich. Der Moment war voller Frieden, doch er wurde jäh unterbrochen.
Krachend flog die Tür nach innen auf, so dass die ganze Hütte von dem Aufprall erbebte, mit dem sie gegen die Wand schlug. Die Schüssel entglitt meinen Fingern und fiel zu Boden, wo sie klirrend in unzählige Scherben zerbrach, und der heiße Tee ergoss sich über meine Hose, doch der erschrockene und schmerzerfüllte Schrei blieb mir im Hals stecken, als ich vor Schreck beinahe wie gelähmt auf die Szene blickte, die sich nun meinen Augen bot. Die große, drohende Silhouette meines Onkels stand in unserer Türe, seine breiten Schultern füllten fast den ganzen Rahmen aus und verdeckten beinahe jegliches Licht, das von draußen herein drang, einer dunklen, schwarzen Wolke gleich, die sich vor die Sonne schiebt. Ich sah das Entsetzen auf dem Gesicht meiner Mutter, als Begreifen in ihren Augen dämmerte. Ich glaube, in jenem Moment wusste sie, dass sie sterben würde.
„Lauf, Ray, lauf!“, schrie sie, und ich erwachte endlich aus meiner Starre. Ich sprang so hastig auf, dass ich dabei den Stuhl umwarf und mir das Knie heftig an der Tischkante stieß, aber ich spürte den Schmerz nicht. Wie von Dämonen gejagt hechtete ich zum Fenster hinüber, das auf die dem Wald zugehende Seite des Hauses führte, und kletterte hindurch, die Finger so fest um das trockene Holz geklammert, dass ich mir ein paar kleine Holzsplitter in die Handfläche bohrte, doch auch diesen Schmerz spürte ich nicht. Dann ließ ich mich auf der anderen Seite in das vom Regen noch feuchte Gras fallen und rannte auf den Wald zu, glitt immer wieder auf dem nassen Boden aus und rappelte mich keuchend und mit pochendem Herzen wieder auf, um weiter zu rennen. Tränen brannten heiß in meinen Augen, als ich meine Mutter in meinem Rücken aufschreien hörte, und das Bild vor meinen Augen verschwamm, als der Schrei in ein leises Stöhnen überging, das mir wie ein Messer ins Herz schnitt. Ich rannte, so schnell mich meine kleinen Beine trugen, obwohl alles in mir danach schrie, bei ihr zu bleiben, sie nicht alleine zu lassen, sie zu beschützen. Ich wusste, dass ich sie nicht beschützen konnte, ich war acht Sommer alt. Und ich kannte den Ton in ihrer Stimme nur zu gut. Es war der Ton, der keinen Widerspruch duldete, und ich tat immer, was sie sagte, wenn sie diesen Ton verwendete. Die Tränen rannen nun unaufhaltsam meine Wangen hinab, als ich mich durch den finsteren Wald kämpfte, kleine Zweige peitschten mir ins Gesicht und zerkratzten meine Wangen, doch ich achtete nicht darauf. Mutti hatte mir befohlen zu rennen, und genau das tat ich.
Doch es war zu spät. Ich hatte nie eine Chance gehabt. Wie aus dem Nichts tauchte ein anderer Vampir vor mir auf. Ich machte einen Satz nach links, schlug verzweifelt einen Haken nach dem anderen, doch das dichte Unterholz behinderte mich in meinem Lauf. Sie fingen mich mühelos ein, starke Arme, die sich unbarmherzig so fest um meinen Brustkorb schlossen, dass mir der Atem mit einem erstickten, japsenden Laut entwich und die Ränder meines Blickfeldes schwarz wurden. Dann stand mein Onkel vor mir, betrachtete mich von oben herab und lachte, als er mir mit dem Finger über die Wange strich. Ich schauderte, den obwohl er lachte, war der Blick in seinen Augen eiskalt.
„Oh, du kleiner Halbmensch, hast du wirklich geglaubt, du könntest uns entkommen?“, fragte er lächelnd. Mir gefiel sein Lächeln nicht, es war falsch, und ich vernahm auch den eisigen Unterton in seiner Stimme. Dann schlug etwas hart auf meinen Kopf, und Dunkelheit umfing mich.
Ich erwachte ebenfalls in der Dunkelheit, die nur spärlich von einer einzigen Kerze erhellt wurde, welche sie uns gelassen hatten. Ich wusste nicht, wieviel Zeit verstrichen war. Es war eine düstere Höhle irgendwo am Rande der Wälder gewesen, in die sie uns verschleppt hatten, doch das wusste ich damals nicht. Ich wusste nur, dass es dunkel und kalt war, und dass ich mich fürchtete.
Ich hätte auf das wenige Licht verzichten können, das die Kerze spendete. Ich wollte die Verzweiflung in den Augen meiner Mutter nicht sehen.
Meine Mutter... ihr schönes, leuchtendes Haar war inzwischen stumpf, verklebt und dreckig, und auf den zerfetzten Überresten ihres Hemdes prangten dunkle Flecken. Ich wusste, dass es Blut war, ich nahm den vertrauten, salzigen, leicht metallischen Geruch wahr. Blut, das aus Verletzungen drang, die mein Onkel ihr zugefügt hatte. Ich verstand nicht, warum es das tat. Ich kam mir vor wie in einem Albtraum, der nicht enden wollte.
Die Fesseln schnitten tief in das weiche Fleisch meiner Handgelenke und schnürten mir das Blut ab, doch ich riss mich mühsam zusammen. Kein Laut der Klage sollte über meine Lippen dringen, schwor ich mir. Ich würde ein tapferer Junge sein. Ich würde meinem Vater keine Schande machen. An diesem Gedanken hielt ich fest, und er gab mir ein wenig Kraft – zumindest bis zu dem Augenblick, in dem Carum irgendwann unser Verlies betrat.
Seine Augen funkelten gefährlich, als er sich über die inzwischen zusammengesunkene Gestalt meiner Mutter beugte, die reglos in den eisernen, an der Wand befestigten Fesseln hing. Er stieß sie grob mit dem Fuß an, und sie schien zu erwachen, denn ich vernahm ein leises Wimmern, dass mir das Herz zusammenkrampfte.
Nie würde ihr verzweifeltes Schluchzen vergessen, als er sie schändete. Oder das leise, feuchte Schmatzen, mit dem sich seine Zähne in ihre Haut gruben, als er begann, sie auszusaugen.
Mein eigener, schriller Schrei schien mir noch immer in den Ohren zu klingen...
*****
Keuchend sank ich an der Wand zusammen und versuchte verzweifelt, in die Gegenwart zurück zu finden. Das alles war schon so lange her, und dennoch schien ich nicht davon loszukommen.
Mein Herz raste, und ich strich mir mit zitternden Fingern den kalten Schweiß von der Stirn. Dann lehnte ich den Kopf an die harte Holzwand in meinem Rücken, die beinahe warme Struktur ein willkommener Kontrast zu dem eiskalten Stein meiner Erinnerung, und atmete tief ein und aus, um das Gefühl beklemmender Enge in meinem Brustkorb loszuwerden. Jeder Atemzug entwich mir mit einem kleinen Seufzen, dass gefährlich nahe an einem Schluchzen war. Mit aller Macht versuchte ich, mich zusammenzureißen. Ich war ein Mann, verdammt! Ich würde nicht heulen wie ein kleiner Junge! Nach einer geraumen Weile hatte ich meine Fassung schließlich wieder soweit erlangt, dass ich klar denken konnte.
Ich wusste, ich würde alles in meiner Macht stehende tun, um zu verhindern, dass Caitlin das selbe Schicksal erlitt wie meine Mutter. Oder ich das meines Vaters.
Mein Vater hatte sich nach dem Tod meiner Mutter verändert. Der einst so friedliebende, mitfühlende Mann war von jenem Moment an, in dem sie ihren letzten Atemzug tat, verschwunden. Von nun an hatte der Hass in ihm getobt. Es war, als wäre das Herz meines Vaters mit meiner Mutter gestorben, und seine leere Hülle wurde nur noch durch den Gedanken an Rache aufrecht gehalten.
Damals hatte ich mir geschworen, so etwas nie zuzulassen. Niemals so zu werden wie er. Und um mich vom Hass fern zu halten, hatte ich mir verboten zu lieben. Wenn es niemandem mehr gelang, Zugang zu meinem Herzen zu finden, würde mich das davor schützen, erneut so verletzt zu werden.
Ich würde sie nach wie vor beschützen, ich konnte nicht anders. Ich würde über sie wachen wie bisher. Unbemerkt. Unsichtbar. Sie würde mich vergessen, hatte sie mich doch kaum kennen gelernt. So war es am Besten - für uns beide.
Ich blieb noch lange neben ihrem Bett sitzen und konnte die Augen nicht von ihr wenden. Es war die erste Nacht, in der sie vollkommen ruhig schlief. Sonst hatte sie sich oft unruhig von einer Seite auf die andere geworfen, leise vor sich hin gemurmelt, manchmal war sie gar schreiend aufgewacht, hatte wild und gehetzt um sich geblickt, um wenige Augenblicke später wieder einzuschlafen. Diese Nacht jedoch schlief sie vollkommen ruhig, ein leises Lächeln auf den Lippen.
Sobald sich der erste Schimmer des neuen Morgens ankündigte, verließ ich fluchtartig ihre Kammer.
Am Dorfrand traf ich meinen Cousin Aiden, der schon ungeduldig auf mich wartete. Ich war noch immer tief in meinen Erinnerungen versunken und versuchte gleichzeitig verzweifelt, den Geruch des Mädchens zu vergessen, der immer noch an mir zu haften schien.
„Ray, ich spreche mit dir!", schnitt Aidens genervte Stimme einem Messer gleich durch meine Gedanken.
„Entschuldige, Aiden!“ Ich schüttelte leicht den Kopf, um wieder klar denken zu können – erfolglos. Zu viel ging mir durch den Kopf. "Lass mich einfach...", meinte ich schließlich resigniert.
Mein Cousin wandte sich leise seufzend zum Gehen, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. „Ich hatte gehofft, es würde ein wenig besser werden mit der Zeit“, murmelte er so leise, dass ich ihn kaum verstand. „Diese eine Nacht vor einem Mond warst du so glücklich – du hast regelrecht gestrahlt, weißt du das? Ich habe dich noch nie so lächeln sehen.“ Er warf mir einen raschen Blick über die Schulter zu und hielt erstaunt inne, als er sah, dass ich ihm tatsächlich zuhörte.
„Was ist geschehen?“, fragte er ein wenig lauter. „Hat sie dich abgewiesen?“
Ich lachte hart. „Wenn es das nur wäre“, meinte ich bitter. „Es wäre so viel leichter zu ertragen, wenn sie mich einfach abgewiesen hätte...“
„Was ist es dann?“ Seine hellen Augen blickten suchend in die meinen, ehe sie sich dann überrascht weiteten.
„Du hast Angst!“, stellte er fest. Hastig wandte ich den Kopf ab. Wieso nur war er manchmal so verdammt aufmerksam!
„Ich will nicht darüber reden!“, presste ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
„Natürlich nicht“, murmelte Aiden. „Das willst du nie.“
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zurück zu unserer Siedlung, ohne ein weiteres Wort zu wechseln. Aiden wusste es besser, als dass er noch einmal versucht hätte, ein Gespräch mit mir zu beginnen. Er hatte den Ausdruck in meinen Augen gesehen. Er kannte ihn noch aus Kindertagen. Er wusste genau, wann ich ansprechbar war und wann nicht. Im Augenblick war ich es definitiv nicht.
(c) by Schneeflocke