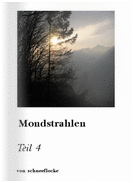6. Winterfeuer
Caitlin
Am nächsten Morgen war ich wieder alleine – um ehrlich zu sein, ich hatte auch nichts anderes erwartet. Es wäre Wahnsinn gewesen, hätte er länger hier verweilt, denn während des Tages hätte er nicht mehr so unbemerkt verschwinden können. Er hatte mir versprochen, mich nicht in Gefahr zu bringen. Und dennoch war ich traurig darüber, dass er gegangen war, ohne sich richtig zu verabschieden.
Als ich mich langsam aufrichtete und mir den Schlaf aus den Augen rieb, fuhr mir ein schwacher, eisiger Luftzug durch das Haar. Ich fröstelte und warf einen Blick hinüber zum Fenster. Es stand einen kleinen Spalt breit offen. Ray hatte es von außen nicht ganz schließen können, vermutete ich, denn der kleine Holzriegel ließ sich nur von innen vorschieben. Dann hatte der Wind die Läden wohl noch ein wenig aufgestoßen. Nur dieser unbedeutende Spalt erinnerte daran, dass ich die letzte Nacht nicht geträumt hatte, dass er wirklich hier gewesen war. Im Licht des neuen Morgens erschien es mir so abwegig, dass wahrlich ein Vampir in meiner Kammer gewesen sein sollte. Ein Vampir, der mir das Leben gerettet hatte. Ein Vampir mit einem wundervollen Lächeln...
„Caiti?“, rief mich die helle Stimme meines jüngsten Bruders wie aus weiter Ferne. „Caiti? Was ist mit dir?“
Hellgraue Augen blickten fragend zu mir auf, und die ersten Sonnenstrahlen spiegelten sich in ihnen wieder. Es war eine ungewöhnliche Augenfarbe, flüssiges Silber im Feuerschein und rauchiger Nebel im Tageslicht. Meine Mutter hatte dieselben Augen gehabt...
Jetzt jedoch glichen sie farblich dem Wasser des rasch fließenden Flusses vor uns, dessen Rauschen so laut war, dass man die Stimme erheben musste, wollte man sich verständigen.
Wieder einmal war ich mit meinen Gedanken abgeschweift, wie schon so oft an diesem Morgen. Trotz des eisigen Flusswassers, das wie mit kalten, unbarmherzigen Fingern nach mir zu greifen schien, war es nur sein Lächeln, das ich sah, die warme Berührung seiner Finger die einzige, die ich auf meiner Haut spüren wollte...
„Ach, es ist nichts, Colin. Es ist nichts...“ Ich schüttelte energisch den Kopf und wandte den Blick zum wiederholten Male vom Wald ab. Er schien heute eine Art magischer Anziehungskraft auf mich zu haben. Immer wieder musste ich dort hinüber sehen, wo wenige Schritte hinter den Feldern, die das Dorf ringförmig umgaben, die ersten Bäume standen. Immer wieder musste ich daran denken, wie Er mich in den Tiefen dieser Wälder gerettet hatte. Wo er jetzt wohl war? Irgendwie gefiel mir der Gedanke, dass er, wenn auch nicht bei mir, so doch irgendwo dort draußen war.
Doch die Strömung zerrte noch immer an dem Eimer, den ich soeben ins Wasser hielt, und ich musste jetzt meine ganze Kraft aufwenden, während nun auch Colin neben mir niederkniete und seine Finger dicht neben den meinen fest um den mit Leder umwickelten Griff des eisernen Henkels schloss. Jede der Bewegungen war durch jahrelange Übung aufeinander abgestimmt. Ein letzter Ruck, und das aus Eichenholz gefertigten und mit einer dünnen Schicht Teer versiegelte Gefäß landete auf dem lehmigen Ufergrund zu unseren Füßen.
Gemeinsam machten Colin und ich uns wieder auf den Weg zurück ins Dorf. Der nun randvolle, schwere Wassereimer schwankte zwischen uns leicht hin und her. Ich war dankbar dafür, dass ich ihn nicht alleine schleppen musste. Ich war die einzige Frau im Dorf, die Hilfe beim Tragen dieser Lasten hatte. Colin war für seine zehn Sommer schon recht kräftig, und einer meiner beiden Jungs, wie ich sie insgeheim nannte, war immer zur Stelle, wenn ich wieder einmal zum Fluss musste. Für gewöhnlich wurde das Wasserholen als Frauenarbeit angesehen, und ich wusste, dass Kian und Colin viel Spott über sich ergehen lassen mussten, weil sie mir dabei halfen.
„Ich mag nicht, wie er dich anschaut“, meinte Colin jetzt, als wir durch das zu dieser Tageszeit geöffnete Palisadentor das Dorf betraten. Die angespitzten Enden der hölzernen Pfähle schienen geradewegs in den eisblauen Himmel zu stechen, das von Wind und Wetter gezeichnete Holz schimmerte silbergrau, als die Sonnenstrahlen sich darauf brachen, und die großen, darin eingebrannten Schutzzeichen klaffte wie schwarze, kohlefarbene Wunden in der ansonsten sauber und ebenmäßig gearbeiteten Oberfläche.
„Wie wer mich anschaut?“, erkundigte ich mich verwundert.
„Die Wache auf dem Wehrgang, Kellan heißt er, glaube ich. Jedes Mal, wenn wir durch das Tor gehen, blickt er dich so seltsam an...“ Colin zuckte ratlos die Achseln. „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es gefällt mir nicht.“
Ich warf einen Blick hinauf in Richtung des Wehrganges, konnte jedoch gegen das Sonnenlicht nur einen Schatten erkennen. Dennoch glaubte ich, einen Rotstich in dem langen Haar zu erkennen, das im Wind wild flatterte. Die feinen Härchen in meinem Nacken stellten sich auf, obschon ich den Mann nicht kannte.
Am Abend zog ich mich sehr zeitig in meine Kammer zurück. Obwohl es verboten war und ich wusste, dass ich mich damit in größte Gefahr begab, ließ ich die Läden offen und schob den Stuhl, der außer meinem Bett und der mit Messing beschlagenen Kleidertruhe das einzige Möbelstück in der schmalen Kammer darstellte, vor das Fenster. Binnen kürzester Zeit klapperten meine Zähne leise aufeinander – die Abendluft war so kalt, dass sich kleine Atemwölkchen vor meiner Nase bildeten. Ungeduldig sah ich zu, wie die letzten Sonnenstrahlen das Dorf in ein wunderschönes, rotglühendes Licht tauchten. Das getrocknete Rietgras, mit dem die Dächer gedeckt waren, schien regelrecht in Flammen zu stehen. Und dann war es endlich soweit. Die Sonne verschwand hinter dem Horizont. Dämmerung senkte sich über das Land. Das Licht verblasste, die ersten Sterne blinkten am Himmel, helle Lichtpünktchen in der Dunkelheit. Ich weiß nicht, wie lange ich wartete. Irgendwann erhob ich mich, um die Decke vom Bett zu ziehen und mich darin einzuhüllen, und da bemerkte ich, dass meine Glieder schon beinahe steif gefroren waren. Ich setzte mich wieder ans Fenster. Und wartete. Und wartete. Irgendwann fielen mir die Augen zu.
Am darauf folgenden Morgen erwachte ich wieder in meinem Bett, die Decke war sorgsam um mich herum festgesteckt, und wie am Tag zuvor stand auch der Fensterladen einen kleinen Spalt breit offen. Ich fragte mich, ob ich mich in der Nacht aus eigener Kraft vom Fenster hierher geschleppt hatte, oder ob Er es gewesen war. Sonst zeugte nichts von seiner Anwesenheit. Das dachte ich zumindest. Bis ich nach dem Frühstück aus dem Haus trat, um meiner üblichen Arbeit auf dem Feld nachzugehen, und beinahe über einen mir wohlbekannten Weidenkorb stolperte, der bis zum Bersten mit Reisig gefüllt war. Das war das Letzte, das ich für lange Zeit von Ray sehen sollte.
Nacht für Nacht wachte ich am Fenster, bis mir schließlich die Augen zufielen. Ich beobachtete den aufsteigenden Mond, und wenn die Nacht wolkenverhangen oder mondlos war starrte ich einfach hinaus in die Finsternis. Ich wusste, dass ich damit mein Leben riskierte. Aber ich konnte einfach nicht anders. Ich konnte die Hoffnung nicht aufgeben, dass es doch kein Traum gewesen war, und dass er eines Nachts zurückkehren würde. Jeden Morgen erwachte ich in meinem Bett, sorgfältig zugedeckt, und das Fenster stand einen kleinen Spalt breit offen. Ich fragte mich, ob es tatsächlich Ray war, der in meine Kammer kam, oder ob nicht vielleicht Kian des Nachts nach mir sah und mich ins Bett trug. Doch warum stand das Fenster dann offen? Ich wagte es nicht, meinen Bruder danach zu fragen, denn was wäre, wenn es tatsächlich Ray war? Ich hatte mir geschworen, mein Geheimnis für mich zu behalten. Kian hatte auch so schon genug Sorgen. Jetzt im Herbst musste die Ernte eingefahren werden, oder wir würden im Winter hungern müssen.
Ray fehlte mir. Obschon ich ihn nicht wirklich hatte kennen lernen dürfen, fehlte er mir. Er war von heute auf morgen Teil meines Lebens geworden, und ebenso schnell war er wieder verschwunden. Er hatte keinerlei sichtbare Spuren hinterlassen. Ich hatte nichts, das mich an ihn erinnerte. Er war wie ein Schatten, wie ein Gedanke, flüchtig wie ein Geist.
Irgendwann kam ich zu dem Schluss, dass er mich mied, da ich für ihn nicht weiter von Belang war, und dass ich ihn wohl auch nicht wieder sehen würde. Alles deutete darauf hin. Vielleicht hatte er sich in meiner Gesellschaft gelangweilt, vielleicht hatte er auch Besseres zu tun, als seine Zeit mit einem Dorfmädchen zu verbringen. Ich dachte mir, dass es so wohl besser war. Sicherer. Ich musste aufhören, mich ständig selbst in Gefahr zu bringen. Von diesem Tag an blieben die Fensterläden geschlossen.
****
Die Zeit verging, und der Winter hielt Einzug. Schnee legte sich einem weißen, federnen Mantel gleich über das Land, und die weiße Decke nahm sowohl die Wärme als auch sämtliche Farben mit sich. Die Tage wurden kürzer, und in den langen Nächten, die nur von flackernden Kerzenlicht und dem Schein des Kaminfeuers erhellt wurden, verbrachte ich viel Zeit in der Stube, in meine gewebte Decke gehüllt und eines der Bücher meines Großvaters in der Hand. Die Luft war von jener seltenen Klarheit, die von großer Kälte zeugt, und des Nachts malten sich wie von Zauberhand Eisblumen an die Fenster in der Stube. Die Stube war der einzige Raum im Haus, in dem wir Fensterscheiben hatten. Großvater war sehr stolz darauf, nicht jedes Haus konnte sich mit verglasten Scheiben rühmen. Er hatte sie noch vor der Geburt meines Vaters bei einem fahrenden Händler erstanden.
Ich lernte sehr viel in jenen Tagen. So erfuhr ich, dass einst alle Dörfer und Städte des Reiches durch ein Straßennetz miteinander verbunden gewesen waren. Fahrende Händler und Kuriere waren auf ihnen gereist, und es hatte einen regen Warenaustausch gegeben. Das war die Zeit der Magier gewesen, und vieles, was heute längst in den Nebeln der Vergessenheit verschwunden war, wie beispielsweise die Kunst, Fenster aus Glas zu fertigen, stammte aus jenem blühenden Zeitalter.
Heute waren die Straßen unbenutzt und von Gestrüpp überwuchert. Die Magier waren verschwunden, und mit ihnen die Magie. Aberglaube beherrschte nun die Menschen, und die Furcht vor den Vampiren oder anderen Wesen der Nacht hatte die Gesellschaft verändert. Starke, mutige Herrscher wurden gesucht, und sie regierten mit eiserner Hand. Wir hatten unser Leben mit dem Preis unserer Freiheit erkauft.
****
Dann kam der Tag des Mittwinterfestes. Mittwinter war die längste Nacht im Jahr, und von jenem Tag an wurden die Nächte wieder kürzer. Es war ein Anlass zum Feiern, und weil im Winter sowieso die meiste Arbeit ruhte, da auf den Feldern nichts mehr gedieh, hatten die Menschen Zeit zu Feiern. Das Mittwinterfest war das fröhlichste und größte Fest im Jahr.
Der große Platz vor dem Ratshaus war zu diesem Anlass vom Schnee freigefegt worden, und in dessen Mitte hatten die jungen Burschen einen großen Holzstoß aufgeschichtet, der mit Einbruch der Nacht entzündet werden und bis Sonnenaufgang brennen würde.
Gemeinsam mit Kian, Colin und Großvater machte ich mich wie alle anderen kurz vor Sonnenuntergang auf den Weg in Richtung des Dorfplatzs, gegen die schneidende Kälte in meinen wärmsten Mantel gehüllt. Wie ein kleines Kind freute ich mich immer wieder auf das riesige, beeindruckende Feuer und die ehrfurchtsvolle Stimmung, die die Menschen an diesem besonderen Tag erfasste.
Kaum waren wir am Feuer angelangt, verschwand Colin auch schon in der Menge, die sich bereits um das Feuer versammelt hatte. Er hatte Alan erspäht, einen Jungen in seinem Alter, mit dem er immer allerlei Unfug anstellte.
Großvater setzte sich auf die Bank, die dem Feuer am nächsten war, neben den alten Bror, den einzigen anderen Menschen im Dorf, der ebenfalls ein so hohes Alter erreicht hatte, dass seine Haare die Farbe frisch gefallenen Schnees angenommen hatten. Wie es die Art alter Männer ist, schickten sie sich an, den Abend Pfeife rauchend und in Erinnerungen schwelgend zu verbringen.
„Tante Caiti, Tante Caiti!“ Eine kleine, in dicke Felle gehüllte Gestalt warf sich so schwungvoll in meine Arme, dass ich einen Schritt zurück taumelte, ehe ich mein Gleichgewicht wieder fand. Hellblonde Locken glänzten im Feuerschein fast golden, und große, haselnussbraune Augen sahen treuherzig zu mir auf.
„Nia!“, lachte ich. „Jetzt hättest du die arme Tante Caiti fast umgeworfen!“
„Tut mit leid“, entschuldigte sich das kleine Mädchen mit großen Augen. Ich schüttelte nur lächelnd den Kopf. Als ich die Hand hob, um ihr über das Haar zu streichen, zuckte meine Nichte erschrocken zurück und vergrub das Gesicht an meiner Schulter. Ich wechselte einen bedeutungsvollen Blick mit Kian, der noch immer an meiner Seite stand.
„Kleines, sieh mich an.“ Die Stimme meines großen Bruders war leise und sanft. Zögernd hob Nia den Kopf. Unendlich vorsichtig strich Kian das dichte Haar hinter ihr Ohr zurück. Ein dunkler Fleck, etwa von der Größe einer Handfläche, zeichnete sich im flackernden Licht der Flammen auf dem zierlichen Wangenknochen ab.
„Connor!“, zischte Kian erbost. „Dieser Drecksack! Dieser erbärmliche Drecksack! Er kann es einfach nicht lassen!“
„Ich war böse“, versuchte Nia zu erklären und sah beschämt zu Boden. „Vater hat gesagt, ich soll die Werkstatt scheuern, und ich hab einen Fleck übersehen. Ich war ein böses Mädchen. Er musste mich bestrafen. Er tut das nicht gern, aber er muss es tun, weil er mich lieb hat.“
Da umfasste Kian sanft mit beiden Händen ihr Gesicht, und der kobaltblaue Blick verschmolz mit dem braunen.
„Nein, Nia!“, sagte er eindringlich. „Es ist nicht deine Schuld, das darfst du niemals glauben. Dein Vater ist nicht mehr er selbst, wenn er getrunken hat. Und daran ist er ganz allein schuld.“
Nia atmete erleichtert aus. „Dann glaubst du nicht, dass ich eine schreckliche Last und ein verzogenes Balg bin?“, fragte sie schüchtern.
„Nein, das bist du nicht. Ganz gewiss nicht. Hat dein Vater das gesagt?“
Die Kleine nickte stumm. In ihren Augen las ich eine tiefe Traurigkeit, für die sie mir noch viel zu jung erschien. Noch ein Kind, das zu früh hatte erwachsen werden müssen.
Ich schluckte und ballte meine Hände zu Fäusten. „Sie ist fünf Sommer alt, Kian!“, flüsterte ich aufgebracht. „Fünf! Wie kann er nur! Und warum unternimmt Eila nichts dagegen?“
Eila war meine Schwägerin. Sie mochte mich nicht besonders, aber sie schien niemanden besonders zu mögen, also nahm ich es ihr nicht wirklich übel. Der grimmige Gesichtsausdruck, den sie stets zur Schau trug, hatte tiefe Falten in ihre Haut gegraben. Dennoch musste sie ein Herz haben - irgendwo.
„Hast du das blaue Auge nicht gesehen, dass sie mit Farbe zu verdecken versucht? Er schlägt sie doch auch. Das ist nichts Ungewöhnliches, Caiti. Du bist sehr behütet aufgewachsen“, erwiderte mein Bruder so leise, dass Nia, die inzwischen wie gebannt in das Feuer starrte, nichts mitbekam. Ich war froh, dass sie wenigstens kurzzeitig Ablenkung finden konnte, jetzt, da ihr Vater anderweitig beschäftigt war und sich nicht mehr groß um seinen Nachwuchs zu kümmern schien. Connor war dabei, sich an die jungen Mädchen heran zu machen, die am anderen Ende des Feuers standen – ich sah, wie er sich zu einem der Mädchen beugte und ihr etwas ins Ohr flüsterte, woraufhin sie leise kicherte. Ich kannte sie flüchtig, glaubte mich zu erinnern, dass sie Ciara hieß, und wusste, dass sie in etwa in meinem Alter war und demnach seine Tochter hätte sein können. Eila stand wenige Schritte hinter ihm und warf ihm einen hasserfüllten Blick zu. Ich hoffte um ihretwillen, dass er sich nicht im falschen Moment umwenden und den Ausdruck in ihren Augen sehen würde. Nein, sie hatte wahrlich kein leichtes Leben. Eine leise Woge des Mitgefühls erfasste mich.
„Es ist das Recht der Männer, sich ihre Frauen und Kinder gefügig zu machen.“ Kian spie das Wort aus, als sei es giftig. „Was glaubst du, warum Großvater und ich uns so dafür eingesetzt haben, dass du bei uns lebst? Nicht, dass er sich übermäßig dagegen gewehrt hätte“, fügte er spöttisch an. „Ein Maul weniger zu stopfen. Es war Connor nur zu recht, dich in meiner und Großvaters Obhut zu lassen. Danke Gott dafür.“
Ich nahm das Mädchen noch fester in die Arme und wiegte sie sanft hin und her. „Ich hab dich lieb, Nia. Du wirst schon sehen, alles wird gut!“, murmelte ich leise in ihr Ohr. Wenn ich mich nur selbst davon überzeugen könnte! Wir konnten nichts dagegen tun. Das war das Schlimmste daran. Wir mussten tatenlos mit ansehen, wie unser Bruder seine kleine, zierliche Tochter schlug, mit dem Wissen, dass wir sie nicht davor schützen konnten.
Eine ganze Weile saßen Kian und ich schweigend am Feuer und blickten gedankenversunken in die Flammen. Nia hatte ihren Kopf an meine Brust gelehnt und war eingeschlafen. Ich wiegte mich langsam im Takt der Dudelsäcke, die mit ihren klagenden Klängen die Nacht vertreiben sollten. Da stand Kian auf einmal auf, straffte die Schultern und atmete tief ein, so, als würde er sich selbst Mut zusprechen. Dann ging er mit federnden Schritten um das Feuer herum. Ich sah, wie er sich zu einer jungen Frau hinunter beugte, die etwas abseits auf einem umgedrehten Holzfass saß. Schwarze, lange Haare, die im eisigen Wind flatterten, ein alter, abgenutzter Umhang. Lachend warf sie jetzt den Kopf zurück, und das Gesicht meines Bruders verzog sich zu einem breiten Grinsen. Die sorgenvollen Falten auf seiner Stirn glätteten sich. Ich hatte ihn schon sehr lange nicht mehr wirklich lachen sehen, fiel mir auf. Wer war diese Frau nur?
„Scheint so, als würde sich dein Bruder da drüben prächtig amüsieren“, raunte mir eine tiefe, rauchige Stimme ins Ohr. Der heiße, feuchte Atem ihres Besitzers strich mir über den Nacken und jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken. Ich fuhr herum, meine Hand legte sich instinktiv auf das aus dunklem Kirschholz geschnitzte Kreuz, das an einem ledernen Band um meinen Hals hing. Es hatte meiner Mutter gehört. Sie hatte immer gemeint, es helfe gegen das Böse, und seit dem Tag, an dem wir sie verloren hatten, hatte ich es niemals abgelegt. Ich fühlte mich ihr nahe, wenn ich es trug, so als wäre ein Teil von ihr noch immer bei mir. Und man sagte, dass ein Kreuz vor Vampiren schützte – doch nach meinem Erlebnis im Wald zweifelte ich daran. Weder Elenzar noch Ray schienen sonderlich davon beeindruckt gewesen zu sein. Vor dem Mann, der nun vor mir stand, konnte es mich wohl ebenfalls nicht beschützen, denn er trug auch eines um den Hals, wie die meisten Wachen es taten.
„Darf ich mich vorstellen – ich heiße Kellan und versehe für gewöhnlich den Wachdienst am Tor.“
„Ich grüße dich“, erwiderte ich kühl. Der Mann war mir unheimlich. Er hatte den Ausdruck eines Jägers in seinen kalten, grauen Augen. Eines menschlichen Jägers. Die breiten Schultern und die grau und rot gesprenkelten Bartstoppeln gaben ihm ein schon beinahe wildes Aussehen, was mir noch zusätzliche Angst einflößte. Kellan. Ich erinnerte mich, den Namen schon einmal vernommen zu haben, und auch die roten Haare kamen mir sehr bekannt vor.
„Und die da drüben, die gerade deinen Bruder anschmachtet, das ist meine Schwester Bria“, fuhr Kellan jetzt fort. „Richte ihm aus, er soll sich in Acht nehmen. Sie ist nicht zu haben.“ Er hielt inne und betrachtete Nia, die nach wie vor auf meinem Schoß saß und sich vertrauensvoll an mich schmiegte. Die tiefe Stimme schien sie aus dem Schlaf geschreckt zu haben, denn sie setzte sich rasch auf und warf mir einen fragenden Blick zu. Ich strich ihr beruhigend über das Haar. Uns würde nichts geschehen. Es waren zu viele Zeugen anwesend, als das er gewagt hätte, sich mir anzunähern. Dennoch war mir nicht wohl in meiner Haut.
„Das Kind steht dir. Gefällt mir. Ist das deines?“, fragte Kellan bedächtig.
„Das meines Bruders“, beschied ich ihm knapp.
„Dann bist du also noch zu haben?“ Er taxierte mich mit einem berechnenden Blick.
„Nicht für dich“, erwiderte ich eisig. Allein bei dem Gedanken, diesem Mann zur Frau gegeben zu werden, gefror mir das Blut in den Adern. Ich wusste, dass ich keine Wahl haben würde, was meinen zukünftigen Ehemann betraf, aber ich hoffte, dass mir noch ein wenig Zeit blieb. Ich hatte nicht den Wunsch, in ein fremdes Haus zu einer mir fremden Familie zu ziehen, zu einem Mann, der über mich würde verfügen können, wie er wollte. Ich bezweifelte, dass ich das Glück haben würde, einen Mann wie Kian zu finden, und ich fürchtete den Tag, an dem ich sein Haus für immer verlassen musste.
„Das werden wir noch sehen!“, gab Kellan ebenso eisig zurück. Er warf mir einen vernichtenden Blick zu, dann machte er auf dem Absatz kehrt und ließ mich mit Nia vor dem Feuer zurück. Ich fühlte mich auf einmal sehr allein und sehr hilflos. Diese Unterhaltung würde noch Folgen haben, dessen war ich mir gewiss. Kellan hatte nicht wie ein Mann gewirkt, der sich abweisen ließ, obwohl ich mir größte Mühe gegeben hatte.
Als Kian weniger später zurück kam und sich neben mich setzte, atmete ich erleichtert auf. Dann sah ich ihn mir genau an. Niemals zuvor hatten seine Augen so gestrahlt, und er schien nicht verhindern zu können, dass sich immer wieder ein leises Lächeln auf seine Lippen stahl.
„Vielleicht ist es jetzt an mir, dich zu warnen, Bruder“, meinte ich leise.
Kian wandte sich zu mir um. „Und wovor, Schwester?“, fragte er, noch immer lächelnd.
„Vor zu offensichtlichem Interesse? Ich weiß es auch nicht so recht, aber kaum warst du gegangen, da kam ein rothaariger Hüne auf mich zu, stellte sich als Kellan vor und sagte, ich möchte dir ausrichten, dass du dich in Acht nehmen soll, da seine Schwester nicht zu haben ist.“
Das Lächeln verschwand, und ich verspürten einen leisen Stich des Bedauerns. Er hatte es verdient, glücklich zu sein, und ich hasste es, ihn in die Wirklichkeit zurück stoßen zu müssen, doch der Wortwechsel mit Kellan hatte ein ungutes Gefühl in meiner Magengegend hinterlassen, und er schien seine Warnung ernst gemeint zu haben.
„Kellan?“ Kian musterte mich jetzt aufmerksam und zog die im Feuerschein golden glänzenden Augenbrauen zusammen, als er den panischen Ausdruck in meinen Augen gewahrte. „Was wollte er von dir?“
„Mir drohen, nehme ich an? Er schien Interesse an mir zu haben.“ Ich schauderte.
„Wir werden noch vorsichtiger sein müssen als wir es ohnehin schon sind.“ Kian legte nachdenklich die Stirn in Falten. „Kellan ist vom selben Schlag wie unser lieber Bruder. Gib Acht, dass du niemals mit ihm alleine bist!“
(c) by Schneeflocke