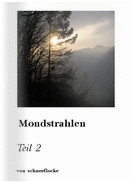4. Familienangelegenheiten
Düster und beinahe bedrohlich ragte der schwarze Schatten des Hauses vor mir auf. Das Holz, das jahrzehntelang der Witterung ausgesetzt gewesen war, war im Laufe der Jahre so dunkel geworden, dass es das wenige Licht des Mondes fast vollständig schluckte. Nur der schwache Lichtschein, der durch die schmalen Türritzen drang, wies mir den Weg. Er sagte mir auch, dass augenscheinlich noch jemand wach war. Der Grund war eindeutig: man wartet auf mich. Normalerweise gingen die Dorfbewohner kurz nach Sonnenuntergang zu Bett – außer im Winter natürlich, denn im Winter waren die Tage zu kurz, als dass man die ganze Nacht hätte schlafen können.
Ich blickte suchend in die Schatten, die mich umgaben. Nichts rührte sich, und ich hoffte, dass mich meine Augen nicht trogen und ich tatsächlich alleine hier draußen war. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und trat aus dem Mondschatten des Nachbarhauses heraus, der mich bis jetzt verborgen hatte. Ich hoffte inständig, dass es Connor nicht einfiel, in diesem Moment aus seinem Küchenfenster zu sehen – es war das einzige Fenster seines Hauses, dessen Blick zu eben jener Gasse hin ging, die mich jetzt noch von meinem Zuhause trennte. Mit zwei großen Sätzen überquerte ich die Gasse zwischen den beiden Häusern. Ich seufzte erleichtert auf, als ich an der breiten Eichentüre anlangte, die sich nur als schwärzester Schatten in der Dunkelheit abhob. Zögernd klopfte ich an – dreimal kurz, dreimal lang, das geheime Klopfzeichen meiner Familie.
Ich hörte, wie drinnen der Riegel leise klappernd beiseite gezogen wurde, und Augenblicke später riss mein Großvater die Tür auf. Nebelähnlich flatterte sein schlohweißes Haar in dem Windstoß, den er durch die rasche Bewegung verursacht hatte. Die Schatten einer halb durchwachten Nacht lagen in dunklen Ringen unter seinen Augen, und das angespannte Netz kleiner Fältchen, die seinen Mund umgaben, zeugte von großer Besorgnis. Er blickte wie gehetzt in die dunkle Nacht hinaus, wohl um sich zu vergewissern, dass uns niemand beobachtete. Es war nicht erlaubt, in der Nacht die Tür zu öffnen – eine Tatsache, die mir vielleicht das Leben retten würde, denn wenn niemand wagte, bei Nacht das Haus zu verlassen oder auch nur hinaus zu blicken, dann konnte mich auch niemand sehen, wenn ich gegen eben jene Regeln verstieß.
Dann schloss sich die Hand meines Großvaters mit erstaunlicher Kraft um den Ellbogen meines linken Armes. „Caitlin, Kind! Komm rasch herein!“ Ich wurde regelrecht über die Schwelle gezerrt, und der alte Mann zog rasch, aber dennoch beinahe lautlos die Tür hinter mir ins Schloss. Mit einem dumpfen Poltern rastete der schwere Riegel wieder ein.
„Wo warst du nur, Mädchen? Kannst du dir überhaupt vorstellen, welche Ängste wir ausgestanden haben?“ Mich traf ein eisgrauer Blick, der sowohl zornig als auch erleichtert schien.
Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, dass wir nicht alleine in der geräumigen Wohnstube waren. Mein älterer Bruder Kian hatte sich mit vor der Brust verschränkten Armen neben dem Kamin aufgebaut. Sein weizenblondes, lockiges Haar glänzte golden im Feuerschein und verlieh ihm beinahe das Aussehen eines Engels. In vielerlei Hinsicht war er das auch für mich: ein Schutzengel, der seit dem Tod meiner Eltern über mich wachte.
„Wo ist Colin?“, fragte ich leise nach meinem jüngsten Bruder.
„Er schläft“, teilte mir Kian mit. „Und dafür kannst du sehr dankbar sein! Je weniger hiervon wissen, desto besser. Ich selbst war kurz davor, in den Wald zu gehen und nach dir zu suchen! Verdammt, Mädchen, du spielst mit deinem Leben, und mit unserem noch dazu!“ Seine Stimme klang streng, doch ich sah auch die Sorge, die in seinen Augen glomm.
„Es tut mir leid“, flüsterte ich. „Ich habe mich verlaufen. Es wird nicht wieder vorkommen. Aber ich konnte einfach kein Reisig finden, und...Oh nein, mein Korb!“, keuchte ich entsetzt. „Ich muss ihn wohl irgendwo in der Dunkelheit verloren haben!“ Ich schlug die Hände vor das Gesicht. All die Mühe – für nichts! Seltsamerweise schien mir der Verlust des Weidenkorbes auf einmal sehr viel bedeutsamer, als es normalerweise der Fall gewesen wäre. Wahrscheinlich war es nur die Erschöpfung und der allmählich nachlassende Schock, der meine Gefühlswelt durcheinanderwirbelte. Ich war am Ende meiner Kräfte.
Da schloss mich Großvater fest in die Arme.
„Vergiss den Korb! Wir werden ihn schon wieder finden. Viel wichtiger ist doch, dass du noch lebst!“ Seufzend strich er mir durch das zerzauste Haar. Sein vertrauter Geruch und der Trost seiner warmen, breiten Brust, die mir als Kind immer Zuflucht geboten hatte, beruhigten mich langsam. Ich atmete zitternd ein. Es war so still und friedlich hier. Leise seufzend schloss ich die Augen.
„Wie oft habe ich dir schon erklärt, das der Wald gefährlich ist!“, fuhr Großvater ein wenig später fort. „Du hättest sterben können!“
Mühsam gelang es mir, ein hysterisches Kichern zu unterdrücken. Oh ja, ich wusste, wie gefährlich der Wald war! Nur zu gut...
„Du raubst uns noch den letzten Nerv, Kind! Lass uns hoffen, dass niemandem dein Fehlen aufgefallen ist! Wie bist du überhaupt noch durch das Tor gekommen?“ fragte er.
„Ich habe einen Freund in der Wache, der hat mich hineingelassen“, murmelte ich. Röte überzog meine Wangen ob der Lüge. Ich hatte schon als Kind gelernt, dass es manchmal überlebenswichtig sein konnte, überzeugend die Unwahrheit sagen zu können. Doch bei meinem Großvater und Kian fiel es mir noch immer schwer. Glücklicherweise war mein Gesicht in den rauen Stoff von Großvaters Hemd gepresst, so dass er nichts bemerkte.
Schweigen erfüllte den Raum, und die Stille der Nacht wurde nur vom Knistern der Flammen im Kamin unterbrochen. Hin und wieder knackten die Dielen über uns. Es war warm in der Stube, und ich gewahrte, wie ich schläfrig wurde, jetzt, da ich in Sicherheit war und die Anspannung allmählich von mir abfiel. Müdigkeit machte meine Glieder schwer. Ich gähnte leise.
„Du bebst regelrecht Kind – kein Wunder, du bist den ganzen Tag im Wald gewesen, und das mit nichts als einem dünnen Mantel am Leib!“ Großvaters Stimme war sanft.
Ich hatte nicht bemerkt, dass ich fror, doch auf einmal fiel mir selbst auf, dass ich haltlos zitterte. Ob es an der Erschöpfung oder an der Kälte lag vermochte ich jedoch nicht zu sagen.
„Geh hinauf in deine Kammer, Caitlin“, meinte Großvater leise. „Schlaf ein wenig.“
Ich nickte zögernd und löste mich aus seinen Armen. Der alte Mann sah mich nachdenklich an, dann ging er zum Kamin hinüber und stieß mit dem Schürhaken die brennenden Holzscheite ein wenig auseinander, so dass die Flammen nicht mehr hoch genug schlugen, um Funken zu sprühen. Ein offenes Feuer war immer gefährlich. Ich konnte mich noch gut erinnern, wie eines Nachts das ganze Dorf auf den Beinen gewesen war, um das Feuer zu löschen, dass in Ciaras Elternhaus ausgebrochen war. Ein Funke aus dem Kamin war auf dem Teppich vor dem Kamin gelandet, und dieser hatte sofort in Flammen gestanden. Doch im Winter war es einfach notwendig, den Kamin brennen zu lassen, wollte man nicht im Schlaf erfrieren, und so stießen wir die Scheite immer ein wenig auseinander, ehe wir zu Bett gingen, und hofften das Beste.
Kian nahm die kleine Laterne vom Kaminsims, und schweigend stiegen wir Seite an Seite die Stufen in den oberen Teil des Hauses hinauf. Großvater öffnete die Tür zu meiner Schlafkammer. Seit ich mit dem Anbruch meines zwölften Winters als Frau angesehen wurde, hatte ich eine eigene kleine Schlafkammer am einen Ende des oberen Flurs. Ich trat an ihm vorbei und setzte mich dann auf die Kante meines schmalen Bettes, das den größten Teil des kleinen Raumes einnahm. Mein Vater hatte es gezimmert, kaum dass ich der Wiege entwachsen war. Damals war ich mir auf der für mich riesigen Matratze immer ein wenig verloren vorgekommen, doch heute war ich froh, dass Vater so umsichtig gewesen war, ein ausreichend großes Bett zu zimmern. Ich hätte mich um nichts in der Welt von dem Möbelstück trennen wollen. Die sorgsam abgeschliffenen und gerundeten Ecken und der matte Glanz geölten Eichenholzes erinnerte mich an die sorglose und unbeschwerte Zeit meiner frühen Kindheit.
Kian verabschiedete sich wortlos mit einem Kopfnicken und ging den Gang hinunter in seine eigene Kammer.
„Gute Nacht, Caitlin“, murmelte mein Großvater, der noch ein wenig in der Türöffnung verharrte.
„Gute Nacht, Großvater. Danke, dass du nicht die Wachen gerufen hast!“ flüsterte ich.
Er lächelte. „Ich würde niemals meine einzige Enkeltochter verraten. Das solltest du eigentlich wissen. Ich habe ein Herz. Was immer da draußen in den Wäldern geschieht, ich glaube nicht, dass es dieses rücksichtslose Foltern und Morden an Unseresgleichen rechtfertigt. Ich halte es für Unrecht, die Verlorenen auszustoßen. Denn auch du, mein Kind, wärst eigentlich schon lange eine von ihnen.“
Und mit diesen rätselhaften Worten wandte er sich um und schloss die Tür. Ich saß eine ganze Weile im Dunkeln auf der Bettkante und lauschte seinen schweren Schritten, die leise in der Ferne verklangen. Das einzige Geräusch war jetzt das leise Klappern der geschlossenen Fensterläden im Wind, ansonsten hätte man meinen können, die Welt sei in einem tiefen Schlaf versunken.
Kurze Zeit später wurde meine Tür beinahe lautlos wieder geöffnet. Ich sah einen großen Schatten auf mich zukommen, doch ich empfand keine Angst. Ich wusste, wer es war, der sich da neben mir auf der Bettkante niederließ. Nur er konnte sich derart lautlos im Haus bewegen – er kannte jede lose Bodendiele und jede knarrende Stufe. Colin ebenfalls, doch er machte sich meist nicht die Mühe, darauf zu achten. Seine Schritte waren stets ungeduldig und stürmisch, wie es auch seinem ganzen Wesen entsprach – er war noch jung und ungestüm.
Der hölzerne Rahmen protestierte mit einem leisen Stöhnen gegen das zusätzliche Gewicht.
„Kleine Schwester, was hast du dir nur gedacht!“ murmelte Kians Stimme leise und vorwurfsvoll neben mir.
„Es war, wie ich sagte – ich habe mich verlaufen“, verteidigte ich mich, nicht gewillt, alles preis zu geben, was mir heute widerfahren war. Ich wollte ihn nicht noch mit meinen Sorgen belasten – ich hatte ihm bereits genug aufgeladen, und er hatte schon zu viel Verantwortung zu tragen.
„Ich bin eine Weile im Wald herum geirrt, und dann bin ich durch Zufall wieder auf einen Weg gestoßen, der mich zum Dorf führte“, fuhr ich fort.
Doch Kian ließ nicht locker.
„Natürlich – und wie bist du durch das Tor gekommen? Duncan hat diese Nacht keine Wache, das weiß ich, also lüg mich nicht an!“
Ich schluckte hörbar. Duncan war ein Freund aus Kindertagen, der ab und an den Wachdienst am Tor versah. Er hätte mich nicht verraten, das wusste ich, und er hätte mich auch nach Einbruch der Nacht noch hereingelassen und darüber geschwiegen. Natürlich wusste ich auch, dass er heute nicht am Tor gewacht hatte – ich war hindurchgegangen, bevor ich den Wald betreten hatte. Es war ein mir unbekannter, grobschlächtiger, groß gewachsener Kerl gewesen, der dort oben auf dem Wehrgang gestanden hatte. Sein langes, strähniges rotes Haar hatte im Wind geflattert, und er hatte mich mit einem seltsamen Blick gemustert, als ich an ihm vorbei schritt. Ich hatte den Blick nicht recht zu deuten gewusst, doch irgendetwas hatte in seinen Augen aufgeblitzt, das mir einen eiskalten Schauer über den Rücken gejagt hatte.
Was sollte ich Kian antworten? Ich wusste, dass die Nacht mein Gesicht vor ihm verbarg, und ich war relativ gut darin, anderen etwas vorzumachen. Das musste ich auch, anderenfalls hätte ich nicht so lange überlebt. Doch Kian schien es immer zu wissen, wenn ich ihm etwas verschwieg. Er kannte mich einfach zu gut, und es fiel mir immer so schwer, ihn anzulügen.
„Du bist irgendwie... anders. Irgendetwas ist dort im Wald geschehen, das du mir nicht erzählen willst. Sicher, du bist verängstigt, aber gleichzeitig ... ich weiß nicht... aufgeregt?“ Kians Stimme klang nachdenklich. „Du warst nicht allein im Wald – und irgendwer hat dir durch das Tor oder über die Palisaden hinweg geholfen!“
Ich hörte ein leises Rascheln, und dann flammte die kleine Kerze auf der Truhe neben meinem Bett auf. Kian musterte mich eindringlich und nickte schließlich grimmig, so als hätte sich seine Vermutung bestätigt. „Ich wusste es! Ich wusste es, verdammt! Ein Vampir! Caiti, weißt du, was das bedeutet?“
Ich sog überrascht die Luft ein. Warum nur konnte er mein Gesicht so gut lesen? Ich verfluchte mein Unvermögen, meine Gefühle vollständig hinter dieser ausdruckslosen Miene zu verbergen, die mein Bruder geradezu perfektioniert hatte.
„Es ist nicht so, wie du denkst!“, gab ich mich schließlich geschlagen. „Er hat mich gerettet! Da waren zwei Vampire im Wald, sie wollten mich töten!“ Meine Stimme brach, und ich hielt kurz inne, um mich zu sammeln. Die Geschehnisse der Nacht waren noch so frisch. „Einer der beiden hat mich verfolgt, und dann hat mich ein dritter Vampir gerettet. Er hat mich hierher gebracht und ist wieder im Wald verschwunden. Aber er war anders als die anderen. Er hatte sogar eine andere Augenfarbe!“
Erkenntnis blitzte in Kians Augen auf, doch seine Miene blieb undurchdringlich. Er wusste etwas über diesen anderen Vampir, etwas, das er vor mir verbarg. Ich kannte ihn gut genug, um nicht nachzufragen. Wenn er mir etwas nicht mitteilen wollte, konnte ihn nichts und niemand dazu bringen, es preis zu geben. Er würde es mir zu gegebener Zeit sagen – oder auch nicht.
Als Kian nach ein kleinen Weile wieder sprach, war seine Stimme sehr ernst.
„Caiti, überleg dir gut, was du tust! Nicht alle im Dorf sind so nachsichtig wie ich es bin. Denk an Connor! Er würde dich eher den Wölfen zum Fraß vorwerfen, als seinen guten Ruf zu gefährden, und hierbei steht sehr viel mehr auf dem Spiel als nur sein Ruf! Denk an die Strafe, die auf Vampirbuhlschaft steht! Ich kann dich in dieser Hinsicht nicht beschützen, Caiti, wir alle sind an die Gesetze des Dorfes gebunden, ob wir sie billigen oder nicht. Versprich mir, dass du keine Dummheiten begehen wirst, Schwester!“
Ich senkte den Blick. „Ich verspreche, dass ich vorsichtig sein werde“, flüsterte ich. Es war, genau genommen, keine wirkliche Lüge, beruhigte ich mich. Ich musste vorsichtig sein. Und das würde ich. Aber das bedeutete nicht, dass ich mich von meinem geheimnisvollen Retter fernhalten würde – wenn ich ihn denn überhaupt jemals wieder sehen würde. Ich glaubte nicht, dass ich das konnte. Er übte eine Faszination auf mich aus, die ich mir nicht erklären konnte.
Schweigen erfüllte den Raum. Ich riskierte einen kurzen Blick in Kians Richtung. Er musterte mich sehr genau, Skepsis lag in seinen Augen. Dann seufzte er tief. Er schüttelte den Kopf und erhob sich. Er schien es dabei zu belassen. Ich wusste, dass er mich von nun an noch mehr im Auge behalten würde, als er es ohnehin schon tat.
„Gute Nacht, Kian“, murmelte ich, als er zu meiner Kammertür hinüberging. Wahrscheinlich bildete ich es mir nur ein, aber es erschien mir, als seien seine Schultern noch ein wenig mehr gesunken unter der Last, die ihm diese Nacht zusätzlich aufgebürdet worden war. Ich wünschte, ich könnte sie mit ihm teilen, doch ich war nur eine Frau, und als solche war ich dazu verdammt, immer von einem Mann abhängig zu sein, der für mich eintrat. Normalerweise war das zuerst der Vater und dann der Ehemann. In meinem Fall, da ich meinen Vater so früh verloren hatte, war diese Aufgabe auf meinen ältesten Bruder übergegangen, auf Connor, der mit dem Tod meines Vaters dem Gesetz nach zu meinem Vormund geworden war. Connor war nicht gerade begeistert von dem Gedanken gewesen, neben den hungrigen Mäuler seiner eigenen Bälger, wie er sie zu nennen pflegte, auch noch das meine zu stopfen. Ich war froh, dass Kian diese Aufgabe freiwillig übernommen hatte, obwohl Connor natürlich immer das letzte Wort haben würde, sei es, was meine Vermählung oder auch meine Hinrichtung bei einem Verstoß gegen die Regeln betraf. Er billigte Kians Einmischung nur, weil sie ihm eine Menge Arbeit ersparte. Und ich dankte dem Himmel, dass ich dadurch bei ihm und meinem Großvater leben durfte. Ich mochte mir nicht ausmalen, wie es mir bei Connor ergangen wäre. Ich würde wohl bereits diese Nacht im Verließ unter dem Ratshaus zubringen – wenn ich dort nicht schon sehr viel früher gelandet wäre.
„Gute Nacht, kleine Schwester“, antwortete mein Bruder leise. Er wandte sich noch einmal zu mir um, und die tiefblauen Augen blickten suchend in die meinen. „Wirst du schlafen können? Ich kann auch bei dir bleiben“, bot er mir an. Seine Fürsorge erstaunte mich immer wieder. Ich schüttelte abwehrend denn Kopf.
„Es wird schon gehen“, beruhigte ich ihn. Ich hatte das seltsame Bedürfnis, ein wenig für mich zu sein – mir ging so viel durch den Kopf. Ich wusste nicht, ob ich überhaupt ein wenig Schlaf finden würde, und ich wollte ihn nicht um den seinen bringen.
„Bist du dir sicher?“, fragte mein Bruder. Es wäre nicht das erste Mal, dass er die Strohmatte von seinem Bett gezogen hätte, um neben mir zu schlafen. Obschon ich die Vorteile einer eigenen Kammer zu schätzen wusste, gab es doch Nächte, in denen es mir unerträglich war, alleine zu sein. Wenn ich wieder einmal schreien aus einem Albtraum erwacht war, in Schweiß gebadet, die Bilder vom Tod meiner Eltern so deutlich vor Augen, als wäre es gestern gewesen, war es stets Kians Kammer, in die ich schlich. Und obwohl ich eigentlich zu alt dazu war, hatte er nie auch nur ein Wort darüber verloren.
Jetzt antwortete ich jedoch mit einem Nicken auf seine Frage. Kian warf mir einen letzten, prüfenden Blick zu, dann zog er sanft die Tür hinter sich ins Schloss.
(c) by Schneeflocke