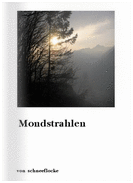Beschreibung
Nein! Verzweifelt brüllte ich auf, als mich die beiden Wachen von ihm fortrissen. Seine Hand fiel aus der meinen, erschlafft, leblos und kalt, so kalt. Ich hörte das leise, dumpfe Geräusch, mit dem sie auf dem vom Regen aufgeweichten Erdboden aufschlug, und der Laut fuhr mir einem Messer gleich ins Herz. Die Leere brannte sich beinahe schmerzhaft in meine noch immer nach ihm ausgestreckte Hand...
Prolog
„Nein!“ Verzweifelt brüllte ich auf, als mich die beiden Wachen von ihm fortrissen. Seine Hand fiel aus der meinen, erschlafft, leblos und kalt, so kalt. Ich hörte das leise, dumpfe Geräusch, mit dem sie auf dem vom Regen aufgeweichten Erdboden aufschlug, und der Laut fuhr mir einem Messer gleich ins Herz. Die Leere brannte sich beinahe schmerzhaft in meine noch immer nach ihm ausgestreckte Hand. Wie durch einen dichten Nebel nahm ich wahr, dass mir einer der Wächter gehässige Obszönitäten ins Ohr zischte, und dann wurden mir die Arme brutal hinter den Rücken gerissen und dort gefesselt. Sie wickelten das Seil so fest um meine Handgelenke, dass mir das Blut beinahe abgeschnürt wurde, doch ich nahm den Schmerz nur am Rande wahr.
Es war mir gleich, was sie mit mir machen würden. Ich hoffte auf einen schnellen Tod, und wusste zugleich, dass ich das Recht dazu schon vor langer Zeit verwirkt hatte. Sie würden mir diese Gnade nicht erweisen, aber auch das war mir nun egal. Alles, woran ich denken konnte, war das erloschene Leben in seinen Augen. Diese warmen, braunen Augen, die mich nun nie wieder anlächeln würden. Ich hatte alles gewagt, hatte alles in meiner Macht stehende getan, und doch hatte ich ihn nicht retten können.
1. Im Wald
Caitlin
Alles begann an einem Nachmittag im Mond der fallenden Blätter. Als ich den entscheidenden Schritt in den Wald hinein tat, wusste ich noch nicht, dass dies eine Wende in meinem zuvor recht monotonen Leben bedeuten würde, und ich hatte noch keine Ahnung von den Ereignissen, die ich damit auslösen würde. Dennoch überfiel mich leises Unbehagen, als mich die Schatten der Bäume verschluckten, grau im spärlichen Licht, das durch die dichte Wolkendecke drang. Unwillkürlich zog ich das aus bunter Wolle gewebte Schultertuch noch fester um meine Schultern.
Natürlich wusste ich um die gefährlichen Geschöpfe, welche die nahen Wälder bewohnten. Ich wusste ebenfalls, dass sie nicht immer in den Wäldern jenseits des Flusses blieben. Auch wenn in der Landeshauptstadt Gynerion bekräftigt wurde, der Fluss biete ausreichend Schutz vor den Vampiren, war dem nicht immer so. In den Wäldern diesseits des Refoins war man nach Einbruch der Dunkelheit ebensowenig vor einem Angriff sicher. Aus diesem Grund wurden im Dorf bei Anbruch der Dämmerung sämtliche Fenster und Türen verrammelt. Wir hatten einen einfachen, aber hohen hölzernen Palisadenzaun, der das ganze Dorf umgab, und bei Einbruch der Dämmerung hatten alle in ihren Häusern zu sein. Drei Wachtürme gab es, und sie waren Tag und Nacht bemannt.
Wir lebten abgeschieden am Rande der Wälder, viele Tagesmärsche von der Hauptstadt entfernt. Die Truppen dort konnten uns nicht helfen. In Gwenara hatten wir unsere eigenen Gesetze. Bran und seine Mannen herrschten über das Dorf. Ihre Gesetze waren die einzigen, die ich kannte. Die strengen Regeln, die ebenso rigoros wie gnadenlos durchgesetzt wurden, sollten nur unserem Schutz dienen. Ich wusste das. Ich brachte hier schon mein ganzes Leben zu, all dies war so tief in mein Gedächtnis gebrannt, dass es zu meinem Leben gehörte wie das Atmen. Doch noch war die Dämmerung fern.
Meine Eltern waren schon vor langer Zeit gestorben, und ich erinnerte mich nur bruchstückhaft an sie. Eines jedoch hatte ich nie vergessen: den Tag, an dem ich beide verloren hatte. Ich war noch sehr jung gewesen, vielleicht sechs Sommer alt, und doch erinnerte ich mich in aller Deutlichkeit. Oft schrak ich des Nachts schreiend aus dem Schlaf; seit jenem Tag vor zehn Sommern wurde ich von Albträumen geplagt. Albträume, die immer von weißen, spitzen Zähnen und rotglühenden, gierigen Augen handelten. Albträume, die mich wohl mein ganzes Leben lang begleiten würden. Doch immer, wenn die Albträume zu wirklich wurden, wenn ich schreiend aufschrak und dann wieder erschöpft in mein Kissen zurücksank, stand auf einmal ein anderes Bild vor meinen Augen. Ein bleiches Gesicht, von schwarzen, halblangen Haaren umrahmt, und zwei warme, rehbraune Augen. Und dieses Bild nahm mir jedes Mal die Angst.
Niemand konnte sich erklären, warum gerade ich überlebt hatte. Noch nie zuvor hatte ein Mensch einen Angriff der bluttrinkenden Wesen überlebt. Nur ich. Ein kleines, aschblondes, sechsjähriges Mädchen. Völlig verängstigt hatte ich mich hinter dem breiten, ausladenden Rock meiner Mutter versteckt, als die Horde Vampire aus dem Wald zum Angriff übergegangen war. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen hatte ich hilflos mit ansehen müssen, wie sie zuerst meinen Vater und dann meine Mutter töteten. Und dann hatten sich mir gierige, rote Augen genähert. Die weißen Zähne gebleckt, hatte sich einer der Vampire über mich gebeugt– und war von einem auf den anderen Augenblick verschwunden. Statt dessen hatte ich in warme, braune Augen gesehen. Und ein unglaublich intensives Gefühl der Sicherheit hatte mich durchströmt. Irgendwie hatte ich gewusst, dass mir jetzt nichts mehr geschehen konnte. Vertrauensvoll hatte ich die Hand nach meinem Retter ausgestreckt, und er hatte mich aufgehoben und mich ins Dorf zurück gebracht. Irgendwann war ich in seinen Armen eingeschlafen. Er muss mich, von allen anderen unbemerkt, bis in mein Bett getragen haben, denn dort war ich am nächsten Morgen aufgewacht.
Ich vergaß jene rotglühenden Augen, die meinen Tod gefordert hatten, nie, und ich träumte noch immer von ihnen. Doch jedes Mal, wenn die Angst zu übermächtig wurde, sah ich erneut jene warme, braune Augen, die mich gerettet hatten, und fühlte mich beschützt.
Jahre waren seitdem verstrichen, doch während ich an jenem Nachmittag den Wald betrat, fühlte ich mich plötzlich wieder von jener unbegreiflichen Angst ergriffen, die mich selten trog. Ich war in Gefahr. Etwas war im Begriff zu geschehen. Doch dann schüttelte ich den Gedanken energisch ab. Es war Tag. Die Sonne war hinter einer dichten Wolkendecke verborgen, doch die bluttrinkenden Wesen warteten immer bis zum Einbruch der Dunkelheit. Niemals war ein Vampirangriff vor der Dämmerung erfolgt.
Und wir brauchten dringend Reisig. Mein Bruder Connor brachte uns ab und an bereits gespaltenes Brennholz – die Familien waren einander verpflichtet, anders hätte sich der alte Geizkragen nie zu solch einer Mildtätigkeit durchringen können. Meine Schwägerin hatte jedoch mit der Feldarbeit, dem Haushalt und ihren drei Kindern genug zu tun, um auch noch Reisig für uns zu sammeln. Unseres war gestern zur Neige gegangen, und die Nächte wurden jetzt bereits empfindlich kalt. Ich musste in den Wald. Ich würde nicht allzu lange brauchen, ich wäre lange vor der Dämmerung zurück. Vielleicht ahnte ich einen drohenden Angriff auf das Dorf. Das würde meine Angst erklären. Ein wenig beruhigt, doch immer noch mit bangem Herzen, folgte ich dem schmalen Pfad in den Wald hinein.
Menschenmengen schienen den Wald vor mir nach Reisig wahrlich durchkämmt zu haben, denn ich fand ungewöhnlich wenig davon. Zu wenig. Ich zwängte mich durch das dichter werdende Unterholz immer tiefer in den Wald hinein, um meinen Korb zu füllen. Kleine Äste und Dornen verfingen sich in meinem Rock und in meinem Haar, sie schienen raschelnd nach mir zu greifen und mich zu verhöhnen, und es war mir, als wolle mich der Wald mit aller Macht daran hindern, weiter in seine Tiefe vorzudringen. Irgendwann gab ich mich geschlagen. Mehr als zur Hälfte würde der Korb nicht voll werden, doch ich war vollkommen erschöpft, und zu meinem Entsetzen bemerkte ich da auf einmal, wie lang die Schatten bereits geworden waren. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Meine Zeit lief ab. Ich wandte mich um und ging den schmalen Pfad zurück, auf dem ich den Wald betreten hatte. Auf einmal fand ich mich auf einer kaum sichtbare Weggabelung wieder, die ich zuvor nicht wahrgenommen hatte. Welchem Pfad sollte ich folgen? Ich entschied mich für den breiteren der beiden, doch bereits nach kürzester Zeit wurde er immer schmaler und endete schließlich ganz.
Dunkle Schatten immergrüner Tannen umgaben mich. Mich fröstelte. Es war unnatürlich still im Wald. Irgendwo zu meiner Linken knarrte ein alter Baum in einer leichten Brise, die seufzend durch die hohen Wipfel strich und mir sanft durch das Haar zauste. Das leise Zirpen der Grillen, die in der Dämmerung ihr eintöniges, beruhigendes Lied anstimmten, war verstummt. Kein Vogel zwitscherte, keine Maus raschelte durch das tote Laub, das den Waldboden bedeckte. Ich erstarrte ebenfalls. Ein verstummter Wald, das wusste ich, bedeutete Gefahr. Das Nahen eines Raubtieres. Ich musste so schnell wie möglich fort von hier!
Um nicht Gefahr zu laufen, im Kreis umherzuirren, entschied ich, meine einmal eingeschlagene Richtung beizubehalten, obschon ich keinen Weg mehr erkennen konnte.
Rücksichtslos kämpfte ich mich nun so schnell ich es vermochte durch das dichte Gestrüpp. Äste und Dornen verfingen sich wiederum in meinem Haar, kratzten und rissen an mir, wollten mich nicht gehen lassen. Ich bis die Zähne zusammen, bemüht, die Wut und die Verzweiflung, die in mir aufstiegen, niederzuringen, riss mich los und wischte mir energisch die Tränen vom Gesicht. Das leise Schluchzen drängte ich gewaltsam zurück, bis nur noch ein ersticktes Keuchen aus meinem Mund drang. Schon bald musste ich mir eingestehen, dass ich mich bereits hoffnungslos verirrt hatte. Im Dämmerlicht wurden die wenigen, schwach ausgetretenen Waldpfade vollständig von den Schatten verschluckt. Ich war verloren, und ich wusste es.
Ich kämpfte mich weiter durch das Unterholz, bis ich irgendwann völlig erschöpft eine Lichtung erreichte. Sie war nicht groß, doch die tiefen Äste einer alten Weide zu meiner Linken bildeten eine Art natürlichen Unterstand. Mehr sah ich nicht im schwindenden Licht, und ich wusste, dass ich so weit gekommen war, wie ich heute kommen würde. Zitternd hüllte ich mich in meinen dünnen Umhang und kroch so tief wie möglich in den Schatten. Ich schlang die Arme um meine Knie und legte das Kinn auf die verschränkten Arme. Es würde eine lange Nacht werden. Ich wagte nicht, zu schlafen, zum einen befürchtete ich, zu erfrieren, zum anderen gab es viele gefährliche Raubtiere, die des Nachts jagten. Ich hatte nicht vor, kampflos zu sterben. Leise ein altes Kinderlied summend wiegte ich mich hin und her.
*****
Ich weiß nicht, wie viel Zeit verstrichen war, aber ich musste wohl doch leicht eingenickt sein, denn ich schrak unvermittelt auf, als ich leise Stimmen ganz in der Nähe vernahm. Sie näherten sich. Sie kamen aus der Richtung, aus der ich die Lichtung ebenfalls betreten hatte. Aus genau derselben Richtung! Folgten sie meinen Spuren? Ein leiser Hoffnungsschimmer flackerte in mir auf. Vielleicht waren es Männer aus dem Dorf, meine Brüder gar, die losgezogen waren, um mich zu suchen? Ich wäre gerettet!
Doch ich schalt mich augenblicklich eine Närrin. Natürlich war das eine völlig unsinnige Hoffnung. Es war gut möglich, dass man im Dorf mein Verschwinden bereits bemerkt hatte – doch das würde wohl eher zu meiner Verbannung oder zu einem Todesurteil führen. Das Dorf lebte in einer beständigen Angst, die von der so nahen Gefahr ausging. Dieser Bedrohung wurde mit strikten Regeln begegnet, die alle akzeptierten. Es war nur natürlich, dass jene, die zu lang im Wald geblieben waren, der Verschwörung mit unseren Feinden verdächtigt wurden. Ich hatte das immer verstanden. Wer war schon so dumm, sich freiwillig nach Einbruch der Dunkelheit im Wald aufzuhalten? Doch tief in meinem Inneren war immer ein leiser Zweifel geblieben. Ich verstand, warum man ab und an Menschen aus diesem Grund verbannte, wenn mir dies auch grausam erschien. Doch Hinrichtung und Folterung? Rechtfertigte die Gefahr dies auch? In meinen Augen nicht, doch ich wäre niemals so töricht gewesen, diese Meinung laut zu äußern.
Eine der Stimmen, schon sehr viel näher jetzt, riss mich aus meinen Gedanken Ein eiskalter Schauer rann mir den Rücken hinab, und mein Atem beschleunigte sich. Leise kroch ich noch tiefer in den Schatten. Ich zog den Umhang noch enger um mich und wünschte, ich könnte unsichtbar werden. Die Stimmen waren verstummt, doch ich spürte die Bedrohung beinahe körperlich, die so lautlos wie eine Schlange immer näher kam.
Ich vernahm ein leises Rascheln, und dann sah ich mich auf einmal einem bleichen Gesicht gegenüber. Mein Herz setzte einen Schlag aus und begann dann schon beinahe schmerzhaft schnell zu pochen. Ich starrte wie gebannt in die gierigen, roten Augen, die sich in meine bohrten, mich taxierten. Es waren die Augen, die mich in meinen Träumen verfolgten! Mir wurde übel.
Der Vampir machte sich nicht einmal die Mühe, sofort nach mir zu schnappen. Er wusste, dass ich keine Chance hatte. Ein selbstbewusstes Lächeln spielte um seine Lippen.
„Die gehört mir, Endor!“, schnurrte er.
„Wie du willst, Elenzar“, antwortete eine andere Stimme in beinahe gelangweiltem Tonfall von der anderen Seite der Lichtung. Leises Blätterrascheln begleitete die Worte – mein anderer Verfolger entfernte sich augenscheinlich und überließ mich diesem Elenzar. Mit einer Bewegung, die so schnell war, dass sein Arm vor meinen Augen verschwamm, schob er einen Ast aus dem Weg und stand plötzlich vor mir.
Mein Körper spannte sich, ich ballte meine Hände zu Fäusten und stand langsam auf. Mein Herz raste, mein Magen zog sich vor Angst zusammen und ich war kurz davor, zusammenzubrechen, doch mein Überlebensinstinkt war sehr stark. Obwohl ich wusste, dass es sinnlos war, wandte ich mich um und rannte.
Ich rannte, wie ich noch nie zuvor gerannt war, kämpfte mich keuchend und schluchzend durch den dunklen Wald. Ich hörte ein leises Rascheln hinter mir, das mir verriet, dass mir der Vampir dicht auf den Fersen war. Er hätte mich ohne die geringste Anstrengung einholen können. Er tat es nicht – noch nicht. Er spielte mit mir.
„Hilfe!“ brüllte ich verzweifelt in die unbarmherzig schweigende Dunkelheit hinein. „Hilfe! Ist da jemand? Hilfe!“ Ich weiß nicht, wie lange ich schrie, doch irgendwann brach meine Stimme. Ich vernahm ein leises, belustigtes Lachen hinter mir.
„Hier hört dich niemand, Mädchen“, erklärte mir mein Verfolger unbekümmert. „Schrei, so laut du willst, ich werde trotzdem dein Blut trinken, bevor die Nacht herum ist. Ich mag Beute, die sich wehrt!“ Ein genüssliches Schmatzen hallte laut in der Stille. Ein eiskalter Schauer durchfuhr mich. Die Stimme wurde rauer, animalischer. „Das Blut ist immer so viel süßer, wenn das Opfer zuvor ein wenig leidet. Und leiden wirst du, das verspreche ich dir.“
2. Begegnung
Ray
Der Schattenclan machte uns den Teil des Waldes, den mein Vater von seinem Vater erhalten hatte, streitig, so lange ich mich erinnern konnte. Seit mein Großvater gestorben war tobte der Kampf zwischen den beiden Vampirclans der Caldunwälder. Im Grunde ging es um die Frage, ob es rechtens war, Menschen zu töten. Mein Vater hatte sich schon immer auf die Seite der Menschen geschlagen, doch als er meine Mutter kennenlernte, war sein Schicksal endgültig besiegelt – meine Mutter war ein Mensch gewesen. Und natürlich ging es – vor allem anderen – auch um das Land. Das Land, von dem meine Cousins überzeugt waren, dass es ihnen rechtmäßig zustand. In ihren Augen war unser Clan nur eine Horde Abtrünniger, und mein Großvater ein sentimentaler alter Narr, der sie um einen Teil ihres Erbes betrogen hatte. Es wurde gemunkelt, dass er keines natürlichen Todes gestorben war.
Seit dem Tod meiner Mutter hatte der Streit noch an Verbissenheit zugenommen. Immer wieder kam es zu Kämpfen an unseren Grenzen. Wir erhielten ein zuverlässiges Netz aus Grenzwachen aufrecht, um den Schattenclan daran zu hindern, auf unserem Gebiet zu jagen. Normalerweise waren wir über die Raubzüge des Feindes dank mehrerer Späher recht gut unterrichtet. Natürlich gelang es ab und an einzelnen Vampiren, die Grenzen zu überschreiten und den ein oder anderen Menschen zu töten, doch meist konnten wir sie daran hindern. Meist, jedoch nicht immer. Es war einer jener Tage gewesen, an dem ihre Eltern starben.
All dies ging mir durch den Kopf, als ich lautlos durch das Unterholz des Waldes huschte. Wieder einmal ging die Sonne unter, ihre letzten Strahlen tauchten den Wald in ein düsteres, tiefrotes Licht. Die herbstlich verfärbten Blätter schimmerten blutrot - eine Vorahnung? Mich schauderte, und ich beschleunigte meine Schritte. Wieder einmal ging ein Tag zur Neige, wieder einmal schickte ich mich an, über ein schlafendes Mädchen zu wachen - wie ich es jede Nacht tat, seit nunmehr elf Sommern. Ich konnte mich noch in aller Deutlichkeit erinnern, wie alles damals begonnen hatte...
*****
Mein Cousin Elenzar hatte mit ein paar anderen Vampiren einige unserer Wachposten überwältigt und war bis tief in unser Gebiet eingedrungen. Sie waren auf Menschen gestoßen, die so unvorsichtig waren, den Wald kurz vor Sonnenuntergang zu betreten. Es sollte ihr letzter Fehler gewesen sein.
Ich war damals zwölf Sommer alt, und mein Onkel hatte mich nur mitgenommen, weil ich ihm keine Ruhe damit gelassen hatte. Ich war ein schwieriger Junge gewesen, er war froh, dass ich überhaupt Interesse an etwas zeigte. Wenn ich ein Schwert in der Hand hielt, fühlte ich mich lebendig, ich hatte dann ein Ziel, eine Aufgabe. Und ich konnte schon äußerst geschickt mit meinem Schwert umgehen – es war das Schwert meines Vaters, und ich hatte mich immer dann, wenn der Schmerz zu groß wurde, in meinen Übungen vergraben. Auf diese Weise gelang es mir manchmal, wenigstens für ein kleine Weile zu vergessen.
Und so hatte Jaro mir meinen Wunsch gewährt, obwohl ich eigentlich noch zu jung war, um in den Kampf zu ziehen. Jedoch nur unter der Bedingung, dass ich nicht einen Augenblick von seiner Seite weichen würde.
Wir waren auf der Lichtung angelangt, und alles, was ich sah, war ein kleines, blondes Mädchen, dass völlig verängstigt und entsetzt neben den Leichen einer Frau und eines Mannes, augenscheinlich ihre Eltern, kniete, und ihrem nahen Tod in Gestalt meines Cousins ins Auge sah. Sie schrie nicht, sondern erwiderte kreidebleich den hungrigen, rotglühenden Blick, obwohl ihr Tränen der Trauer und der Angst über die Wangen flossen. Ich unterdrückte einen entsetzten Aufschrei. In jenem Moment sah ich mich dort kauern, und neben mir lagen die leblosen Körper meiner Eltern. Ich wusste genau, was jenes kleine Mädchen empfand. Und ich konnte nicht anders. Obschon mein Onkel noch kein Zeichen zum Angriff gegeben hatte, stürmte ich über die Lichtung auf das Mädchen zu. Ich riss Elenzar von ihr fort – woher ich die Kraft dazu nahm, kann ich bis heute nicht sagen. Es muss die Kraft der Verzweiflung gewesen sein. Und natürlich war der Moment der Überraschung auf meiner Seite.
Elenzar, bis zu diesem Augenblick völlig auf seine Beute fixiert, fauchte aufgebracht und bleckte die Zähne, als ich es wagte, mich zwischen ihn und das Mädchen zu drängen und sie mit meinem Körper vor ihm abzuschirmen. Seltsamerweise verspürte ich in jenem Moment jedoch keinerlei Furcht. Alles was zählte war das Leben des unschuldigen Mädchens. Ich zog das Schwert aus der Scheide und ging leicht in die Knie, ohne meinen Gegner auch nur einen Augenblick lang aus den Augen zu lassen. Ich beobachtet jede seiner Bewegungen. Roter Hass schlug mir aus seinen Augen entgegen, doch ich zuckte nicht einmal mit der Wimper. Ein leises Knurren ließ meinen Brustkorb erbeben, und Elenzar lachte leise.
„Glaubst du wirklich, du seist ein Gegner für mich, Kleiner? Geh mir aus dem Weg und lass mich mein Mahl beenden, dann werde ich mich um dich kümmern, wenn du so erpicht darauf bist, mit deinen Eltern vereint zu werden!“
Das leise Schluchzen des Mädchens in meinem Rücken schnitt mir einem Messer gleich ins Herz, und ich schüttelte entschieden den Kopf.
„Du wirst mich zuerst töten müssen!“, entgegnete ich entschlossen und umklammerte das Schwert in meinen Händen noch fester. Es war kein Breitschwert, dennoch war es für meine Arme noch zu schwer, als dass ich es mit einer Hand hätte führen können.
Elenzar zuckte die Achseln. „Wenn du darauf bestehst.... Aber weißt du, ich hatte eigentlich vor, noch ein wenig damit zu warten. Ich hätte nicht gedacht, dass Jaro es zulässt, dass du dich in Gefahr begibst, und da sagte ich mir, es wäre doch so viel besser, dich erst zu töten, wenn du weißt, wie schön das Leben sein kann. Wenn du weißt, was du verlierst.“ Mein Cousin musterte mich nachdenklich.
„Aber vielleicht verwunde ich dich auch nur. Und dann darfst du dabei zusehen, wie sie stirbt. Ganz langsam und qualvoll. Wie deine Mutter damals, kannst du dich noch erinnern?“
Ich erbleichte, und Elenzars Augen glühten vor Begeisterung. „Oh ja, du erinnerst dich!“, seufzte er. „Das war kein Anblick, den man so schnell wieder vergisst, oder?“
Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn, und mir wurde übel. Ich war wie erstarrt, und die Erinnerungen drohten, mich wieder einmal zu überwältigen. Er würde gewinnen, wie er bis jetzt immer gewonnen hatte. Ich war ein Narr gewesen, zu glauben, dass ich bereit war. Ich war es nicht.
Ich taumelte einen Schritt zurück, und dann noch einen. Die Schreie meiner Mutter klangen wieder in meinen Ohren, schrill, panisch, verzweifelt. Ich schauderte.
„Ray!“, drang da Jaros Stimme durch den Nebel der Vergangenheit zu mir durch. „Ray, Junge!“
Kräftige, warme Hände packten meine Schultern und schüttelten mich leicht. Wie betäubt blickte ich in die bekannten, gütigen Augen auf, die mich besorgt musterten.
„Wo ist er?“, fragte ich erstaunt. „Elenzar, wo ist er hin?“
„Er hat das Weite gesucht – unsere Überzahl war ihm zu groß. Ist mit dir alles in Ordnung, Junge? Hat er dich verletzt?“
„Nein“, murmelte ich leise.
„Was hast du dir nur dabei gedacht! Einfach so voran zu stürmen – er hätte dich töten können!“
„Das Mädchen! Ich wollte das Mädchen retten...“
Erschrocken wandte ich mich um – und da war sie. Sie schien sich die ganze Zeit keinen Deut von der Stelle gerührt zu haben. Wie erstarrt verharrte sie halb kniend, die linke Hand nach wie vor fest um die ihrer Mutter geschlossen.
„Kümmere dich um sie und bleib bei ihr, Ray. Ich muss Logan helfen, diese verdammte Horde in die Flucht zu schlagen“, meinte mein Onkel. Ich nickte nur, die Augen nach wie vor auf das Mädchen geheftet.
Ehe ich mich versah, kniete ich vor ihr nieder. Große, blaue Augen sahen zu mir auf, und dann legte sich eine kleine, kühle Kinderhand vertrauensvoll in meine. Ich schluckte, und eine kleine Ewigkeit sahen wir uns verblüfft an. Nur mühsam konnte ich mich von diesem erstaunlich direkten Blick lösen, der bis tief in mein Innerstes zu sehen schien.
Da gewahrte ich auf einmal, dass das Kind kurz davor war, zusammenzubrechen, und ich nahm sie vorsichtig und behutsam auf meine Arme. Sie legte die Arme um meinen Nacken und schmiegte sich eng an meine Brust, begann leise zu zittern und beruhigte sich wieder. Ihr Körper entspannte sich, wurde schwerer, der kleine Kopf barg sich Schutz suchend an meiner Schulter. Ich erstarrte, wie vom Donner gerührt. Auf einmal verspürte ich den übermächtigen Drang, dieses Mädchen, das so zerbrechlich und zart schien, vor allem Bösen auf dieser Welt zu bewahren. Meine Hände schlossen sich instinktiv fester um den schmalen Körper. Leise und beruhigend murmelte ich ihr tröstende Worte zu, und ihre Augen schlossen sich. Ihre Atemzüge wurden langsamer und regelmäßiger, und kurze Zeit später erschlaffte sie vollständig in meinen Armen – sie war eingeschlafen, doch ihre kleinen Fäuste waren nach wie vor fest in meinen Mantel gekrallt. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich es nicht über mich gebracht, diesen verzweifelten Griff zu lösen, mit dem sie sich am Leben festklammerte. Sie hatte soeben alles verloren. Ich war der einzige Halt, den sie hatte. Ich würde ihr das nicht nehmen. Ich wusste zu gut, wie sich Schmerz und Verlust anfühlten.
Eine kleine Weile stand ich so schweigend am Waldrand, das Mädchen in meinen Armen, und versuchte, meiner Gefühle Herr zu werden. Dieses kleine, unschuldige Wesen, das mir so vorbehaltlos vertraute, berührte mein Herz in einer Art und Weise, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Ich hatte mir geschworen, dass dies nie geschehen würde. Und dennoch war ich hilflos. Ich konnte das Kind nicht sterben lassen. Wenn ich ihm jetzt den Rücken kehrte, wäre sein Tod besiegelt.
Und so nahm ich an dem kurzen, heftigen Kampf, der auf der Lichtung tobte, nur als Beobachter teil, der Ausgang war ohnehin offensichtlich. Selbst der stärkste Kämpfer ist einer solch überwältigenden Überzahl nicht gewachsen. Wir hatten unsere Gegner überrascht, und obschon wir jeden Grund gehabt hätten, sie alle zu töten, um unsere eigenen Verluste zu rächen, taten wir das nie. Wir töteten nicht zum Vergnügen. Das war eine der Regeln, denen der ganze Clan folgte, auch wenn es dem einen oder anderen sichtlich schwer fiel. Wir töteten nur, um uns und andere zu verteidigen. Hätten wir uns der blinden, mächtigen Wut und dem Hass hingegeben, würden wir früher oder später zu dem werden, was wir zu bekämpfen suchten. Gründe für Hass und Wut gab es zur Genüge. Wir hatten bereits viele Verluste hinnehmen müssen, seit wir uns für diesen Weg entschieden hatten. Es gab nicht eine Familie, die nicht jemanden verloren hatte. Oh ja, wir alle wussten, was Schmerz ist. Doch der Schmerz verschwand nicht, wenn man Rache nahm. Das hatte uns die Vergangenheit gelehrt.
Wenig später war der Kampf auf der Lichtung vorüber; die Überlebenden hatten ihr Heil in der Flucht gesucht, dem feigen Beispiel Elenzars folgend. Jaro kam zu mir herüber. Nachdenklich blickte er auf das kleine Bündel in meinen Armen.
„Sie wird nie wieder sicher sein, bist du dir dessen bewusst?“ fragte er ruhig. „Elenzar ist entkommen, und er wird nicht eher ruhen, bis er sich für diese Niederlage hier rächen kann. Das Mädchen ist ein leichtes Opfer, und er hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, dich zu verletzen.“
Ich nickte. „Es tut mir leid, ich konnte nicht anders“, flüsterte ich.
Mein Onkel musterte erst mich, dann das kleine Mädchen in meinen Armen aufmerksam und schweigend. Schließlich nickte er ebenfalls.
„Willst du sie in unsere Familie aufnehmen? Sie annehmen an Kindes Statt?“, fragte er. Neugierde blitzte kurz in seinen Augen auf, doch ich sah auch die Güte, die genauso zu meinem Onkel gehörte wie die unglaublich intensive, grüne Augenfarbe. Ich wusste, dass er es ernst meinte. Nach dem Tod meines Vaters hatte er mich ohne das leiseste Zögern in seine Familie aufgenommen, sich um mich gekümmert, als sei ich einer seiner anderen Söhne. Es war nicht leicht gewesen, ich wusste, dass ich verstört und traumatisiert war, keine leichte Aufgabe, zumal Jaro zudem mit seiner neuen Bürde, die Stelle meines Vaters als Anführer des Clans zu übernehmen, zu kämpfen hatte. Doch er hatte mich das nie spüren lassen.
„Ich könnte sie ebenfalls aufnehmen, wenn die Verantwortung dir zu groß erscheint. Auf ein Kind mehr oder weniger kommt es wirklich nicht mehr an“, bot Jaro mir achselzuckend an, nachdem ich eine lange Weile geschwiegen hatte.
Ich schluckte. Widerstreitende Instinkte kämpften in mir. Einerseits wollte ich, dass das Mädchen sicher war. Die Menschen konnten sie nicht verteidigen, aber dennoch gehörte sie zu ihnen. Sie war ein Mensch, und es wäre falsch, sie zu zwingen, bei uns zu leben. Sie wäre immer ein wenig anders als alle anderen. Ich schüttelte langsam den Kopf. Nein, das würde ich dem kleinen Mädchen nicht antun. Nicht, nachdem sie heute ihre Familie verloren hatten. Wiederum wusste ich nur zu gut, wie sich dieser Schmerz anfühlte. Und wäre sie bei meinem Clan wirklich in Sicherheit? Wenn wir jederzeit mit einem Angriff der anderen Vampire rechnen mussten? Nein, entschied ich. Und vielleicht hatte sie ja heute nicht ihre gesamte Familie verloren...
„Ich werde sie zurück in das Dorf bringen. Ich folge ihrem Geruch und versuche herauszufinden, ob sie noch eine Familie hat, die auf sie Acht geben kann. Sollte dies der Fall sein, werde ich sie im Dorf lassen. Ich will nicht, dass sie heute ALLES verliert. Wenn sie keine Familie mehr hat, dann werde ich dich bitten, sie in den Clan aufzunehmen“, erklärte ich.
„Du bürdest dir große Verantwortung auf“, meinte Jaro, doch ich sah das gütige Lächeln in seinen Augen.
Ich wusste, worauf er anspielte. Ich würde das Mädchen nicht sich selbst überlassen können, nicht, nachdem Elenzar gesehen hatte, wie ich sie rettete. Das bedeutete, dass ich von nun an über sie würde wachen müssen, sollte sie überleben.
„Ich bin der Aufgabe durchaus gewachsen“, erklärte ich mit fester Stimme.
Würde ich nicht weiterhin auf sie Acht geben, dann würde sie leiden müssen. Unendlich leiden, um meinen Schmerz zu mehren. Das konnte ich nicht zulassen. Ich konnte mich nur zu gut erinnern, wie meine Mutter gelitten hatte. Ich war dabei gewesen. Carum – ich weigerte mich nach wie vor, ihn auch nur in meinen Gedanken Onkel zu nennen - hatte sehr daran gelegen, dass ich ihren Schmerz mitbekam. Sie war gestorben, irgendwann, nach endlosen Qualen, während derer ich verzweifelt an meinen Fesseln gezerrt hatte. Ich hatte sie nicht retten können. Und mein Vater war zu spät gekommen. Gerade noch rechtzeitig, um ihre letzten Atemzüge zu erleben. Sie war in seinen Armen gestorben, und ich wusste, mein Vater wäre ihr am Liebsten gefolgt. Doch es gab ja noch mich. Sie hatte ihm das Versprechen abgenommen, auf mich Acht zu geben. Ich hatte die Verzweiflung in seinen Augen gesehen.
Damals schwor ich mir, nie wieder jemanden so nahe an mich heranzulassen. Nie wollte ich den Schmerz erleben müssen, der meinen Vater so viele Jahre verfolgte. Letztlich hatte er seinen Tod regelrecht herbeigesehnt. Als ich zehn Sommer zählte war sein Wunsch dann in Erfüllung gegangen, und ich war zur Waise geworden.
Und so hatte ich das kleine Mädchen zurück in ihr Dorf gebracht. Ich hatte festgestellt, dass sie tatsächlich noch eine Familie hatte, die sich um sie kümmern konnte – einen Großvater und zwei Brüder, die für sie sorgen würden. Der Ältere der beiden Brüder teilte sich ein Zimmer mit ihr, und er schien vertrauenswürdig zu sein. Verlässlich. Er liebte sie, das konnte man sehen. Er würde sich gut um sie kümmern.
Natürlich konnte er sie nicht ausreichend schützen. Das war von nun an meine Aufgabe.
*****
Den ganzen Abend schon hatte ich das seltsame Gefühl gehabt, dass irgend etwas im Begriff war zu geschehen, dachte ich, als ich beobachtete, wie das letzte Licht des Tages nun allmählich verblasste. Ich war angespannt, und die Sorge um das Mädchen war auf einmal um einiges stärker als sonst. So seltsam es auch erschien, ich war mir auf einmal sicher, dass sie in Gefahr war. Unsinn, schalt ich mich in Gedanken. Ich war nur unruhig, weil sich der andere Vampirclan in letzter Zeit so ruhig verhalten hatte. Doch es gab keinerlei Hinweise, dass sich dies gerade heute ändern würde. Schon seit Tagen lag Spannung in der Luft. Wir alle spürten dies, es war die Ruhe vor dem Sturm. Doch warum sollte dieser gerade heute losbrechen? Es gab keinerlei Anzeichen dafür.
Ich würde mich vergewissern, dass sie in Sicherheit war, beruhigte ich mich. Ich würde außerhalb der Palisaden warten, bis die Nacht ihre langen Schatten gänzlich über das Land geworfen hatte, um dann in ihrem Schutze zu wachen.
Ich war schon auf halbem Weg, als ich auf einmal in der Entfernung Schreie vernahm. Menschliche Schreie. Weibliche. Ich kannte diese Stimme!
`Nein!´, stöhnte ich innerlich auf. Und nun flog der Boden regelrecht unter meinen Füßen dahin. Ich hoffte inständig, mich geirrt zu haben, doch die Stimme, die auf die Hilfeschreie antwortete, war mir ebenfalls sehr gut bekannt.
Elenzar! Wie lange würde er mit ihr spielen, bevor er sie tötete? Ich kannte ihn gut, ich wusste, wie er tötete. Wie er seine Opfer quälte. Mir wurde übel, als ich mir das zarte, zerbrechliche Mädchen in seinen Fängen vorstellte. Erinnerungen stiegen auf, Erinnerungen, die ich so sehr zu verdrängen suchte – meine Mutter, blutend, sterbend, dieses verzweifelte Schluchzen, das mich noch immer in meinen Albträumen verfolgte – mit Gewalt rang ich die Bilder nieder. Wie lange würde er sie quälen, bevor ihn seine Blutlust überwältigte? Würde dies mir genug Zeit lassen, um sie zu finden? Wann würden die Verletzungen, die er ihr zufügte, so schlimm sein, dass sie daran starb, auch wenn es mir gelang, sie in Sicherheit zu bringen?
Was hatte sie überhaupt hier draußen im Wald zu suchen, so kurz nach Einbruch der Dunkelheit?! War sie verrückt? Alle Menschen fürchteten sich – völlig zu recht – vor den Vampiren, die den Wald des Nachts beherrschten. Warum musste sie ihr Schicksal derart herausfordern? Hatte sie keinerlei Instinkte? Ich fluchte und schimpfte leise vor mich hin, doch die Verzweiflung gewann rasch die Oberhand. Was, wenn ich zu spät kam? Wenn ich sie dieses Mal nicht mehr retten konnte? Wie oft ließ sich das Schicksal zum Narren halten? Ich verbot mir diese Gedanken, sie waren zu schmerzhaft. Statt dessen konzentrierte ich mich darauf, sie zu finden. Rechtzeitig.
3. Der Fremde
Caitlin
Ich bin nach wie vor überzeugt, dass mein Herz stehen blieb, als sich plötzlich eine warme, starke Hand auf meinen Mund legte, während sich ein anderer Arm fest um meine Taille schloss. Im nächsten Augenblick wurde ich zur Seite gerissen, und dann raste der Waldboden unter meinen Füßen dahin, während ich vor Angst regelrecht gelähmt war. Der Vampir rannte mit mir auf den Armen so schnell durch den Wald, dass ich nicht hätte sagen können, ob seine Füße die Erde überhaupt berührten. Ich starrte wie gebannt auf den Boden, der so schnell unter mir hinweghuschte, dass alles zu einem schwarzen Band verschwamm.
Mir wurde übel, als ich daran dachte, was nun folgen würde. Er würde mich aussaugen, so wie es diese verdammten Vampire immer taten. Wie sie es damals mit meinen Eltern gemacht hatten. Ich konnte mich noch so gut an das langsame, feuchte, saugende Geräusch erinnern, mit dem sie erst meinem Vater und dann meiner Mutter das Leben genommen hatten. An die erst entsetzten, dann gequälten Schreie meiner Mutter, die mich unter ihren Röcken versteckt hatte, in der verzweifelten Hoffnung, die Vampire würden mich übersehen und nur sie töten. Eine unsinnige Hoffnung, bedachte man, dass ein Vampir einen Menschen auf mehrere hundert Schritte weit riechen konnte. Wir waren die Beute, sie die Jäger. Natürlich waren sie uns weit überlegen. Und sie hätten mich an diesem Tag sicherlich getötet – wäre nicht mein unbekannter Retter gewesen. Ich fragte mich oft, wer es wohl war, dem ich mein Leben zu verdanken hatte. Was ihn wohl veranlasst hatte, so zu handeln. Und wie es ihm gelungen war, sich gegen den Vampir zu stellen.
Ich hätte schon vor so langer Zeit sterben sollen, doch ich hatte wie durch ein Wunder überlebt. Das Schicksal ließ sich wohl nicht zum Narren halten, und so war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es zurückforderte, was ihm vorenthalten worden war. Es sah ganz so aus, als ob heute dieser Tag wäre. Ich fühlte mich wie in einen meiner Träume versetzt. Fast jede Nacht erlebte ich den Tag, an dem ich meine Eltern verloren hatte, wieder und wieder. Jetzt war der Traum Wirklichkeit geworden. Meine Zeit war endgültig abgelaufen, das Spiel vorbei. Ich hatte gewusst, dass ich ihm nicht entkommen würde, als ich mich umgewandt hatte und gerannt war. Warum war ich auch so töricht gewesen und hatte mich so weit vom Dorf entfernt? Warum nur hatte ich nicht auf meine innere Stimme gehört, die mir eindringlich zugeflüsterte hatte, dass ich mich in Gefahr begab? Doch jetzt war es zu spät, mir deswegen Vorwürfe zu machen. Ich würde für meinen Fehler bezahlen.
Eine endlose Zeit fühlte ich nur den eisigen Hauch des Windes, der mir durch das Haar fuhr, als wir durch die Nacht zu fliegen schienen, und die kräftigen Arme, die mich hielten. Warum hatte er seinen Worten noch keine Taten folgen lassen, wunderte ich mich. Warum brachte er mich nicht einfach um? Wohin brachte er mich jetzt? Ein schrecklicher Verdacht stieg in mir auf. Wollte er mich an einen Ort bringen, an dem er mich ungestört foltern konnte? An dem er meinen Tod - bis zum letzten Tropfen - auskosten konnte? Vielleicht liebte er es, seine Opfer langsam zu töten. Vielleicht schmeckte mein Blut tatsächlich süßer, wenn ich Qualen litt.
Ich wusste, wie es sich anhörte, wenn ein Mensch Qualen litt. Ich war einmal Zeuge gewesen, als Richter Brans Männer einen der Verlorenen hingerichtet hatten. Zuerst hatten sie ihn ein wenig erhangen, bis er gerade noch so lebte. Das schreckliche Würgen und die bläuliche Farbe, die sein Gesicht nach und nach angenommen hatte! Und dann hatten sie ihn auf die Streckbank gelegt und langsam auseinander gerissen. Als wäre es gestern gewesen, hörte ich das ekelerregende Knirschen, mit dem seine Schultergelenke aus der Fassung gesprungen waren, noch immer in meinen Ohren klingen. Und den beinahe unmenschlichen, schrillen Schrei, den er in den letzten Augenblicken seines Lebens ausstieß, kurz bevor er vor Schmerzen das Bewusstsein verloren hatte...was musste er gelitten haben! Ob es mir heute wohl ähnlich ergehen würde? Ob das letzte, was diese Welt von mir vernahm, auch so ein entsetzlicher, durchdringender Schrei sein würde?
Auf einmal fiel da die Erstarrung von mir ab, und ich versuchte fieberhaft, mich zur Wehr zu setzen. Ich wusste, dass ich keine Chance gegen ihn hatte, doch ich kämpfte mit dem Mut der Verzweiflung. Er hatte seine Arme fest um mich geschlungen und drückte mir dadurch die Arme an den Oberkörper, so dass es mir nicht möglich war, freizukommen oder mich auch nur ein klein wenig zu bewegen. Ich versuchte zu schreien, doch der Laut wurde durch die Hand über meinem Mund zu einem unbestimmten Murmeln abgedämpft. Versuchsweise schnappte ich mit meinen Zähnen nach ihr, und tatsächlich gelang es mir, die Schneidezähne in einem seiner Finger zu versenken. Ich hörte ein überraschtes, ersticktes Aufkeuchen, und ich gewahrte, wie er leicht zusammenzuckte, doch die Hand bewegte sich keinen Deut von der Stelle.
„Verdammt, halt still! Er ist uns noch immer dicht auf den Fersen!“, raunte mir eine sanfte, tiefe Stimme beschwörend ins Ohr. „Und ich warne dich: wenn du noch einmal versuchst, mich zu beißen, drücke ich noch fester zu, und das wird nicht sehr angenehm für dich sein!“, fügte sie in drohendem Tonfall hinzu.
Ich keuchte überrascht auf. Das war nicht die Stimme des Vampirs, der mich verfolgt hatte! Einem Donnerschlag gleich hallte die Erkenntnis in mir wieder. Ich kannte diese Stimme! Es war lange her, dass ich sie zuletzt vernommen hatte, und ich konnte mich auch nicht mehr entsinnen, wem sie gehörte, doch sie vermittelte mir ein unglaublich starkes Gefühl der Sicherheit. Zögernd entspannte ich mich und vertraute mich dem Unbekannten an, der mir gerade das Leben rettete. Zumindest hoffte ich das. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass es mein Los verbesserte, wenn ich mich in seinen Händen statt in denen Elenzars befand.
Ich vernahm ein wütendes, bedrohliches Knurren in unserem Rücken und begriff, dass der rotäugige Vampir uns nach wie vor verfolgte. Wir schienen jetzt nur so durch den stockfinsteren Wald zu fliegen; die kalte Nachtluft schlug mir wie ein eisiger Windstoß entgegen. Schon bald wich jedwedes Gefühl aus meinem Gesicht. Der Atem stach spitzen Nadel gleich in meiner Lunge. Hin und wieder erhaschte ich durch die bereits herbstlich kahlen Äste der Bäume einen Blick auf den Mond, der sichelförmig über dem Horizont erschienen war, ansonsten umgab mich tiefste Schwärze. Bald war mir, als habe ich die Fähigkeit zu sehen endgültig verloren. Es war ein beunruhigendes Gefühl. Noch beunruhigender war das zornige Zischen unseres Verfolgers dicht hinter uns – so dicht, dass ich schon glaubte, seinen feuchten Atem in meinem Nacken zu fühlen. Ein leiser Schauer rann durch mich hindurch, und mein Retter schien dies zu spüren. Die Arme, die mich hielten, schlossen sich noch ein wenig fester um mich.
„Ganz ruhig“, murmelte er mir beruhigend zu. „Wir haben fast das Dorf erreicht. Bald bist du in Sicherheit. Dir wird nichts geschehen.“ Und seltsamerweise glaubte ich ihm.
Nach einer Zeit, die mir sehr lang erschien, fühlte ich endlich wieder festen Boden unter meinen Füßen. Taumelnd kämpfte ich um mein Gleichgewicht und stützte mich schwer auf den Arm, der mir augenblicklich zu Hilfe kam. Als die schwarzen Schleier schwanden, die mir die Sicht genommen hatten, blickte ich auf – und gewahrte, dass wir uns bereits im Dorf befanden! Unbemerkt, lautlos und ohne die geringste Anstrengung hatten wir die Palisaden überquert! Und ich hatte immer so sehr auf die Sicherheit hinter dem hölzernen Bollwerk vertraut!
Dann erinnerte ich mich wieder meines geheimnisvollen Retters, der schweigend vor mir stand. Ich fühlte seinen nachdenklichen Blick auf mir ruhen. Scheu sah ich zu ihm auf - und mir stockte der Atem. Ich sah in ein Paar warme Augen, deren Farbe ich im spärlichen Licht des Mondes nicht so recht zu erkennen vermochte – rot waren sie jedoch nicht, dessen war ich mir gewiss. Ihnen fehlte der eiskalte, entrückte Glanz, der den Augen der anderen Vampire inne gewohnt hatte. Ganz im Gegenteil schienen die seinen von einer außergewöhnlichen Tiefe zu sein, die dem zufälligen Betrachter verborgen blieb. Ich war jedoch kein zufälliger Betrachter. Ich glaubte, so etwas wie Verlorenheit und tiefe Trauer in ihnen zu lesen – Gefühle, die mir nicht fremd waren. Vermutlich erschienen sie mir deswegen so offensichtlich.
Die Augen, die mich so gefesselt hatten, lagen in einem ebenmäßigen Gesicht, das von rabenschwarzem, dichten Haar umrahmt wurde. Es fiel ihm leicht in die Stirn, was ihm ein beinahe jugendliches Aussehen verlieh – obwohl ich vermutete, dass er doch ein paar Sommer älter war als ich.
Vor mir stand ein Vampir, ohne jeden Zweifel, seine Kraft und seine Schnelligkeit hatten ihn verraten. Ich wusste, dass Vampire gefährlich waren. Tödlich. Ich hatte es selbst erleben müssen. Und dennoch empfand ich seltsamerweise keine Angst. Er war mir irgendwie .... vertraut. Als würde ich ihn irgendwoher kennen...
Ich muss ihn viele Augenblicke lang sprachlos und wie gebannt angestarrt haben, und er schien mich nicht minder intensiv zu betrachten. Nicht wie der andere Vampir, nicht wie ein Jäger seine Beute. Er musterte mich neugierig und...beinahe liebevoll? Er fing sich jedoch schnell wieder, und ein leises Lächeln huschte über seine Lippen, bevor seine Miene wieder sehr ernst wurde.
„Geht es dir gut?“, erkundigte er sich schließlich leise.
Ich nickte wortlos, ich hatte meine Stimme noch immer nicht so weit unter Kontrolle, dass ich auch nur einen Ton über meine Lippen hätte bringen können. Der Schreck saß mir noch in den Gliedern.
„Das war ganz schön knapp. Bist du des Lebens schon so müde, dass du bewusst den Tod suchst?“ Er sprach immer noch sehr leise, doch ich hörte den Vorwurf deutlich heraus. Mühsam riss ich mich zusammen.
„Ich habe mich verirrt“, erklärte ich mit unsicherer, zitternder Stimme.
Die vollen Lippen verzogen sich ungläubig und missbilligend, und seine breiten, dunklen Augenbrauen zogen sich wie die Schwingen eines Raben über den ausdrucksstarken Augen zusammen.
„Wie dem auch sei, es wird in Zukunft nicht mehr vorkommen, dass du alleine in der Dunkelheit durch den Wald streifst!“, stellte er schon beinahe beiläufig fest. So, als habe ich in dieser Hinsicht nichts zu sagen, und als wäre es alleine an ihm, über mein Tun und Lassen zu bestimmen. Unwillkürlich richtete ich mich ein wenig auf. Er mochte recht haben - ich wusste selbst, dass ich einen Fehler begangen hatte, und ich gedachte nicht, ihn zu wiederholen. Dennoch regte sich leiser Widerstand in mir. Doch aus Erfahrung wusste ich, dass es nicht ratsam war, dem nachzugeben und einem Mann zu widersprechen. Zudem einem, den ich nur so flüchtig kannte und der augenscheinlich um einiges stärker war als ich selbst.
„Und jetzt solltest du rasch hineingehen!“, drängte der Fremde und nickte mit dem Kopf in Richtung des Hauses, das ich zusammen mit meinem Großvater und zwei meiner Brüder bewohnte. Wir standen nur wenige Schritte weiter die Straße hinunter, verborgen in den Schatten des Nachbarhauses, einen Steinwurf von unserer Haustüre entfernt. Ich sah einen schwachen Lichtschimmer unter der schweren Eichentüre hindurch dringen, und aus dem Kamin drangen kleine Rauchwolken, die sich hell gegen den dunklen, sternenklaren Himmel abhoben und im Wind verwehten. Woher hatte er nur gewusst, wohin er mich bringen musste, fragte ich mich. Er hatte kaum ein Wort mit mir gewechselt, und ich hatte ihm den Weg nicht gewiesen. Hatte er meinen Geruch verfolgt? Es wäre eine mögliche Erklärung...
„Die Tore sind schon lange geschlossen. Deine Familie wird in großer Sorge um dich sein. Bete, dass sie noch nicht die Wachen auf dein Verschwinden aufmerksam gemacht haben!“, fuhr der Fremde fort und riss mich damit abrupt wieder in die Gegenwart zurück. Ich erschrak. Bis zu diesem Augenblick war ich zu erleichtert gewesen, dass ich tatsächlich überlebt hatte, um mir der Gefahr bewusst zu sein, in der ich nach wie vor schwebte. Ein Dorfbewohner, der die Tore nicht vor Einbruch der Dunkelheit erreichte, wurde zu den Verlorenen gezählt. Einem Verlorenen war es auf ewig verwehrt, das Dorf erneut zu betreten. Tat er es dennoch, war er des Todes. Es wurde angenommen, dass jene Menschen entweder den Vampiren zum Opfer gefallen waren oder sich mit ihnen verbündet hatten. Ich fragte mich, woher mein Retter all dies wohl wusste. Nichts als Fragen, und keine Antworten. Der Fremde war ein einziges Mysterium. Doch ich hatte jetzt keine Zeit, lange darüber nachzusinnen. Ich musste so schnell wie möglich nach Hause.
Rasch sah ich wieder zu ihm auf. „Werde ich dich wiedersehen?“ fragte ich leise. Ich wollte mich noch nicht von ihm trennen. Er hatte mein Leben gerettet, und ich fühlte mich ihm so nah. Mich jetzt von ihm verabschieden zu müssen ohne ihn jemals wiederzusehen – der Gedanke schmerzte. Ich kannte noch nicht einmal seinen Namen!
Er sah mich nachdenklich an. Ich konnte seinen Blick nicht recht deuten. Sich widersprechende Gefühlsregungen spiegelten sich für einen kurzen Moment in den dunklen Augen wieder, doch es geschah zu schnell, als dass ich sie hätte benennen können. Dann streckte er langsam den Arm aus und strich mir sanft mit dem Handrücken über die Wange. Die Wärme seiner Haut schien bis auf meine Knochen zu dringen, und sie entzündete ein kleines Feuer in meinem Herzen.
„Ich sollte dies nicht tun“, flüsterte er. „Aber ich werde da sein. Du wirst schon sehen.“ Im nächsten Augenblick war er verschwunden.
Fassungslos sah ich ihm hinterher – oder zumindest in die Richtung, in die er meiner Meinung nach verschwunden war. Auf einmal fühlte ich mich sehr einsam und sehr schutzlos.
(c) by Schneeflocke