Fantasy & Horror
MYRA - Die Runenrolle - Szenen und Geschichten von der Welt der Waben
Kategorie Fantasy & Horror
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Myra-Definition: Was ist, was will das Projekt Myra? "Das Projekt MYRA hat zum Ziel, eine eigene Welt der Fantasy namens Myra mit beliebig vielen Menschen über beliebig viele Jahre hinweg in allen Aspekten zu entwickeln, zu simulieren und zu beschreiben. Rollenspielabenteuer in Myra gehören ebenso dazu wie gesellige Treffen in Gewandung, das Brettspiel "Wabenwelt" oder Geschichtenprojekte. Ein Teil dieses Projektes ist die Simulation der ...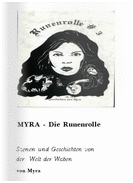
MYRA - Die Runenrolle - Szenen und Geschichten von der Welt der Waben
Beschreibung
Die Runenrolle ist das Storyzine des VFM e.V. - auch du bist herzlich eingeladen, deine Fantasy-Geschichten auf Myra anzusiedeln und damit bei uns zu veröffentlichen wo sie für alle Zeit erhalten bleiben und Teil einer ganzen seit über 25 Jahren bestehenden Welt werden.
BURUNDIÄNGSTE 2 - (Karcanon, ca. 414 n.P.)
Burundiängste, zweite Geschichte
Mit einem gewaltigen Satz sprang er auf die drei Reiter zu. Er brüllte derart unmenschlich, daß deren Pferde sofort scheuten. Höhnisch lachend schwang er sein Krummschwert einmal um sich herum und genoß den Blutregen, welcher sich nun aus den aufgeschlitzten Leibern der Pferde und ihrer Reiter über ihn ergoß. Einem der Reiter riß er einen Arm ab und biß hinein. Der Geruch frischen Blutes betäubte ihn fast, als er plötzlich von einem Pferd von hinten schwer getreten wurde. Er stürzte und verlor sein Schwert aus der Hand. Dem Reiter, welcher ihn niedergeritten hatte, sank gänzlich der Mut, als er die Bestie, blutverschmiert, blau gezeichnet und sich im dampfenden Blut seiner Kameraden wälzend, das Bein eines seiner Mitstreiter zur Abwehr schwingen sah, wobei sie immer noch fürchterlich brüllte. Hinter ihm galoppierte ein neuer Kämpfer heran, der, mutiger als der erste, wohl weil er ein deutliches älter war, eine gewaltige Lanze auf den zu Boden liegenden Burundi richtete, mit dem festen Willen, gleich was auch geschehe, die Lanze tief in den Leib der Bestie zu rammen. Unmöglich für das grausame Tier zu entkommen!
Der Burundi sah den Tod auf sich zukommen und glaubte schon die Spitze der Lanze in seinen Gedärmen zu spüren. Doch noch hatte der Reiter ihn nicht erreicht. Mit der Linken fuhr er suchend über den Boden. Durch Matsch, Blut und Fleisch. Und er versuchte verzweifelt sein Schwert zu greifen. Sein Bestreben dem nahen Tod zu entgehen entsprang jedoch nicht einer verständlichen Todesangst, wie der Bakanasanische Reiter mit der Lanze glaubte, sondern der „nüchternen“ Überlegung, daß sein Tod es ihm nicht mehr erlauben würde, sich weiter im Blut gefallener zu suhlen und sich mit deren rohen Fleisch den Magen vollzuschlagen.
In dem Moment, als die Lanze in ihn eindrang - der Schmerz war gar nicht so groß, wie er erwartet hatte, also hatte die Göttin Recht behalten, als sie solches ihm und seinen Gefährten weissagte - im selben Augenblick geschahen mehrere Dinge. Er fand sein Schwert und um ihm herum wurde es dunkel und schrecklich kalt. Den Reiter mit der Lanze konnte er jedoch weiterhin deutlich sehen. Ihm schien es ähnlich zu gehen, verwirrt zog er an den Zügeln seines Reittieres. Das Pferd bäumte sich auf und der Hieb des Burundi zerfetzte Bauch und Eingeweide des Tieres, das sich überschlug und seinen Reiter unter sich begrub. Mit einem zweiten Hieb trennte der Burundi den Kopf des Bakanasaniers ab, bevor er ohnmöchtig wurde.
Als er wieder zu sich kam, fror er immer noch und da das Blut in welchem er lag noch immer warm war, schloß er, nicht allzu lange ohne Bewußtsein gewesen zu sein. Sein Blut? Das Blut des Menschen? Die Lanze an die er sich noch erinnerte, war nicht mehr in seinem Körper. Überrascht wollte er sich erheben, doch ein fürchterlicher Schmerz zwang ihn liegen zu bleiben. Da sah er das Etwas.
„Hihihi!“
Es war über das aufgebrochene Reittier gebeugt und tat sich an dessen Innereien gütig.
„Auch wenn ich Dir den Splitter herauszog, das Loch dort bleibt noch eine Weile. Du wirst gut daran tun, Dich nächste Zeit etwas vorsichtiger zu bewegen und auf zu passen, wen Du in Deine Nähe läßt!“
Zornig wollte sich der Burundi wieder erheben und auf das so kleine Ding stürzen, doch es war ihm des Schmerzes wegen unmöglich, sich weit genug aufzurichten.
„Hihihi! Kannst Du nicht hören? Ist es wahr, das Ihr doch nur Tiere seid? Verstehst Du mich nicht? Hihihi!“
Das Etwas war nicht einmal ein Viertel so groß, wie ein Burundikrieger. Aber das Wesen war über und über mit den blauen Opfernarben der Burundis geschmückt. Und der Burundi konnte sogar sehen, was, welche Verhöhnung, auf dem Arsch des Etwas tätowiert war: Es war exakt die Zeichnung, welche ihm die Harpye zu Beginn des Kriegerrituals gewidmet hatte, niemand durfte diese Zeichen außer ihm selbst tragen, und schon gar nicht an solch einer Stelle! Er wollte nach seinem Krummschwert greifen, doch ein irrsinniger Schmerz, genau an der Stelle, wo ihn die Lanze getroffen hatte, ließ ihn sich krümmen und winden. Es war ihm unmöglich das Schwert in die Hand zu nehmen.
„Hihihi, willst Du nicht begreifen? Dumm, wie ein Esel und blöd, wie ein Schwein. Hmm, Schweine sind gar nicht so blöde, habe ich wohl etwas verwechselt. Ach das hier? Nette Zeichnung, macht sich doch prima, oder?“ Das Etwas beobachtete den Burundi eine Weile, griff dann nach einem Stück Darm des Pferdes und schlürfte es aus. „Was ist? Hast Du kalt? Oder ist das gar Wundfieber? Das sieht aber nicht sehr gut aus...“
Der Burundikrieger zitterte und schwitzte, und jeder Versuch sich zu erheben oder sein Schwert zu greifen, endete in einem Bad höllischer Schmerzen. Auch ließ seine Kraft langsam nach.
„Nein, mach’ Dir mal keine Sorgen, Du wirst nicht sterben, nicht ehe Deine Göttin erfahren hat, daß Du Dich feige vor einem Kampf gedrückt hast. Was meinst Du, wie dort drüben“, es deutete hinaus in das tiefe Schwarz, „der Kampf wohl ausgehen wird?“
Das Etwas griff sich mit erstaunlicher Kraft das riesige Krummschwert und stach es mit dem Griff voran in die Erde, genau zwischen die Beine des Kriegers. Nun nahm es den Kopf des Bakanasanischen Reiters und spießte ihn auf die Spitze des Schwertes.
„Tja, ich muß Dich nun verlassen, ich habe noch etwas Arbeit zu erledigen, aber laß Dir sagen, Du bist recht nett, ein angenehmer Zeitgenosse, wie man so sagt. Ich habe rechten Spaß mit Dir gehabt. Man sieht sich! ... Vielleicht!“
Das kleine Ding verschwand ganz plötzlich und es wurde nochmal kälter. Der Krieger schwitzte und fror gleichzeitig. Mit den Beinen versuchte er den Kopf vom Schwert zu stoßen, doch vergebens, der Schmerz war beinahe unendlich groß und nur zu ertragen, wenn er ganz ruhig lag. Selbst dann raubte er ihm fast den Verstand. So verging die Zeit und es war eine lange Zeit!
Inzwischen saß der junge Bakanasanische Held immer noch bleich auf seinem Pferd und starrte verständnislos auf die Leichen dreier Krieger vor den Hufen seines Pferdes. Da war doch ein Burundi gewesen? Und sein Kamerad, welcher mit einer Lanze auf das Tier geritten war... Einbildung? Illusion eines Geistes? Eine Magie der grausamen Göttin? Ihm war, als wäre es deutlich kälter geworden. Weg hier, bloß weg von hier, dieser Ort war verflucht! Und er ritt ziellos davon, so, als säße Pottundy persönlich ihm in Nacken.
SELERION - (Cyrianor, 423-424 n.P.)
Selerion
Elanthir hatte lange „geschlafen“. Eigentlich war er gewandert, nur sein Körper hatte geschlafen. Er hatte viel gesehen, viel erlebt, viele Wesen getroffen. Nun lag er nackt auf seinem großen Bett und machte sich langsam wieder mit seinem körperlichen Dasein vertraut. Die Zeit der Ruhe war vorbei, er wurde gebraucht. Auf Cyrianor würde sich vieles verändern, und seine Aufgabe würde es sein, Selerion durch die Wirren einer neuen Zeit zu leiten. Ein weißes Gewand lag bereit für ihn, und ein Glas mit kühlem Quellwasser stand neben dem Bett. Als er kurz darauf, noch etwas schwach, durch die Tür schritt, ließ ihn ein verhaltener Schrei und polternder Lärm zusammenfahren. Mit großen Augen stand eine junge Frau vor ihm, die offensichtlich eben noch eine Platte mit Brot und Käse in ihren Händen gehalten hatte.
„Schade drum.“ sagte er noch etwas heißer, und „Wer seid Ihr, und wo ist Lea?“. „Lea ist tot. Ich bin Minira, ihre Tochter.“ Elanthir hob die Augenbrauen und schaute sich um. „Ihr seid groß geworden.“ Er trat ans offene Fenster. Eine leichte Brise vom Meer bewegte sein langes, weißes Haar. Er atmete tief durch, lief seinen Blick über die See und das grüne Land schweifen. Mirina trat vorsichtig hinter ihn. „Ich habe geträumt, dass Ihr erwacht, Herr.“ „Natürlich hast Du das. Du bist ihre Tochter.“ Er schloss die Augen, konzentrierte sich, hob die Hände über den Kopf, die Handflächen aneinandergepresst – und ließ sie wieder sinken. Er seufzte als er sich umdrehte und sie anschaute: „Wir werden ganz von vorn anfangen müssen.“ Sie nickte, mit glänzenden Augen. „Reiter stehen bereit...“ „Gut. Sehr gut. Sie sollen satteln und sich in einer halben Stunde auf dem Platz versammeln. Nun lasst mich etwas essen.“
Als Elanthir wenig später auf die Freitreppe trat, standen auf dem Burghof unter ihm 20 Reiter mit ihren Pferden – dicht umdrängt von Hunderten Menschen. Er blickte in Gesichter, die Erstaunen, Freude und Hoffnung ausdrückten. Seine Haare und sein Gewand wehten leicht im Wind, die Morgensonne war warm. Die fast unwirkliche Stille wurde nur durch die Rufe einiger Möwen unterbrochen. Plötzlich erfüllte ein Rascheln und Klirren die Luft, als die Menschen auf dem Platz in die Knie gingen. Mit einer fast ungeduldigen Handbewegung hieß er sie aufstehen. Als er zu sprechen begann, war seine Stimme tief und voll. Selbst die Möwen schienen zu schweigen. „
Cyrianor ist erwacht! Und ich bin zurückgekehrt, um mit Euch gemeinsam Selerion auferstehen zu lassen!“ Die Menschen begannen zu jubeln. „Diese Reiter hier werden nun ausreiten und die Kunde in die Lande tragen, und auch jeder Einzelne hier soll in seinem Rahmen dazu beitragen. Unser Volk in den Provinzen soll wissen, dass die alte Ordnung wiederhergestellt wird. In zehn Tagen wird eine Waffenschau gehalten, denn wir werden zügig unsere Grenzen sichern müssen, so lange wir nicht wissen, wer die Herrschaft über die benachbarten Ländereien übernommen hat. Der Anfang mag schwer werden, doch wenn wir alle mit anpacken, wird Selerion schon bald im alten Glanz erstrahlen! Feiert heute den Neubeginn, und morgen geht an Eure Arbeit. So nichtig sie dem Einzelnen erscheinen mag, so wertvoll ist sie für unsere Gemeinschaft. Lang lebe Selerion!“
Er schaute einen Moment versonnend lächelnd auf die jubelnden Menschen, bevor er sich umdrehte, und sich auf den Weg in den Turm machte. Er hatte viel zu tun.
GEDANKENSPIELE - (Corigani, ca. 420 n.P.)
Gedankenspiele
Quelle: ANRASH
Vollmundig und ruhig erklang die Stimme des Redners auf dem Podium durch die geräumige Versammlungs- und Audienzhalle des Großen Beckens. Im Halbrund vor ihm sitzend der wißbegierige, naseweise und ungestüme neue Jahrgang der Akolythen seines Mentors.
Interessiert musterte er die Anwesenden, welche ungeduldig der Dinge harrend zu ihm aufschauten. Angenehm fiel ihm auf, daß erstmals nicht nur Okeazar aus den Kriegerkasten zu ihm in den Tempel gesandt wurden - nein, auch Kinder der See von allen Weltmeeren hatten sich eingestellt. Und was ihn am meisten erfreute - erstmals, nach vielen Jahrzehnten der Wirrnis, waren auch Menschen wieder unter ihnen. War dies nicht ein gutes Omen und der beste Weg, um den Landbewohnern die Lebensweise und Gedankenwelt der Kinder der See zu vermitteln? Und... ja, er irrte sich nicht, sah er nicht auch einen niederen Wasserdämon unter den Lernbegierigen sitzen? Welch interessante Konstellation: Ein Dämon als ausgebildeter Priester und Streiter seines Herrn!? Wie amüsant!
Hatte ER es doch wieder einmal verstanden ihn zu überraschen. Er besann sich der auf ihn gerichteten Augenpaare und begann wieder mit seiner Vorlesung: „I nmitten des unendlichen Universums mit all seinen Gestirnen zieht die Welt Myra unermüdlich ihre Bahnen um das immerwährende lebenspendende Licht der Weltensonne. Eine Welt voller Gegensätze und Lebewesen und trotz oder gerade wegen dieser Vielschichtigkeit lebenswert. Unterteilt durch die Macht und Doktrin des Lichtboten in unterschiedliche Bereiche des Wirkens. Bewahrt unter der schützenden Hand der erwählten Hüter und behütet durch den allgegenwärtigen Pantheon dieser Welt. Im Machairas der Welt befindet sich Ysatinga - ein Bereich unter vielen, ein Teil des Ganzen und doch irgendwie - anders. Aktionen jeder Art bewirken Reaktionen - die Waagschale des Gleichgewichts neigt sich zur Seite - der Hüter beobachtet dies mit ernstem Blick und der Pantheon erwacht.
Die Lebewesen auf allen Teilen Myra´s schöpfen ihre tägliche Kraft zum Leben aus ihrer Arbeit, ihrem mühsam erworbenen Wissen, ihrer ihnen aufgetragenen Tradition oder übernommenen Verantwortung, aus der Liebe ihrer Nächsten und aus ihrem Glauben zu ihren Göttern. Götter? Was ist ein Gott und was stellt Er oder Sie dar? Eine der wenigen nicht greif- und erklärbaren Wesenheiten dieser Welt? Schenkt man den Priestern dieser Entitäten Glauben so sind diese sehr real und von dieser Welt. Myra, so scheint es, ist den Göttern weit näher als andere Welten. Ist diese Welt vorstellbar ohne die Anwesenheit von Göttern? Was wäre diese Welt ohne ihr Wirken? Doch was ist ein Gott? Eine Existenzform frei von Ansprüchen und Äußerem? Einem jedem selbst ist es überlassen sich sein Bild von seinem Gott zu machen - sofern ihm die Priester diese Arbeit nicht abnehmen oder dies zumindest versuchen. Nutze ein jeder seine ureigene Imagination. Ein Jeder hat Ohren zum hören und Augen zum sehen!
Wünsche und Verwünschungen, Gebete und Bittgesuche, Weheklagen und Opfer - all dieser Aufwand für des Menschen eigener Gott. Er nährt sich von des Menschen Tun und formt sich nach deren Vorstellungen. Gebraucht von den seelisch Schwachen, benutzt von den Herrschenden der Länder und von den Priestern, welche sich in dem Licht ihres Gottes suhlen. Wann begreift der Mensch, daß er selbst die Verantwortung auf seinen Schultern trägt für seine Gedanken und Taten?
Vergißt er etwa, gefordert durch das tägliche Leben und Überleben, welchen Einfluß er auf die Waagschale des Pantheon auszuüben vermag? Oder weiß er es etwa nicht oder vermag er nicht die Wechselwirkung zu beurteilen? Ist dies überhaupt sinnvoll oder gar erwünscht? Hat nicht der Bauer sein Feld zu pflügen und der Wächter die Sicherheit seines Herrn zu gewährleisten? Ist es nicht die Aufgabe der Priester ihren Gott zu verstehen und seine Gebote dem abergläubischen Volk näherzubringen?
Einundzwanzig ist die Zahl dieser Welt. Dargestellt und repräsentiert auch durch das Wirken der Entitäten. Festgelegt vor Jahrtausenden in den Ewigen Kristallen des Pantheon. Unter Ihnen weilt auch ER, dessen Lebensweg in die Geschichte Myras einging. ER ist der Sohn des Norto und Tondurs, der Denaide. Gezeugt - ohne Wissen des Norto - durch die Einwirkung eines Zaubers der Göttermutter, festgelegt in den Fäden des Schicksals. Geschrieben im Mythos der Tondur stehen auch die Gaben des Norto an seinen Sohn, welcher dieser jedoch nur sehr widerwillig gab.
Auch Götter sind empfänglich für der Weiber Gunst. So verwundert es nicht, daß es der Tondur gelang ihren Sohn bei dem Adlergott in die Lehre zu schicken. Gestärkt durch dieses Wissen zog es IHN in die Tiefen der See zu Ygorl, von welchem er als Ziehsohn anerkannt wurde.
Gedachte ER doch gegen seinen Vater Norto zu rebellieren. Nach der Geburt seines Halbbruders Norytton, und nachdem dieser sich für seinen Vater entscheiden hatte, wandte ER sich noch mehr als bislang dem Chaos zu - und der Finsternis. In den darauffolgenden Chaoskriegen spielte ER eine entscheidende Rolle. Der durch den Einfluß seiner Mutter erreichte Friede hinterließ Spuren in der Beziehung zu seinem Vater und seinen Halbbrüdern. Dannach kam die Zeit, in welcher ER sich der Finsternis verschreiben hatte. Und dies war auch die Zeit, in der die Finsteren Sechs wurden. Mit den Finsterkriegen kam auch die erste Niederlage für die Finsternis.
Und als Warnung für IHN die Verbannung des Mannanaun. ER verstand die Warnung uns zog sich von der reinen Finsternis zurück, um sich in seinem eigenen Reich, dem unterseeischen (in der Menschensprache) Atalantis dem Chaos zu widmen. In der Sprache der Okeazar bedeutet der Name ´See der Großen Mutter´. Unterstützt wurde er in diesem Unterfangen durch die Denaide Anemona.
Er wurde nun mit dem, was er von seinem chaotischen Lehrmeister dem Adlergott gelernt hatte zur Sturmpeitsche von Ysatinga und mit dem Wissen aus den Lehren seines Ziehvaters der Bruder der Kinder der See.
Es begab sich zu jener wilden und zügellosen Zeit des großen Umbruchs auf Myra. Die Kinder Tondurs waren untereinander zerstritten; die Fronten des Pantheon waren für alle Ewigkeit verhärtet und die Welt Myra befand sich mit all ihren Lebewesen in einem Wandel der Zeit.
Ein Menschenleben ist wie ein kleiner steter Wassertropfen auf einem heißen Stein - kaum wahrnehmbar und sehr schnellebig. Und doch hinterläßt der eine oder andere Tropfen eine unverkennbare Spur in der Zeit.
Zeit? Ein Begriff aus der Menschensprache! Zeit? Ein Bildnis, oder ein Götze gar?
Zeit, ein Dämon, welcher sich der Menschen auf allen Kontinenten Myras bemächtigte und mit Ihnen nach Gutdünken spielte und sich an dem ihm sich bietenden grotesken Ergebnis labte!
Kraft im Inneren des noch unbekannten Körpers - geistige Verwirrung, über die bestehenden Möglichkeiten - der körperlich und seelisch spürbare Druck auf den breiten Schultern durch die imaginäre Verantwortung, welche durch das eigene Tun und Handeln geprägt wird und - letztendlich - die Erkenntnis!
Und es begann die lange Wanderschaft zu dem von den Göttern vorbestimmten Ziel - vom leiblichen Vater ohne Liebe aus dessen Herzen verstoßen, von der Mutter dafür abgöttisch geliebt - durch ihr unermüdliches Wirken aufgenommen in den Hort des Adlers, die Zeit des Lernens begann - die Trotzphase kam es und zog Ihn in die Tiefe der Unendlichen See; es brachte Ihm dem Vater der Schlinger nahe, welchem er unermüdlich an den Lippen hing - die Zeit der unauslöschlichen Taten folgte, das Pantheon kochte - wieder war es die Tondur, welche die Lösung brachte, um den Knoten zu zertrennen.
Das Wissen grub sich ein, daß auch die in Ihm ruhende weibliche Seite ihren Nutzen und Sinn in sich birgt - Wut und Verzweiflung gebaren die finstere Seite in Ihm - die Finsterkriege brachten nicht nur Unheil über die Welt, auch die letzten Weichen zum endgültigen Ziel wurden gestellt - die goldene Mitte wurde erwägt, sowohl örtlich als auch geistig. - Anemona half beständig mit gutem Rat und und geizte nicht mit Taten, die wilden Okeazar wurden seine Arme und die zahlreichen Wesen der Tiefen See seine Beine.
War die Welt Myra nicht abhängig von einem steten Geben und Nehmen, dem ewigen Kreislauf der Natur? Wie konnte das Negative ohne das Positive existieren? Die Erkenntnis wuchs - eine Ordnung in diesem ewigen Chaos war nötig - eine chaotische Ordnung: wild, launisch, unberechenbar und doch ordnend und hilfreich, einer übergeordneten Matrix - seiner Bestimmung - folgend!
Die Erkenntnis gedieh! Es fehlte nur noch eine Kleinigkeit, um dies auch bewerkstelligen zu können. Es fehlte ein wichtiger Part, die weibliche Essenz. Sie wurde in den Tiefen der Ozeane der Welt Myra gesucht und durch die Okeazar in Eris gefunden - die Erkenntnis war da!
Politik, ein Begriff der Sterblichen, soll der Spielball der Menschen bleiben. Macht, ebenfalls ein Begriff der Kurzlebigen, wird von Ihm einer anderen Definition unterworfen.
Bündnisse und Allianzen nach dem Willen und Gutdünken der Menschen kann es nicht geben!
Wohlwollen, Respekt, Unterstützung und Schutz vor den Unbillen der Hohen und Tiefen See können sich die Menschen durch seine Anbetung und durch ihr sinngerichtetes Verhalten erwerben.
Wasser, der ewige Energiestrom benetzt alle Küsten und Flußufer der Welten Myra und Ascar; somit auch ein Teil des Ganzen - Die Hohe See ist der Bereich seines unermüdlichen Wirkens, die Tiefe See sein beständiges Reich und Hort seiner ewigen Kraft. Auch Er zieht Kraft und Wissen aus dem Angebot seiner menschlichen Anhänger, welche Er - nach seiner Maxime - vor dem Unbill der Welt behüten wird.
Hilfreich hierbei ist die Errichtung von Heiligen Stätten zu seinen Ehren. Durch die Hüter dieser Bauwerke - die Priester seines Glaubens - besteht ein immerwährender Kontakt zu Ihm in der Tiefen See so groß die räumliche Entfernung auch sein mag. Hilfreich und sinnvoll ist es dem Glauben an diese Ordnung im Reich der Menschen Raum zu geben durch Unterstützung der Missionare und durch das Wohlwollen der Regierenden gegenüber den Gläubigen und deren Religionsausübung.
Die mit hellgrauem Fell besetzte Pfote schloß mit einer energischen Bewegung das schwere Buch, welches auf dem Podest, inmitten des kühlen Runds der Haupthalle, lag. Obwohl er diese - wie auch die anderen - Kapitel des ´Buches der Götter´ bereits auswendig kannte bemächtigte ihn immer wieder eine Unruhe wenn er an das Ausmaß dieser Worte dachte. Er gedachte die Unterweisung der Akolythen für heute zu beenden.
„Schwestern und Brüder des Wassers, für heute mag es genug sein. Zieht Euch zu Euren Studien zurück oder macht Euch anderweitig bei Euren Lehrern und Mitschülern nützlich.“
Er gedachte sich von den magischen Fortschritten der Schüler des vierten Kreises zu überzeugen. Waren diese doch nun dabei die Kraft des Wasser-Elementars kennen zu lernen und diese nach ihrer Imagination zu formen und deren Kraft zu nutzen. Er wandte sich in Richtung der Außenbezirke, um auf die Plattform der Übergänge zu gelangen. Schon von weitem spürte er das Hantieren und die Konzentration der Schüler durch die dicken Wände des Großen Beckens.
Ehrerbietig wurde er von dem leitenden Priester dieses Kursus begrüßt. Seine Hautfärbung und Gestalt wiesen ihn als einen Priester der Schwarzen Mutter aus. Seine Haltung und Schuppenfärbung ließ auf seine Herkunft aus der Tiefen See von Kiombael schließen. „Fh´ch´a shren dar´ch, Hohepriester, Euer Besuch ehrt mich.“
„Auch Euch entbiete ich den Gruß der Unendlichen Tiefe, Blob´Dumel, Oberpriester der Mutter der See. Laßt Euch durch meine Anwesenheit nicht in Eurer Arbeit stören. Mich interessiert nur der Fortschritt dieses Kreises.“
Der Kuor-Toa zeigte den Ansatz eines Nickens und schnippte in die Richtung eines Anrashay. „Mer´ch´lan, unser Meister gibt uns die Ehre eines Besuches. Erklärt Eure Vorgehensweise bei der Gestaltung des Elementars.
Der angesprochene Okeazar wandte sich dem Hohepriester zu und bat ihn durch eine einladende Geste zu ihm an seinen Arbeitstisch zu treten. Sein Arbeitsplatz bestand in dem umgedrehten Rückenpanzer einer Seeschildkröte, welcher auf einem großen Podest lag. Gefüllt war dieser Panzer zur Hälfte mit Wasser. Auf der Oberfläche dieses künstlichen Sees schwammen einige Miniaturen von den Seefahrzeugen der Landbewohner, welche sehr naturgetreu nachempfunden waren. Der Hohepriester kam nicht umhin die Arbeitsleistung des Okeazar zu würdigen.
Der Schüler wartete bis sich der Hohepriester alles angesehen hatte und begann dann mit seiner Beschwörung. Er begann einen Singsang in der Sprache der Ur-Tritonen und sein Körper schwang rhytmisch dabei mit. Eine Aura der Stille legte sich über die Anwesenden. Der Blick des Tritonen wurde glasig in Erwartung der Kraft des Wassers und des Windes, welches durch ihn zu fließen begann. Mit sanften Bewegungen begann der Okeazar Luftgebilde in die Luft zu malen und diese wie eine Marionette am seidenen Faden aus den Wellen des Wassers emporsteigen zu lassen. Der Intensität des Singsangs nahm zu. Das Wasser begann sich an einigen Stellen zu kräuseln. Langsam stiegen mehrere kleine Wassersäulen rund um die stilisierten Schiffe empor und vereinigten sich über ihnen zu dem Sinnbild eines Riesenkraken der Tiefen See, um sich sodann ohne Vorwarnung auf die Schiffe zu stürzen. Das Bersten der Miniaturen vermischte sich mit dem glucksenden Geräusch des Strudels, welcher die zermalmten Reste der Schiffe auf den Grund des Panzers zog.
Der Singsang ebte ab und der Okeazar kehrte wieder in die Realität zurück.
Syras´sel wandte sich zufrieden von dem Geschehen ab und sprach den Tritonen an: „Ich danke Euch für die Demonstration Eures Könnes, Mer´ch´lan. Ich würde mich freuen, Euch nach Beendigung Eurer Studien in meinen Gemächern begrüßen zu dürfen.“ Er wandte sich zum Gehen.
Wenige Minuten später war er wieder allein. Allein in der weiten Halle, welche schon viele Jahrtausende lang das geschäftige Treiben in ihr gesehen hatte. Ein Raum - wie der gesamte Komplex - geschaffen aus dem Gestein der Weltmeere, geschliffen und geformt durch das Wissen und die Kraft des Wassers und durch die schlurfenden Schritte abertausender von Akolythen, Priestern, Besuchern und.... ja, auch durch die Kinder der See.
Mit einem wehmütigen Lächeln gedachte er den Bewohnern der See und ihrer Lebensweise. Wie sehr sich doch das Leben unter der Wasseroberfläche von dem unruhigen Treiben darüber unterschied. Der Ozean glich - wie immer - alles aus. Durch seine Masse war er in der Lage sich selbst zu regulieren. Solange - und hier wurde sein Blick grimmiger - solange die Landwesen nicht in ihrem Übermut ihren Zwist, ihren Unrat und ihre Machtbesessenheit auf den Ozean ausweiteten. Doch machte er sich da nichts vor? War es nicht schon soweit? Kaum eine Wasserparzelle der See, welche nicht von jagenden Menschen heimgesucht wurde!? Was sollte er davon halten, wenn die Bewohner der Meere nicht gefangen wurden, um in der Bratpfanne der Köche zu enden; sondern um deren Eingeweide und andere Teile für obskure alchimistische oder magische Extrakte zu gewinnen?
Kaum ein Ort, welcher nicht von Kampfhandlungen bedacht wurde? Weit bedenklicher jedoch erschien ihm, daß die Träger des immateriellen Wissens sich der Kraft der Elementare bedienten. War dies nicht vor Äonen den Sterblichen untersagt worden oder nur durch einen sehr hohen Preis zu rechtfertigen? Was würde mit dieser Welt geschehen, wenn die Götter sich anschickten dem Bauer zu sagen was er auf seinem Acker zu säen hätte? Wäre dies ein weiterer Schritt in Richtung des Chaos? Doch war dies nicht im Sinne seines Mentors? War eine notwendige Änderung oder die Erhaltung des Status Quo nicht denkbar ohne den immerwährenden Umbruch, der wilder, ungestümer und vernichtender nicht sein konnte? Oder gar mußte? War es nicht schon immer so gewesen, daß die Landwesen nur durch ihre selbst begangenen Fehler zur Einsicht gelangten? War es nicht so, daß ohne die harte und zugleich schützende Hand der Macht ein Begreifen und Lernen unmöglich war? Welch Ironie!
Ein Tentakel wand sich ihm entgegen und umschlang ihn behutsam. Unterbewußt hatten ihn seine Schritte zum Bassin des Großen Beckens gelenkt. Er strich behutsam über den Tentakel des Riesenkraken, welcher träge im Wasser lag und ihn interessiert beäugte, und schaute sich um. Auch dieser Raum des Großen Beckens bestand - wie die gesamte Tempelstadt - aus einer Mischung aus magischem Wuchs in Form von riesigen Korallen, welche das Skellett darstellte und sehr hellem, grauen und geformten Gestein, welches durch lichtdurchlässige und unterschiedlich breit ausgelassene Kristalle unterbrochen wurde. Die breiten Röhren, welche durch das gesamte Bauwerk verliefen, als auch die Fensterplatten aus diesem Kristall in den Decken, ermöglichten sowohl den Ein- und Ausblick, als auch, daß die Kinder der See in ihrem Element belassen an dem Wirken im Großen Becken teilnehmen konnten. Er legte sich flach auf den Boden der Halle und genoß die Stille und die Kühle des Bodens; sowie den Ausblick und die ehrerbietigen Grüße der an den Fensterkristallen vorbeischwimmenden Okeazar.
Viele Monde hatten bereits gewechselt seit er das Große Becken verlassen hatte, um auf anderen Welten im Sinne seinem Mentors zu wirken und Wissen zu sammeln. Umso mehr verwunderte ihn nun das hektische Treiben an der Oberfläche Ysatingas. Das Gleichgewicht der Kräfte war merklich ins Wanken geraten. Die Menschen befuhren nicht mehr nur die See und bedienten sich dort nach ihrem Gutdünken.
Nein, manche lebten sogar auf ihr und fühlten sich dort wohl und geborgen. Ja, sie verehrten sogar die See als ihre Mutter. Das war neu! Sein Mentor hatte ihm von diesen ´See-Lohanis´ berichtet; doch er wollte mit den eigenen Sinnen diese Existenzform in sich aufnehmen. Er hatte sich die Mühe gemacht deren Treiben zu beobachten und mußte erkennen, daß diese Menschen nicht nur nahmen, sondern auch der See ihren Anteil nicht vorenthielten. Auch das war neu!
Lag es an der Erkenntnis, daß es nur mit der See zusammen ging und nicht ohne ihr Wohlwollen? Lag es an dem Treiben der Anhänger seines Mentors Stiefvaters?
Er gedachte die ´Herren der See´ zu prüfen. So wie alle Menschen, welche sich anmaßten der See zu nehmen was nur ihr gebührt. Denn es wurde Zeit eine entgültige Entscheidung zu fällen. Schien es nicht so, daß die Brüder und Schwestern des Pantheon sich erneut diesem Teil der Welt zuwandten? Hatte Ysatinga, gebeutelt durch die Finsterkriege, in denen auch Aurinia und Kartan verwickelt waren, nicht bereits genug gelitten? Die Menschen auf dem Kontinent und auf den Inseln gedachten sich in das Spiel der Götter einzumischen, oder um es genauer auszudrücken, sich benutzen zu lassen. Anders konnte er sich deren unvorsichtigen Taten nicht erklären.
Noch nie in den vergangenen Zeitaltern verstanden die Menschen mit der Anderswelt umzugehen. Oder warum meinten sie immer wieder im Namen ihrer Götzen die Heiligen Stätten anderer Entitäten zu schänden oder die Geistwesen und Dämonen der Anderswelt beschwören zu müssen? Wußten Sie etwa nicht, daß nicht Sie die Fäden in der Hand hielten sondern andere Wesenheiten mit sehr scharfen Nägeln an ihren Händen durch welche all die Fäden liefen? Oder war dieses Wissen im Verlauf der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Oder weit schlimmer - wurden Schriftrollen von deren Bewahrern zurück behalten oder falsch interpretiert? Und war es nicht so, daß auch ER sich wieder einmal entscheiden mußte für ein Für oder Wider? Oder war es nicht, nach all den Wirrnissen der letzten Wechsel, die Zeit sich diesmal für die eigenen Interessen und die seines Volkes zu entscheiden? Oder - denn ER war frei von allen Verpflichtungen - die Karten neu zu mischen, zu verteilen und seinen Preis einzufordern? Ein Lächeln glitt über seine spitze Schnauze.
Seine Gedanken wurden unterbrochen durch einen Okeazar, welcher, nahezu geräuschlos auf einem ausgewachsenem Dhard sitzend, im Bassin neben dem Riesenkraken auftauchte.
„F hch´a ´nash chren, Hohepriester des Großen Beckens, ich bitte Euch ergebenst um die Gunst einer Unterredung.“
„Auch durch Euch fließe der Strom der Reinheit, Dhardführer Zz´chetl. Womit kann ich Euch behilflich sein?“
Der Okeazar nahm seinen Bohrfisch aus der Halterung am Gürtel, um ihn in das Bassin zu entlassen; schwang sich behende aus dem Bassin und streckte seine bullige, gedrungene und doch geschmeidig anmutende Gestalt. Seine dunkelgrüne Hautfarbe und die graumellierten mit hellbraunen Pigmenten gezeichneten Schuppen wiesen ihn als Mitglied einer höher gestellten Kriegerkaste der Nordwelt-Okeazar aus. Gerüstet war er mit einem Ganzkörperpanzer, gefertigt aus der weichen, anschmiegsamen und doch sehr widerstandsfähigen Haut eines Schlingers aus der Tiefen See. Ein unverkennbares Erkennungsmerkmal der Dhardreiter. Wie von ihm gewohnt trug er auch hier im Inneren des Großen Beckens sein, von ihm ´Besteck´ genanntes, Arsenal aus unterschiedlich langen, geformten und scharfen Schneid- Hack- und Stechwerkzeugen, welche an Halterungen an den Extremitäten und am Rücken befestigt waren. Der nahezu körperlange, leicht ovale Schild, gefertigt aus dem Panzer einer Drachenschildkröte und der überlange Dreizack aus dem unverwüstlichen Gebein des in den Weiten der Meere selten gewordenen Belanwales hingen an dem Geschirr des Dhard, welcher sich mit dem Bohrfisch zu dem Riesenkragen gesellte.
Hohe Töne, welche aus dem Bassin erklangen, kündeten von einem angeregten Austausch. Er wandte sich ehrerbietig dem Priester zu.
„Meister, ich bringe Euch die frohe Kunde von der erfolgreichen Umsetzung Eurer weisen und vorausschauenden Gedanken zur Unterweisung der Reiter der Dhards. Die Mitglieder des Reiterclans sind nunmehr bereit und gierig den Willen unseres Herrn auf den Wellen reitend der Welt kundzutun. Berichtet dies bitte unserem Herrn, sobald er wieder unter uns weilt.“
„Unser Dank sei Euch gewiß, Zz´chetl, Führer des Reiterclans der Dhards. Wisset, daß meine Augen und Ohren auch die unseres allwissenden Herrn sind. Erhalte ich Kunde von einem Ereignis, so weiß es zur selben Zeit auch unser aller Herr. Verbreitet die frohe Kunde, daß ER in wenigen Gezeitenwechseln wieder von der Welt Tebreh zu uns zurückkehren wird.“
„Ich bitte um Vergebung, Meister ob meiner Unkenntnis. Ich werde mich nun zu den Meinen begeben und sehnsüchtig der Nachricht entgegensehnen, welche uns auf den Rücken unserer Dhards den unverschämten Hautbeuteln und deren dämonischen Führern entgegenbringen wird. “
Der Okeazar wurde mit einem freundlichen Nicken des Hohepriesters entlassen und begab sich zu seinem Dhard, um durch das Bassin in die Tiefe See außerhalb des Großen Beckens zu gelangen. Wenige Augenblicke später erschien er an einem der äußeren Kristalle, bot ehrerbietig den Gruß der stolzen Reiter und entschwand mit seinem Dhard so schnell wie er kurz zuvor erschienen war.
Der Hohepriester setzte sich zu seinem Riesenkraken und kraulte ihn zärtlich oberhalb der Augenwülste. Welch´ eine frohe Kunde! Er hatte gewußt, daß der Führer der Dhards ein fähiger und vor allem sehr konsequenter Arbeiter war - aber daß er innerhalb von nur sieben Mondwechseln diese Einheit neu zu formen wußte - nun, dies sprach deutlich für seine Begabung zu motivieren. Kam diese Nachricht doch wohl zur rechten Zeit. Bahnten sich nicht Ereignisse an, welche das Gleichgewicht deutlich zu Ungunsten aller daran beteiligten Lebenwesen verändern würde?
Die Anrashay waren gewappnet. Viel zu lange hatten diese knurrend und vor Wut und Tatendrang strotzend dem Willen ihrer Clanführer gehorcht und sich abwartend verhalten.
Sprachen jedoch vereinzelte Übergriffe von Patroullien in den Weiten der See nicht eine ganz andere Sprache? War es nicht an der Zeit manchen Seereisenden ihre Grenzen aufzuzeigen und ihnen deutlich zu verstehen geben, daß diese nicht alleine und nach Gutdünken handeln durften? Er verstand beide Seiten wohl. War es nicht eine Art von weltenübergreifender Politik? Mußte ER nicht mehreren ´Herren´ dienen? Seine Väter, Lehrmeister und Freunde des Pantheon und deren Widersacher auf allen Ebenen des Seins? Seine menschlichen Anhänger, welche sich von ihren zuweilen anmaßenden Taten Schutz und Wohlwollen erhoffen und deren feindlich gesinnten Nachbarn? Sein Volk und dessen Interesse an Fortbestand und Wachstum? Wahrlich nicht einfach zu meistern. Doch - es schien ihm nun immer klarer zu werden. All die Worte der letzten Unterredungen kamen ihm erneut in den Sinn. Wie ein steter Wasserfall, welcher sich in die ruhigen Bahnen des Flusses eingliederte, erkannte er nun die maßgeblichen Ursachen und die daraufhin von IHM weitsichtig getroffenen Entscheidungen. JA! Dies alles ergab einen Sinn!
Sollten seine Schlußfolgerungen zutreffend sein, so konnte sich jede Partei dieses Spieles auf einen sehr wilden Wellenritt einstellen. So erschreckend die möglichen Folgen auch für sie alle sein konnten, so kam er doch nicht umhin festzustellen, daß ein schwerer Stein von seinem Herzen abfiel. Die Entscheidung - so schien es - war gefallen - und das war gut so!
Er erhob sich und begab sich in das Innere des Großen Beckens - eine wohlbekannte Stimme in seinem Kopf ersuchte ihn um eine persönliche Begegnung.
Denn ER war eingetroffen.
Quelle: Bote von Karcanon 61/6-12
DAS GESCHENK CORCHWLLS - (Cyrianor, 424 n.P.)
Das Geschenk Corchwlls
Cyrianor 424 n.P.
Baran durchwanderte seinen kleinen Raum und dachte über die Dinge des Reiches nach, es kam zu keinen militärischen Konflikten, scheinbar überlegte sich Skratek eine neue Vorgehensweise, anders konnte er sich dies nicht erklären. Dann der Mann der von sich behauptete der Lichtbote zu sein, nur ein verrückter Narr und doch die Wahrheit? Er verscheuchte den Gedanken wieder, es gab wichtigeres zu tun. Er legte seine graue Kutte ab und streifte sich die schwarze mit dem silbernen Wolfskopf auf den Rücken über. Es wurde Zeit für sein Gebet und sein Blutopfer an Corchwll, er spürte das heute etwas besonderes passieren würde, etwas wichtiges und machtvolles. Er wusste nicht was, doch das Verhalten seiner Wölfe und das Gefühl welches er in der Magengegend hatte, zeugte deutlich von der Wichtigkeit des heutigen Tages.
Er betrat die große Halle und damit den Tempel Corchwlls, der steinerne Altar war mit Fackeln erhellt, sonst brannte kein Licht im inneren. Die beiden Königswölfe lagen abseits des Altars, doch im flackern der Fackeln konnte man das Leuchten in ihren riesigen Augen sehen. Auch sie waren angespannt. Baran trat zum Altar, darauf lag sein reich verzierterer Opferdolch und eine Schale aus Ton. Einer seiner Novizen hatte alles vorbereitet. Er zitierte seine Gebete als er sich dem Altar näherte, öfter kniete er sich kurz nieder und erhob sich. Demut und Respekt gegenüber Corchwll. Am Altar angekommen kniete er sich nieder, betete und schob den Ärmel seiner Kutte nach oben. Dann griff er nach dem Dolch und der Schale, während er weiter Gebete zitierte schnitt er sich mit dem Dolch eine Wunde in den Arm. Das Blut ließ er in die Schale fließen, sein Opfer an Corchwll. Als die Schale voll war, hob er sie weit über seinen Kopf, es störte ihn nicht das die Wunde noch blutete und den Ärmel seiner Kutte durchnässte. Lauter und intensiver wurde sein Gebet, als er es beendet hatte, senkte er die Schale und ließ das Blut auf den Altar laufen. Dort regierte es ungewöhnlich heftig und ein leichter Schreck fuhr Baran in die Glieder, so heftig hatte noch kein Opfer reagiert. Dort wo das Blut auf den Altar getropft war, begann es zu qualmen, es warf Blasen und dann schien es, als würde der Altar das Blut aufsaugen. Im Qualm sah man kurz das Abbild Corchwlls. Er nahm sein Opfer an. Dann spürte er die Energie die sich vom Altar in seine Hände glitt und sich von dort direkt in seine Magengegend übertrug. Spürte wie sein Körper die Macht aufnahm, ein Geschenk von Corchwll. Die Energie summte in seinen Schädel, fuhr durch seinen gesamten Körper und jagte einen Schauer nach dem anderen über seine Haut. Noch nie fühlte sich Baran so gut und mächtig. Die beiden Wölfe im Hintergrund heulten laut, sie spürten die Gegenwart ihres Gottes, materialisiert durch die Energie die in Baran gefahren war.
Einige Minuten später war es vorbei, das Blut war völlig vom Altar aufgezogen worden. Doch Baran spürte die Energie in sich. Die Wölfe trotteten näher und schmiegten sich an ihn. Baran streichelte ihre Köpfe und erhob sich dann. Corchwll hatte hier an diesem Ort seine Macht gezeigt und weitere Orte würden folgen, dessen war sich Baran sicher.
(Quelle: Bote von Cyrianor 7, 424 n.P.)
DIE HIRTEN - (Ysatinga, 416 n.P.)
Die Hirten
(Quelle: unbekannt)
In langen Reihen zogen Rinder über den Hügel, ein Wogen aus braunen Rücken, die einträchtig nebeneinader trotteten.
Kälber blöckten, versuchten, kurz auszuscheren um einige Gräser auszurupfen und wurden von den Muttertieren sanft weitergestupst, die jungen Stiere rempelten gegeneinander und brachten kurze Unruhe, bis sie von den nachdrängenden Bullen weitergestoßen wurden.
Yearl saß stolz auf seinem Pferd und ließ sie an sich vorbeiziehen, zum ersten Mal hatte ihn sein Vater mit den übrigen Hirten allein gelassen. Er sah aus wie alle anderen Hirten, bekleidet mit abgewetzten ledernen Hosen, staubigen Stiefel, die ihm bis fast an die Knie reichten, einem abgerissenen Poncho aus Schafswolle. Nur an seinem edelem Pferd und dem reich bestickten Sattel sah man, daß er der Sohn des Clanführers war.
Die Wintersonne stand tief am Himmel und es würde bald Zeit, die vorderen Tiere langsam im Kreis zu führen damit sie über Nacht eng zusammenstanden. Die Hirten würden die lange Nacht am Feuer verbringen, einige würden das Lager zusammen mit den Hunden in weiten Bögen umreiten um die Wölfe, die in dieser Zeit hungrig sein würden, zu vertreiben. Hochlandrinder sind groß, gewaltige Körper auf kräftigen Beinen, es gibt kaum ein Tier, außer Schneelöwen oder einem Rudel Wölfe, das einen ausgewachsenen Stier zur Strecke bringen kann.
Aber eine Herde Hochlandrinder, die durch Wölfe in Panik gerät, bricht los, die mächtigen Köpfe gesenkt. Die gewaltigen Körper trampeln mit einem Donnern, das die Erde erschüttert über alles hinweg, was ihnen im Wege steht, schwache Tiere bleiben am Rande zurück oder werden von ungezählten Hufen zu blutigem Matsch zerstampft. Selbst erfahrene Herdenführer riskieren ihr Leben, wenn sie versuchen, eine Panik zu beenden. Das Einfachste wäre, zu warten, bis die Tiere erschöpft innehalten, aber der Verlust an der Herde wäre groß und die Herden waren Besitz und der Stolz des Clans.
Es war also wichtig, daß sie rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit einen Lagerplatz mit Wasser und ausreichend Futter fanden, der gleichzeitig gut überschaubar sein mußte.
Die Herden des Clans der Songor zogen zwar jedes Jahr in etwa die gleiche Route, aber die Lagerplätze änderten sich. Wasserstellen versiegten oder waren von anderen Herden verschmutzt. Zwei der Hirten waren vorrausgeritten, um einen solchen Platz zu finden.
Nun, sie würden bald kommen und melden, wenn sie einen Platzgefunden haben würden. Bis dahin war Zeit.
Yearl zog sich seinen Poncho enger um die Schultern, es wurde frisch. Sein Jagdbogen baumelte verführerisch hinter seinem Sattel und er überlegte kurz, ob er nicht ein Kaninchen für den Abend jagen sollte. Ein schneller Ritt über das Grasland, und...
Aber er hatte Angst, daß er so der Verantwortung, die ihm übertragen worden war, nicht gerecht werden würde. Also lies er es. Ancorn Sangos, sein Vater, Führer des Clans war einige Tage vorrausgeritten um mit den anderen Clanführern das große Treffen zur Jahreswende, zum Sakaat vorzubereiten.
Unterwegs würde er von den anderen Clans den jährlichen Tribut, den Talab eintreiben. Der Talab wurde seit jeher vom Clan der Sangos verwaltet, aus ihm wurden die Sakaatfeiern, Bier, Wein und Opfer an die Götter bezahlt. Aus dem Talab wurden auch die kleinen Clans, unterstützt, deren Herden durch ein Unglück zuviele Tiere verloren hatten, um gut über den Winter zu kommen.
Im Frühjahr würden die, die das Jahr über Pech gehabt hatten ihr Recht wahrnehmen und von allen Clans, deren Herden mehr als 21 mal 21 Tiere zählten, einen oder mehrere Jährlinge zu fordern. Die Herden würden wieder im Tiefland weiden, wo die alten Hirten, die nicht mehr mitzogen, warteten.
Sie hatten den Sommer über Heu getrocknet und die Ställe für die jungen Tiere vorbereitet.
Dann brach die Zeit der Ruhe an, Geschichten würden erzählt, die Alten würden mit ihnen die Sättel, die Bögen und das Geschirr für die Wagen ausbessern, und sie würden im Schnee das Sakaatfest feiern, zum Andenken an die letzten Herrscher des Landes.
Dieses Jahr schien der Sakaat für alle Clans von Sorgen überschattet:
Zwei mächtige Reiche griffen mit gierigen Fingern und noch gierigern Truppen nach dem Land, in dem sie seit Generationen ihre Herden weideten und seit über 10 Jahren ohne Herrscher lebten. Nur die Alten kannten die Erzählungen vom letzten Herrschergeschlecht, dem Bruder, der seinen Bruder vertrieben hatte und nur wenige Jahre später ohne Nachfolger gestorben war. Der Bruder war irgendwohin, weit über das Meer geflohen, dort als geachteter Priester gestorben, aber nicht zurückgekehrt.
Im Zeichen des Drachens war er geboren, so hieß es, eines Tages er im Zeichen des Drachens zurückkommen und sein angestammtes Erbe übernehmen.
Antaf ritt scharf an Yearks Seite und weckte ihn aus den Träumen:
"Wir haben eine Platz gefunden, eine Wasserstelle und genügend Gras. Sollen wir beginnen, die Herde zusammenzutreiben?"
Yearl nickte bedächtig, so wie sein Vater genickt haben würde.
Antaf der Jäger war ein erfahrener Hirte, sein Wort zählte viel an den Feuern und wenn er einen Platz für geeignet hielt, so konnte man sicher sein, daß er es auch war.
Antaf und Yearl sprengten nach vorne und wiesen den übrigen Hirten den Weg zum Lagerplatz, Antaf übernahm nun die Führung, um die Herde in einen Kreis dorthin zu führen, während Yearl zurück galoppierte, um die Wägen, in denen Frauen, Kinder und Kranke reisten, in denen Vorräte und Werkzeuge waren, direkt zum Lagerplatz zu führen. Dann würde alles bereit sein, wenn die Hirten ihr
anstrenges Tagwerk vollbracht hatten.
Feuer würden brennen, in den großen eisernen Kesseln würde heißer Wein und Fleisch bereitet, die Zelte würden aufgestellt und diejenigen, die nicht zur Wache eingeteilt waren, würden sich ohne viel Gerede schlafen legen.
Sie waren weit gezogen heute, die Hirten hatten es nun eilig, denn sie mußten das Tiefland vor Einbruch des Winters erreichen.
Die Tage vergingen und Yearl ritt nun mit Antaf, um die Lagerplätze zu finden. Insgeheim erwartete er, seinen Vater zu treffen, der über kurz oder lang wieder zur Herde stoßen mußte.
Er wollte ihn als einer der Ersten begrüßen.
Am vierten Tag stießen sie auf die Reste einer kleinen Feuerstelle, die von einzelnen Reitern stammen mochte. Sie hätten sich nicht weiter damit aufgehalten, denn das Land war frei und jeder mochte reiten und jagen, wo es ihm gefiel.
Antaf ritt trotzdem hin und stieg vom Pferd. Er bückte sich und roch an der Asche.
"Einen Tage alt" meinte er erstaunt, "vielleicht zwei. Jemand hat versucht, die Asche zu zerstreuen und hat reingepisst, damit die Stelle aussieht, als sei sie einige Wochen alt."
"Was bedeutet das?"
"Ich weiß nicht," wandte sich Antaf zu Yearl und sein braungebranntes Gesicht bekam Sorgenfalten.
"Wer immer hier war, hat versucht, seine Spur zu verwischen. Und er hat das eilig gemacht. Jeder Hirte sieht am Boden, daß es hier wochenlang nicht geregnet hat."
"Dann wollten sich diese Leute nicht vor Hirten verbergen. Wieviele waren es?"
Antaf band seinem Pferd die Fesseln, damit es die Spuren nicht zertrampelte.
Auch Yearl war abgestiegen.
Sie bewegten sich vorsichtig und suchten mit scharfen Augen den Boden ab. "Drei Pferde, Hirten, die Pferde waren nicht beschlagen" meinte Antaf, "aber nur zwei Reiter."
"Ein Packpferd?"
"Nein, es trug keine Last," schüttelte Antaf den Kopf.
Und dann fand Yearl die abgebrochene Spitze eines Pfeils, unweit der Feuerstelle im Gras.
Kein Pfeil eines Hirten, sondern der Pfeil eines Soldaten.
"Kartaner," vermutete Antaf, "ygorische Reiter wurden hier noch keine gesehen.
Die sind weiter gen Ophis.".
"Der dunkle Orden," murmelte Yearl und nun hatte auch er Sorgen.
"Wir sollten hier lagern und morgen die Spur verfolgen."
"Besser, sonst zertrampelt die Herde die Spuren," stimmte Yearl zu, "morgen früh werden wir mit zwei Fährtenkundigen weitersuchen."
"Hältst Du die Sache für so wichtig?"
"Man hört einiges in letzter Zeit. Boten zweier Clans suchten meinen Vater auf und sie brachten schlechte Nachricht. Kartan will die Freiheit der Clans beenden."
Antaf blickte erstaunt auf.
"Sie wollen ...?"
Yeral nickte. "Steuern, Abgaben, Orkongläubige. Es ist noch nicht sicher, was geschehen wird, aber seit Mörderbienen gesichtet wurden rechnen die Clanführer mit dem schlimmsten. Und Ygora scheint das Gleiche zu wollen, abgesehen vom Glauben. Sie schicken Orks um das Land zu erobern."
Es wurde eine unruhige Nacht mit schweren Träumen.
Irgendwo da draußen in den Weiten des Landes trieben sich die Reiter des dunklen Ordens herum und - Yearls Vater und seine Begleiter.
Als die Sonne einen Fuß über dem Boden stand, saßen Antaf, Yearl und zwei der Spurenleser bereits in den Sätteln und folgten den spärlichen Fährten. Sie hatten ihre Jagdbögen gegen die schweren Kriegsbögen eingetauscht, obwohl ihnen klar war, daß sie auch mit diesen Waffen einer Reitertruppe hoffnungslos unterlegen waren. Der Clan konnte zwar an die 2000 Reiter mobilisieren, aber sie waren weit über das Land verstreut und trieben die Herden ins Winterquartier. Es hätte Wochen gedauert um sie zu versammeln.
Ihre Ehre gebot ihnen, sich nicht kampflos zu ergeben.
Sie ritten, so schnell sie die Spuren erkennen konnten und gegen Mittag fanden sie eine weitere Feuerstelle. Diesmal hatte sich niemand die Mühe gemacht, sie zu verbergen. In der Asche lag ein halbverkohltes Stück Stoff und es war getränkt mit Blut.
"Einer der beiden ist verwundet."
"Die Pfeilspitze..."
"Auf, sie können nicht weit sein. Es sind Hirten wie wir und sie werden Hilfe brauchen," trieb Antaf an.
Scharf sprengten die Reiter über den trockenen Boden, über die Hügelkette und das nächste Tal entlang. Die Spuren waren noch frisch denn der Tau hatte nicht ausgereicht um das geknickte Gras wieder aufzurichten.
Als sie das Ende des Tals ereicht hatten, stiegen sie ab um ihre Tiere zu schonen.
Der Boden wurde steinig und steil, die Spuren spärlich.
Antaf und die Fährtenleser blickten wie gebannt auf den Boden. Yearl sah so gut wie nichts, nur manchmal erkannte er an geknickten Disteln oder losgetretenen Steinen, daß sie der Spur noch folgten. Die Sonne stand tief am Himmel, als sie das langestreckte Joch erreicht hatten, auf dem einige kümmerliche Herbstblumen und halbverwachsene Sträucher dem kaltem Wind trotzten.
Die kleine Gruppe hielt inne.
Die Spur war verschwunden. Hier, wo wieder spärlich Gras wuchs, hätten sie sie wiederfinden müssen.
Antaf grunzte ärgerlich. "Wir benehmen uns wie kleine Kinder die Lehm kneten."
Die beiden Fährtensucher nickten nur.
"Sie sind natürlich nur halb auf das Joch geritten und dann nach links oder rechts ausgewichen."
Spuren, wie Yearl sie gesehen hatte, konnten auch von freilebenden Sprinböcken oder Wölfen stammen.
"Wir verfolgen Hirten, keine Barbaren, Männer!"
"Das macht nichts," murmelte einer der Fährtenleser, "seht dort:"
Sie waren ein Stück über das Joch gewandert, um vielleicht durch Zufall die Spur wiederzufinden. Auf der nächsten Hügelkette erkannten sie zwei Männer, einer lag halb auf einem Pferd, das der andere führte. Von den beiden anderen Pferden war nichts zu sehen.
"Natürlich, sie haben die beiden Pferde hier hinaufgetrieben und wir sind darauf hereingefallen." meinte Antaf mit einem bewundernden Unterton. "Und nun ziehen sie weiter, aber da einer der beiden verwundet ist, muß der andere ohnehin sein Pferd führen, so daß sie mit den beiden Pferden auch nicht schneller wären."
"Tapferer Mann, er lässt seinen Gefährten nicht im Stich."
"Auf nun, hinterher. Reitet ihr Hirten und reitet schnell!"
Nun ließen sie ihren Pferden die Zügel frei und galoppierten, die Tiere wieherten kurz und wußten, was von ihnen verlangt wurde. Yearl beugte sich über den Hals seines Pferdes und genoß den scharfen Ritt, sie alle waren gespannt, wen sie dort treffen würden. Er bildete mit seinem Pferd eine Einheit, lies ihm die Zügel locker und dirigierte es nur mit den Schenkeln.
Hirten reiten seit ihrer Jugend und jeder zieht sein eigenes Pferd groß, so daß sich Pferd und Reiter wie blind verstehen und vertrauen. Die beiden Männer, denen sie folgten mußten sie bemerkt haben, denn plötzlich waren sie hinter einigen Felsblöcken verschwunden. Antaf ritt alleine vor:
"Heda, wir sind Hirten wie ihr!", brüllte er, "habt keine Angst, wir sind vom Clan der Songor und bereit euch zu helfen!"
Es kam keine Antwort.
"Bei mir steht Yearl Songor, der Sohn des Ancorn Songor und ich bin Antaf der Jäger!"
Zwischen zwei Büschen bewegte sich vorsichtig ein Mann, beäugte die Gruppe vorsichtig und lies erst dann seinen Bogen sinken.
Er hätte sie vom Sattel schießen können, so nahe stand er.
"Vom Clan der Songor?"
"Vom Clan der Songor!" bekräftigte Yearl und erschrak: Vor ihnen stand Asbe Sejar, ein Vertrauter seines Vaters.
"Kommt und helft. Pesar liegt da und verblutet"
"was ist passiert?" Sie waren abgestiegen. Antaf kümmerte sich um den Verwundeten.
Yearl rüttelte Asbe am Poncho. "Was ist passiert, Mann! Sag was!"
Asbe wandte stumm den Kopf ab.
Yearl umfasste seine knochigen Schultern und fragte ihn mit ruhiger, fester Stimme:
"Asbe Sejar! Was zum Orkon ist geschehen. Wo ist mein Vater und wo sind die anderen? Und wer hat auf Pesar geschossen?"
Asbe flüsterte nur:
"Yearl, du bist nun Clanführer. Die anderen sind Gefangene. Pesar und ich waren zurückgeblieben, weil, weil, " der Alte brach vor Yearl in die Knie.
"Pesars Pferd hatte einen Stein im Huf. Ich half ihm nur den Stein zu entfernen..."
"Was ist passiert? Kartaner?"
Asbe nickte nur und senkte den Kopf.
"Als wir den anderen nachreiten wollten, kam uns Ganjab in vollem Galopp entgegen und schrie "flieht" und im nächsten Moment hörten wir, daß er von Reitern verfolgt wurde. Wir drehten und folgten ihm und vor uns tauchten noch mehr Reiter auf. Sie hatten Lanzen und trugen Rüstungen und wir wichen ins offene Gelände aus, schneller als sie, viel schneller. Aber sie schossen einige Pfeile nach uns und trafen Ganjab in den Rücken und Pesar in den Schenkel. Wir entkamen ihnen. Bevor er starb erzählte Ganjab." Antaf und die Fährtenleser standen im Halbkreis um die beiden und lauschten.
" Die Kartaner hatten sie aufgehalten. Sie wollten wissen, warum wir Waffen tragen. Ancorn sagte, daß wir freie Hirten sind und es unser Recht ist. Der Offizier der Kartaner sagte, daß sie durchsucht werden. Sie wollten ihre Taschen sehen. Acorn verweigerte es ihnen. Da kam es zu einem Händel und Ganjab floh."
Asbe sah auf.
"verzeiht uns, Herr, wir sind geflohen. Wir wußten nicht was passiert ist...."
"Schon gut," meinte Yearl und zog Asbe hoch, "schon gut. Was passierte weiter?"
"Ich weiß nicht, " schüttelte Asbe den Kopf, "aber die Ganjab wollte noch etwas sagen, etwas von Wegelagerern..."
Antaf nahm Yearl zur Seite:
"Pesar ist gestorben. Wir kamen zu spät. Er bittet, seine Schande nicht seiner Familie anzulasten." Yearl nickte geistesabwesend.
"Wo war das Asbe?"
Der alte Hirte wieß mit dem Finger gegen Osten. Zwei Tage von hier, nicht weit, wir konnten nicht mehr schnell und ich hatte Angst, Pesar würde verbluten."
"Pesar ist tot", knurrte Antaf.
Asbe schluchzte kurz. "Sie verloren unsere Spur gestern. Sie können keine Spuren lesen, wenigstens nicht wie wir."
"Gut, lasst uns Pesar begraben, wie es einem Hirten geziemt, der als freier Mann in Ehre gestorben ist. Wir werden hier lagern. Morgen wirst Du uns den Platz zeigen, an dem das alles geschah."
Yearl überlegte kurz: "Antaf, du bleibst bei uns. Du, " er wandte sich an einen der Fährtenleser, "reitest zurück und berichtest den anderen. Falls wir nicht in 4 Tagen bei der Herde sind, schickt Boten zu allen Clans und meldet daß Ancorn und Yearl Songor Gefangene der Kartaner sind und alle Reiter der Clans sich vor dieser Burg, Ormonal, einfinden sollen. Mit Kriegsbögen und der großen Herde. Sie sollen 21 mal 21 Stiere mit sich führen. Mein Halbbruder, Deracht, soll das Kommando führen. Tut dann, was ihr für richtig haltet, aber rächt uns." Er sah den Fährtenleser scharf an. "Klar?"
"Gut. Aber ich reite sofort, Yearl, ich kann nachts reiten, ich kenne den Weg jetzt."
"Gut, reite."
Früh ritten sie gen Osten, schnell und vorsichtig.
Am ersten Abend hatten sie die alte Feuerstelle längst hinter sich gelassen. Sie erreichten ohne Zwischenfall den kleinen Saumpfad, an dem Ancorn mit seinen Begleitern aufgehalten worden war. Die Spuren auf dem Pfad waren noch zu erkennen:
"Hier warteten sie, in dieser Senke." Der Fährtensucher tastete mit den Fingern den Boden ab. Yearl unterbrach ihn und meinte mit trockenem Hals: "Lasst uns lagern. Heute erreichen wir nichts mehr, wir suchen morgen weiter." Der Fährtenscher blickte zweifelnd zur untergehenden Sonne und schwieg, als er Yearl widersprechen wollte.
Sie entzündeten kein Feuer. Die Kartaner waren vielleicht noch in der Gegend und sie wollten kein Risiko eingehen.
Yearl und Antaf wälzten sich unruhig, sie schliefen schlecht. In den Strahlen der aufgehenden Sonne stapften die Hirten durch das feuchte Gras links und rechts des Pfades.
Viele Reiter hatten in einem Hinterhalt gelegen und den Boden zertrampelt.
"Schlaues Versteck. Vom Pfad aus nicht zu sehen," meinte der Fährtensucher.
"Hier, sie haben einige Pfeile verloren." "Oder daneben geschossen."
"Aber es gibt keine Spuren von Blut oder Anzeichen eines Kampfes," meinte Yearl beruhigt. "Sie haben sich irgendwie friedlich geeinigt." "Oder sie wurden einfach gefangen genommen. Wieviele Begleiter hatte Ancorn dabei?"
"Mit Pesar, Ganjab und Asbe waren es 11 Mann."
"Die hätten sich gegen über hundert Kartaner auf keinen Fall wehren können."
Sie suchten weiter. Der Fährtensucher war sich sicher:
"Sie sind hier entlang geritten. Die Krieger und die Hirten. Seht ihr: Zwischen den tiefen Spuren der Pferde der Krieger sind kleinere und leichtere von Hirtenpferden."
"Also haben sie sie gefangen." Antaf runzelte die Stirn. "Und sie sind Richtung Ormonal geritten."
"Reiten wir ihnen nach."
"Aber vorsichtig!" warnte Antaf. "Wir reiten nicht den Pfad sondern hier, diesen Hügel entlang. Wenn Asbe recht hat und wir schnellere Pferde haben, so können wir wenigstens fliehen, wenn wir sie sehen."
"Fliehen?" fragte Yearl unwillig. "Das ist unser Land. Wieso sollten wir fliehen?"
Antaf knurrte nur: "Das war unser Land, Yearl, wenn es das noch wäre, glaube ich nicht, daß Ancorn freiwillig mit den Reitern aus Kartan gekommen ist. Also lass uns vorsichtig sein. Ich für meinen Teil möchte mir keinen Pfeil zwischen meine Schultern fangen..."
Sie hielten sich ein wenig unter dem Hügelkamm, damit sich ihre Silhouetten nicht gegen den Himmel abzeichneten. Und es zeigte sich, daß Antaf recht hatte:
Unten, den Saumpfad entlang zogen lange Reihen kartanischer Reiter, hundert und aberhunderte.
"Das sind über 2000 Mann," staunte Yearl. Noch nie in seinem Leben hatte er eine so gewaltige Truppenmasse gesehen, die in disziplinierter Ordnung gleichmäßig dahinritt.
"Sie reiten gen Ophis. Dorthin, wo angeblich ygorische Reiter gesichtet wurden."
"Na dann viel Spaß."
"Aber wo ist Ancorn?"
"Das werden wir gleich erfahren, lasst uns erstmal zur Burg kommen." meinte Antaf.
Zwei Tage später tauchten die düsteren Umrisse der Burg des dunklen Ordens vor ihnen auf. Sie hatten vor ihr gehört, aber noch nie so mächtige Mauern gesehen. Langsam ritten sie auf die Burg zu. Sie wählten einen kleinen Hügel, der vor der Burg lag, um zu beobachten. Obwohl sie mit Sicherheit noch nicht bemerkt worden waren bewegten sie sich vorsichtig. Sie führten die Pferde an den Zügeln, bereit, beim geringsten Zeichen fremder Truppen aufzuspringen und zu fliehen. Ihnen war unheimlich.
Antaf blieb stehen:
"Halt, was bei den Göttern ist das?!"
Vor der Burg standen Kreuze und über den Kreuzen kreisten Geier.
"Nein, bei Drakos, das kann nicht wahr sein! Sie kreuzigen Menschen!"
Die Hirten schlichen näher. Ihre Pferde rochen den Leichengestank und tänzelten unruhig.
Zwischen einigen verdorrten Körpern, die nur noch an den bleichen Knochen erkennen liesen, das es einmal Menschen gewesen waren, hackten die Geier auf blutiges Fleisch ein.
Acht Männer hingen dort, Stricke tief in schwarz angelaufene Gelenke geschnitten, die Augen waren von den Geiern herausgehackt und niemand würde je wissen, ob sie das noch lebend erlebt hatten. Die aufgeschwemmten Bäuche und die gebrochenen Beine hingen an grotesk lang gestreckten Armen und Oberkörpern.
Die Köpfe waren ihnen im Todeskampf nach vorne gesunken, aus wirren Haarbüscheln waren blutige Fetzen gerissen.
Fleischklumpen, die einmal Zungen waren quollen aus den blau angelaufenen Gesichtern.
"Das sind Hirten," erkannte Asbe, "die ledernen Hosen, es sind Hirten! Hingerichtet wie feige Wegelagerer!" Der Alte schrie vor Verzweiflung. Antaf hielt ihm mit eisener Faust den Mund zu.
"Wenn du so schreist, hängen wir bald daneben, Narr! Und jetzt holen wir sie da runter", befahl er.
Yearl stand stumm vor Schrecken und Angst. Ihm war, als wäre ihm ein Stier in vollem Lauf gegen den Schädel geprallt.
Er brachte es nicht über sich, Antaf und dem Fährtensucher bei dem grausigen Geschäft zu helfen.
Antaf hatte Tränen in den Augen, als sie die Reste von Ancorn Songor vorsichtig, fast zärtlich vom Kreuz nahmen. Der Führer der Songor mußte schreckliches erlebt haben, bevor er starb, sein Kiefer war verrenkt, Brandwunden übersähten den Leichnam, einzelne Nägel waren ihm ausgerissen worden.
Sie ritten auf den nächsten Hügel und schweigend begannen die Hirten, ein Grab in den harten Boden zu hacken, ein Grab für ihren Herrn und seine Begleiter, die lieber gestorben waren, als sich zu beugen.
Yearl stand dabei und Haß loderte in seinen Augen.
ERFÜLLUNG - (Yhllgord, 416 n.P.)
Erfüllung
Der leise Wellenschlag hatte ihn in den Schlaf gleiten lassen. Der Rhythmus war durch den Schlaf; war durch die Träume gewandert, hatte sich über sie gelegt, hatte sie durchdrungen, hatte sie bestimmend geformt. Nun holte ihn die Gleichmäßigkeit wieder aus dem Schlaf heraus. Wieder war es dämmrig; nun das Grauen des frühen Morgens. Wieder und noch immer der Klang der anrollenden und sich entfernenden Wellen. Alles schien gleich. Nur einen Augenblick schien sich seine Aufmerksamkeit abgewendet zu haben. Keine Veränderung zeigte sich und doch war die Zeit zerflossen, hatte sich die Erde gedreht, hatten fremde Menschen gelebt. Erfrischt und unendlich wohl und kraftvoll fühlte er sich. Es war schön in dieser kleinen Bucht. So ruhig, so verlassen von allen anderen Menschen. Aberglaube hatte die Luft geklärt, hatte den Raum frei gemacht, hatte den Frieden der Leere geschenkt. Die Alten und die Weiber erzählten den Kindern sonderbare Geschichten von Nixen, von den Muyranen genannten Kiemen-Menschen, von anderen Meeresunwesen und Halbwesen, von Ungeheuern. Wilde Phantasien, berichtet in alten Zeiten von jenen, die gerade noch davongekommen waren. Kleine Gruseleien, die sich in den Köpfen der Kinder einnisten, die sich dort ausdehnen und neue Schattierungen, neue Ausschmückungen gewinnen. Und diese Geschichten bleiben in den Köpfen, bleiben dort bis der Tod sich seine Beute holt, bis diese verängstigten Menschen heimgeholt werden. Alles Schabernack. Er glaubte nur an das, was er sah. Es mochte viele Dinge und Wesen und Menschen unter der Sonne geben. Doch einfach so alles glauben?
In der Ferne erhob sich ein Zipfel der Sonne. Noch stark verformt und verschwommen durch die Wellen. Mehr und mehr stemmte sie sich empor. Die Luft war noch von jenem milchigen Blau, das so unwirklich wirkt, das so leer und ewig wirkt. Ein Blau, das sich selbst genügt; das bereit scheint, auf die Menschheit, auf alle Betrachter, auf alle Wesen, auf alle Existenz an sich zu verzichten. Ein Blau, das sich darin gefällt, allein zu sein. Ein Blau, das verachtend herabstrahlt, weil es die ewige Ruhe und Beschlossenheit in sich selbst gefunden hat.
Die Wellen krochen an den Strand, strichen über den Sand und zogen sich zurück, um neuen Wellen Platz zu machen. Er zog sich aus und trat ins Wasser.
Es war nicht kalt, sondern angenehm warm. Wenige Schwimmzüge trugen ihn ins tiefe Wasser. Er legt sich auf den Rücken und gab sich dem Wogen hin.
Feine Wolkenstreifen hingen im Himmel, ganz dünn, ganz zart. Fäden von reinem Weiß.
Ihre grünen Augen lachten ihn an. Er war zwar überrascht, jedoch keine Abwehr, kein Zurückschrecken. Ein Gesicht voll der Freude und voll der Unschuldigkeit. Seine Schwimmbewegungen hielten ihn über Wasser. Sie bedeutete ihm zu schweigen, legte ihre Arme um seinen Hals. Ihre Lippen waren kühl und salzig. Rasch und gierig eilte ihre Zunge über seine Zähne.
Auch er umarmte sie und dennoch blieben beide im Wasser stehen. Etwa zehn Fuß tief mußte Wasser unter ihnen sein. Er schwamm nicht und auch sie nicht und dennoch standen sie. Ihre Beine berührten sich. beide bewegungslos. Er tastete an ihrem Arm entlang, erreichte ihre Hand und spürte zwischen den Fingern die Schwimmhäute. Sie war eine Muyrana, ein Kiemen-Mensch, ein Halbwesen; weder Fisch noch Mensch, sowohl Fisch als auch Mensch. Ihr Fischschwanz trug sie. Ein Märchen hatte Gestalt angenommen. Doch er spürte keine Angst. Ruhe erfüllte ihn. Ruhe und Genuß über den Augenblick. Rein und klar lachten ihn ihre Augen an. Keine Arglist, keine finsteren Gedanken; pures Sinnenfühlen war in ihr. Ein Körper, der unberührt war von den Irrungen und Gefahren des Geistes, des zernagenden Verstandes, der unterkühlten Ratio.
Sie war schön und genoß es, schön zu sein.
Er genoß die Zeit; genoß es, in ihren Armen zu sein. Er genoß es und er küßte sie. Ihr Hände fühlten über seine Wirbelsäule, fuhren dann an den Seiten hoch, spielten in den Achselhöhlen. Sie zog ihn an sich, drückte ihn, klammerte sich an in. Ihr Mund liebkoste sein Gesicht. Ihrer beiden Wangen streichelten sich.
Schmetterlingen gleich zuckten ihre Wimpern über seine Haut. Das Gesicht, der Hals, die Schultern. Sie tauchte, hielt ihn mit den Armen, während ihre Lippen seinem Körper huldigten. Durch das strömende Wasser wurden ihre Bewegungen, ihre Berührungen, ihre Küsse verstärk und in verschwommene Leichtigkeit verrückt. Sie tauchte auf und küßte ihn auf den Mund. Ihre Haut war fest und kühl. Das Haar lang und schön, Seepflanzen waren hineingeflochten. Voll und zart standen ihre Brüste ab. In seinem Munde verhärteten sich die Knospen. Kleine Bisse ließen sie dezent erschauern. Er konnte nur kurz unter Wasser bleiben. Den Fischschwanz wollte er sich nicht besehen.
Das Verlangen wuchs. Sehnlich begehrte er sie. Wilder und wilder wurden ihrer beiden Bewegungen. Das Wasser kreischte und tobte um sie her. Der Himmel schwarz verhangen; kalt die Fluten; die Sonne bereits in ihrem Untergang. Er sah nichts von alle dem, nichts um ihn herum. Nichts war außer ihm und ihr für ihn. Nichts wollte er als sie lieben, als Teil von ihr werden, als mit ihr verschmelzen, als in ihr die Lust, in ihr das Glück erfahren. Er küßte sie und drang in sie ein. Fest umschloß sie ihn. Warm und weich und glatt und von unendlicher Schönheit, Vollkommenheit und Glückseligkeit. Ihr Gesicht wurde hart und fern. Sie ließ sich treiben in den Wassern. Die Wellen rollten stärker heran. Zwei Wellen trugen sie hinan, eine dritte überrollte sie, ließ ihn nach Luft schnappen. Es war nicht weit zum Ufer, kaum ein Augenblick hätte ihn dorthin gebracht. Er wollte das Glück auskosten, wollte sie lieben; wahre Liebe geben und wahre Liebe empfangen. Er zog, preßte sie an sich, küßte fiebrig ihr Gesicht. Er stieß in sie vor, glitt ein wenig zurück, ließ das Becken kreisen, stieß und drückte sie an seinen Körper. Tiefer und tiefer wollte er in sie eindringen; wollte sich in ihr verlieren, in sie hineinstürzen; ewiger Sturz in das Nichts.
Höher schlugen die Wellen. Schon jede zweite begrub das Paar unter der Wasserflut. Tiefer und tiefer. Schneller und hastiger. Angespannter und verzweifelter. Gieriger und gewaltiger. Nichts existiert, nichts besteht, nichts ist, nur Schmerz, Verlangen, maßloses Begehren. Wunsch nach Erfüllung, nach dem Ende und Wunsch nach dem Andauern, nach dem Nie-versiegen, nach Unendlichkeit. Brutaler und hastiger bewegte er sich. Die Luft qualvoll anhaltend, die Lungen bis zum Zerreißen gespannt. Hastiges Einatmen; bald zum rechten, bald zum falschen Augenblick; dann hustend das Wasser erbrechend. Nah war das Ufer und mit Macht tobten die Wellen. Er mußte, mußte das Glück erleben; mußte das absolute Vergehen erhaschen. Die Wogen schlugen in seinem Rhythmus an die beiden Körper; hielten ihn fest und schwangen mit ihm, seine Bewegungen in das Spiel der Weltmeere einbettend.
Dann Stille; unendlicher Schmerz; Augenblick, in dem die Zeit, in dem der Raum, in dem die Ewigkeit anhalten. Augenblick, wo nur noch Körper, wo nur noch Sinne, wo nur noch der Augenblick ist. Glück, Freude, Erfüllung, Verschmelzen, Schweben.
Die Welle überrollte ihn, drückte ihn unter Wasser. Die Lungen füllten sich mit Wasser. Die Wucht riß ihn fort. Der Geist noch nicht wieder mit dem Körper vereint. In der Glückseligkeit zu kraftlos und zu entfernt. Allein und befangen in der Erfüllung, im Aufgehen im Augenblick der Einzigartigkeit. Kurz trugen ihn die Fluten auf den weißen Kämmen der Gewalt. Sie spielten ihr schnell lebloses Spiel. Ein Spiel mit einem leichten Ball, der auf den Meeresgrund glitt. Hin und her wiegte sich sein Körper im Rhythmus des Wellenschlags.
Aasvögel kreisten über einer Stelle am Strand. Sie flogen hernieder, andere erhoben sich; stetiger Wechsel. Ein Leichnam, den sie mit ihren scharfen Schnäbeln zerrissen, dem sie Fleichbrocken entnahmen, den sie Stück um Stück aufaßen. Die Knochen waren allesamt zerschlagen. Sein Leib eine formlose Masse, von den Vögel kaum mehr entstellt. Nur das Gesicht war unberührt geblieben.
DIE SCHLACHT UM PHILIAS - (Erendyra, Tektoloi, ca. 412 n.P.)
Die Schlacht um Phillias
„Gônbrathil“, „das Grünwaldtal“ wird die peristeriste Provinz der Mark Garian genannt, denn zwei steile Ausläufer des Peristeragebirge, das sich fast 150 Meilen von Machairas nach Ophis entlang des peristerischen Meeres erstreckt, umschließen die Provinz. Gen Phialae bilden der Lâd Mériag, „das Drachenhaupt“ und der Lâd Elmurant „das Schattenhorn“, deren Gipfel sich mehr als 3000 Meter erheben, eine an der schmalsten Stelle kaum eineinhalb Meilen breite Schlucht, die sich Richtung Lychnos mehr und mehr weitet.
Das Herzogtum untergliedert sich seit über 350 Jahren in ein Dutzend Markschaften, die aus den Provinzen gebildet werden. Mark Garian, das ursprüngliche Stammland des Herzogtums, unterteilt sich dabei in die meisten Provinzen (vierzehn Nuathyn), während die neueren Markschaften, die in den späteren Jahren dem Herzogtum hinzugefügt wurden, zum Teil deutlich weniger und damit auch größere Provinzen bilden.
Neben der Machairasfelsprovinz der Mark Garian im Machairas ist das Grünwaldtal nicht nur die kleinste Provinz des Herzogtums sondern auch die ärmlichste. Kaum mehr als 1500 Bürger leben hier, Gwanlin am peristerischen Ende der Nebelschlucht ist mit etwa 900 Einwohnern die einzige größere Siedlung; hier steht auch die „Greifsburg“ des Nuathyn, dem Führer und Vorsitz von Gônbrathil. Nuathyn Dalmîn Gilabêch ist ein greiser Führer, der die Provinz seit 32 Jahren trotz seines hohen Alters mit großer Umsicht und Weisheit verwaltet. Sein Sohn Belanchis ist einer der drei Thronuathyn, die dem Nuathyn unterstehen.
In Gônbrathil lebt der örtliche Statthalter des Nuathyn auf einem kleinen Gehöft, statt – wie sonst üblich – in einem prächtigen Backsteinbauwerk; die Provinz ist militärisch gänzlich unbedeutend, denn an drei Seiten verweigern die schroffen Bergzüge jedem Feind den Zugang – allein in phialaeischer Richtung führt eine Straße in die angrenzenden Provinzen Garians und dort sichern starke Burgen das Gebiet, allen voran die alte Festung des Herzogtums inmitten des Waldes, auf der ständig die starke und kampferfahrene Wache von Garian stationiert ist und der Althyn der Mark regiert. Diese Feste liegt nur knapp 6 Meilen von Dalmîns Nuathynburgsitz entfernt.
Seit Stunden schon fegten tosende Sturmböen über das Land, die mächtigen Bäume des alten Waldes wogen sich im Sturm und Regen peitschte gegen die starken Außenmauern der Feste. Die Wachen auf dem ersten Festungsring zum Außenhof saßen am wärmenden Kaminfeuer in der Wachstube über den hinteren Toren der äußeren Befestigungsanlagen und erzählten sich gegenseitig von den neusten Begebenheiten in den fernen Reichen, von endlosen Schlachten, mächtigen Kriegern und dem Fall stolzer Burgen. Einer der Männer berichtete von zahllosen Armeen, die plötzlich im Machairas eingefallen sind und nichts als Tod und Verderben mit sich bringen. Einen mächtigen Drachen will man gesehen haben und viele munkeln gar diese neue Macht seien die Vorboten der Finsterheere Haarkons, dem elenden Sohn der Schlange.
Auf diese Weise bemerkten die Wachen die hagere Gestalt vor den hinteren Toren zunächst nicht. Müde trottete ein schwarzes Pferd durch den tiefen Matsch der vielen Pfützen auf die Tore zu, der Reiter war völlig durchnäßt und erschöpft von der weiten Reise. Vor sechs Tagen war er in Mitrania, der Hauptstadt des Reiches, aufgebrochen und ritt seither die große Waldstraße entlang nach Machairas.
„Ecthion Fâgund, Androth der fünften Halbschar des Nuathyn der Phialaeprovinz von Mark Dorlian, dritte Fünferschar der ersten Heimwache“, antwortete der Reiter auf das Rufen der Wachen. Kurz darauf öffnete sich das hintere Tor und man führte Ecthion in den Außenhof.
„Ich kannte deinen Vater Bêlion flüchtig“ berichtete später ein älterer Soldat. „Wir waren fast drei Monate zusammen in der gleichen Fünferschar bei der Schlacht um Mitrania vor gut zwei Jahren. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen oder von ihm gehört.“ „Ein halbes Jahr später fiel er bei der Schlacht um Phillias.“ sagte Ecthion ruhig. „Ich suche nach den Soldaten, die dort mit ihm in einer Schar zusammen waren. Vor zwei Monaten ernannte unser Faroth mich zum Führer einer Halbschar und ich darf die Einheit meines Vaters aufsuchen. Er diente jahrelang in der ersten Armee bevor sie wegen des Kriegs nach Ophis befohlen wurde. Danach ist das Heer wieder in Garian stationiert wurden, denn hier kommen die Männer her.“ Darauf erzählte ein junger Soldat, der die Unterredung gespannt mit angehört hatte, daß die erste Armee vor mehr als einem Jahr in die Grafschaft Lychai und von dort gen Machairas aufgebrochen ist und nach dem Krieg nur wenige Monate in Garian verweilte. Es war längst zuspät, die Gefolgsmänner der Schar hier anzutreffen.
Am Tag darauf preschte Ecthion sechs Meilen weiter mit seinem Pferd durch die Schlucht zwischen Lâd Mériag und Lâd Elmurant, der Grenze zum Grünwaldtal. Nur noch der schlammige Straßenrand zeugte vom gestrigen Unwetter und für einen Tag im Jijar war es ungewöhnlich warm.
Nach einiger Zeit erreichte Ecthion die kleine Siedlung Angrem. Nur etwa drei Dutzend Holzhütten waren kreisförmig aufgebaut. in der Mitte des Rundkreises stand ein riesiger, knorriger Ahornbaum, hinter den Häusern lagen zahlreiche kleine Hütten, Tierställe mit angrenzenden Weiden, Scheunen, Handwerkstätten, Holz- und Lebensmittellager.
„Der Dorfrat von Angrem kann ihm vielleicht helfen“, so sagte einer der Wachen in Garian, „keine Viertelmeile von der Siedlung entfernt liegt ein heiliger Hain und dort leben mächtige Ilwath, heißt es.“ Obwohl keiner der Soldaten jemals einen der Ilwath, der „Wissenden“ gesehen hatte, so glaubten doch die meisten von ihnen daran. Auch Ecthion hatte Legenden über die Wissenden gehört, er war in der Mark Garian aufgewachsen, wo beinahe jeder Bewohner an die Macht der Tierkulte glaubte.
Weiter im Ophis, in Phillias oder Allenos, spöttelt man darüber und hält diese Riten für primitiv und grobschlächtig, doch im Machairas des Kaiserreiches ist die Vergötterung mancher Tiere tief in der Gesellschaft verwurzelt. Allen voran steht der uralte Bärenkult; es heißt die Schamanen seien kleine Geister, gute und böse, die dem Großen Bären dienen, ein Teil von ihm sind und sich selbst in Bären verwandeln können. In Gônbrathil würde kein Bewohner des Waldes es je wagen, einen Bären zu töten, aus Furcht den endlos flammenden Zorn des Großen Bären auf sich zu ziehen. Gelehrte sehen in diesen Glauben eine enge Verbindung zu den Völkern der Waldreiche. Dort gibt es ähnliche Tierkulte, sagt man, bei denen jedoch der Wolf eine führende Bedeutung einnimmt; von Gestaltenwandlern ist dagegen nicht die Rede.
Als Ecthion auf den Dorfplatz um den Ahornbaum ritt und absaß kamen viele Bürger zusammen. Nach kurzer Zeit herrschte ein reges Treiben auf dem Platz, Kinder, Hunde, Hühner und Gänse liefen durcheinander, aus den Häusern riefen die Mütter ihre Kleinen zurück und die Väter kamen aus den Handwerkshütten hervor. Fremde sind in Angrem selten und in der Regel eine gern gesehene Abwechslung. Fünf hochgewachsene kräftige Männer geboten den anderen Ruhe und schritten auf Ecthion zu. Der Dorfratälteste, der seiner Lederschürze nach zu urteilen ein Schmied sein mußte, führte ihn zusammen mit den anderen Dorfratsmitgliedern in seine Hütte. Als ein Androth, der Führer einer Halbschar des Herzogtums war Ecthion ein willkommener Gast, der nach einer heißen Suppe zur Stärkung von den Neuigkeiten in den übrigen Teilen des Herzogtums und Tektolois berichten mußte. Viele der Dorfbewohner versammelten sich in der Hütte des Dorfrates, um den Erzählungen des Gastes zu lauschen. Als Ecthion seinen Bericht beendete, schickten die fünf Männer des Dorfrates die anderen zurück in ihre Häuser und ließen Ecthion erst dann sein eigentliches Anliegen vortragen. Schließlich, nach einer kurzen Beratung, wies der Älteste Ecthion den Weg zu den heiligen Ort und gebot ihm sofort und ohne Pferd aufzubrechen.
Als Ecthion das Haus verließ, hatte die Abenddämmerung bereits lange eingesetzt, im Feuerschein aus den umliegenden Häusern und im fahle Licht des Mondes erschienen die Bäume des dichten Waldes in allen möglichen Formen. Langsam folgte Ecthion den schmalen Weg, der sich jedoch nach kurzer Zeit im dichten Wald verlor, doch gab kein Unterholz, nur viele verschlungene und miteinander verwachsene Wurzeln. Kein Rascheln und keine Bewegung in den Zweigen war festzustellen, und doch hatte Ecthion das unbehagliche Gefühl, beobachtet zu werden. Dieses Gefühl wurde immer stärker und schließlich ertappte er sich dabei, wie er rasch hochschaute oder zurückblickte.
Inzwischen war es völlig dunkel und Ecthion mußte erkennen, daß er sich hoffnungslos verirrt hatte und nicht einmal annähernd die Richtung zurück zur Siedlung wußte. Plötzlich aber konnte er zwischen den knorrigen Baumstämmen in einiger Entfernung ein großes Feuer erspähen und schritt vorsichtig darauf zu. Als Ecthion aus den Bäumen heraustrat, stand er auf einer kleinen Lichtung, wo der Wald nach Bathron hin in steinigen Felsengrund überging. Moosbedeckte Steine und überwucherte Felsen lagen hier und davor, mehr zu den Bäumen hin, loderte ein großes Feuer. In vielen der Felssteine waren seltsamen Schriftzeichen und Symbole gehauen, manche davon von Flechten und Moos überwachsen.
Zuerst bemerkte Ecthion niemanden, doch dann warf der Schein der Flammen einen dunklen Schatten auf die hinten liegenden Felsen und er konnte eine riesige, über zwei Meter hohe steinerne Gestalt zwischen den Felsbrocken stehen sehen. Hastig schreckte der Soldat hoch, er schrie kurz auf. Die Figur hatte an seinen ausgebreiteten, kräftigen Armen zwei große Schwingen, die Finger mit langen Krallen bewehrt. Die Haltung der Anne und besonders die gespannte Stellung der Arme erweckte den Eindruck, als würde dieses mächtige Wesen gerade zu einem unverhofften Sprung ansetzen, um sich auf sein Opfer zu stürzen. Am eindrucksvollsten aber war das Gesicht, das eine Mischung aus einem Drache und einem Dämon zu sein schien – oder vielmehr die Augen, denn während der Rest der steinernen Figur mit Wurzeln, Gras, Moos und vor allem Flechten überwachsen wurde, waren die Augen so wie neu geschliffen, daß sich das Feuer in ihnen seltsam spiegelte. Ecthion kannte diese Wesen von den Legenden aus seiner Kindheit, die sie „Nolmen Dôr“ geflügelte Unholde nannten. Man sagt, solche Steinfiguren würden an allen Kultstätten stehen. Die Wissenden nennen sie Wachsteine und es heißt, beizeiten, zu besonderen Riten (etwa bei Sommer- oder Wintersonnenwende) erwachen sie zu Leben.
Langsam ging Ecthion auf den Unhold zwischen den Felsen zu und plötzlich ließ eine tiefe Stimme vom Wald her ihn herumschrecken. „Berühre den Wächter nicht !“ Langsam traten drei große Gestalten aus den schwarzen Schatten des Waldes auf das Feuer zu. Die Person in der Mitte hatte sich ein Bärenfell übergeworfen, welches so groß war, daß man von seinem Träger nichts erkennen konnte. Die Pranken des Bären falteten sich auf der Brust des Wissenden, der große Kopf, den er auf seinem Haupt trug, warf einen undurchdringlichen Schatten auf sein Gesicht. Um den Hals trug der Schamane eine Kette mit aufgereihten Knochen, Steinchen, Zähnen und Klauen. Der Wissende links hinter dem Bären war in das schwarze Fell eines riesigen Wolfes gehüllt. Auch er trug eine Kette und den Schädel des Tieres auf sein Haupt. Die dritte Gestalt, rechts neben dem Bären schließlich hatte sich ein Hirschfell übergeworfen. Dessen Geweih war größer, als Ecthion es jemals zuvor gesehen hatte. Lautlos setzten sich die Wissenden, auf ihre Seite des Feuers, so daß die Flammen zwischen ihnen und Ecthion loderten. Angespannt beobachtete er die drei durch das Feuer und für einen Augenblick war er sich sicher, wirklich einen Bären, einen Wolf und einen Hirsch vor sich zu haben.
„Wir haben dich erwartet, Suchender“, begann der Wolf mit rauher Stimme zu sprechen.
„Nur wenige kommen in diesen Tagen, um nach dem Vergangenen zu fragen, das im Finsteren liegt“, flüsterte der Hirsch. „Aber so sei es !“ Behende sprang der Bär auf und tanzte, einem alten Ritual folgend vor dem Feuer, in der einen Hand die Knochenkette, die er um den Hals trug, in der anderen drei glatte Steine mit mystischen Runen darauf, die er immer wieder gegeneinander schlug. Sonderbar war es anzusehen. Während der Bär vor dem Feuer tanzte, murmelten der Wolf und der Hirsch längst vergessene Wörter und warfen beizeiten Kräuter in das Feuer. Nach einiger Zeit stiegen mehr und mehr dicke Rauchwolken aus dem Feuer empor. Ecthions Augen brannten, er glaubte seltsame Dinge im Rauch erkennen zu können – ein Drache stieg aus dem Feuer empor, flog eine Runde und verschwand dann in der Nacht, Scharen von Kriegern waren zu sehen und schließlich das Gesicht seines Vaters. Immer mehr Rauch bildete sich und umgab Ecthion, bis er den Bären nur noch schemenhaft erkennen konnte, dann schließlich gar nicht mehr.
Die Rauchschwaden waren keineswegs erstickend, sondern wie Nebel der einem umgab, feucht und erfrischend. Ecthion wurde plötzlich schwindelig und er versuchte sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, aber sein Arm war starr und regungslos, er konnte ihn nicht heben. Dann sah er plötzlich ganz deutlich seinen Vater, Bêlion vor sich. Inmitten der endlosen Scharen. Wie viele Krieger mochten es wohl sein ? Fünftausend ? Sechstausend ?
In Wirklichkeit bestand das Heer aus etwa 120 Fünferscharen. Für jeden der Soldaten war es eine unvorstellbare Ehre in diesem Heer diesen zu dürfen, des es gehörte zu den besten des Herzogtums. Ecthion war denkbar stolz auf seinen Vater.
Die Rüstungen der Soldaten glänzten im Schein der Sonne wie ein riesiges Meer oder wie die Sterne am Abendhimmel. Dann gab der Heerführer der Armee den Befehl zum Aufbruch und die Gilroth, die Führer der Fünferschar, signalisierten die Bereitschaft in den Krieg zu ziehen. Der Klang ihrer Hörner, zehn Dutzend, hallte ohrenbetäubend im Außenhof der Feste von Garian. Ecthion blickte den endlosen Reihen lange nach.
Während Bêlion in die Schlacht des Ophis zog, hielt Ecthions Einheit vorerst die Festung von Garian, um dann später als Nachschubtruppen die eroberten Gebiete zu sichern. Sämtliche Fünferscharen seines Heeres bildeten sich aus neuen Rekruten, die für den Krieg angeworben waren.
Vier Monate später, im Nisan 412 n.P., zogen die Vorboten des großen Sturms über das Reich.
Die stolze Stadt Mitrania war längst in einem Sturmangriff genommen. Die stolzen Heere von Garian und Lychai hatten sich nördlich der Stadt vereint, um den Schrecken im Lande ein Ende zu bereiten. In der kurzen Schlacht fiel der Fürst der Stadt, doch das sollte erst der Beginn einer langen, erbitterten Schlacht sein.
Überrascht durch den ungebeugten Mut und der Tapferkeit der garianischen und besonders der Heere Lychais, schlossen die Fürsten von Semros, Titanas, Allenos und Phillias gemeinsam einen Pakt gegen die beiden Reiche und erklärten ihnen geschlossen den Krieg. Der Herzog von Titanas und der Graf von Semros ließen ihre starken Heere entschlossen nach Ophis ziehen, um sich mit den Truppen des Herzogs von Allenos zu vereinen.
Zur gleichen Zeit, in der Bêlions Heer, das Mitrania eroberte, die Stadt verließ, um dem nahenden Gegner aus dem Oklis abzuwenden, wurde Ecthions Einheit hier stationiert, die umliegenden Ländereien zu sichern. Nur kurz konnte er seinen Vater sehen.
Starke Truppen aus Titanas und Semros marschierten von Phialae her auf, die Heere aus Phillias und Allenos standen im Ophis und Bêlions Stammheer wurde in drei Unterheere aufgeteilt, um den Feinden an allen Fronten begegnen zu können. Bêlion wurde dem Phialaeheer zugeteilt, dem die Aufgabe zukam. die Gefahr von Titanas abzuwenden.
Am 16. Tag des Widdermondes kam es 13 Meilen im Lychnos von Mitrania dann zu einer erbitterten Schlacht. Die erfahrenen Soldaten des Phialaeheeres marschierten von Stauros ein und preschten in die Flanken der überraschten Krieger aus Titanas. In deren Heer brach Panik aus, fast zweitausend Titaner fielen, nichts schien die stolzen Truppen Garians aufhalten zu können, doch dann erklangen von Diktyon her viele Hörner und frische Truppen aus Allenos drängten auf das Schlachtfeld. Schlagartig kippte das Siegesglück um. Mutig und entschlossen stellten sich die Garianer dem neuen Gegner entgegen.
Bêlion kämpfte verbissen im verworrenen Getümmel der Schlacht. Die sonst so geordneten Reihen der garianischen Heere, die eben noch den Gegner arg bedrängten, standen nun wirr durcheinander, nur die jeweilige Schar unter dem Faroth stand dicht beieinander. Schnell erlangten die Truppen aus Allenos die Oberhand, das Heer aus Garian zog sich zurück. 500 Krieger aus Bêlions Heer wurden in der Schlacht erschlagen, weitere 200 auf der Flucht; er selbst war nur leicht am Oberarm verletzt. Dennoch hielt sich der Heerführer an seine Befehle und kehrte nicht nach Mitrania zurück, sondern ließ die Lager in sicherer Entfernung aufschlagen. Im Monat darauf rüstete Garian verstärkt für den Krieg und rekrutierte viele neue Truppen. Tage später traf die neugerüstete neunte Armee aus Mitrania auf die Phialaetruppen von Bêlion. Verfrüht griffen nun die 3000 Allenosier die erste Armee Garians an. Überraschend für das ophische Herzogtum erhielten diese starke Unterstützung vom neunten Heer aus Mitrania. Die Verstärkung von knapp 1100 titanasischen Kriegern, 400 ihrer Reiter und weitere 1000 allenosischen Soldaten kam für Allenos zu spät. Durch überragende Schlachttaktiken und geradezu katastrophalen Fehlern in der Allianz von Allenos und Titanas wurden die im vergangenen Monat siegreichen Allenosier vollständig besiegt. Die ihnen zur Hilfe eilenden gemischten Truppen liefen direkt in die Falle der inzwischen siegreichen Garianer und kein Feind entkam lebend der Schlacht, die später in Garian die „Wolfsschlacht“ genannt wurde.
Der Große Wolf gilt in Garian als Sturm-, Kriegs- und Siegesgott, viele glauben, ein solch überwältigender Sieg wie in der Wolfsschlacht sei nur durch die Gunst des Siegesgottes möglich.
Während Bêlion im Oklis von Mitrania kämpfte, marschierte sein Sohn Ecthion in der Hauptstreitkraft von Garian, 14.000 größtenteils Neulinge im Kriegshandwerk, Rekruten aus Mitrania, wagemutig in Richtung Phillias, um den Herzog mit seinen 1000 Kriegern, die dort in kleineren Scharmützeln geschlagen wurden zu unterstützen.
Im Gegenzug marschierten 11.000 Veteranen und Elitekrieger von Phillias und Allenos in Richtung Mitrania, um Garian die besetzte Stadt wieder zu entreißen. In der Mitte der beiden Städte trafen die Heere aufeinander und es kam zur „Großen Schlacht“. Durch die kleine Armee des Herzogs von Garian zwischen den beiden riesigen Heeren hatten die Phillianer zunächst einen Vorteil, der jedoch schnell zunichte gemacht wurde. Schlachtenglück und die endlose Menge der Soldaten trieben das Entsatzheer aus Phillias gegen die Waldfront von Alvis und rieben es dort auf. Kein Phillianer entkam der Schlacht, auch die Hälfte der Ritter von Allenos fiel. Acht Mann aus Ecthions Schar wurden erschlagen, er selbst schwer verwundet. Insgesamt fielen 4200 Krieger des Herzogtums.
Am zwanzigsten Tag des Monats beschloß der Graf von Phillias mit seinen Schätzen die Stadt zu verlassen und nach Allenos zu fliehen, denn noch lagerte nur die kleine Ritterschaft unter der Führung des Herzogs von Garian in der Nähe, doch die übrigen Heere rückten von Mitrania und aus dem Phialae heran. Am Abend verließ ein Gefolge, bestehend aus 3500 Allenosiern und 1200 seiner Krieger, die Stadt. In einer nahezu wahnsinnigen Aktion stürzte sich plötzlich der Herzog von Garian mit nur 400 Rittern auf diese 4700 Mann starke Armee.
Es heißt, als seine Kundschafter ihm die Botschaft vom Verschwinden des Grafen überbrachten, soll er sich kühn und stolz erhoben und mit dröhnender Stimme gerufen haben „Auf ihr Ritter Garians! Setzen wir dieser habgierigen Schlange nach, auf daß sein Schild zersplittere, sein Schwert zerbreche, sein Speer zerschelle und das Leid, welches er über das Land gebracht hat vergehe!“ Damit nahm er sein großes Horn und blies es so schmetternd, daß es zerbarst. Der Graf von Phillias wendete daraufhin und befahl seiner Armee auf den Herzog und seine Ritter einzustürmen, doch sogleich erschallten Dutzende Hörner vom Phialae her und wie ein Sturm brach die Phialaearmee des Herzogtums über die Ebene. Mit zusammen etwa 3000 Kriegern drängen die zahlenmäßig überlegenen Garianer den Grafen und dessen Krieger auf einen Hügel und belagern ihn dort. Bêlions Schar kämpfte in vorderster Reihe. Plötzlich ergoß sich ein wahres Meer von Pfeilen über ihn und er vermochte sein Schild nicht rechtzeitig schätzend vor sich halten. Ein Pfeil bohrte sich durch seinen Hals, zwei weitere in Brust und Bauch. Während Bêlion tödlich getroffen zu Boden stürzte, stürmten große Armeen aus Mitrania von Stauros her vor die Tore der Stadt Phillias. Die Belagerung von Phillias begann, über fünftausend gutgerüstete und erfahrene Garianer standen knapp tausend Gegnern ohne Anführer gegenüber. Der Herzog selbst führte seine Truppen einen Monat später zum endgültigen Sieg. Ecthions Einheit dagegen wurde nach der Großen Schlacht in die Ländereien vierzehn Meilen im Thysias von Mitrania befohlen, um dort kleinere Verbände von Kriegern aus Titanas abzuwehren, die dort stets einfielen.
Als Ecthion die Augen öffnete, war es früher Morgen, dichter Nebel schwebte über dem Dorfplatz und sein Pferd graste neben ihm. Er selbst saß an den Stamm des großen Ahornbaumes in Angrem gelehnt. Nie konnte er sich erinnern, wie er hierher zurückgekehrt ist, doch schwieg er darüber und ritt – ohne je ein Wort über die Wissenden oder die Schlacht um Phillias zu sagen – stillschweigend nach Mitrania zu seiner Halbschar. „Habe Dank, Großer Bär“, dachte er, „daß nun Friede herrscht in Tektoloi.“
DIE WOLKE - (Karcanon, Midligur, 415 n.P.
Ort: Das Reich Midligur im Ophis Karcanons
Zeit: Das Jahr des Buches (BDA?) 415 n.P.
Die WOLKE
Es war Nacht in den ligurischen Bergen, und es war still bis auf das Prasseln des kleinen Lagerfeuers, das die Flüchtigen entzündet hatten, um die Kälte abzuwehren, die zu dieser Jahreszeit manchmal bis in die einstmals so fruchtbaren Ebenen Midligurs hinabsank. Sie waren zu dritt, und alle waren sie Crisen, hochgewachsen und schwarz, und sie hatten sich erst heute getroffen auf ihrem Weg nach Rhykor, wo sie zu berichten gedachten, was ihnen geschehen war, jedem von ihnen. Der Eine trug die roten Roben eines Artanpriesters, verblichen und verdreckt von dem beschwerlichen Weg; der Zweite war ein armer Hirte, alt und auf seinen Stab gestützt glich er eher einer Vogelscheuche als einem Menschen. Der Dritte hatte wohl die längste Reise hinter sich, seine einstmals sicher teure Kleidung hing ihm nur in Fetzen vom von Hunger gekennzeichneten Leib. Der Hirte war von Machairas gekommen, der Priester von Thysias. Der Dritte kam jedoch von Phialos, von wo schon sein Jahren niemand mehr gekommen war.
Der Hirte packt einen halben Laib trockenes Brot aus.
Der Dritte: "Es ist lange her, daß ich etwas anderes zu Essen sah als Beeren, Pilze und Würmer..."
Der Hirte: "Nehmt, morgen wird es verschimmelt sein." (teilt das Brot in drei Teile)
Der Priester: "Artans Segen über Dich, alter Mann, in diesen Zeiten ist ein Stück Brot mehr wert als ein teurer Wein." (stellt eine Lederflasche neben das Feuer. Der Dritte macht große Augen)
Der Dritte: "Ich kann nichts beisteuern, was ihr für genießbar halten würdet, doch wenn wir erst in Rhykor sind werde ich meinen Ring versetzen und euch in ein Gasthaus einladen wo ihr essen könnt bis zum Umfallen, ich verspreche es!" (verschlingt gierig das Brot)
Der Hirte: "Priester, woher kommt ihr?"
Der Priester: "Aus der Gegend, wo der Große Wall die Götterberge trifft. Schreckliches geschieht dort. Die schwarzen Krieger des Zardos ziehen plündernd, mordend und vergewaltigend von Dorf zu Dorf, seit sie von ihrem Kriegszug nach Bakanasan zurückgekehrt sind. Mich ließen sie meist in Ruhe, und seltsam, zwar rissen sie die Chnumschreine nieder, die überall noch aus alten Zeiten stehen, doch stattdessen bauen sie Schreine, die sie Artan weihen, aber sie sind anders als wir, sie sprechen anders, sie beten anders, und sie glauben anders. Sie besudeln die neuen Altäre mit Blut..."
(schreckliche Ereignisse spielgeln sich in den Augen des verstummten Priesters wieder, als er den Blick wieder zum Feuer wendet) "Ich versuchte zu helfen und zu lindern, wo ich konnte, doch auch ein Priester kann nur soviel Elend ertragen..."
Der Hirte: "Ich sah Burg Stokmor fallen. Nächtelang hörte man die Kriegstrommeln der Burundi, und eines morgens griffen sie an. Ich hatte mich in den Bergen ophis von Stokmor versteckt und konnte sehen, wie sie in blinder Wut gegen die Mauern rannten. Das Tor hielt nur eine Stunde, und nach nur einer weiteren Stunde wurde es still. Kurz danach sah man die Rauchsäulen vieler kleiner Lagerfeuer aufsteigen. Drei Tage lang brannten die Feuer, dann zog das Heer der Dschungelkrieger weiter. Ich stieg hinunter zur Burg, einen halben Tag habe ich dazu gebraucht, aber ich wollte sehen, was sie angerichtet hatten..." (ein Schatten zieht über das Gesicht des alten Hirten) "Sie haben sie gegessen. Alle. Die Menschen, die Pferde, die Hunde, nur Knochen waren übrig. Sie sind nicht wie wir. Ich habe einen ihrer Toten gesehen, es waren nicht viele. Sie sind drei Köpfe größer als wir, und viel kräftiger. Sie sind braun, aber am ganzen Körper haben sie blaue Zeichnungen. Niemand hat Stokmor überlebt, der an jenem Morgen in der Burg war."
Der Dritte: "Ich komme aus Theineor..." (erstaunte Ausrufe der beiden anderen) "Ich weiß, möglicherweise ist niemandem vor mir die Flucht bis hierher gelungen, bis über das Gebiet der WOLKE hinaus. Artan weiß, wie nahe ich dem Tode war und wie oft. Als Theineor an die Mörderbienen fiel, versteckte ich mich in einem leeren Faß, alle rannten und schrien und versteckten sich, niemand versuchte zu kämpfen. Nachts floh ich aus der Stadt, ich sprang von der Mauer, und brach mir nur eine Rippe, glaube ich. Ich floh Richtung Peristera, Tage, Wochen, ich weiß es nicht. In allen Dörfern bot sich dasselbe Bild, Tod, Verderben, Du hast es gesehen, Priester... Dann kam ich in das Gebiet der WOLKE. Ich traf dort in all der Zeit nur zwei lebende Menschen, und beide waren wahnsinnig. Der eine starb in meinen Armen, ich glaube, er hatte sich mit irgendetwas vergiftet. Der andere verwandelte sich eines abends in einen Wolf und biß mir fast ein Bein ab, bevor ich mich auf einen Baum retten konnte." (schlägt das kaputte Gewand beiseite, am Bein sind eitrige Narben zu sehen) "Ich fand Menschen, die zu Stein verwandelt waren, verbrannte, erfrorene und erstickte Menschen. Noch schlimmer waren die Pflanzen und Tiere. Was überlebt hatte, wuchs entweder immer weiter oder verkrüppelte. Ich habe Riesen gesehen, Wölfe, die Feuer spien, Ratten groß wie Hunde..." (steigert sich immer mehr in seine Erzählung hinein, irgendwann wird seine Sprache wirr und unverständlich, Wahnsinn leuchtet in seinen Augen)
Der Priester (zum Hirten gewandt): "Theineor fiel vor drei Jahren..."
Viel wird erzählt über die Schrecken der WOLKE, und vieles davon ist wahr.
DER WEG DER ELRHADAINN - (Ysatinga, Rhyandi, 414 n.P.)
Der Weg der Elrhadainn - eine Initiation
(Rhyandi, Ysatinga, 414 n.P.)
Über Lirynelrhad leuchtete der volle Mond von einem klaren Himmel. In der Kuppel des Fayi-Lùn im zentralen Felsenturm der Stadt hatten sich bereits an die drei Dutzend Elrhadainn der verschiedensten Familien versammelt. Man sprach leise miteinander und diskutierte das Neue an der geplanten Initiation. Nicht nur würde zum ersten Mal eine Initiandin die Kuppel betreten, die nicht aus Rhyandi kam, sondern es wäre auch die erste große Tathru nach der Rückkehr der Elrhadainn. Es hatte Zeit gebraucht, um alles wieder so zu organisieren, wie es vor der Abreise gewesen war. In den entlegeneren Gebieten wurden immer noch keine regelmäßigen Prüfungen durchgeführt, um die Jungen und Mädchen mit Neigung und Fähigkeiten für den Weg der Elrhadainn auszusuchen. Nur hier, am Rand des Kristallgebirges, wo sich die meisten der Zurückgekehrten vorübergehend angesiedelt hatten, lief alles reibungslos.
Der Tormeister schlug einen Gong, und der langsam anschwellende Ton erinnerte die Anwesenden daran, daß das Ritual bald beginnen würde. Die Initianden waren in den vergangenen Monden in den grundlegenden geistigen Fähigkeiten der magischen Kunst, der Meditation, der Schaffung von Energiemustern, der Konzentration und Visualisierung, unterwiesen worden, und hatten offenlegen müssen, warum sie diesen Weg gehen wollten. Niemand war abgelehnt worden, aber einige wenige waren zurückgetreten, und andere würden die Initiation nicht überleben.
Der zweite Gongschlag kündete die Ankunft der Mentoren an. Jeder Initiand, der das Ritual zum erstenmal durchlief, benötigte einen Mentor, der ihm den Ring öffnen würde. Diejenigen, die ihren zweiten oder dritten Ring hier erwarben, konnten ihr eigener Mentor sein. Jetzt sah man eine Prozession von Weisen durch das Tor mit gemessenen Schritten eintreten. Alle trugen knöchellange Roben in einer der zwölf Farben des Rings, mit schwarzen Bordüren an den Ärmeln und am Saum, auf die silberne Runen gestickt waren. Die weiten Ärmel betonten die Hände der Inititiierten, an denen man die eldrysbesetzten Silberringe sehen konnte. Zuletzt sah man die Erste Elrhadyni Shinaya eintreten, in einer violetten Robe und mit ihren sieben Eldrys, die sich aber sonst durch nichts von den anderen Mentoren unterschied. Zusammen mit den übrigen bereits anwesenden Elrhadainn versammelten sich die Mentoren um den Außenkreis des Rings.
Mit dem dritten Gongschlag setzte Stille ein, und das Ritual begann. In regelmäßigen Abständen standen die Mentoren um den begrenzenden Kreis aus den neun Marmorpodesten, über denen die Eldrys schimmerten, gehalten von unsichtbaren Kräften zwischen schlanken steinernden Händen. Dunkel, klar und fast wie ein Gesang klang die Stimme der Ersten Elrhadyni durch die Kuppel und in den Himmel hinauf.
„Dunkle Ildru, Göttin der Prüfungen, und Weiser Seker, Wanderer auf allen Welten, wir rufen Euch auf, Zeugen zu sein, wie hier alte Wege enden und neue beginnen. Ihr Künder alter Weisheit, Bewahrer des Wissens der Erde, Beschützer der Weisen des Weges, Richter der Unmäßigen und Hüter der Kraft! Kommt und beschützt die Prüfung und die Feier der Tathru der Elrhadainn!“
Erwartungsvolle Stille senkte sich herab. Zu sehen war nichts, aber alle fühlten eine Präsenz, die vorher nicht dagewesen war. Ob es tatsächlich die Aufmerksamkeit der Götter war, hätte niemand zu sagen vermocht, aber etwas war da. Die Elrhadainn traten vorwärts in den Kreis, drehten sich um, so daß ihre Gesichter nach außen zeigten, und begannen langsame, wellen- und kreisförmige Bewegungen mit den Händen auszuführen, während Shinaya weitersprach.
„Um unsere Gedanken zu befreien von allem, was vorher war und nicht hierher gehört, um diesen Raum von allen Geistern und Gedanken zu befreien, die nicht hierher gehören, um für diese Zeit alle schlechten Einflüsse und Geister zu bannen, errichten wir diese Grenze zwischen der Welt des Tages und der Welt des Sternlichts.
Entlang einer Kreislinie, die durch silberne Einlegearbeit im Boden zu erkennen war, bildete sich ein Strang aus blauem Feuer. Die Elrhadainn stimmten zusammen einen einzelnen tiefen Ton an, und der Strang wurde dicker, die blauen kalten Flammen schlugen höher bis über die Schultern der Anwesenden. Als der Ton langsam verklang, wandten sich die Elrhadainn wieder der Mitte des Kreises zu.
„Innerhalb dieser Grenze soll unser Tempel der Weisheit sein, die Weisheit, die alle Welten miteinander verbindet, und die zu finden unser höchstes Ziel ist. Den Weg zu beginnen, sind fünf Schüler heute gekommen. Das Tor soll geöffnet werden, um ihnen Einlaß zu gewähren.“
Zwei Elrhadainn mit langen Stäben gingen den Feuerkreis entlang, bis sie einen Punkt im Nordosten des Kreises erreichten, an dem eine Rune in Form einer Gabel in den Boden eingelassen war. Sie setzten ihre Stäbe etwa einen Schritt auseinander auf die flammende Linie, und begannen einen leisen Gesang. Der zwischen den Stäben liegende Teil der Linie begann die Stäbe hinaufzuwandern, über die Hände der sie haltenden Weisen hinweg, und hinterließen blaue Flammen auf ihrem Weg. Die Flammen wanderten über die Weisen hinweg und verhielten schließlich am Ende der Stäbe, so daß die Torwächter und ihre Stäbe die Pfeiler des Tores, die ursprüngliche Flammenlinie am oberen Ende der Stäbe sein Dach bildeten.
Aus einem Torbogen an der Außenwand der Kuppel, unmittelbar dem Flammentor gegenüber, traten jetzt die Initianden. In schmucklose Roben der Farbe ihrer Wahl gehüllt, näherten sie sich dem Tor, blieben aber zuerst dort stehen. Je ein Elrhadainn näherte sich einem der zwölf Marmorpodeste - den neun des Äußeren Rings und den dreien des Inneren Rings - stellte dort eine Messingschale ab und legte ein Stück Räucherkohle hinein. Wenige Augenblicke später begann die Kohle zu glühen, und die zwölf Elrhadainn entnahmen einem Beutel an ihren Gürteln eine Kräuter- und Harzmischung, die genau auf die Sphäre ihrer Wahl abgestimmt war, und streut etwas davon auf die glühende Kohle. Feine Schwaden wohlriechenden Rauchs stiegen aus den Schalen auf und verteilten sich im Kreis. Die Mischungen waren so aufeinander abgestimmt, daß man mit etwas Übung jede einzelne Mischung herausriechen konnte. Nach einigen Augenblicken des Wartens, während sich der Rauch verteilte und sich einer der Mentoren vor das Flammentor begab, ergriff Shinaya wieder das Wort.
„Wir begrüßen die Schüler des Wegs der Elrhadainn: Taynÿa Lir’An“ Ein Mädchen aus der Gruppe der Schüler in einer erdbraunen Robe trat durch das Tor.
„Sei uns willkommen!“ Der Mentor nahm sie an der Hand und führte sie zu einem Platz im Kreis, wo die Elrhadainn auseinandergerückt waren, um Platz zu sie zu machen.
„Lanakh Erin’Dar. Sei uns willkommen!“ Ein etwa dreißigjähriger Mann mit flammendrotem Haar und Bart, gekleidet in schwarz.
„Rúna Raidiyr-an-Aránel. Sei uns willkommen!“ Eine junge Frau mit schwarzem glatten Haar und einem ernsten, aufmerksamen Gesichtsausdruck, in violett gekleidet und barfuß.
„Dar an-Crys Luum. Sei uns willkommen!“ Ein Junge mit dem weißen Haar der Fhari Nyel, jung aber hochgewachsen, gekleidet in nachtblau.
„Sheila Jamos Esqualez von den Amajn. Sei uns willkommen!“ Mit diesen Worten trat Shinaya selbst vor und führte Sheila an ihren Platz im Kreis. Dann wandte sie sich wieder ab und führte das Ritual fort.
„Die Schüler, die heute hier ihren Weg finden wollen, haben ihren Platz im Kreis der Weisen gefunden. Damit sie sich auch im Angesicht der Elemente und der Göttin der Prüfungen beweisen, soll nun das Tor geschlossen werden.“
Die Torwächter führten die dieselbe Zeremonie wie vorher aus, nur in umgekehrter Reihenfolge. Das Flammentor schloß sich, und die Torwächter legten ihre Stäbe vor die Kreislinie und wandten sich wieder der Mitte des Kreises zu. Alle Elrhadainn stimmten ein Summen im gleichen Ton an. Das Summen erfüllte die Kuppel und durchdrang die Görper und den Geist der Anwesenden, bis sie zu schwingen schienen. Die Stimme Shinayas drang wie aus weiter Ferne in die Ohren der Schüler.
„Ihr Schüler werdet den Elementen begegnen, die Ihr gewählt habt oder noch im letzten Augenblick wählen werdet. Zum letzten Mal werdet Ihr sie nun von außen betrachten können, zum letzten Mal habt ihr die Gelegenheit, Euch zu entscheiden. Seht, hört und fühlt nun die Kräfte, aus denen die Welt, Eure Körper und Euer Geist gemacht sind, und spürt, welche von ihnen zuerst Eure Freunde werden. Denn Freunde müssen sie Euch sein, oder Euer Leben ist hier zu Ende, um irgendwo zwischen den Welten ein neues zu schaffen. Euer alter Weg ist hier zu Ende, und ein Neuer Weg erwartet Euch. Wählt weise!“
Wieder eine kurze Pause. Die Elrhadainn standen stumm und mit nach innen gerichtetem Blick in dem Flammenkreis. Plötzlich begann einer der Weisen mit singendem Tonfall zu sprechen.
„Erde! In ihren Tiefen sind unsere Wurzeln. Sie trägt und sie beschützt. Zu ihr kehren wir zurück. Sie ist der Spiegel unserer Hoffnungen und Träume, und der Ursprung aller unserer Kraft. Alles Leben kommt aus der Erde.“
Im Machairas entstand eine Nebelwolke, die sich langsam zu einem Torbogen umbildete. Durch diesen Torbogen konnte man verschwommen einen Nachthimmel erkennen, der mit Sternen besetzt war. Kühle Luft strömte in den Kreis und trug mit sich eine Geruchsmischung von Moder und nächtlichem Wald. Das Tor begann in dunklem violett zu leuchten. Eine andere Elrhadyni begann zu singen.
„Wasser! In ihm ist Heilung für Körper und Seele. Was uns verbindet, wird von Wasser getragen. Wasser fließt, und mit ihm fließen wir durch das Leben und verändern uns. Wasser verbindet uns mit denen, die wir lieben, und auch mit denen, die wir hassen. Was auf uns zurückfällt, wird von Wasser getragen.“
Diesmal entstand die Nebelwolke im Westen. Ganz kurz sah man durch das Tor eine Szene, die ein Sonnenuntergang über einem Meer hätte sein können, und der Wind aus dem Tor trug einen frischen Duft von salzigem Wasser und Leben im Meer mit sich. Die Farbe des Tors war ein dunkles, sattes Grün.
„Feuer! In ihm ist der Wille und die Macht! Das Feuer, das niemals erlischt, ist das Leben selbst. Feuer verändert uns selbst und die Welt mit uns. Flammen der Leidenschaft durchschlagen alle Fesseln, und Flammen des Willens durchbrechen Grenzen zwischen Welten. Das Feuer des Lebens ist die Kraft der Veränderung!“
Eine Nebelwolke im Ophis öffnete ein Tor, durch das gleißendes Licht ohne jegliche Konturen zu sehen war. Ein glühendheißer Luftstrom brachte Gerüchte von überquellendem Pflanzenwuchs und Dschungeln. Das Tor glomm in flammendrotem Licht.
„Luft! Die Quelle der Weisheit liegt in Erkenntnis. Luft zeigt uns unsere Grenzen, und den Weg, sie zu überwinden. Das eiskalte Schwert richtet und vergibt nicht. Wenn wir Weisheit suchen auf dem falschen Weg, wird das Schwert der Luft es uns zeigen. Wind trägt Wissen und auf ihm reiten wir, die Weisheit zu suchen.“
Auch der vierte Gesang öffnete, wie bereits erwartet, eine Art Tor, diesmal im Osten. Darin waren nur undeutliche, von blauem Nebel verhangene Formen zu erkennen. Ein eiskalter Windstoß ließ die Versammelten erschauern. Das Lufttor leuchtete in einem blauen, klaren Licht.
„Die Tore zu den Sphären sind geöffnet.“
Die zwölf Elrhadainn, die vorher das Räucherwerk entzündet hatten, traten vor, jeweils einer von ihnen vor einem der Eldrys. Die Schüler gingen gegen den Sonnenlauf den äußeren Kreis entlang, und wenn sie einen dieser Elrhadainn trafen, erhielten sie von ihm etwas Räucherwerk. Sie traten vor die Eldrys und schlossen die Augen. Was in ihrem Geist ablief, sah man nicht, nur eine Andeutung von Bildern aus farbigem Licht schwebte über dem Eldrys, vor dem ein Schüler stand. Die anderen warteten geduldig, während der Schüler die Sphäre begrüßte und für sich willkommen hieß. Es dauerte nicht lange, und die Schüler schlugen die Augen wieder auf und wanderten weiter, um die gleiche Prozedur für jeden Eldrys auszuführen. Wer genau hinsah, konnte die Bilder über den Eldrys beobachten. Meist stellten sie Wesen dar, die mit den Schülern sprachen, wenn man auch nichts davon hören konnte, und immer erschienen die Bilder in der Farbe des Eldrys der Sphäre. Als die Schüler mit den Eldrys des äußeren Kreises fertig waren, wiederholte sich alles im inneren Kreis. Danach begaben sich Schüler und Elrhadainn wieder auf ihre Plätze im Kreis. Jetzt sprachen die Mentoren die Schüler an:
„Taynya Lir’An! Wähle nun die Sphäre deines Weges! Wähle Weise!“ Das Mädchen schritt um den Kreis herum, und hielt vor dem dunklen, fast lichtlosen schwarzen Korund der Sphäre der Erde. Vor ihr auf dem Podest lag ein Häufchen Räucherwerk, von den Elrhadainn zurückgelassen. Sie nahm etwas davon auf und streute es auf glühende Kohle. Ein tiefes Brummen war zu hören, und fast unsichtbare, durchsichtige Lichtfäden bildeten sich um den Eldrys, umschlangen Taynyas Kopf, flammten kurz auf und schienen in ihrem Haar zu verschwinden. Das Mädchen trat zurück, wanderte zum inneren Kreis hinüber, umschritt ihn, setzte sich auf den Boden, atmete einmal tief ein und aus und schloß die Augen.
„Lanakh Erin’Dar! Wähle nun die Sphäre deines Weges! Wähle Weise!“ Auf die gleiche Art ging der Mann durch den Kreis zum Eldrys des Feuers, nahm Räucherwerk auf und streute es auf Kohle. Rote Flammenfäden umschlangen ihn, und er trat wieder zurück.
„Rúna Raidiyr-an-Aranel! Wähle nun die Sphäre deines Weges! Wähle Weise!“ Die junge Frau wählte die Sphäre der Luft, und haarfeine blaue Lichtfäden verschwanden in ihrem Haar.
„Dar an-Crys Luum! Wähle nun die Sphäre deines Weges! Wähle Weise!“ Den grünen Eldrys des Wassers wählte der Junge, und mit weichen, welligen Bewegungen umschlangen ihn grüne Lichtfäden.
„Sheila Jamos Esqualez! Wähle nun die Sphäre deines Weges! Wähle Weise!“ Sie wußte, wohin es sie zog. Mit langsamen Schritten, sich jeden Augenblick der Bedeutung ihrer Wahl bewußt, ging Sheila den Kreis entlang, blieb vor dem Eldrys ihrer Wahl stehen und streute Räucherwerk auf glühende Kohle. Sie spürte, wie die Kraftlinien des gewählten Elements sie umgaben. Kühler Wind aus allen Toren umgab sie. Eine unauffällige Kraft oder Wesenheit heftete sich an ihren Geist, und sie hieß sie willkommen. Dann trat sie zurück, wanderte hinüber zum Inneren Ring, ging einmal die Runde ab und setzte sich neben die anderen Schüler an den Rand des Inneren Rings.
„Wir heißen die Geister der Sphären in unserem Kreis willkommen!“ klang Shinayas Stimme durch die Kuppel. Sie nahm einen Stab auf, den sie vor sich liegen hatte, und wanderte einmal am äußeren Flammenkreis entlang, dann durch die Mitte der Sphäre der Wesen und einmal um den Inneren Ring herum, bis sie diesen schließlich betrat und vor dem Eldrys der Sphäre der Leere, dem dunkelroten Granat, stehenblieb. Dieser Stein repräsentierte die Verwandlung, die die Schüler gewählt hatten.
„Schüler! Versammelt Euch nun vor dem Altar der Innersten Kraft!“
Die Schüler standen auf und traten nach vor in den Inneren Ring, in dessen Zentrum Shinaya stand, dem Eldrys der Innersten Kraft zugewandt, von dem ein dunkelrotes Glühen ausging. Der Kristall auf Shinayas Stab schimmerte in allen Farben des Regenbogens. Aus den Toren zu den Welten der Elemente drangen farbige Rauchschwaden, und irgendwer schien zu singen. Plötzlich stieß Shinaya mit ihrem Stab nach oben und rief laut: „BEGEGNET NUN DER DUNKLEN GÖTTIN DER PRÜFUNGEN...“
Ein Donnerschlag ließ den Boden erzittern, und ein Blitz fuhr aus dem wolkenlosen Himmel hinab in Shinayas Stab. Gleißendes, blendendes Licht umgab sie, und sie drehte sich um - und vor den Schülern stand nicht die Elrhadyni, sondern eine alte Greisin mit einer weißen Mähne, die im Wind der magischen Energien wehte, und mit flammenden, durchdringenden Augen. In der einen knochigen Hand hielt sie eine glänzende, messerscharfe Sichel, mit der anderen zeigte sie auf die Schüler. Jeder fühlte ihren Blick und ihren Finger ausschließlich auf sich selbst gerichtet. Das Licht in den Augen wurde heller, blendete in den Augen und bohrte sich schmerzhaft ins Gehirn. Mit einer unirdischen Stimme, die dem Krächzen eines Raben ähnelte, sprach die Gestalt die abschließenden Worte.
„...UND SEHT IN DAS AUGE DER VERNICHTUNG!“
Ein Lichtblitz aus ihren Augen bohrte sich in die Köpfe der Schüler. Jemand schrie. Der Boten unter ihren Füßen schien zu schwinden und ihr Geist wurde von Dunkelheit umfangen. Und diese Dunkelheit führte sie hinab und hinüber in eine andere Welt... und zu anderen Begegnungen....
IRGATHANAS OPFER - (Erendyra, Tektoloi, 418 n.P.)
Irgathanas Opfer
(Erendyra 418 n.P.)
„Pamôtron Kallorg, Graf von Lychai, ist für vogelfrei erklärt!“ Herolde riefen in Allennos. Kaum hatten sie begonnen, erreichten schon die ersten atemlosen Adeligen die Tür zur Ratskammer. Ein Held, wer wollte das nicht sein. Und wann bekam man schon einmal die Gelegenheit, einen leibhaftigen Fürsten umbringen zu dürfen? Vielleicht würde es auch eine Belohnung geben? Da öffnete sich die Tür und Pamôtron Kallorg erschien. „Der Verbrecher!“. Und verschwand sogleich wieder. Mit ausgestreckten Armen, ihn zu haschen, und mit offen Mündern standen sie da und schnappten nach Luft.
Die Edlen hatten sich noch nicht von ihrer Verblüffung erholt, da hallte eine kräftige Frauenstimme durch den Gang. „Laßt mich durch da. Wollt ihr etwa eine Frau anfassen?“ Sie kam durch den Gang gelaufen und blieb atemringend vor der Tür des Ratssaals stehen. Ihr folgten zwei Wachen, die offensichtlich nicht wußten, wie sie auf die Situation zu reagieren hatten. Da keiner der Edlen kommandierte, blieben sie einfach stehen und wagten nicht, die Frau anzufassen. Verlegen schaute einer der Wachmänner auf einen dunkelblauen Stofffetzen in seiner Hand.
Eine schöne Frau von schlanker und hoher Gestalt. Sie rang nach Luft. Ihre Wangen waren heftig gerötet. In dem reifen und ebenmäßigen Gesicht rollten die Augen einer Wahnsinnigen. „Ich bin es. Hört Ihr es da drinnen? Ich, Irgathana. Irgathana Kallorg. Hört Ihr es, ihr Verbrecher dort drinnen?“ Sie rief laut genug, daß man es selbst im Hof hätte hören müssen. Einer der Edlen faßte ihren Arm. „Untersteh dich du Bestie.“ Sie wirbelte herum, fauchte ihn an und riß sich wieder los. „Meinen Bruder wollt ihr zur Strecke bringen. Auf Rhyaliandas Befehl. Ha! Das wird unser Gott nie zu lassen. Nie. Erainn! Erainn!“ Die letzten Worte schrie sie aus sich heraus. Dann warf sie sich auf die Knie, in die Pfütze, die unter ihr entstanden war.
Ihr Kleid triefte, als ob sie zuvor in den Burggraben gefallen wäre, aber der Geruch stimmte nicht. Ein seltsames Parfüm, ein Lampenöl? Aus ihrem Rock zog sie zwei faustgroße Steine, die sie über ihrem Kopf gegeneinander schlug. Im Rhythmus der Schläge rief sie: „Erainn! Erainn!“ Mit jedem Schlag stob ein Regen von Funken über ihren Körper. Flammen leckten an dem durchtränkten Stoff des Kleides empor. Einer der Wachmänner versuchte, ihr die Steine zu entwinden, aber er mußte zurückspringen, als die Flammen explosionsartig emporschossen und die Frau in einer zuckenden Säule umgaben.
Sie stand wieder auf und rief: „Erainn! Ich opfere mich ... für ... meinen Bruder ... Pamôtron Kallorg ... meinen einzigen ...“ Danach waren ihre Schreie nicht mehr verständlich. Atemzüge später verstummte sie ganz. Niemand konnte ihr mehr helfen.
TAGEBUCH DES RUTIN SI GULBAN - (Corigani, Aron lon Dorinam, 414-417 n.P.)
Tagebuch des Rutin si Gulban
Aron lon Dorinam, 414 - 417 n.P.
3. Siwan 414 n.P.
Heuer haben die Meermenschen Ernst gemacht: sie haben 30 Schiffe im Hafen versenkt. Jetzt hat sich die leichtsinnige Politik unseres Sturmherren Thalin na Read bitter gerächt. Hätte er doch nur auf die vernünftigen Stimmen in seinem Beraterkreis gehört. Statt dessen gab er aber den Falken in seiner Umgebung den Vorzug und liess es auf eine Konfrontation mit den Meermenschen ankommen. An und für sich hätte das ja gut gehen können, wie ich hörte. Schliesslich war Aron lon Dorinam nicht das einzige Land, das die Maut verweigern wollte, schliesslich hat unser Land enorme Ressourcen für einen eventuellen Kampf gegen Selavan. Doch Thalin nutzte keine Möglichkeit aus, sich mit Gleichgesinnten zu verbünden; er liess auch die Forschung nach geeigneten Waffen im Kampf gegen die Meermenschen versanden. Das kann niemand richtig verstehen. Wenn man etwas anfangen will, so muss man es auch richtig tun!
15. Aw 414 n.P.
Für morgen ist eine ausserordentliche Konferenz der Grossgilden Aron lon Dorinams einberufen worden. Einziges Traktandum: Absetzung Thalin na Reads. Ich als Sekretär der Gulban-Grossgilde werde die Interessen unserer Mitglieder im Rat vertreten; ich wurde von der Versammlung der Gulban-Landesgilden ermächtigt, für die sofortige und unehrenvolle Absetzung des unfähigen Sturmherren zu stimmen.
16. Aw 414 n.P.
Die Versammlung der Grossgilden war teilweise erfolgreich: Man hat mit überwältigender Mehrheit beschlossen, Thalin in ein Kloster im Lansai-Gebirge zu verbannen. Aber noch bevor die Stimmenauszählung vorbei war, kam aus dem Palast die Nachricht, dass Thalin sich in der Morgendämmerung mit einem grossen Teil des Reichsschatzes Richtung Kerlim abgesetzt habe. Dies machte die ganze Sache noch schlimmer, denn nun war Thalin nicht nur ein Versager, sondern auch noch ein Dieb! Deshalb wurde auf seine Ergreifung die Belohnung von 10’000 Gold ausgesetzt und die Ritter von Londor gen Kerlim in Bewegung gesetzt. Leider bis jetzt noch keine Erfolgsnachricht.
28. Elul 414 n.P.
Plötzlich hat sich Thalin als gewiefter Taktiker erwiesen. Auf der Flucht schlägt er dauernd Haken und legt seinen Verfolgern falsche Fährten, durch sie sie immer mehr Zeit verlieren. Zudem kann er mit seiner Diebesbeute Helfer kaufen, die für ein Goldstück die Verfolger in die falsche Richtung weisen, oder die ihn ein Stück weit mit einem Küstensegler nehmen. So ist er in Rekordzeit über die Grenze nach Ciakan entkommen und in den dortigen Sümpfen untertaucht
Deshalb musste der Rat der Grossgilden zugeben, dass Thalin für immer entkommen ist. Aber für die Wiederbeschaffung des geraubten Goldes wurde neu der zehnte Teil davon als Belohnung ausgesetzt, während man nun auf die Ergreifung der Person Thalins verzichtet.
Im Rat wurde in den letzen Wochen hitzig beratet, welchen Weg Aron lon Dorinam jetzt einschlagen soll. Radikale Räte schlugen eine reine Gildenherrschaft vor, die künftig solche Tiefschläge in der jüngeren Vergangenheit verhindern soll. Die Mehrheit aber war dafür, dass Aron lon Dorinam eine konstitutionelle Monarchie bleiben soll, mit den Gilden als Kontrollinstanz. Denn besonnene Stimmen wiesen zu Recht darauf hin, dass auch eine Regierung der Gilden nicht fehlerfrei sein könne, dass eine solche Regierungsform sehr schwerfällig sein werde, da der Sturmherr als einigendes Element wegfallen würde und die verschiedenen Gilden sich wegen ihren eigensüchtigen Interessen gegenseitig blockieren würden.
Als dieses Hickhack endlich vorüber war, konnte es endlich an die Wahl eines neuen Monarchen gehen. Man einigte sich darauf, für die Kandidatensuche ein halbes Jahr aufzuwenden. Danach sollte der am meisten geeignete Bewerber in den Ssakat 414 n.P. gewählt werden.
1. Ssakat 414 n.P.
Es ist unfassbar, was da an Kandidaten für das Amt des Sturmherren zusammengetragen worden sind. Scheinbar hat jede der sechzig Grossgilden einen eigenen Favoriten aufgestellt, denn es bewerben sich über sechzig Leute für die Herrschaft!
Es schaudert mich schon nur beim Gedanken an die endlosen Debatten, die nun unausweichlich kommen werden. Die Wahl wird sicher nicht vor den Ssakat 415 n.P. perfekt sein, denn ich kenne meine lieben Kollegen von den anderen Gilden. Zudem wird es mir, der ich gerne zu einem guten Kompromiss bereit wäre, von den Vertretern der Landesgilden untersagt sein, für einen anderen Kandidaten als den unseren zu stimmen. Ich muss leider Rücksicht auf sie nehmen, so schwer es mir fallen wird, denn sonst würde ich sofort als Sekretär der Gulban-Grossgilde abgewählt werden, und mir gefällt es eigentlich gut in dieser Position.
5. Ssakat 415 n.P.
Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich übertroffen. Ein ganzes Jahr haben wir unterdessen mit endlosen Debatten, politischen Grabenkämpfen und kurzlebigen Allianzen verschwendet, und immer noch stehen über fünfzig Kandidaten zur Auswahl. Ich bin verzweifelt, denn es geht mit Aron lon Dorinam immer schneller bergab. Diese heillose Gildenpoltik macht das Land kaputt, die Landesteile beginnen schon langsam auseinanderzudriften. Hoffentlich gibt es keinen Bürgerkrieg! Da bin ich unendlich froh, dass wir uns nach dem Ende der Herrschaft Thalins für die Beibehaltung der Monarchie entschieden haben, denn wir unersättlich gierigen und eigensüchtigen Gilden sind einfach nicht fähig, uns auf einen simplen Konsens zu einigen. Dies geht so weit, dass wir uns nicht einmal auf geregelte Pausen in der Beratung einigen können. In der Rewha-Grossgilde ist man sich gewöhnt, den Bordago als Ruhetag einzuschalten, also will man die Beratungen auch am Bordago unterbrochen haben. Dem widersetzt sich aber die Batya-Grossgilde, denn bei ihnen gilt der Arodago als Ruhetag. Man stelle sich nur mal vor, es gibt genau sechzig von diesem Grossgilden, jede von ihnen hat einen eigenen, charakteristischen Ruhetag und will diesen auch als Ruhetag für den Rat durchgesetzt haben. Schon nur wegen diesem lächerlichen Problemchen geht Woche für Woche wertvolle Zeit verloren.
Ich bin sehr pessimistisch, wenn es um eine Beurteilung geht, wann diese Marathonsitzung glücklich mit der Wahl zum Sturmherren zu Ende geht. Das Ganze wird wohl noch einen zweiten Jahrestag erleben...
20. Adar 416 n.P.
Der leidige Streit um die Wahl des neuen Sturmherren hat eine unerwartete Wendung genommen. Heute erschien Warthon, der oberste Dondra-Priester in Aron lon Dorinam im Ratssaal und griff in die Diskussion ein. Er bezeichnete sich in einer kurzen Rede als unabhängigen Vermittler und berichtete, dass Dondra im Traum zu ihm gesprochen und ihn angewiesen habe, uns Räten mitzuteilen, dass die Wahl Dondras bereits gefallen sei. In den kommenden Tagen der Ssakat würde offenbar werden, welcher der Kandidaten erwählt sei.
Endlich scheint also die Sache ausgestanden zu sein: Wir Räte, die zum grössten Teil unterdessen eingesehen haben, dass wir absolut unfähig sind, ausserhalb der internen Affären der Gilden Entscheidungen zu treffen, waren erleichtert, dass jetzt eine höhere Macht eingegriffen hat und für uns entschieden hat. Ich bin sehr gespannt, welcher Kandidat der Glückliche Auserwählte sein wird. Ich fiebere dem Beginn der Ssakat entgegen.
3. Ssakat 416 n.P.
Zu unser tiefstem Erstaunen war es keiner der Kandidaten der Gilden, der durch Dondra gekennzeichnet wurde, sondern es war der jüngere Bruder des alten Sturmherren Thalin, Dhiarra na Read! Aber ich greife vor, alles der Reihenfolge nach:
Am ersten der Ssakat geschah es, dass Dondra den Krönungsturm zu Londor zum Zentrum eines Wirbelsturms machte, der niemanden unbehelligt den Platz rings um den Turm betreten liess. Priester Warthon aber versammelte alle Kandidaten vor dem Platz und sprach zu ihnen, dass Dondra seinen Auserwählten sicher und unbehelligt den Krönungsturm betreten lassen werde und befahl ihnen, es zu versuchen. Keinem der sechzig Kandidaten der Gilden gelang es, mehr als einen Schritt weit in den winddurchtosten Platz zu setzen. Alle wurden weit durch die Luft geschleudert und unsanft ausserhalb des Kreises des Platzes abgesetzt. Nun rief Warthon jeden der Anwesenden auf, sein Glück zu versuchen. Darunter waren auch verschiedene Verwandte der bisherigen Sturmherren und viele Höflinge, die natürlich das Gefühl hatten, besonders auserwählt zu sein. Und wirklich, einer lief seelenruhig schnurstracks zum Tor des Krönungsturmes und betrat ihn. Doch es war keiner der selbstsicheren und aufgeblasenen Höflinge, sondern der jüngste Sohn der vorletzten Sturmherrin und ihres fähigsten Magiers, Dhiarra na Read, der kaum volljährig geworden ist!
Nachdem Dhiarra auf dem Balkon des Turmes erschien, legte sich der Wirbelsturm und er sprach zum sich versammelnden Volk. Er berichtete er, dass Dondra seit einiger Zeit zu ihm im Traum spreche und ihn gründlich auf die Aufgabe als Sturmherren vorbereitet habe. Und wirklich, der blutjunge Mann strahlte Würde und Selbstsicherheit aus. Er ist ein wahrhaftiger Herrscher, geboren um zu befehlen. Schon jetzt war ich bereit, ihn voll anzuerkennen und mich ihm unterzuwerfen. Ich bin sicher, dass es nicht nur mir so ging!
Er liess uns wissen, dass der Tag seiner Krönung am 10. Tammus des kommenden Jahres sein werde, der ein grosser nationaler Feiertag ist und befahl uns allen, alle nötigen Vorbereitungen dazu zu treffen. Voller Freude, endlich wieder einen Herrscher zu haben und endlich den ermüdenden und fruchtlosen Ratssitzungen entkommen zu sein, machten sich die Gildenräte ans Werk und begannen, eine würdige Krönung und ein rauschendes Fest zu organisieren, das am 10. Tammus stattfinden soll.
10. Tammus 417 n.P.
Heute um zehn Uhr begann der offizielle Teil der Krönung mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages, der Dhiarras Ernennung zum Sturmherren legitimiert. Ich war als Vertreter der Gulban-Grossgilde anwesend und setzte im Namen meiner Gilde meine Unterschrift unter das Dokument. Damit war die Krönung eigentlich schon besiegelt, doch am Nachmittag begann die eigentliche Krönungszeremonie; Dhiarra ritt auf dem heiligen Pferd der Könige zum Krönungsturm, begleitet von seiner rot-schwarz gekleideten Leibgarde. Dann betrat der künftige Sturmherr den Turm allein. Was in der folgenden halben Stunde im Turm geschah, weiss niemand, das ist das Geheimnis der Herrscher Aron lon Dorinams. Die Legende geht so, dass in jener halben Stunde der Sturmherr durch seine Ahnen zu gutem Königstum ermahnt wird. Wer weiss, ob das stimmt.
Dann betrat Dhiarra den Balkon des Turmes, so dass jedermann dem folgenden Wunder der Krönung beiwohnen kann. In einem uralten Ritual erscheint der erste Sturmherr Aron lon Dorinams, Hagron, der das Land und den neuen König segnet und wieder verschwindet. Danach erscheinen zwei weitere legendäre Gestalten, Maggo der Kühne und Dionigar von Londor, die Dhiarra im Namen der Armee und des Volkes das Recht übergeben, über Aron lon Dorinam zu herrschen.
Damit war die Zeremonie vorbei und Dhiarra na Read ritt wieder zum Palast zurück, wo er das Zeichen zum Beginn des Volksfestes gab. Auf dem Gelände des Palastes hatten die Köche schon seit Tagen das Festmahl für das Volk von Londor vorbereitet, das sich nun dort versammelte und mit dem Gelage begann, während der Sturmherr, die Gildenvertreter und die Edlen aus allen Teilen des Landes im Innern des Palastes mit ihrem Fest begannen.
Ich schreibe noch schnell diese Zeilen fertig, bevor ich mich wieder ins Getümmel des Festes werfe; denn in zehn Minuten, um Mitternacht, soll ein prächtiger Ball beginnen und ich möchte mal wieder mein Tanzbein schwingen und vielleicht die eine oder andere Dame kennenlernen...
SCHLACHTFELD DER MONSTER - (Cyrianor, 424 n.P.)
Schlachtfeld
Die Sonne stand hoch über den schwelenden Feldern, doch sie wärmte nicht. Ein dünner Dunstschleier hatte sich gebildet, wie um Alles zuzudecken, die Ereignisse vergessen zu machen, ungeschehen zu machen. Wie um allen Beteiligten zu sagen: Vergesst! Vergesst. Doch zu vergessen war unmöglich, zu klar waren noch die Schrecken der Schlacht, zu lebhaft die Erinnerungen an abgehackte Glieder und zertrümmerte Körper. Die Schreie der Monster hallten immer noch gespenstisch in den Dunstschwaden umher. Zum Vergessen bräuchte es Trank, und den gab es hier nicht.
Mühsam stapfte der alte General durch die Vernichtung. Gestern war hier noch ein grüner Hain gewesen, kraftvolle Bäume in voller Pracht, Vögel, die im Buschwerk zwitscherten und Kleingetier, auf der Suche nach Paarungspartnern. Heute sah man nur einen braunen Morass. Die Bäume waren umgestürzt, die Tiere geflohen oder im Kampf der Heere als bedauernswerter Kollateralschaden umgekommen, das Gras zertrampelt, der Boden von schweren Schritten aufgeweicht. Anstelle des Zwitscherns der Vögel hörte man nur das pausenlose Brummen der Fliegen, die in Scharen auf diesen Ort des Verfalls herabgestossen waren, und sich nun in dunklen Wolken um die Körper der toten Soldaten scharten, ein Festmahl zu halten. Angewidert ob dieser Verschwendung trat der General an den nächsten Körper heran und versuchte, die dunkle Massen kleiner Insekten zu verscheuchen. Einer der Seinen. Ein Bein fehlte und der Kopf war halb zertrümmert, aber der General erkannte diesen Krieger. Wie auch die anderen, die er bislang gesehen hatte. Jeder seiner Krieger war ihm wie sein eigen Fleisch und Blut, jeden einzelnen von ihnen hatte er persönlich ausgesucht und von früh an persönlich betreut. Jeden einzelnen konnte er in dunkelster Dunkelheit an seinen individuellen Eigenschaften erkennen. Und nun lagen sie hier, zertrümmert von den grausamen Monstern.
Auf seinen Wink sprangen Träger herbei und bargen den geschundenen Körper seines Kriegers. Dein Tod soll nicht vergeblich gewesen sein. Die Träger würden die Toten in die Heimat überführen, wo sie angemessen behandelt werden würden. Eine Art Seufzen entrang sich der Kehle des Generals, als er an die Geschehnisse der Schlacht zurückdachte: Die Monster waren deutlich in der Überzahl gewesen, als sie ihren Angriff vortrugen. Silbern glänzte ihre Haut im bleichen Mondlicht, ihre grotesken Köpfe waren von länglichen, buschartigen Auswüchsen gekrönt. Tief lagen ihre Augen in ihren silbernen Schädeln, kalter Hass war darin zu lesen. In ihren vorderen Gliedmaßen hielten sie bizarre Gegenstände, deren Zweck nur allzubald klar wurde: Ein langer Stock, der wundersamerweise durch die Panzer seiner Soldaten glitt, wie ein Stein durch die Wasseroberfläche; und eine grosse Planke, die die Angriffe seiner Soldaten wirkungslos abprallen ließ. So kamen sie herangestürmt, unaufhörlich ihre gräßlichen Laute ausstoßend, ein wahnsinniges Gellen, welches Wasser gefrieren lassen könnte. Und die Monster griffen an ohne Sinn und Verstand, geführt nur von einer unnatürlichen Intelligenz, deren einziges Ziel die Vernichtung aller anderen Lebensformen war.
Nach diesem anfänglichen Schock, hatten sie ihren Widerstand organisiert, den ersten Ansturm zurückgeschlagen. Dann der Gegenangriff. Das folgende Gemetzel war fürchterlich gewesen. Kaum einer seiner Krieger, der unverwundet war. Kaum eines der Monster, das nicht blutend vom Feld wankte. Glieder, Köpfe und Leiber lagen wahllos verstreut auf dem Schlachtfeld herum. Mit solcher Wut hatten sich seine Krieger verteidigt, daß sie die Körper der Monster einfach zerfetzt hatten. Mit solcher Arroganz hatten die Monster angegriffen, daß sie die Köpfe seiner Krieger oft einfach abgehackt hatten. Keine Seite machte Gefangene. Aber sie hatten standgehalten, sie hatten die Monster zurückgeschlagen und sich eine Art Patt erkämpft. Sie hatten herbe Verluste erlitten, aber die Verluste der Monster waren noch größer. Der Vormarsch der Monster war aufs Erste gestoppt. Sicher, diese würden sich jetzt neu gruppieren und wieder angreifen, aber auch anderswo hatten die Monster herbe Verluste erlitten. Und die Armeen des Stammes würden sich erst zufriedengeben, wenn die Monster aus dem Stammesgebiet verdrängt worden waren. Schon jetzt rückten neue Heere nach, die Verteidigung gegen die Monster zu verstärken. Und in den Brutstätten des Stammes reiften neue, gewaltigere Krieger heran.
Tk’Irg N’Tlik hob den leblosen Körper eines Angreifers auf und warf ihn den Trägern zu. Alle Toten wurden nun vom Schlachtfeld geborgen, um dann später den Verdauern übergeben zu werden. So erfüllten selbst die Toten des Stammes noch eine wichtige Funktion. Mit diesem Überangebot an Nahrung würden die neuen Krieger zu wahren Kolossen heranwachsen, denen die Monster Nichts entgegensetzen könnten. Die Zyklen der Monster waren gezählt.
Aus Bote von Cyrianor 07, 424 n.P.
JOWANIS TAGEBUCH - (Zhaketia, 421 n.P.)
Endlich ...
Aus dem Tagebuch von Jowani
geschrieben am 9. des Dachsmondes 421 nP
... haben sich alle versammelt. Das große Zelt ist bis zum letzten Platz gefüllt. Die Heerführer der verschiedenen Heere kann man schnell an ihren Tuniken erkennen, während die Feuerläufer ihre tätowierten Flammen auf ihren Oberkörper zeigen und auf jegliche Oberkörperbekleidung verzichten. Auf einer Tischecke hockt eine mir wohl bekannte kleine grüne Gestalt, die wohl ein Talisman der Burgherrin zu sein scheint, denn welche Rolle sollte dieser Wicht sonst übernehmen ? Mit einem Nicken begrüße ich Tasrail, den jungen Anurpriester, den ich beim Orakel traf und der mir schnell zum Freund wurde.
Durch einen Vorhang betritt nun Isha Tuavera das Zelt und begibt sich stumm zum Kopf des Tisches. Alle Gespräche sind verstummt und im Zelt macht sich ein lautes Schweigen breit. Ein Kribbeln auf der Haut verspüre ich, als ob Magie im Raum gewirkt würde, aber es wird wohl nu die innere Spannung sein auf diesen Augenblick.
Isha beginnt zu sprechen: “ Heute ist der Tag, den ein Orakel uns vor langer Zeit verkündet hat. Das Volk der Anuri erhebt sich wieder mit den Feuerzwillingen an seiner Seite. Die Schmach, die wir erlitten, ist getilgt und die Buße bezahlt. Das letzte Mal soll vom alten Orakel verkündet werden, was nun wahr ist:
„ Erst lange Zeit nach meinem Tod sollen die Hüter sich wieder erheben !“
Heute ist dieser Tag, der erste Tag des Dachsmond. Wenn wir gegen unsere Feinde bestehen und unserem Sicherheit geben können, wird Anur uns vielleicht unser altes Privileg wieder gewähren: Hüter des Orakels. Doch bis dahin gibt es genug zu tun und nur Anur weiß wann und wo das Orakel neu geboren wird. Ab jetzt heißt es aber: Lang lebe das Volk der Anuri, lang lebe Quadad ! –(Die Versammelten stimmen in den Ruf mit ein) – Macht Euch nun auf und erfüllt eurer Schicksal !“
Sogleich strömen die Versammelten zu den Ausgängen und draußen macht sich das Geräusch der jubelnden Menge und von abziehenden Heeren bereit. Währenddessen begeben sich Tasrail und ich zu Isha Tuavera. Gerade als ich beginnen will etwas zu sagen, bringt sie mich zum Schweigen: „ Halt, sprecht nicht hier. Es herrscht zwar Frieden, aber auch das einfache Volk darf nicht alles erfahren und auch nicht. Folgt mir in meine Gemächer, dort wollen wir weiterreden!“
Ohne weiteres Zögern verläßt sie das Zelt und führt uns zu ihren Gemächern. Obwohl die Sonne gerade erst beginnt die Zeltstadt zu erleuchten, bin ich beeindruckt von dem großen Garten, dessen sattes Grün trotz des morgendlichen Dunstes schon durchscheint. Welch ein Unterschied zu der kargen Welt außerhalb der Stadt. Kein Wunder, daß den Bewohnern der Stadt die Wüste außerhalb einsam und verlassen vorkommt und weshalb sie ihren Namen bekam. Doch schon bald muß ich meinen Blick von diesem Wunder abwenden, denn wir erreichen die Gemächer der Pura – Priesterin.
Auf Kissen sitzend und Wasserpfeife rauchend warten wir höflich bis es Isha gefällt mit der Unterredung anzufangen. „ Ich möchte eigentlich nichts von euch wissen. Mir ist egal wo ihr herkommt, allein, daß ihr da seid, zählt. An mir liegt es nun euch auf eure zukünftigen Aufgaben ein wenig vorzubereiten. Nun, zunächst werde ich euch verzaubern.“ – Während sie das sagt, wird mir ein wenig mulmig und sie scheint es gemerkt zu haben, denn sie lächelt mich an, während sie fortfährt - „Wie mir scheint weiß zumindest Jowani nicht, wie es ist, verzaubert zu werden, doch soltet ihr diesen Schutz genießen. Er nennt sich Verschmelzung mit der Natur, warum werdet ihr wohl selbst noch herausbekommen. Seid nun still!“ Sie beginnt ein paar umständliche Worte zu murmeln und wieder spüre ich ein Kribbeln, wie ich es schon im Versammlungszelt wahrgenommen habe, nur daß es diesmal nicht so lange andauert.“ Während der restlichen Stunden sollt ihr noch ein wenig darüber erfahren, wie ihr euch in fremden Städten Gehör beim Volk verschaffen könnt.“
Nach diesen lehrreichen Stunden, die nur durch ein kurzes Mittag- und Abendessen unterbrochen wurden, entließ Isha uns und gab uns jeweils einen Rat mit auf den Weg:
„ Tasrail, vertraue ruhig dem Kobold, Du wirst es nicht bereuen, auch wenn er dich manchmal zu täuschen scheint. Und Du, Jowani, werde Dir zunächst über Deinen Weg klar bevor Du einen Punkt erreichst, an dem Du nicht mehr umkehren kannst. Vielleicht solltest Du erst einmal die Welt außerhalb Deiner Heimat kennenlernen. Schließe Dich doch dem Erkundungsheer an, welches nach Cyrannia und weiter nach Zwarniac reist. Wenn Du allerdings direkt dort hin reisen möchtest, es liegt am Meer der Tränen, dort wo ...(nun erzählt sie ihm die Position)...
Ich wünsche Euch, daß ihr euer Schicksal liebt und nicht dagegen ankämpft. Möget ihr bald wieder Gast in Shabulei Quadad sein und Euch die Feuerzwillinge bis dahin beschützen!“
Als wir aus dem Zelt heraustraten verabschied ich mich von Tasrail, mein Schicksal liegt in Cyrannia und Zwarniac,seines für mich in undurchdringlichem Nebel.
In derselben Nacht saß ich dann auf meinem Pferd. Ein schwarzer Vollbluthengst genauso jung und ungestüm wie ich. Mit dem Erkundungsheer 100 machten wir uns auf die Reise.
Alle Männer waren gute Reiter und schnell war klar, warum die diese Männer als Erkunder ausgewählt worden waren. Nahezu lautlos konnten sie sich mit ihren Pferden bewegen. Mensch und Pferd schienen mit ihrer Umwelt eins zu sein. Die Pferde gehörten zum besten was das Reich Quadad zu bieten hat, schnelle und ausdauernde Pferde, dabei jedoch schlank und grazil aussehend. Kein Wunder, daß alle Männer ihre Pferde sorgsamst versorgten. Die Ausrüstung der Krieger bestand nur aus dem nötigsten an Bewaffnung – Dolch, Krummsäbel oder Bogen – auf großartige Rüstung wurde ganz verzichtet und die Pferde trugen nur leichtes Zaumzeug und Satteltaschen, in denen Verpflegung und Decken verstaut wurden. Wohl dank der Verzauberung, die mir Isha gewährte, gelang es mir ähnlich gut mit der Wildnis zu verschmelzen, wie es den Erkundern gelang.
Tag für Tag gewöhnte ich mich mehr wieder an dieses Leben, Ein Mond von der Wildnis getrennt gewesen, brauchte ich etwas Zeiz, um mich wieder an dieses Leben zu gewöhnen, doch als es soweit war, übertraf ich die Erkunder bei weitem in ihren Fähigkeiten mit der Umwelt zu verschmelzen und sie respektierten mich als einen der ihren. Einer meint, daß es Anur wohl gut mit mir meine und mich gesegnet hätte. Schmunzelnd entgegnete ich , er läge wahrscheinlich nicht ganz daneben.
Nach und nach bezog mich auch der Führer der Erkunder, Hadjem, mehr und mehr in die Entscheidungen ein, wer auf eine Erkundungstour zum Spähen geschickt werden solle, welcher Weg eingeschlagen werden soll. Meine Jugenderfahrungen und der Glaube an Anur machten sich bezahlt. Einig waren Hadjem und ich uns, daß wir keinen der Männer in Gefahr bringen würden, wenn es nicht unbedingt nötig war. Feindliche Heere würden wir umgehen oder uns notfalls zurückziehen. Doch wenn dies der Fall sein sollte und wir tatsächlich auf ein gegnerisches Heer oder ein Monster träfen, so würde ich mittels einem Zaubersturm einen Sandsturm erzeugen, in dessen Deckung wir an dem Heer vorbeiziehen könnten oder vor ihm fliehen würden, natürlich lieber ersteres. Schließlich sind wir alle jung und neugierig, was es bei unserem Nachbarn so zu sehen und entdecken gibt...
WELLENSCHLAG (Yhllgord, Morassan, ca. 416 n.P.)
Es war ein schöner Spät--Nachmittag gewesen. Noch so ein bißchen die Hitze vom Tag, die sich als Wärme auf die Haut legt. Doch schon der nahende Abend, die kommende Nacht. Die Schwärze und die Kälte der Nacht, die diese Hitze wegziehen, die den Menschen in Vorahnung frösteln lassen und die dadurch die Wärme fast angenehm machen, auch wenn man am Tage noch so sehr geschimpft hat. Die Bucht war nicht sehr tief, daher lagen wir weiter draußen vor Anker. Fast zwei Jahre waren wir umhergesegelt. Von Küste zu Küste, von Insel zu Insel. Nur kurz Proviant und Wasser auffüllen. Nur kurz die Nachrichten und Befehle abholen, die in den Häfen auf uns warteten.
Was wir die lange Zeit über so gemacht haben? Tut mir leid, aber ich darf nichts sagen. Unser ganzes Tun war streng geheim. Obwohl es bald dreißig Jahre seit damals sind, kann ich dennoch nichts sagen. Wir wurden alle einzeln ausgewählt und mußten einen Eid leisten zu schweigen. Und dürfte ich erzählen, so wären es doch keine aufregenden Geschichten. Keine Schlachten, keine wilden Abenteuer, keine Entdeckungen. Alles eher eintönig. Sie verpassen also nichts.
Aber an diesem einen Abend sollte sich mein Leben ändern. Bin seither nicht mehr zur See gefahren, habe nicht einmal meine Füße auf ein Schiff gesetzt. Ich traue mich nicht mehr.
Lachen Sie nicht! Nicht, daß ich ein Angsthase wäre, aber ich traue dem Ganzen nicht mehr. Ich würde mich unsicher fühlen. Es ist wie bei den Menschen. Wenn man einmal von einer Person enttäuscht worden ist, dann vertraut man ihr ja auch nicht mehr, nie mehr. Und so geht es mir mit den Schiffen und der Seefahrt; das Vertrauen ist weg. Nun denn...
In ein, zwei Tagen würden wir nach Hause kommen; würden wir dort landen, wo wir gestartet waren. Wir freuten uns auf `Zuhause', freuten uns auf unsere Heimat. Nicht daß die Stimmung ausgelassen gewesen wäre, dafür waren wir zu diszipliniert und zu gewissenhaft. Nein, aber wir alle hatten diese Vorfreude in uns. Dieser Geruch nach Erde, nach festem Land, nach Bäumen war so unwahrscheinlich schön und aufregend.
Vor allem war es der Geruch unserer nahen Heimat. Und dann diese warme Luft, die den Körper einhüllt und ihn umfängt. Der Himmel, an dessen Horizont das Rot verglimmt. Die freudige Erwartung. All dieses. Die Unruhe und Gespanntheit; Hast, die die wenigen verbleibenden Augenblicke nicht mehr aushalten will.
Es war absolut windstill. Die Luft stand. Kein Hauch, kein zartes Wehen. Nichts. Hätte sich bis zum folgenden Tag kein Wind erhoben, so hätten wir in der Bucht verbleiben müs sen. Oder wir hätten unsere Boote losgemacht und das Schiff rudernd gezogen. Keine Wolke, kein Wind; nur die Wärme, die Stille, der Geruch nach Festland. Abend, Nacht. Gänzlich finster wurde es nicht, mit guten Augen ließ sich noch alles erkennen. Die Wärme, das Land, dieses ewige Wiegen des Schiffes, dieses ständige Wissen, daß man der Natur ständig ein Schnippchen schlägt, indem man ihren Gesetzen widerspricht, indem man das eine Naturgesetz gegen das andere ausspielt. Die Wärme, das Atmen der Anderen in ihren Hängematten, das nahe Land. Das Land, das Land. Die vielen Tage der Wiederholung, des endlosen Meeres, das sich stets wiederholt. Und das Ende, das Ende der Reise, das Abmustern so greifbar nahe. Die Wärme, die Windstille, das Land.
Ich weiß, daß es Wahnsinn war und daß es mich den Kopf hätte kosten können. Doch ich habe schon immer auf eine Instinkte vertraut. Eine Stimme raunte mir zu: " Das Land, sieh Dir nur das Land an, es ist nahe, es ist nahe, es ist festes Land, es riecht nach Erde, es riecht nach Unbeweglichkeit, es ist Land, es ist Land." Die Wärme, das Land, die Windstille. Ich schlich an den Nachtwachen vorbei und konnte unbemerkt ein kleines Boot zu Wasser lassen. Mit meinem Hemd und meiner Hose umwickelte ich die Ruder, so daß ihr Eintauchen keinen
Lärm verursachte. Und unbemerkt konnte ich entkommen. Ich wollte nur ein paar Stunden am Strand schlafen und dann rechtzeitig zurückkehren. Würde ich dann erwischt, so würde ich eine Strafe willig auf mich nehmen. Ich denke, daß eine Sache, die man wirklich genießt, es wert ist, daß man für sie leidet. Aber darüber wollte ich mir noch keine Gedanken machen. Ich zog das Boot bis über die Flutgrenze und legte
mich nieder. Die Luft stand noch immer. Durch die Anstrengung und durch die Wärme war ich mit Schweiß bedeckt.
Sogleich schlief ich ein.
Ein Albtraum weckte mich. Aus der Dunkelheit schloß ich, daß ich nicht lange geschlafen haben konnte. Doch wie erstaunte ich, als ich sah, daß das Schiff fort war. Ich war alleine.
Doch wie konnten sie weg? Es regte sich kein Lüftchen. Und wieso? Wieso mitten in der Nacht? Ich war alleine.
Verlassen. Einsam. Was sollte ich tun? Nach Sonnenaufgang er gründete ich die Bucht und fand ein kleines Dorf. Man half mir. Zu Land kam ich in dem Hafen an, den wir zu Schiff verlassen hatten. Keiner wußte etwas. Nichts.
Ich verdiente mir den Lebensunterhalt mit unterschiedlichen Geschäften. Dort in jener Hafenstadt, ständig die Ohren offen für mögliche Zeugnisse von meinem Schiff. Nach Jahren dann vernahm ich etwas von einem Unglück. Ein Schiff hatte ein anderes gerammt. Nichts hatte auf die Katastrophe hingedeutet. Das andere Schiff war scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Ruhiger Seegang, klares Wetter, hellichter Tag.
Nicht weit von der Küste. Doch plötzlich war es da. Von jenem Geisterschiff überlebte niemand, zumindest wurde keiner geborgen. Der Mann, der mir davon erzählte, konnte mir sogar das Datum nennen. Denn es war der Tag, an dem er geheiratet hatte. Sie brachen seine kleine Feier ab. Die ersten Überlebenden wurden gebracht, die ersten Opfer behandelt. Daher wußte er noch immer das Datum. Ich hatte die Geschichte anfangs noch für ein weiteres Stück Seemannsgarn gehalten. Doch dann horchte ich auf. Der Tag war jener, an welchem mein Schiff verschwand. Tausende von Meilen, fast am anderen Ende der Welt hatte sich das Unglück ereignet. Am gleichen Tag. Dort war ein Schiff aus dem Nichts aufgetaucht, so wie mein Schiff in das Nichts verschwunden war.
Ich verließ die Stadt.
Seid nun so freundlich und reicht mir den Weinkrug. Meine Kehle dürstet es nach dem edlen Naß des Verdrängens.
LIEDER? - (Corigani, Aldaron, 419 n.P.)
Lieder ?
(Corigani 419 n.P.)
Talon saß wieder in dem Raum der ihm nun nur all zu vertraut war. Vor ihm der massive Tisch, gewachsen aus einer alten Eiche. Auf diesem Tisch liegt nur ein Buch, doch der Tisch scheint fast zu brechen unter dem schweren Buch.
Es ist das Buch Denas, das schon seit Pondaron hier liegt.
Es ist das Buch Denas, welches nur der Hochkönig der Aldar zu lesen im stand ist. Er saß wieder eine ganze Weile vor dem Buch, für ihn nur Augenblicke aber für seinen alten Lehrer und Berater waren es mehr als nur Augenblicke.
Wendwin saß daneben und ging einige andere, auch sehr alte Bücher und Schriftrollen durch, doch ihm war es nicht vergönnt die Zeit an sich vorbei ziehen zu lassen. Er laß gerade ein Buch über die Kraft die sich ein fähiger Magier aus der Natur nehmen konnte.
Immer noch wahr es im Unklar warum der König immer noch an diesem Buch las. Ja, es war Dick, aber nicht unendlich. Oder vielleicht doch ? Waren die Seiten immer wieder neue wenn der König anfing zu lesen ? So viele Fragen, doch die meisten würden ohne Antwort bleiben.
***
Zwei Tage später kam Wendwin wieder in den Raum der Magie, wie ihn der König nannte. Seit nun mehr einer Woche war der König nicht mehr aufgestanden. Es wurde Zeit das er mal wieder an die frische Luft kam.
Kaum hatte Wendwin diesen Gedanken fertig gedacht stand der König plötzlich auf, als könne er seine Gedanken lesen.
Talon griff nach einem Glas Wasser, das immer bereit stand und lehrte es mit einem großen Schluck.
„ Nun mein Freund, wie lange war ich diesmal nicht hier“ fragte er mit einem lächeln auf den Lippen.
„ Doch eine Woche, so. Nun denn ich hatte ja auch wieder viel zu lernen. Nun aber wird es Zeit das ich probiere was Dena mir beibringt. Laß uns in den Wald gehen auf das ich probieren und erkennen kann.“
***
Der Wald war angenehm kühl jetzt im Dachsmond. Viel kühler würde es auch das ganze Jahr nicht mehr werden bis dann im Frühling die Wärme zurückkommen würde.
Talon suchte sich eine kleine Lichtung in deren Mitte er sich dann stellte.
„ Wendwin, mein Freund, ich hoffe Eure Nerven sind noch genau so fest wie sie es früher waren. Erschreckt Euch nicht bei dem was jetzt passieren soll.“
Der König breitete die Arme aus und fing an Gesten in den Wind zu malen. Dabei sahen seine Bewegungen eher einem Tanz als einem magischen Ritual ähnlich. Ein Tanz den er nur mit sich und dem Wald tanzte. Wenn man ihm dabei so zusah konnte man denken er tanze zu eine Unhörbaren Melodie. Nach ein paar Minuten dieses Tanzes öffnete er seine Lippen und er begann.....zu singen.
Die Sprache die seine Lippen verließ war eine Sprache wie sie wohl die ersten Elfen auf Corigani gesprochen haben müssen. Von einem inneren Leuchten, zugleich wild doch im nächsten Moment so lieblich wie das lächeln einer Königin.
Nun sang der König nun schon über 10 Minuten und Wendwin fing langsam an den Erfolg zu bezweifeln.
Da veränderte sich die Gestalt des Königs. Erst schien es als ob er sich in einen Baum verwandeln wollte. Er wurde größer, seine Haut wurde langsam immer brauner, seine Arme immer massiger, bis er eher einem Bären als einem Elfen glich und selbst da hörte er noch nicht auf zu wachsen. Erst als er so groß war wie eine der größten Eichen hier hörte er auf zu singen. Als er aufhörte sich zu bewegen konnte man auf den ersten Blick nicht erkennen das dort etwas anderes als ein Baum steht. Nur wenn man die Rinde oben am Baum näher betrachtete konnte man dort ein Gesicht erkennen das zu lächeln schien.
***
Wendwin saß mit dem König in einem der vielen Gärten des Palastes. Der König sah immer noch ein wenig erschöpft aus aber er strahle über das ganze Gesicht.
„Es war einfach herrlich, dieses Gefühl. Ich weiß auch nicht wie ich das genau gemacht habe, ich habe einfach das gemacht was für mich richtig erschien. Und Du hast gesehen, es hat funktioniert. Es ist schon interessant was ein Lied alles bewirken kann.“
EIN TAG IN AURINIA 1 - (Ysatinga, Aurinia, 404-405 n.P.)
Ein Tag in Aurinia (1)
"Sendet mir den Nächsten herein", sagte er, wieder etwas besserer Laune. Blaß wirkte er noch, denn in den letzten Nächten hatte er wenig, und wenn, schlecht geschlafen, was kein Wunder war angesichts der Zustände in der Welt und in der Umgebung seines Landes, was aber auch mit den - dank der Weißblütenbäume nur mäßig erfolgreichen - Versuche des Herrn der Untoten zu tun haben konnte, vor denen ihn das Orakel von Esmaryll rechtzeitig gewarnt hatte. Der Herrscher war früh aufgestanden, um die ersten Berichte der Späher und Fragensteller(1) entgegenzunehmen und diesen Berichten und dem Urteil der Weisen an seinem Hofe gemäß die Entscheidungen zu treffen, die für diesen Tag und diese Woche zu treffen waren. Sie hatten Philanthus schon seit sechzehn Wochen nichts Gutes mehr gebracht. Vor sechzehn Wochen, ja, an einem sonst schönen Ardago hatte er definitiv Kunde von der Lage Aurinias erhalten, ein Wissen, das in den langen Jahren des Chaos über Ysatinga verloren gegangen war.
'Ja, das Chaos', dachte er schwermütig. Es drohte wieder die Schwertwelt zu überschwemmen. Würden sie, würde die Liga stark genug sein, um der Front der Reiche - Chi-Tai-Peh, Kartan, Titanik, Ygora (und dazu vielleicht noch den Eisriesen und den Monstern Stormwhips) -auf lange Zeit zu trotzen? Noch war die Position der sogenannten Neutralen unklar.
Dann aber richtete er seine Gestalt auf, um den nächsten Besucher würdig empfangen zu können. Schließlich war er, Philanthus von Aurinia, trotz seines jungen Alters (er hatte noch nicht einmal die dritte Oktade vollendet) die Hoffnung seines Volkes, der Iron von Aurinia, und hatte von daher die Verkörperung all der Tugenden und auch der Hoffnungen seines Volkes zu sein... Dann wurde die Tür geöffnet. Katzbuckelnd und voll ausgesuchter Höflichkeit näherte sich ein Mann, der, sich die Hände reibend, dann stehenblieb und anhub zu reden:
"Seid gegrüßt, oh Philanthus, Herrscher über das schöne Aurinia, der Ihr die Krone der Lichtwelt seid! Einen weiten und beschwerlichen Weg habe ich zurückgelegt, um Euch etwas zu bringen, auf das Ihr nicht verzichten könnt: "Wasser des Lebens". Einen Moment wartete der Besucher auf eine Reaktion, einen erstaunten Ausruf vielleicht, aber sein potentieller Kunde verzog keine Miene, Philanthus wartete.
"Dies ist das berühmte 'Wasser des Lebens", hob sein Besucher von Neuem an: "Es wurde geschöpft aus dem legendären Jungbrunnen der Hestande te Jegy (2), und garantiert eine Lebensspanne in Freude und Gesundheit, wie sie auch die Aegyr dadurch erhielten. Weit von Peristera bin ich gekommen, von den Höhen von Resamyd, wo mir ein alter Mann diese Ampulle zum Dank für die Rettung vor Echsenmenschen(3) gegeben hatte. Für eine im Vergleich zu seinem Wert lächerliche Sum..." Philanthus unterbrach ihn, sich wundernd, warum wohl die Fragensteller noch nichts über diesen Mann aus Peristera berichtet hatten: "Habt Ihr, da Ihr doch, wie Ihr sagt, aus dem Zeichen der Taube kommt, irgend etwas Ungewöhnliches gesehen?" "Nichts besonderes, oh Sonne der Lichtwelt." "Und die Rauchwolken, von denen mir immer wieder, sich nähernd, berichtet wird? Keine fremden Heere?"
Offensichtlich war dieses Thema dem dunkelgesichtigen Mann unangenehm, denn er begann, nervös mit den Fingern im Saum seines Umhangs zu spielen. "Freudenfeuer werden es sein, als Feier Eures großen Entschlusses, der Liga gegen Finstere Einflüße beizutreten. Darum würde ich mir an Eurer Stelle keine großen Sorgcn machen. Und fremde Heere? Wer würde es wagen. Euer Land anzugreifen? Also - nur für..." - Weiter kam er nicht in seiner Rede. "Scharlatan", brüllte Philanthus ihn an, "verschwinde!"
Blitzschnell zuckte die rechte Hand des Besuchers hervor aus den Falten seiner Kleidung, in denen sie noch eben gesteckt hatte. Blitzschnell - doch nicht schnell genug. Wirkungslos prallte der Wurfdolch ab und fiel mit einem lauten Klirren zu Boden. Zwei Wachen stürtzen herein, auf den Eindringling zu, und fielen röchelnd zu Boden. Diese Messer, zugleich geschleudert, hatten ihr Ziel besser gefunden. Was nun? Philanthus rührte sich nicht, zuckte mit keiner Wimper. Ein leicht schnarrendes Geräusch war zu hören. Gehetzt sah der Meuchler sich um. Der Anblick war nicht dazu angetan, seine Freude zu wecken: Alle Tore waren nun mit Steintüren versiegelt, und solange Aurinias Iron sich in diesem Zustand befand, konnte nicht einmal Acum selbst ihm etwas anhaben. "Bei Cat... ..rox", sagte er laut, "ihr sollt mich nicht haben! Acum komme über euch!" rief er zweimal, und setzte seinem Leben ein Ende.
"Geht es dir wieder besser?" fragte Heidronar besorgt, "oder soll ich dir einen Heiler rufen?" Philanthus winkte ab.
"Nicht nötig. Die Verwandlung ist zwar immer etwas anstrengend, aber ich habe es ja gut hinter mich gebracht. Nur der kleine Kratzer, das macht mir doch nichts aus." Müde aber lebend lächelte Philanthus den Asarcn an, um diesem zu zeigen, daß es ihm gut ging. Heidronar, von denen, die ihn achten und furchten gelernt hatten, respektvoll 'Pumafreund' genannt wegen des ihn begleitenden Tieres, das ihn nie verließ, war nicht überzeugt. Aber wenn der iron Aurinias meinte, das sei so richtig, dann war das vermutlich auch so. Ob sein Belle-das aber nie Fehler machte, da war er nicht so sicher. Da er eine solche Antwort auf seine Fragen schon erwartet hatte, hatte Heidronar, Sprecher der Asaren in Montalban und Tafelrunden-Ritter des Devan-Clans, bereits Monte rufen lassen, ein anderes Mitglied der Runde. Der Aegyr würde sicherlich wissen ob etwas zu tun nötig sei und, wenn ja, auch genau was. Und Monte te Malak kam. Der Aegyr aus dem Tibouman-Wald wirkte äußerst besorgt. "Keine Wiederrede, Phile", sagte er, "öffne dein Gewand und laß dich untersuchen!"
"Weshalb die Aufregung", mußte er sich fragen lassen, "Was ist denn passiert?" Wahrend er sich bereits an der Brust des iron zu schaffen machte, antwortete Monte: "Die Wurfmesser dieses Burschen waren mit einem uns noch völlig unbekanntem Gift überzogen. Die getroffenen Wachen zeigen noch im Tode einen seltsamen Ausschlag und haben Schaum vor dem Mund. Das war ein absoluter Fachmann, und sicher kein Einzelganger."
Inzwischen hatte er festgestellt, daß tatsächlich nur die Kleidung des Herrschers aber kein Teil seines Körpers beschädigt war, und selbst diese nur leicht. "Glück gehabt, Phile", sagte er, "Das hätte böse ausgesehen, wenn du etwas später reagiert hättest. Jeder andere wäre jetzt mit Sicherheit tot." Philanthus griff zu dem Weinpokal, den man ihm reichte, und verbreitete Zuversicht: "Ja", sagte er, "das Geisterbe Gaphyrs des Eisernen hat mir schon mehr als einmal das Leben gerettet und wird es auch weiterhin tun, so der Eine es will - und Dondra darüber wacht." Leichte Skepsis zu dieser Unverletzt ichkcit überfiel die beiden Männer, die sich seine Freunde nennen durften, aber sie hielten sich zurück. Weshalb unnötig grübeln?
"Hat denn schon jemand den Mann selber untersucht? Was ist mit diesem Dolch, mit dem er sich selbst getötet hat?" fragte Philanthus. "Und dieser Name, den er zweimal rief, weiß da jemand etwas darüber? Wer ist dieser 'Acum'?" Es war Monte, der ihm antwortete: "Der Dolch ist vermutlich ein rrtueller Opferdolch der Religion des Wolfsgottcs. Der Griff hatte einen Wollskopf, das Holz des Griffes paßt, und die Schneide ist relativ aufwendig ziseliert. Am Körper trug er nichts, was weiteren Aufschluß über ihn geben könnte, nur etwas Geld, aurinische Prägung. Was diesen Namen betrifft, so ist Pirinas gleich in die Bibliothek gegangen. Was es zu 'Acum' gibt, wird er finden." "Pirinas in Montalban? Warum sagt mir denn keiner etwas? Immer erfahre ich alles als Letzter", klagte Philanthus mit gespielt beleidigtem Ton.
"Er ist vorhin gekommen, als du nicht ganz bei Bewußtsein warst. Und als er davon gehört hat, ist er sofort zur Bibliothek gestürmt." Monte sah zur Tür: "Da ist er auch schon. Nun, Berglöwe, was sagt uns dein geschulter Verstand zu dem Namen 'Acum'? Und vor allem,
was sagen die Schriften?" Pirinas O'Gayhan, der als "Berglöwe" titulierte, weil er sich in früheren Kämpfen im Bergland um den Stammsitz Gayhan als äußerst zäh und als guter Kämpfer erwiesen hatte, war wie immer mit reichen Gewändem und einem weiten Mantel angetan. Wer ihn nicht kannte, würde in der etwas rundlichen Form des wohlgewandeten Mannes nie den tapferen und gewandten Devan-Ritter vermuten, der in dem daruntersitzenden Kettenhemd steckte. Er sah vom einen zum anderen, grüßte den iron mit einer Geste und sprach:
"Die Schriften schweigen. Es kann keineswegs als sicher angesehen werden, daß der Opferdolch tatsächlich der Borgon-Religion entstammt. Wenn er einmal geweiht gewesen ist, müssen damit verübte Untaten das überdeckt haben. Und von den Borgon-Verehrem unter den Asaren, die ja keine Priester der Alten Götter haben, ist er mit größter Wahrscheinlichkeit auch nicht." "Das hätte ich dir auch sagen können", brummte Heidronar. "Da hättest du deine Zeit besser mit Weinholen verbracht!"
Es blieb also weiterhin alles andere als klar, was und vor allem wer hinter diesem feigen Mordanschlag steckte. Die Freunde berieten sich beim Wein, den die freie Gefährtin und Co-Rcgentin des iron brachte. Auch Elena ließ sich bei den Männern nieder und beriet sich mit ihnen, während sich vor dem Oklis-Tor des Königshofes weitere Menschen sammelten, die auf den Aufruf "Philanthus ruft die Lichtwelt" hin ausgesandt worden waren, dem Herrscher Aurinias etwas Entsprechendes zu bringen, oder die selbst meinten, im Besitz eines solchen Gegenstandes oder entsprechenden Wissens zu sein.
Auch die Zahl der Barden und Skalden, die Lieder vortragen wollten, da sie sich von diesem Aufruf herausgefordert fühlten und dem im Volke sehr beliebten Herrscher behilflich sein wollten, war nicht unbeträchtlich, auf die Dauer gesehen. Viele hatten in diesen Zeiten Worte der Ermutigung oder des Trostes parat. Selten zuvor auch hatten sie soviel von den alten Helden erzählt und gesungen, von denen die Schriften berichten. Die Zeichen der Zeit waren deutlich: Es herrschte Ruhe, aber es war eine Ruhe vor dem Sturm. Nun, dieser Sturm, sollte er über Aurinia hereinbrechen, würde dieses Land nicht unvorbereitet treffen.
Während die anderen die Neuigkeiten berieten, die sie einander zu erzahlen hatten, und das mögliche Vorhandensem eines Drachen im Afrena-Gebirge, das der Iron erwähnte, strich Elena von Deckter mit einer Hand über das weiche Fell des Asaren-Pumas, der sich an sie schmiegte. Nie war dieser Kampfgefährte Heidronars so ruhig und friedlich wie in der Gegenwart dieser Frau. Sie war vielleicht keine Kämpferin, gewiß keine Amazone, aber doch mit Sicherheit eine außergewöhnliche und selbstbewußte Frau. Die Ritter achteten sie - nicht als schlichte Gemahlin ihres Herrschers, sondern als kluge und mutige Gefährtin und weise Co-Regentin über das sie liebende Volk von Aurinia. Sie war in den Augen dieser Männer im gleichen Maße eine Stütze für den Herrscher wie auch eine Stütze für das Land; und Philanthus wußte das. Er liebte sie aus mehr als einem Grunde.
Indessen überdachte Philanthus noch einmal die Ereignisse des Tages. Auf wie vielfache Weise halte man jetzt schon versucht, ihn zu betrügen oder aus diesem großen Projekt zum Nutzen Jer gesamten Lichtwelt privaten monetären Nutten zu ziehen...
Was hatten sie ihm nicht alles zum Kauf angeboten: Einen angeblichen magischen Ring zur Benutzung von
Dimensions- und Weltentoren den er bei der ersten berührung aufgrund seiner Fähigkeiten als normalen Armreif aus Bronze ihne jede magische Eigenschaft erkannte), ein atsächlich magisches Schwert und einen etwa Irei Handteller großen Obsidianschild (er hatte beides schon in besserer Ausführung in seiner Vaffenkammer), obskure Geschichten von undorten magischer Schätze und manchmal uch noch Lagekarten dazu (die mit den wirklichen Geländeverhältnissen nie übereinstimmten nd daher auch zu keinem Schatze führten). Mauskripte seltsamer ("Das hat meines Vaters Vater damals...") und nichtiger Art ("Das ist sicher ne Geheimschrift, sieht aus wie Runen, Euer Majestät") und selbst Auszüge aus dem Tagebuch eines gewissen Mezzaroc von Quellsten, angeblich Herrscher eines mächtigen Landes der ergangenheit, in dessen Tagebuch sich, wiederum angeblich, Hinweise auf ein magisches Tor zu einen großen Einhomfriedhof befinden sollen. Ein solcher Friedhof wäre natürlich eine Fundgrube an weißmagischen Komponenten zum Zaubern, aber dennoch...
Es war zu unwahrscheinlich gewesen, und solange der Reichsschatz von Aurinia noch so nahe dem Nullpunkt war, mußte Philanthus haushalten. Er war seinem Grundsatz in dieser Unternehmung treugeblieben, daß nur in Ausnahmefällen auch Gold gezahlt werden sollte für die Gaben, die Anteile an diesem großen Werk der Lichtmächte. Eine magische Harfe mit den ihr zugeschriebenen Eigenschaften, wie sie der Artan anbetende Krieger Kane besitzen sollte, wäre da eine der möglichen Ausnahmen, sollte sie ihn jemals erreichen... Aber es hatte auch Positives geben in dieser Zeit; so hatten etwa die besten Geschichtenerzähler des Landes sich versammelt und das beliebte Volksmärchen von Vendre und der Hexe neu und in schöner Form erzählt. Dieses Märchen basierte hauptsächlich auf einer sehr verkürzten Geschichte, die in der Ebene von Femdalc auf Tonscherben eingezeichnet gerunden worden war, aber vielleicht war auch tatsächlich Dylano unter den Erzählern Aurinias gewesen, und wenn das der Fall sein sollte, so war dem Ewigen Barden durchaus zuzutrauen, daß er sich eine solche siebenfache Hochzeit nicht entgehen ließ. Direkt bevor der Meuchelmörder aufgetreten war, hatte sich ein Bardenspielcr vorgestellt und gesagt: "Ich bringe Euch, oh Philanthus, das angenehme, schöne und beruhigende Plätschern eines kleinen Gebirgsbaches, der Oishin, die später in den großen Fluß einmündet", und hatte dazu ein wunderschönes Stück auf seiner Harfe gespielt, das dieses Geräusch und diese Harmonie auf das Herrlichste wiedergab. Und wie immer, wenn jemand einen Beitrag zum Lichtwerk brachte, saßen im Raum darüber die Sammler, die alles in seiner Grundschwingung aufnahmen und in den vielfarbig schimmernden Kristall projezierten, der sich Stück für Stück mit Leben, Liebe und Licht füllte. Auch die überbrachten Dinge, etwa diese Feder eines Riesenraben, fanden sich inzwischen, noch matt in ihrer früheren Kontur schimmernd, in dem Kristall wieder. Die Farben stammten zum Teil von dem roten Granit aus Machairas, zum Teil von den kürzlich im Bette des Flußes gefundenen klaren blauen Kristallen, deren wahre Natur (außer, daß sie nicht finster waren) noch keiner kannte, und zum Teil vom hellen Schein der alles überstrahlenden Lichtsonne Aro mit ihrem goldenen Glänzen. Es versprach, ein großes Werk zu werden, und die Traumritter mit all ihrer Kraft würden es unterstützen. Zu hoffen war nur, daß genug Zeit blieb, das Ganze auch zu vollenden.
Nun zumindest die Ritter der Ewigkeit würden dies eines Tages tun - wer alle Zeit der Welt hat, kann nie auf Dauer aufgehalten werden...
* * * * *
Mehrere Bäume waren schon vergangen seit jenem mysteriösen Anschlag auf das Leben des Herrschers, und noch immer hatte Pirinas O'Gayhan den alten und neuen Informationen der Bibliothek nichts über 'Acum' entnehmen können. Die einzige Verweisstelle auf diese Runenkombination befand sieh im Archiv der Traumritter, in einem Kapitel, in dem über die Wiederbeschaffüng der an die Finsternis verlorenen Kapitel des Buches der Alptraume (BDA) erzählt wurde. Eines der Kapitel, das im Zusammenhang mit dem Dreischreck Trillum genannt wurde, heißt Raon-acum. Dies allein könnte ein Hinweis sein - nur worauf? Philanthus stand unter dem Gischogan, wog eine von dessen Früchten in seiner Hand und übersah die Hauptstadt. Montalban war gerüstet für den Kampf gegen die Mörder Agons des Abstoßenden, Großkotz des Kartanischen Ekels, Sklave der Finstermachtc und Verbreiter der seelischen Pestilenz. Ob gut genug gerüstet, das würde sich zeigen in den Kämpfen, die zu kommen liatten. Es war nicht gerade eine Woge der Unterstützung gewesen, die ihm entgegen gebrandet war, als er die Alten Götter rief und zu dem Einen Gott flehte, aber der Aufruf hatte doch manches bewegt. Der Verbündete im Thysias, Scaith mac Luand, der Ferdun des LiFE-Reiches Rhyandi, hatte LiFE-Gelder, die für den Kampf gegen Gra-Tha N'My bestimmt gewesen waren und vom Lande des reichen LiFE-Gründers kamen, nach Aurinia weiterleiten lassen, was die Bank von Myra nun - endlich! - getan hatte. Mit diesem Geld war es dem Iron möglich, die vielen Tausende mehr oder weniger freiwilligen Verteidiger der Hauptstadt vernünftig auszustatten ohne die Händler ganz um ihr Geld zu bringen. Ein
Großteil dieser Streitmacht des aurinischen Volkes stellten die wehrhaften Menschen aus dem Volke Heidronars, welche die Lust am Kampfe schon mit der Muttermilch einsaugen, die stolzen Asaren. Noch immer aber waren es nicht genug, um Montalban ein Jahr lang mit Sicherheit zu halten und damit den Gischogan vor dem Zugriff der Finstcnnächte zu schützen.
Der Herrscher hatte darum auf Kodor O'Kerwayn gehört, den Devan-Ritter unter den Tafelrundenmitgliedem, der sich am besten im Buch Grammarye auskannte. Dieser hatte ihm gesagt, was die Schrift für einen solchen Fall empfahl:
Den Jabesch-Ruf. Und so hatte er es auch gemacht. Sechs große Rinder hatte er gekauft, für 12 Talente ingesamt, und hatte sie zerstückeln lassen auf dem Opferaltar AEnes, mit Opferdolchen von Afranit und unter dem Absingen des "Gebets in Zeiten der Not", Diese kleinen Stücke hatte er in die Hände von Boten gelegt und durch diese (Lohn eines jeden waren zwei Talente, denn die Aufgabe war nicht ohne Gefahr) in alle Gebiete Aurinias und Tiboumans tragen lassen, mit der Botschaft: "Wer nicht auszieht dem Philanthus entgegen, dessen Vieh und dessen Familie wird man ebenso tun, wenn der Usurpator Agon der Anmaßende erst ganz Aurinia in seiner Hand hält!" Die fast zwei Hundert reitenden Boten trugen diese grausige Botschaft über das Land und mobilisierten alles, was irgendwie kampffähig und mit einer Waffe oder gar Rüstung dazu ausgestattet war. Diese Männer und Frauen, allesamt potentielle Kämpfer in der regulären Armee des Landes (ein Zehntel des ganzen Volkes) bekamen sämtlich zugesagt, daß sie den doppelten Lohn eines normalen Kriegers erhalten würden, sobald der nächste Rüstmonat käme. Alle weiteren 'Freiwilligen', die ein grausames Schicksal unter Agons Schergen vermeiden wollten und von daher zum Kampf getrieben waren (ein weiteres Zehntel) erhielten zugesagt, daß sie in den ersten Tagen des Nußbaumes im Jahre 94 Wolfer den normalen Sold eines vollwertigen Kriegers erhalten würden. Jene im Thysias beheimateten Ritter des Devan-Clan, die wegen des beschwerlichen Weges durch das Afrena-Gebirge nicht mehr rechtzeitig, das heißt bevor Agons Mörder die Hauptstadt umschlossen haben würden, dieselbe erreichen könnten, waren angewiesen, die Haufe der Volksarmee um sich zu sammeln, die aus dem Thysias Aurinias und aus Ti-bournan zu kommen in der Lage waren, und mit ihnen zur Burg Afrena zu ziehen um dort dieselbe (und die geheime Tafelrunde der Ritter der Ewigkeit, darunter ohne es zu wissen) solange wie möglich zu verteidigen. Der Geheimgang von Montalban zur Tafelrunde (und damit das Land in der direkten Umgebung der Burg) mußte durch ständige Ausfalle frei vom Einfluß des Feindes bleiben.
Philanthus überdachte noch einmal die Verteidigung Montalbans, die er von seinem Standpunkt vom obersten Platze des Königshofes aus, gut überblicken konnte: Die Wachfeuer bildelen einen Ring außen um die Stadt und wurden Tag und vor allem Nacht (dann größer) betrieben. Vor diesen noch der Sperrgraben, normalerweise als Wassergraben um die Hauptstadt dienlich, aber nun, vor dem Angriff Kartans, mit dem Öl des Olea-Baumes überzogen, das im Falle eines Flugangriffes durch die Mörderbienen oder eines schwimmfähigen Sturmes der Landstreitkräfte Agons von den Wachfeuern aus entzündet werden würde. Dieser Graben und die Wachfeuer bildeten einen Teil der neuerrichteten Wallanlage um die Hauptstadt, in die sie integriert worden waren und hinter der die Speerspitze des Volkssturmheeres, die unerschütterlichen Asaren standen, die alle neu hinzugekommenen möglichen Kämpfer auf ihre Plätze wiesen und dort die Veteidigung ordneten. Weitere Fässer mit Öl standen innerhalb der Wallanlagen bereit, um die Flammung des Sperrgrabens aufseht erhalten zu können, auch über mehrere Angriffe hinweg. Als nächstes dann stand die Stadtmauer fest und sicher, begründet noch vor den Zeiten Agonards, bald schon nach dem ersten Femdinger und unter Argundol und einige Zeit später Golias, dem ersten Iron aus dem Hause Valkher, weiter ausgebaut und befestigt.
Auf den Türmen der Stadtmauer standen Teile der wehrhaften Bevölkerung, angeleitet durch die Hauptleute der Stadtwache Montalbans, mit weiteren Schläuchen voll Öl und Kesseln mit Pech an den kleinen Ballisten und Katapulten, um den Mörderbienen einen im wahrsten Sinne des Wortes 'heißen' Empfang zu bereiten, an dem auch Orcan seine Freude haben würde, über dessen zweifelhafte Hilfe durch den in Aurinia mal 'Mismaeraet Schamajim' mal Tole'ah Schamah genannten Drachen, der die Blüte des Landes zum Fräße haben wollte, man sich in Montalban noch im Unklaren war. Würde der 'Wächter des Himmels' den Beschwörungen der Ältesten Monlalbans und den Angeboten des Philanthus gegenüber aufgeschlossen sein? Der Drache, der sich nach seinem ersten großen Kampf gegen Agons Mörderbienen auf den Hügel des Richtens in Montalban niedergelassen hatte, ließ sich Zeit mit einer Antwort. Möglicherweise würde er sich für die Bevölkerung doch als 'Wurm des Greuels' erweisen...
Das Orakel von Esmaryll hatte sich hierzu nicht eindeutig geäußert, sondern lediglich si-byllinisch verkündet, der Drache sei "zweigesichtig wie ein Yorvarer". Das hieß jedenfalls, da waren sich die Traumritter einig, es wäre falsch, sich alleine darauf zu verlassen, daß er ihnen aus reiner Gutwilligkeit helfen würde oder allein weil Orcans Ehre zu erhöhen war. Es hatte sich, den Drachen betreffend, als Segen Aenes erwiesen, daß der Lichtkristall bereits ein wenig von seinen künftigen Fähigkeiten innehatte. Da hatte sich erneut der wahre Wert Elena von Deckters gezeigt, deren seherische Begabung, die schon von ihrer dreijährigen Zeit als Orakeldienerin groß gewesen war, ihr erlaubte, manches aus ihm zu entnehmen: Der Name des Drachen, so wie es übereinstimmend auch Kodor O'Kerwayn, der im Grammarye kundigste, meldete, war nun bekannt. Das war eine unerläßliche Vorraussetzung zur Bezauberung und Zähmung des Drachens und würde sehr wertvoll sein, falls diese Notwendigkeit eintreten sollte. "Smowankysimarlbor" war der Name dieses uralten Purpurdrachen.
Wichtiger vielleicht noch, um das Wohlwollen des Drachen zu erlangen, war die Erkenntnis, die Elena dem Lichtkristall über die klaren blauen Kristalle aus dem Bette des Laythea entlockt hatte: Wie so vieles in der Umgebung des Afrena-Gebirges mit seinem schier unermeßlichen Afranit-Vorkommen war auch dieser Kristall, der "Eben Nipla'ot" hieß, auf geheimnisvolle Weise magisch. Diese Kristalle waren in der Lage, Wünsche zu erfüllen! Ein Wunsch pro Kristall, die Größe des Wunsches in Zusammenhang mit der Größe des jeweiligen Kristalls. Aber es hiesse sich zu früh zu freuen, meinte man nun eine Wunderwaffe gegen Agons Schergen gefunden zu haben, denn so einfach war es beileibe nicht. Was Elena in Erfahrung brachte aus ihren Blicken in den Lichtkristall, der in dieser Zeit den Inhalt der beiden Bücher aus der Lehre des Wegs der Ritter in sich aufnahm, das "Der Heilige Staat" und das ZWEITE BUCH, das "Der Profane'Staat", war, das höchstens ein Wesen so groß und alt und weise wie ein Eyta oder ein Prinz der Aegyr oder der Elfen, oder eben wie dieser uralte Purpurdrache, der viele, viele Menschenalter Zeit gehabt hatte zu lernen und an geistiger Macht zu wachsen, die wundervolle Kraft dieser Kristalle nutzen könne. Dadurch war der IRON auf die Idee gekommen, ihm diese Kristalle als Opfer anzubieten statt der Töchter des Landes, da doch der Nutzen für den Drachen aus den Kristallen so offensichtlich weit größer war, als die mögliche Freude zweifelhafter Art durch das Opfer von Jungfrauen!
Innerhalb der (hoffentlich) für übliche Angriffe unüberwindlichen Stadtmauer stand der große Kreis aus den Bäumen der Sorbus aucuparia aurinica, des Baumes, unter dessen Zeit der IRON geboren war, und den man auch 'Weißblütenbaum' nannte. Einer der drei großen Urväter des Ordens der Traumritter, der Steinmann Necron, hatte sie einst aufseinen Reisen um die damals gerade wachsende Siedlung alter Größe gepflanzt, ebenso wie um den von ihm mit Gaphyr, dem Urvater der IRONS, dessen Nachkomme und Geisterbe auch Philanthus war, eingerichteten Sitz der Traumritter im Afrena-Gebirge.
Über der Stadt selbst blinkten die vielen Silberfäden in der Sonne und erklang der Gesang der Aeolsharfen, deren Klang auf den Dächern der Stadt, das Lied Dondras, die Mörderbienen vertreiben sollte... Es war alles bereit!
Über den Autor
"Das Projekt MYRA hat zum Ziel, eine eigene Welt der Fantasy namens Myra mit beliebig vielen Menschen über beliebig viele Jahre hinweg in allen Aspekten zu entwickeln, zu simulieren und zu beschreiben. Rollenspielabenteuer in Myra gehören ebenso dazu wie gesellige Treffen in Gewandung, das Brettspiel "Wabenwelt" oder Geschichtenprojekte. Ein Teil dieses Projektes ist die Simulation der Zeitgeschichte im Rahmen des Briefspiels "Welt der Waben". Zur Förderung dieses Projektes gibt es den gemeinnützigen Verein der Freunde Myras VFM eV."
(Aus: Wolfgang G. Wettach (Hrsg.): Welt der Waben-Spielregel, Kapitel 0. "Das Projekt und das Spiel", September 1995)
Alle Texte wurden dem VFM e.V. zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und stehen unter Creative Commons Lizenz CC-BY-NC-SA