Fantasy & Horror
Der Gast im Wald
Kategorie Fantasy & Horror
http://www.mystorys.de
Über den Autor:
Ich bin am Niederrhein geboren, aufgewachsen und lebe heute noch dort - wenn auch nicht in der selben Stadt. Das Wichtigste in meinem Leben - auch wenn es mancher nicht glauben mag - ist meine Familie. In meinen Werken ist Zusammenhalt und Konflikte zwischen Familienmitgliedern immer wieder ein Thema. Meine engste Familie, jene mit denen ich zusammenlebe, besteht aktuell aus meiner Frau Veronika, unserem Hund Xanadu, unsere Katze Trixi, sowie ...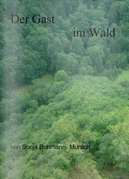
Der Gast im Wald
Beschreibung
Casay entdeckt lagernde Wilderer im nächtlichen Wald. Als Wächter der Tiere wird er selbst zum Jäger - bis er den Herren des Waldes gegenüber steht.
Der Gast im Wald
Grün. In allen Tönen. Sanft geschaukelt vom Wind, der auch die Wolken über den nachtschwarzen Himmel trieb.
Jeder Sterbliche hätte in der Dunkelheit nur ein Meer aus Grau gesehen.
Casay blickte über die Baumwipfel hinweg und erkannte die Farben fast wie am sonnenbeschienen Tage. Casay sah nicht nur mit den Augen, die bernsteinfarben in der Nacht funkelten, sondern auch mit dem Herzen, mit seinen Erinnerungen.
Damals war es ein anderer Wald gewesen. Aber im morgendlichen Nebel, wenn die Sonne sich eben erst erhob, hatte er genauso in allen Grüntönen gestrahlt, wie es dieser hier tat.
Der Mann, vom Aussehen her gerade in den besten Jahren – alt genug um eine junge Familie zu haben, aber nicht so alt, um vom harten Leben ausgezerrt zu sein – stand an einem Steilhang und schaute auf den nächtlichen Wald hinab.
Der Vollmond stand hoch am Himmel. Er leuchtete zugleich beruhigend, beschien friedlich den schlafenden Wald und gab Trost in der Einsamkeit. Doch war er ebenso ein Bote des Grausammen, verantwortlich für lange Schatten, dunkel und unheimlich, tief unter den Baumkronen.
Für Casay war der Vollmond der tröstende Wächter, der die Einsamkeit niemals in sein Herz ließ und ihm stets einfache Dinge zeigte, an denen er sich erfreute. Wie die Schleiereule, die lautlos, nur vom Mond beschienen, über ihm hinweg schwebte und weiter unten zwischen den Baumwipfeln verschwand. Doch ebenso erinnerte ihn der Mond auch immer wieder daran, dass Casay nicht allein in diesem Wald war.
Eine dünne Rauchsäule stieg zwischen den Bäumen auf, nicht weit von der Stelle, wo die Eule niedergegangen war. Rauch, der von Menschen zeugte, die sich sicher und als Herrscher des Waldes fühlten.
Casay verzog keine Miene. Unbeweglich stand er etliche Minuten am Steilhang, bis er sich endlich umwand und den schmalen Pfad entlang ging.
Lautlos, wie die Schleiereule zuvor in der Luft, bewegte sich der Mann am Boden. Auf dem weichen Moos und zwischen den niedrigen Farnen waren seine Schritte nicht zu hören. Immer wieder hob er die Nase witternd in die Luft und folgte dem Geruch des Feuers. Schon bald hörte er das leise Knacken von verbrennenden Zweigen. Leises Janken und Fiepen mischte sich darunter und Casay erkannte die Töne von jungen Tieren, die ängstlich nach ihren Müttern riefen. Neue Gerüche mischten sich in den Rauch, je näher der Mann dem Ursprung kam. Blut, Tod, Schweiß und Alkohol machte er leicht aus. Äußerlich blieb Casay ein teilnahmsloser Wanderer in der Nacht, aber innerlich spürte er die Unruhe und den Zorn des Tiers. Bäume und Büsche versperrten ihm noch den Blick auf den Lagerplatz der Menschen, doch Casay malte sich bereits aus, was er finden würde.
Lautlos duckte er sich schließlich hinter einen Busch. Der Wind wehte ihm ins Gesicht, trug die Gerüche des Lagers zu ihm ohne das er selbst bemerkt wurde. Das Gesicht des Mannes blieb ausdruckslos, wie in Stein gemeißelt, während er den Blick langsam über den Lagerplatz gleiten ließ.
Zwei Männer lagen dort in Decken gehüllt dicht am Feuer. Ein Dritter lief aufrecht in einigem Abstand um den Platz herum, spähte angestrengt in den dunklen Wald ohne Casay zu bemerken. In der Hand hielt die Wache eine Armbrust, eine hinterhältige Waffe mit viel mehr Durchschlagskraft als Pfeil und Bogen – die Waffe eines Meuchelmörders und Söldners, nicht die eines ehrbaren Jägers. Am Gürtel der Wache hing ein Kurzschwert und aus seinen hohen Stiefeln schaute der Griff eines Dolches heraus. Der Mann war so nah, dass Casay all dies ohne Mühe sah. Er hätte eine Hand ausstrecken und die Wache von den Beinen holen können, aber er tat es nicht. Nun war er der Jäger auf der Lauer, ein geduldiger Jäger, der sich nicht von seinem Zorn und schon gar nicht von der Lust am Töten übermannen ließ. Als der Wachmann weiter ging, ließ Casay den Blick über den Lagerplatz gleiten. Nicht weit standen drei gefesselte Pferde und ebenso viele Mulis. Im Schein des Feuers entdeckte der Jäger grob zusammen gezimmerte Käfige aus Ästen und Lederseilen. Junge Wölfe lagen in dem einen dicht zusammen gedrängt, junge Füchse in einem anderen. Ein weiterer, größerer Käfig hielt einen kleinen Braunbären gefangen und in etlichen kleinen Käfigen gab es Marder, Dachse und andere kleine Tiere. Die Meisten waren zu jung, um ohne das Muttertier überleben zu können und bei dem Anblick musste Casay ein Knurren seines Tiers unterdrücken. Still blickte er sich weiter um, folgte seiner Nase und dem Geruch des Todes zu einem kniehohen Berg von Fellen. Der Jäger ließ den Blick über die schlafenden Wilderer und weiter zu dem Wachmann gleiten. Er stellte sich vor, wie er diesen gleich zu sich in die Büsche zerrte, wie er ihm die Kehle zerfetze und sein Blut trank, ohne dass die anderen Beiden auch nur von der Gefahr ahnten. Dann würde er sich diese beiden vornehmen. Oh, er würde sie nicht einfach im Schlaf abschlachten, nein. Auch Casay hatte bisweilen Spaß am Töten und den wollte er dann auskosten. Dann wollte er seine Opfer leiden sehen. Für einen solchen Wilderer konnte kein Tod zu lang und zu schmerzhaft sein.
Die bernsteinfarbenen Augen des Jägers fielen auf die Käfige mit den vielen Jungtieren und zum ersten Mal zeigte sich eine Regung auf seinem Gesicht. Casay konnte die Jäger abschlachten, aber das würde ihre Taten nicht ungeschehen machen. Die gemordeten und gehäuteten Tiere würden nicht wieder leben und diese Kinder würden wohl kaum wieder von den Tieren des Waldes aufgenommen werden. Der Gestank der Menschen hüllte sie längst ein.
Nein, Casay half dem Wald nicht, wenn er nun seiner Mordlust und seinem Tier nachgab. Er hatte bereits eine bessere Idee.
Als der Wachmann wieder an dem Busch vorbei ging, hinter dem Casay bereit saß, kam dieser auf die Beine, lautlos und flink wie ein Luchs. Der Wilderer hatte keine Zeit zu reagieren oder auch nur einen Schrei von sich zu geben. Casay zog ihm einfach die Beine weg und schickte den Mann mit einem gut gezielten Schlag ins Land der Träume, kaum dass er wirklich den Waldboden berührt hatte. Mehr als das dumpfe Geräusch vom Aufprall des erschlafften Körpers war nicht zu hören. Der Jäger ließ den Blick über den Lagerplatz gleiten. Die Reittiere hatten lediglich kurz den Kopf gehoben und gaben nicht mehr als ein leises Schnauben von sich – Casay sah dies als Zustimmung für seine Tat – die Jungtiere jankten weiterhin leise nach den Muttertieren und einer der Schlafenden grunzte ohne aufzuwachen, der andere regte sich erst gar nicht.
Beinahe lautlos handelte Casay. Er sammelte die Waffen der Wilderer ein, selbst die Armbrust, welche einer der Schläfer umklammert hielt, zog er vorsichtig hervor ohne dass der Besitzer aufwachte. Messer mochten die Männer noch haben, aber diese ließ Casay ihnen; sie würden ihnen nicht viel nutzen. Der Jäger wickelte die Waffen in die freiliegende Decke der Wache und sicherte das Ganze mit einem Strick. Geschickt kletterte Casay auf den nächsten Baum, eine blühende Buche, und band die Waffen dort oben fest.
Dann setzte er sich bequem auf einen Ast, der hoch genug war, und schaute zu den schlafenden und dem bewusstlosem Wilderer hinab. Ein kühles Lächeln umspielte für einen Moment seine blassen Lippen, dann hob er den Kopf und legte die Hände um den Mund.
Der Wind trug den Laut, den Casay von sich gab, weit durch den Wald. Er rief die Bären und er wusste, die Bären würden antworten.
Die beiden schlafenden Wilderer schreckten bei dem Laut hoch, griffen gleich zu ihren Waffen, die sie nicht fanden, und sahen sich wachsam um. Der Jäger kümmerte sich nicht darum. Er gab einen neuen Laut von sich und der Ruf der Marder drang durch die Bäume.
Während die Wilderer gewarnt umher schauten und einer zu dem immer noch reglosem Kollegen schritt, rief Casay weiter. Füchse, Dachse und auch die anderen Tiere, würden seinem Ruf folgen.
Die Männer auf dem Boden suchten derweil die Baumwipfel ab, hielten ihre Messer in den Händen und entzündeten Äste in dem kleinen Feuer. Als das Heulen eines Wolfes durch die Bäume klang, kam auch endlich der Bewusstlose zu sich.
Casay beobachtete zufrieden, wie die drei Männer unsicher und ängstlich in den dunklen Wald leuchteten. Es war nun Still, selbst die Jungtiere, die Pferde und die Mulis gaben keinen Laut mehr von sich. Nur der Wind rauschte unheilverkündend durch die Äste.
Casay hörte das Knacken im Unterholz, die nahenden Tiere, lange vor den aufgeschreckten Wilderern. Ruhig wartete er ab und er blieb auch ruhig, als Bären, Füchse, Wölfe, ein Dachs und all die anderen Tiere wie eine Flut über die Wilderer herein brachen. Mit unbewegter Miene lauschte er dem wütenden Brüllen der Wildtiere, den panischen Rufen der Männer und dem ängstlichen Wiehern der Reittiere, die nicht weit fliehen konnten. Die improvisierten Fackeln hielten die Tiere nicht lange auf, die kleinen Messer mochten gegen scharfe Klauen und spitze Zähnen kaum etwas ausrichten. Es war ein Gemetzel, wie es die Menschen unter den Tieren veranstalteten und diesmal waren die Tiere die Jäger.
Nach wenigen Minuten wurde es wieder still auf dem Lagerplatz. Das Feuer war zertreten und nur wenige Funken glühten noch im frischen Moos. Körperteile lagen überall herum und die Luft war erfüllt mit dem Duft von Blut und dem Gestank des Todes.
Casays Augen leuchteten nun rot in der Dunkelheit auf, als er sich gewand und leise von dem Baum abließ und auf dem Waldboden aufkam. Um ihn herum labten sich die Tiere an ihrer Beute und leckten die Felle der Jungtiere, die aus den zerbrochenen Käfigen krabbelten. Nur für einen kurzen Moment bereute der Jäger sein Handeln. Er würde von diesem Mahl nichts mehr abbekommen. Ruhig schritt der Mann zwischen den Tieren hindurch, ohne dass diese sich aggressiv oder ängstlich zu ihm zeigten. Casay trat zu jedem Rudelführer, sprach zu ihnen und schickte sie zurück in den Wald. Sie hatten die Wilderer erlegt und ihre Jungen zurück. Sie sollten von dem Fleisch ablassen und die Tiere taten, worum er sie bat. Die Lichtung leerte sich, doch nahmen nicht alle ihre Jungen mit. Der kleine Braunbär blieb zurück. Einer der Fuchsjungen war verletzt und hielt nicht mit dem Rudel mit. Der Käfig mit den Welpen der Wölfe stand unberührt und heile da.
Casay sah dies alles, doch musste er sich erst einmal um sein eigenes Tier kümmern, das von der Gewalt und dem intensiven Blutgeruch rund herum in seinem Inneren drängte. Der Jäger trat zu den Resten der Wilderer, beachtete nicht Gedärme und Innereien, die herum lagen und versenkte seine Fänge in dem Fleisch, welches das ersehnte Blut in sich trug.
Casay trank gierig, labte sich an dem letzten Lebenssaft und vergaß beinahe den Wald um sich herum. Es war wohl sein Glück, das die Körperteile nicht groß genug waren, um wirklich noch viel des roten Saftes in sich zu tragen, sein Glück, dass schon soviel über den Waldboden vergossen worden war. Es war zu wenig, als dass sich der Vampir gänzlich seinem Blutdurst hingeben konnte und so spürte Casay, dass um ihn herum im Wald noch etwas lauerte.
Casay ließ den Torso des Wilderers achtlos fallen und leckte sich über die vom Blut roten Lippen. Aus leuchtend roten Augen sah er sich langsam um, bewegte sich bedächtig und wachsam. Nicht die zurück gelassenen Jungtiere ließen ihn so aufmerksam handeln, kein Geräusch nicht einmal wirklich ein fremder Geruch, den er wahrgenommen hätte – das Blut überdeckte ohnehin alles.
Dies war nicht sein Wald. Er war nur ein Wanderer, ein Fremder, der sich nicht vorgestellt und die wahren Herren dieses Waldes bisher instinktiv gemieden hatte. Casays rote Augen blieben einen Moment an dem Käfig hängen, in dem die vier Wolfwelpen leise jammerten, glitten dann weiter zu den Überresten der anderen Käfige.
„Es ist immer ein Risiko, die Wölfe zu rufen.“
Die Worte seines Erzeugers halten in Casays Ohren, als würde er genau neben ihm stehen.
Casay starrte auf zwei Bäume, nicht sicher, ob sich dort nun etwas bewegt hatte oder nicht. Doch dann löste sich ein Schatten von diesen Bäumen. Ein Tier, oder eher eine Bestie, trat hervor und im Schein des Vollmondes, der genau jetzt ungehindert durch die Äste viel, erkannte Casay mehr, als ihm lieb war. Das da war kein Wolf. Es war viel größer, mit Pranken, so riesig wie der Kopf eines Mannes und mit langen Reißzähnen.
Casays Herz schlug seit Jahrzehnten nicht mehr, aber gerade jetzt meinte er für einen kurzen Moment, es würde in seiner Brust rasen. Unweigerlich machte der Vampir einige Schritte rückwärts. Ein Geräusch aus dieser Richtung, das Knacken einiger Zweige, ließ ihn aber stehen bleiben und sich halb drehen, nur um in das zahnbewehrte Maul einer weiteren Bestie zu blicken. Ein erschrecktes Keuchen entfleuchte Casays Lippen. Er bemühte sich um Abstand zu beiden Tieren, versuchte seine Panik und das Tier in seinem Inneren ruhig zu halten, während ihm bewusst wurde, wenn diese Wolflinge ihn töten wollten, hätten sie es längst getan. Außer vielleicht, sie spielten ebenso gern mit ihrer Beute, wie er bisweilen.
Es war eine reine Vorsichtsmaßname, der Drang zu überleben, selbst wenn diese beiden Wesen ihn anfallen sollten, dass seine Finger zu langen, rasiermesserscharfen Klauen wuchsen. Doch hielt er diese Klauen gesenkt, bemühte sich um Ruhe und eben diese auszustrahlen – nur keine Angst – während er die beiden riesigen Wölfe mit den Blicken maß.
Die eine Bestie näherte sich Casay langsam, ließ ihn nicht aus den Augen und zerquetschte den Torso, den der Vampir eben losgelassen hatte, mit einer riesigen Pranke. Das matschende Geräusch übertönte selbst das Janken der Welpen.
Der andere Wolfling ging witternd im Lager der Wilderer umher, schnupperte an den Kadavern, an dem jungen Bären und dem verletzten Füchslein, ohne den Jungtieren zu nahe zu kommen.
Casay konnte nicht beide Tiere im Auge behalten, so ließ er zu, dass er von dem einen umrundet wurde, während dieses das Lager inspizierte. Casay ging in die Hocke. Er wusste, eine Flucht würde er nicht überleben, nicht wenn diese beiden Bestien ihn wirklich jagen wollten. Das Gefühl des Waldbodens unter seinen Fingerspitzen beruhigte den Vampir. Wenn es wirklich brenzlig wurde, nahm die Erde in auf und umfing ihn schützend.
Aus der Hocke schaute Casay zu dem wachenden Wolfling hinauf. Den anderen konnte er nicht sehen und als er hinter sich das knackende Geräusch zerberstender Äste hörte, gelang es ihm nur so eben, nicht zusammen zu zucken. Der wachende Werwolf betrachtete Casay aus goldgelben Augen; nicht Mordlust im Blick, aber kalte Genugtuung. Casay wartete ab, angespannt und wachsam, wagte sich jedoch nicht zu dem anderen umzudrehen. Das Tier im Inneren des Vampirs drängte zur Flucht, Flucht oder Angriff, Hauptsache sie würden überleben, aber Casay blieb hocken, starrte die Bestie vor sich weiterhin an.
Er hatte lange im Wald gelebt, schon lange bevor er in die Nacht geholt worden war. Er kannte das Verhalten der Tiere und nichts anderes war doch diese Bestie – ein Jäger, der den Wald schützte. Und dummerweise befand sich Casay auch noch in dessen Revier. Er war nur ein Fremder, der sich nicht einmal vorgestellt hatte. Er hatte kein Verlangen danach gehabt, den Herren des Waldes zu begegnen, doch nun, wo er ihnen gegenüber stand, wollte er sich nicht vertreiben lassen.
Casay musste klar stellen: Er war kein Opfer, er hatte keine Angst. Er war ein Jäger und Hüter des Waldes, genau wie die Wolflinge. Und Casay machte dem Werwolf klar, ohne ein Wort oder einen Laut zu gebrauchen, nur mit den Blicken und seiner Haltung – er erkannte die Herrschaft seines Gegenübers an, aber er würde sich nicht jagen lassen. Er würde kämpfen um seinen Platz in diesem Wald, wenn sein musste.
Casay war sich nicht sicher, ob der Werwolf verstand. Er wusste nicht, wie lange er dort so saß und die Bestie anstarrte. Heißer Atem ließ den Untoten zusammen fahren und den Kopf wenden. Der andere Wolfling war so nahe, dass er nur zubeißen brauchte, um Casays Kopf von den Schultern zu trennen.
Doch keiner der Beiden biss oder schlug zu. Die riesigen Tiere wandten sich einfach ab und ließen Casay mitten auf dem Schlachtfeld hocken.
Der junge Vampir atmete erleichtert durch, vollkommen überflüssig, eine Angewohnheit aus seiner sterblichen Zeit, und schloss für einen Moment die Augen. Ein Schmunzeln huschte über seine Lippen, als er verstand. Der Wolfling hatte den Kampf des Blickes nicht Casay überlassen wollen, aber sie hatten aufbrechen wollen. Es war ein gemeiner Trick gewesen, aber Casay nahm es ihnen nicht übel. Es grenzte an ein Wunder, dass er aus dieser Begegnung so vollkommen unverletzt heraus gekommen war. Langsam richtete sich der Untote auf und seine Klauen schrumpften wieder zu menschlichen Händen. Aus bernsteinfarbenen Augen schaute er sich um. Er war nicht ganz allein auf dem kleinen Lagerplatz der Wilderer. Der junge Bär tabbte unbeholfen zwischen den Büschen herum. Der kleine Fuchs lag immer noch zwischen den Ästen des zerstörten Käfigs; vielleicht war er schon tot. Ein Wolfswelpe kam kläglich rufend auf Casay zu. Aber von den Wolflingen und ihren anderen tierischen Artgenossen war nichts mehr zu sehen. Noch einmal atmete Casay durch, hockte sich hin und nahm den kleinen Welpen hoch. Der Vampir war nicht länger ein Fremder in diesem Wald. Er war ein Gast und – vielleicht sogar mehr.
Über den Autor
Leser-Statistik
94
Kommentare
Kommentar schreiben
| Windflieger Re: Re: Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen aber bis dahin gefällt es mir sehr gut.LG Ivonne - Zitat: (Original von Sunnypluesch am 15.02.2010 - 18:32 Uhr) Danke, schön, dass es dir gefällt! Zitat: (Original von Windflieger am 15.02.2010 - 09:46 Uhr) Die Geschichte ist Dir sehr gelungen. LG Ivonne |
| Sunnypluesch Re: Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen aber bis dahin gefällt es mir sehr gut.LG Ivonne - Danke, schön, dass es dir gefällt! Zitat: (Original von Windflieger am 15.02.2010 - 09:46 Uhr) |
| Sunnypluesch Re: Hey - Danke! Ich beeil mich auch mit "Zwischen Wölfen und Königen" (kurz ZWuK) ;-) Zitat: (Original von Schlauchen am 15.02.2010 - 10:21 Uhr) du schreibst wirklich gut! Ist schon das zweite, dass cih von dir lese und bisher bin ich echt begeistert! Ich mag die Art wie deatiliert du manche Dinge bzw. Szenen beschreibst, ich bekomm da so ein genaues Bild von der ganzen Situation, echt gut! Liebe Grüße Caro |
| Windflieger Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen aber bis dahin gefällt es mir sehr gut.LG Ivonne - |