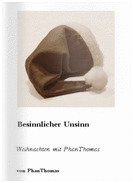»Nein, ich hab's doch nicht so gemeint, ich- bitte, Johnny, leg doch die Axt weg, bitte!« Hysterisches Kreischen, dass man meint, die Fenster würden im nächsten Moment bersten. »Halt's Maul, dämliche Hure!« Kurze Stille. Er holt wohl aus. Dann das dumpfe Geräusch, als die stumpfe Schneide den Schädel der Heulboje wie eine Walnuss knackt, damit die herumspritzende Hirnsuppe auch noch zu ihrem unansehnlichen Auftritt kommt.
»Kommt ihr dann langsam runter? Wir wollen Bescherung machen. Dann können wir auch bald essen. Der Papa hat nämlich schon Hunger«, tönt Mutters Stimme von unten aus dem Wohnzimmer nach oben zu meiner Schwester und mir. Der blecherne Klang ihres Brüllorgans lässt mich vage an das Gezeter vom letzten Jahr denken. Weihnachten in der Familie – immer der gleiche Kleinkrieg: Alle schmeißen so lange grinsend mit lieblosen Geschenken um sich, bis sich irgendjemand erdreistet, etwas Falsches zu sagen. Und schon geht's los: Es wird gestritten und gekeift, bis irgendjemand heult. Vorzugsweise natürlich meine nah am Wasser gebaute Schwester. Hat die sich bereits entnervt verdrückt, springt mein Vater ein. Mutter dagegen kann nicht weinen. Zumindest ist nichts dergleichen überliefert. Und ich? Hocke mit einem lachenden und einem weinenden Auge im familiären Nuklearkrieg und wundere mich immer wieder über das mörderische Echo der belanglosen Meinungsverschiedenheiten. Damit ich nicht ganz leer ausgehe, gibt's für mich stattdessen eine zünftige Magen-Darm-Grippe. Wenigstens war es im letzten Jahr so.
Noch will ich heute jedoch keine allzu schlimme Schwarzmalerei betreiben. Schließlich kommt der Teufel persönlich zum Kaffee und Kuchen vorbei, sobald er seinen Namen vernimmt. Immerhin schaltet mein Schwesterherz nun endlich ihren abartigen Splatterfilm ab. Nicht mal zu Weihnachten hält sie es aus, ohne dass Organe und Hirnteile wie Konfetti über die Mattscheibe fliegen. Jetzt jedoch herrscht für einen Augenblick angenehme Stille. Die Ruhe vor dem Sturm, fürchte ich. Doch dann wirft Vater seine von Eunuchenchören eingesungenen Uraltweihnachtslieder in den CD-Player. Das ist schön, das hat Tradition, verkündet er feierlich, wenn jemand über seine musikalischen Gaumenfreuden nörgelt. Und schon säuseln schmalzige Stille-Nacht-heilige-Nacht-Klänge geschmeidig die Treppe herauf, um ihre schleimige Zunge in mein geschundenes Hörorgan zu schieben.
Das obligatorische Augenrollen später, raffe ich die hastig verpackten Geschenke für die Lieben zusammen: Viel zu teure Frotteehandtücher für mütterliches Wohlbefinden nach der zu heißen Dusche, den unheimlich handlichen Akkuschrauber, den Vater unbedingt haben will, um ihn in den Schrank zu seinen Artgenossen zu legen und natürlich einen Briefumschlag mit hübscher aber eigentlich überflüssiger Glitzerkarte und gebügelten Geldscheinen für das Schwesterlein. Ja, Geld. Denn kaum war das Kind aus Mutters Beckengegend entglitten, rissen eifrige Freiheitsfanatiker die Mauer ein, um sich vom Kapitalismus überrollen zu lassen. Meine Schwester leider inbegriffen.
Im Wohnzimmer angekommen, werfe ich einen angstgenährten Blick in die Runde und sauge ein gewohntes Bild auf: Mutter hockt auf der Couch neben dem falschen Weihnachtsbaum, der so sehr nach giftig ätzendem Kunststoff stinkt, wenn man ihm zu nahe kommt, dass selbst unsere beiden Katzen einen großen Bogen um die Satanstanne chinesischen Fabrikats machen. Vater steht noch immer wichtigtuerisch neben seiner Stereoanlage und fummelt an den für ihn völlig kryptischen Tasten der Fernbedienung herum, um das Klangbild zu optimieren. Und unbeteiligt von alledem, hockt Oma regungslos auf ihrem Lieblingsstuhl am Esstisch und starrt unmotiviert Löcher in die Luft. Wie ich sie so ansehe, mit ihren neunundachtzig Jahren, versunken in ihren tannengrünen Pulli, denke ich für einen kleinen Moment, dass Oma der bessere Christbaum gewesen wäre. Meistens stinkt sie weniger als das Synthetikgewächs aus der Giftbrauerei, jedenfalls solange sie den Mund geschlossen hält, und außerdem bewegt sie sich mindestens genauso selten. Eigentlich weiß man auch nie so recht, ob sie lebt oder schon verwest – bis sie dann schließlich einmal mehr eine ihrer Weisheiten aus der Zwischenwelt zum Besten gibt.
»Oh, ihr habt ja auch was für uns«, tönt Mutter und klatscht theatralisch in die Hände, als meine Schwester und ich mit den Präsenten anrücken, wie wir es jedes Jahr tun. Ha, da haben wir sie aber wieder überrascht.
»Danke schön, mein Schatz«, schmachtet Vater und drückt mir einen wenig appetitlichen Bieratemschmatzer auf die Wange, als ich ihm sein Geschenk hinhalte. Seine naturgehärteten Bartstoppeln bohren sich in meine Poren, was die ganze Angelegenheit noch unangenehmer macht. Doch was tut man nicht alles für die liebe Erzeugerriege?
Während nun alle über ihren bunt verpackten Gaben hocken und eilig das Papier herunterreißen, als gäbe es kein Morgen, glaube ich fast, dass dieses Jahr alles friedlich abläuft. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, hin und wieder dringt sogar ein leises Freudenkichern durch das Tongemisch aus Papierrascheln und dem abstoßenden Kindergejaule von anno dunnemals aus der Stereoanlage. Auf mich wirkt der Abend, als würde sich niemand trauen, zuerst zu motzen, was mich sogleich frappierend an den kalten Krieg erinnert. Und so freut sich Mutter über ihre Handtücher, Vater dreht den neuen Akkuschrauber in den Händen herum, als hätte er den größten Diamanten bekommen, den die Welt je gesehen hat, und das Schwesterherz zeigt, freudig vor lauter Geldgeschenken, die raubkapitalistischen und nachgeweißten Zähne. Ich selbst befreie unterdessen die Bücher, die ich letzte Woche in einem Online-Shop bestellt habe, um sie mir dann unter den Baum legen zu lassen, aus ihrem Papiergefängnis.
»Und für die Großmutter gibt's auch was Feines«, sagt Mutter schließlich zur Oma im selben Tonfall, in dem sie sonst nur mit den Katzen redet, wenn sie ihnen ein besonders leckeres Fressi Fressi mitgebracht hat. Aber wer soll's ihr verübeln? Schließlich ist Oma ja doch irgendwie fast schon transzendent. Und obwohl sie kaum mehr vor die Tür geht, bekommt sie einen dicken Wollschal für ihren betagten Hals. Ihre gequollenen Augen schauen das gute Stück an, während alles ruhig ist und auf den erlösenden Kommentar wartet...
»Früüüher, da mussten wir uns Lappen um die Füüüße wickeln. Mussten wir. Laaappen. Weil wir ja keine Schuuuhe hatten«, krächzt Oma uns prophetisch von ihrem Stuhl zu und will uns damit wohl deutlich machen, dass sie sich über ihren neuen Schal sehr freut. So interpretiert das offenbar auch der Rest der Familie, worauf sich alle wieder wichtigeren Dingen zuwenden, nämlich sich selbst, und Oma zurück in ihre Dauertrance entlassen.
Tatsächlich haben wir es dieses Jahr also geschafft: Mutter räumt bereits die Unmengen an herumliegenden Geschenkpapierfetzen zusammen, und noch hat niemand das Kriegsbeil ausgegraben. Schwesterlein zählt ihr Geld, während sie sich wohl bereits ausmalt, welch sinnlosen Scheiß sie davon wieder kaufen wird, und auch ich bilde einen kleinen Geschenkstapel, damit im allgemeinen Aufräumchaos nichts versehentlich in der Abfalltonne landet.
Beruhigt will ich mich darauf zurücklehnen und die Besinnlichkeit wie einen wohltuenden Aufguss über mich ergehen lassen, als Vater den Kardinalsfehler begeht: Er zaubert ein kleines, buntes Schächtelchen aus dem Wohnzimmerschrank hervor und gibt es meiner Mutter in die Hand.
»Für dich«, sagt er, grinst dabei selbstzufrieden, und drückt auch ihr einen Schmatzer auf die Wange. Ob mein Gesicht wohl auch so seltsam verzogen aussieht wie Mutters, wenn ich angewidert dreinschaue, denke ich kurz, bevor eine glitschige Befürchtung in mein Bewusstsein kriecht, die mir sagt, dass es gleich ordentlich knallen wird.
Mit skeptischem Gesicht rupft Mutter das Geschenkpapier von dem kleinen Ding und zieht eine dunkelbraune Schatulle hervor. Oh oh! Die öffnet sie sogleich und hebt die Halskette zwischen Daumen und Zeigefinger mit einem dermaßen abstoßenden Blick an, dass man meinen möchte, Vater hätte ihr einen alten Fisch geschenkt.
»Du sollst mir doch nichts schenken. Wie teuer war das Ding denn jetzt schon wieder?«, wettert sie sofort wie eine Furie. Eine eisige Brise weht durchs Wohnzimmer. Damit hat der kommunistische Osten dem schwächelnden Westen offiziell den Krieg erklärt. Geschenke sind hier nicht gern gesehen. Mögen die Bomben fallen.
»Du bist unmöglich, weißt du das? Dir darf man nicht mal eine Freude machen«, mault Vater, leider ohne Nachdruck in der Stimme, zurück. Schwesterlein schiebt die Geldscheine in die Hosentasche und rennt die Treppe hinauf. Die Tür knallt, und gleich darauf meine ich zu hören, dass der Fernseher wieder läuft, damit Johnny Boy weiter fleißig Schädel knacken kann. Ich hocke derweil auf der Couch und schaue mir das traurige Spektakel noch ein wenig an.
»Eine Freunde? Du weißt genau, dass wir für solchen Quatsch kein Geld übrig haben«, zetert Mutter. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wovon sollen die Beiden sich jetzt auch die vierte oder fünfte Luxuskaffeemaschine kaufen, die nicht nur Milchschaum auf die besonders exquisiten Kaffeespezialitäten spuckt, sondern sogar noch abgezählte Schokoladenstreusel oben drauf hustet? Da muss man schon Prioritäten setzen.
Dann kontert Vater: »Ach, weißt du was? Du kannst mich mal! Dir schenk ich nichts mehr!« Wenn er sich doch nur daran halten würde, denke ich und schaue zu Mutter. Ihr Konter wiederum, dürfte nicht lange auf sich warten lassen.
»Die Brööötchen mussten wir damals zerbröööseln und in die Wassersuppe tun, damit wir überhaaaupt was zu essen hatten«, kräht Oma dazwischen. Sie scheint mit der Situation auch nicht ganz dakor zu gehen. Leider hört Mutter nicht auf die Altersweisheit und motzt lieber Vater an: »Ich kann dich mal? Was schämen solltest du dich! Und das zu Weihnachten! Vor den Kindern! Sowas überhaupt zu mir zu sagen, ist ein Unding! Geh mir bloß aus den Augen!«
Tut er prompt. Die nächste Tür knallt, dann das Geräusch des Schlosses. Vater hat sich im Schlafzimmer eingeschlossen, um in seine Kissen zu heulen. Das ist schön, das hat Tradition. Derweil lässt er nun Oma, Mutter und leider auch mich mit seiner geliebten Weihnachtsmusik zurück. Die furchtbaren Sänger wollen gerade verkünden, dass der Schnee leise rieselt und der See still und starr herumliegt, als Mutter energisch auf alle Tasten hämmert, bis sie zufällig die Stopptaste erwischt. »Kann sich ja keiner anhören, den Scheiß«, gibt sie bissig zu Protokoll und verdrückt sich darauf wutschnaubend in die Küche, um zur Beruhigung ihre Kaffeemaschinensippe zu säubern.
Ich hocke noch immer auf der Couch und überlege, ob ich weinen oder lachen soll. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich ein Gemisch aus meinen Eltern geworden: mitunter emotional, dass ganze Welten in mir untergehen, bei alledem aber mit verkümmerten Tränendrüsen ausgestattet. Wenigstens bin ich nicht ganz allein, denke ich, als neben mir ein lautes Poltern ertönt. Dann ist wieder alles ruhig. In der Stille werfe ich einen Blick zu Oma, von der das Geräusch kam. Zuerst kann ich sie nicht entdecken, dann sehe ich sie. Ihr Kopf liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch. Die hat's endgültig hinter sich. Mal sehen, wie lange es dauert, bis das jemand bemerkt. Ich bin nun also doch allein.
Ich hätte jetzt zumindest diese weihnachtliche Eskalation auch gern hinter mir, doch so leicht wollen es mir die Weihnachtsgeister natürlich nicht machen: Nun, da ich eben so allein im Wohnzimmer hocke, verkündet das erste krampfhafte Bauchgrummeln, dass auch mein Verdauungstrakt noch ein paar Takte zu sagen hat. Die Magen-Darm-Grippe ist tatsächlich pünktlich wie die Maurer, denke ich und erhebe mich langsam, um mir einen kurzen aber beschwerlichen Weg durch das verstrahlte Krisengebiet zu bahnen und mich schließlich auf eine gemeinsame Nacht mit der Kloschüssel einzustellen. Immerhin hält die gänzlich die Klappe.