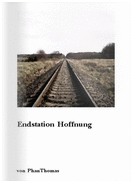Beschreibung
F├╝r diese Geschichte danke ich der lieben LadyLy. Die erheiternden Gespr├Ąche mit ihr brachten mich auf die Idee zu dieser Erz├Ąhlung. Ihr ist zudem diese Geschichte gewidmet, wie auch Daniel, alias Punkpoet, und dem guten Doc, dem ich mal eben und hoffentlich mit seinem Wohlwollen den schwarz gekleideten Mann entliehen habe. Diese Geschichte ist mein Orion, und genau bei diesem Lied ist sie auch entstanden: http://tinyurl.com/684c9o
Akt I
Mir stockte der Atem, als ich am Bahnhof ankam. Nat├╝rlich stehen die Leute immer Schlange, wenn es etwas umsonst gibt, doch mit einem solchen Andrang h├Ątte ich nicht im Traum gerechnet: Auf dem Gleis tummelten sich derma├čen viele Leute, dass ich mich nicht entsinnen konnte, auf welchem Jahrmarkt oder welchem Open-Air-Konzert auch immer ich je so viele Menschen auf einen Schlag gesehen hatte. Geschweige denn auf einem einzigen Gleis. Und dabei war die Anzeige in der Sonntagsbeilage der Zeitung doch eher winzig und unscheinbar gewesen:
Genie├čen Sie Ihre Freifahrt Richtung ┬╗Hoffnung┬ź.
Eine atemberaubende Gratisfahrt ans Ziel all jener, die das Tr├Ąumen noch nicht aufgegeben haben.
Sie ben├Âtigen lediglich Handgep├Ąck. Verk├Âstigung inklusive.
Abfahrt: Heute, 15 Uhr!!!
(Bringen Sie bitte diesen Coupon zur Abfahrt mit. Vielen Dank!)
Ich hatte die ganze Geschichte f├╝r einen ziemlich bl├Âden PR-Gag gehalten, an dessen Ende ziemlich sicher eine h├╝bsche Dame mit festgewachsenem Grinsen stehen w├╝rde, um eine neue Sorte Cola oder Schokolade f├╝r lau an allzu neugierige und gelangweilte Probanden zu verteilen. Und so hatte ich tats├Ąchlich nur meine kleine Umh├Ąngetasche mitgenommen, als ich mich gelangweilt zum Bahnhof aufgemacht hatte.
Hoffnung, was konnte daran schon so falsch sein? Sind wir nicht alle auf der gro├čen Suche nach der Hoffnung? F├╝r mich selbst war diese Suche, schon so lange ich denken konnte, eine Mammutaufgabe gewesen, die ich nie zu erf├╝llen im Stande gewesen war. Man lebt sein Leben und hofft, sich all die W├╝nsche, die man hegt, eines sch├Ânen Tages erf├╝llen zu k├Ânnen. Die materiellen als auch die pers├Ânlichen, die wirklich wichtigen. Ich glaube, wenn ich sie die zwischenmenschlichen Bande nenne, kommt das der Wahrheit ziemlich nahe. Ja, ich gebe es zu: Ich hegte mein Leben lang die Hoffnung, das perfekte Gegenst├╝ck zu finden. Ich habe nie wirklich an der Erf├╝llung dieser Hoffnung gearbeitet. Warum? Nun, wahrscheinlich glaubte ich einfach, dass ich das Wahrwerden dieser Hoffnung verdient haben m├╝sste. Der Teufel k├Ânnte nicht immer auf den gr├Â├čten Haufen schei├čen, wenn ich das so sagen darf, und irgendwann w├╝rde auch mein Tag gekommen sein. So hangelte ich mich immer schon von einem Punkt im Leben zum n├Ąchsten. Traurig, nicht wahr?
Nat├╝rlich verband ich all das nicht mit dieser seltsamen Zeitungsanzeige (Oder tat ich es doch?), aber ein wenig Ablenkung vom tristen Wochenende kam mir doch ziemlich recht. Und nat├╝rlich war ich neugierig, welchen Scherz sich die Veranstalter f├╝r all die armen Idioten, die tats├Ąchlich am Bahnhof aufkreuzen w├╝rden, ausgedacht haben mochten.
Doch nein, dies war ganz und gar kein PR-Gag, wie ich nun ziemlich staunend feststellen musste. Die Bahn war bereits im Bahnhof eingefahren und stellte schon f├╝r sich genommen einen wahren Augen├Âffner dar: Am vorderen Ende des Zuges wartete eine schwarz gl├Ąnzende Dampflokomotive mit einem majest├Ątisch gro├čen Schornstein. Die dunkelgr├╝nen Waggons wirkten geradezu antik, hatten keinerlei neumodische Digitalanzeigen und waren dezent mit goldenen Linien ├╝berzogen. Der ganze Zug erinnerte sehr an eine stark ├╝berzeichnete Version des Orient Express, so pomp├Âs und au├čerhalb jeglicher Moderne, dass er wie ins Bild geschnitten wirkte.
Als ich ehrf├╝rchtig an der Lok vorbeiging und mich den dicht umstandenen Waggons n├Ąherte, entdeckte ich einen blau gekleideten Schaffner. Er stand mitten auf dem Bahnsteig und begr├╝├čte jeden eintreffenden Fahrgast pers├Ânlich. Wenn das mal kein Service ist, dachte ich und sp├╝rte einen Anflug von froher Erwartung in mir aufsteigen. Vor ihm hatte sich bereits eine kleine Warteschlange gebildet, der ich mich nun anschloss.
┬╗Ich hei├če Sie herzlich willkommen, mein Herr┬ź, sagte der Schaffner zu mir, als ich wenige Augenblicke sp├Ąter das vordere Ende der Schlange erreicht hatte und ihm den ausgeschnittenen Zeitungscoupon unter die Nase hielt. F├╝r mich sah er aus, als w├╝rde er sich selbst nicht allzu ernst nehmen: Seinen wohlgen├Ąhrten Leib hatte er in einen reichlich eng sitzenden, blauen Anzug mit golden gl├Ąnzenden Kn├Âpfen gezw├Ąngt. Oberhalb seines pausb├Ąckigen Gesichts thronte die dazu passende blaue M├╝tze. Ja, er h├Ątte glatt aus einer Kindergeschichte stammen k├Ânnen, w├Ąre da nicht dieses seltsame L├Ącheln auf seinem Gesicht gewesen. Seine Lippen waren so rot, als h├Ątte er Lippenstift verwendet, und auch seine leicht ger├Âteten Wangen sahen aus, als w├Ąren sie geschminkt. Und dieses L├Ącheln war doch eher ein Grinsen, das mich ziemlich stark an Jack Nicholson in seiner Paraderolle als Joker erinnerte. Ich war mir sicher, dass er sich M├╝he gab, freundlich zu wirken, doch ich erkannte eher ein Hohngrinsen hinter seiner Bem├╝hung. Dennoch wollte ich mir nichts anmerken lassen, schlie├člich w├Ąre das alles andere als fair gewesen, gerade wo ich diesen Menschen doch ├╝berhaupt nicht kannte.
┬╗Vielen Dank┬ź, sagte ich daher und schaute den dicklichen Schaffner so freundlich, wie es mir m├Âglich war, an. ┬╗Das sind ja ziemlich viele Leute, die hier mitfahren wollen.┬ź
┬╗Oh, das k├Ânnen Sie aber laut sagen, mein Herr. Unsere Fahrten sind immer gut besucht. Wahrlich immer┬ź, entgegnete der Schaffner, der selbst w├Ąhrend des Redens sein aufgemaltes Grinsen zur Schau trug.
┬╗Das glaub ich gern┬ź, antwortete ich. ┬╗Begr├╝├čen Sie all die Leute pers├Ânlich?┬ź
┬╗Aber selbstverst├Ąndlich, mein Herr. Das geh├Ârt zu unserem Service. Hoffnung ist schlie├člich eine sehr pers├Ânliche Sache, nicht wahr?┬ź
Ich dachte nach und fand, dass da irgendwie etwas Wahres dran war. ┬╗Ja, das stimmt wohl┬ź, sagte ich und fragte: ┬╗Wo geht die Fahrt denn nun wirklich hin? An den Waggons steht ja auch tats├Ąchlich ›Hoffnung‹, aber ich kenne keinen Ort, der so hei├čt. Ach ja, und das ist ├╝brigens eine h├╝bsche Dampflok. Ist die denn echt?┬ź
Der Schaffner lachte, dass seine ohnehin enge Uniform sich noch mehr straffte und sagte schlie├člich: ┬╗Aber mein Herr! Nat├╝rlich gibt es einen Ort, der Hoffnung hei├čt. Sie tragen ihn in Ihrem Herzen und in Ihrem Kopf. Au├čerdem ist ‚Hoffung‘ auch der Name dieses Zuges, beziehungsweise, der dieser Lokomotive. Und selbstverst├Ąndlich ist sie echt. Sie ist fast so alt wie die Hoffnung selbst, m├Âchte ich meinen.┬ź Hinter vorgehaltener Hand lachte er ├╝ber seinen eigenen Scherz. ┬╗Sie ist die letzte ihrer Art, mein Herr. Und sie wird es wohl immer sein.┬ź
›Hoffnung‹. Goldene Lettern schm├╝ckten die Schilder, die in die T├╝ren der Waggons geh├Ąngt worden waren. F├╝r einen Moment erinnerten sie mich an Bilder aus dem ersten Weltkrieg, die ich in einem Magazin gesehen hatte. Deutsche Soldaten waren in Z├╝ge gestiegen, die als Ziel ‚Paris‘ angaben. Eine tr├╝gerische Hoffnung und ein ziemlich unpassender Vergleich, wie ich pl├Âtzlich fand. Ich wischte den Gedanken hinfort und dachte wieder ├╝ber die Worte des Schaffners nach. Als ich f├╝r einen Moment nichts sagte, ergriff er stattdessen die Initiative: ┬╗Sie sind sich im Augenblick nicht dar├╝ber bewusst, wo Ihre Hoffnung tats├Ąchlich liegt, nicht wahr, mein Herr?┬ź
┬╗Ich, ├Ąh┬ź, begann ich, bevor mir die Worte komplett entfielen. Der Schaffner hob blitzartig seine H├Ąnde, legte eine auf meine Brust und die andere auf meine Stirn. Er schloss kurz die Augen, dann nahm er sie wieder weg und nickte verstehend. ┬╗Ihr Kopf sagt mir, dass sie auf der Suche nach der Liebe sind. Sie hoffen, die wahrlich wei├č leuchtende Dame zu finden. Doch Ihr Herz, mein Herr, wei├č noch weit mehr ├╝ber Ihre tats├Ąchliche Hoffnung.┬ź Dann wurde sein Grinsen pl├Âtzlich breiter. Er streckte den R├╝cken durch und sagte: ┬╗Vielleicht bekommen Sie w├Ąhrend der Fahrt die Gelegenheit, auf Ihr Herz zu h├Âren, mein┬á Herr. Und wer wei├č, vielleicht bringen wir Sie auch zur wei├č leuchtenden Dame. Mein Herr, ich w├╝nsche Ihnen eine angenehme Fahrt.┬ź
┬╗Danke sehr┬ź, sagte ich kurz angebunden und sp├╝rte ein etwas mulmiges Gef├╝hl in meiner Bauchgegend. Nun wusste ich zwar noch immer nicht, wohin die Reise gehen w├╝rde, doch ohnehin erwartete ich lediglich eine kurze, gem├╝tliche Kaffeefahrt. H├Âchstwahrscheinlich w├╝rde man versuchen, uns w├Ąhrend der Fahrt billige Parfums und Magnetohrringe anzudrehen. Na, von mir aus. Im Moment wollte ich nur noch einsteigen. Das Gefasel dieses Schaffners ging mir doch etwas zu weit. Ich hatte bereits die skurrilsten Gestalten erlebt, seien es aufdringliche M├Âbelverk├Ąufer, die sich selbst zum Kaffee einladen wollten oder auch onanierende Flugzeugpassagiere, doch dieser hier schoss eindeutig den Vogel ab. Dennoch gingen seine Worte mir irgendwie nahe, schien er doch eine recht au├čergew├Âhnliche empathische Gabe zu besitzen.
┬╗├ähm, sagen Sie, bekomme ich einen bestimmten Sitzplatz zugewiesen, oder-┬ź begann ich und wurde wiederum unterbrochen.
┬╗Schauen Sie auf Ihre Fahrkarte┬ź, sagte der Schaffner mit fr├Âhlicher Stimme und zwinkerte mir zu. Ich schaute auf den Coupon, den ich noch immer in meiner Hand hielt und entdeckte tats├Ąchlich eine Sitzplatznummer: Wagen 155, Sitzplatz 11 (Fenster). Seltsam, dachte ich, wie konnte ich das zuvor ├╝bersehen haben? Der Hinweis war deutlich und in fetten Lettern auf den unteren Teil des Coupons gedruckt worden. Ich zuckte mit der Schulter und ging wortlos an dem Schaffner vorbei. Als ich mich einige Schritte entfernt hatte, rief er mir nach: ┬╗Mein Herr?┬ź
Ich drehte mich um und fragte: ┬╗Ja, bitte?┬ź
┬╗Wei├č leuchtende Damen sind rar geworden in diesen Tagen, nicht wahr?┬ź, fragte er langsam und bed├Ąchtig. Wieder nickte er verstehend, doch ich konnte nur abermals mit der Schulter zucken. Was h├Ątte ich ihm auch antworten sollen? ┬╗Vergessen Sie nie, dies ist die ›Hoffnung‹, in die Sie einsteigen┬ź, schloss er an und grinste. Ich spielte ihm ein L├Ącheln vor und drehte mich wieder um.
Ich musste nicht weit gehen, um Wagen 155 zu erreichen. Es war der vierte Waggon hinter der Lok. Als ich gerade einsteigen wollte, warf ich einen Blick nach rechts. Die T├╝r zur Lokomotive stand nun offen, und der Lokf├╝hrer war nach drau├čen gekommen. Ein kalter Schauer durchfuhr mich, als die Gestalt den Bahnsteig betrat. Anders als der Schaffner, trug er keine h├╝bsche, blaue Uniform, sondern einen langen, schwarzen Mantel, der selbst aus der Ferne leicht schmuddelig wirkte. Sein breitkrempiger, schwarzer Hut, der sehr an die Kopfbedeckung der Amish erinnerte, warf einen dunklen Schatten auf sein Gesicht, das so nicht zu erkennen war. Seltsame Aufmachung f├╝r einen Zugf├╝hrer, dachte ich, beschloss dann jedoch ganz entgegen meinem Bauchgef├╝hl, dass die Aufmachung wohl zur Show geh├Âren musste. Und so stieg ich ein.
Im Inneren des Wagens roch es genauso, wie ich es erwartet hatte, als ich die alten Waggons gesehen hatte: irgendwie muffig und nach Staub, was mich an das alte Wohnzimmer meiner Gro├čmutter erinnerte, in dem die gro├če Wanduhr Jahr um Tag so penetrant getickt hatte. Ein Gef├╝hl von kindlicher Behaglichkeit legte sich wie Balsam auf mein Gem├╝t und lie├č mich den seltsamen Schaffner sowie den d├╝steren Lokf├╝hrer vergessen.
Die Sitze waren ungemein gro├č und wirkten im Gegensatz zu den schn├Âden, grauen Sitzen eines modernen ICE wie K├Ânigsthrone. Und genau so f├╝hlte sich der mir zugewiesene Platz auch unter meinem Allerwertesten und an meinem R├╝cken an: ganz, als w├Ąre ich auf Wattewolken gebettet. Derweil konnte ich durch das Fenster beobachten, dass das rege Treiben auf dem Bahnsteig allm├Ąhlich abebbte. Mehr und mehr Leute bestiegen den Zug. Auch der Waggon, in dem ich sa├č, f├╝llte sich zunehmend. Wei├čhaarige Gro├čm├╝tter und -v├Ąter zogen an mir vorbei, junge Frauen und M├Ąnner, hier und da ein P├Ąrchen. Doch keine Kinder. Ich ma├č dieser Tatsache jedoch keine allzu gro├če Bedeutung bei. Der Platz neben mir blieb tats├Ąchlich frei, was mir sehr gelegen kam. Gegen├╝ber dem kleinen Tisch vor meinem Sitz nahm nun eine ├Ąltere Dame ihren Platz ein. Sie wirkte im Gesicht sehr hager und ausgezehrt. Nachdem sie ihren Mantel abgelegt hatte, lie├č sie sich keuchend in den weichen Sitz fallen.
┬╗Einen guten Tag w├╝nsche ich┬ź, sagte ich, bekam jedoch keine Antwort. Sie beachtete mich nicht einmal, sondern schloss stattdessen sofort ihre m├╝den Augen. Dann eben nicht, dachte ich und schaute auf die Uhr. 15 Uhr und 13 Minuten. Wir waren bereits etwas versp├Ątet. F├╝nf Minuten sp├Ąter sank die Dame mir gegen├╝ber – ihr offener Mund verriet es – scheinbar sehr ersch├Âpft in den Schlaf.
Ich schaute wieder aus dem Fenster. Der Bahnsteig hatte sich ziemlich geleert, und auch die letzten Fahrg├Ąste mussten ihren Platz gefunden haben, denn nun endlich setzte sich die Bahn schnaufend in Bewegung. Die Lok lie├č tats├Ąchlich ein geradezu urzeitlich anmutendes Pfeifen erklingen, als sie sich schwerf├Ąllig aus dem Bahnhof schob.
Sp├Ąter nahm ich an, dass es die Luft war, und auch jetzt m├Âchte ich das irgendwie gern glauben, auch wenn ich mittlerweile doch sehr viel mehr dahinter vermute, jedenfalls sp├╝rte auch ich einen pl├Âtzlichen Anflug von M├╝digkeit, als wir die Stadt bereits verlassen hatten und au├čerhalb des Zuges nur noch weite, bewirtschaftete Felder zu entdecken waren. Ich versuchte, mich noch ein wenig bei Laune zu halten, hoffte, dass eine laute Durchsage des Personals mich wachr├╝tteln w├╝rde, doch das passierte nicht. Und so sank ich unter dem fortw├Ąhrenden und gleichm├Ą├čigen Rattern der Waggonr├Ąder allm├Ąhlich in einen tief schwarzen, traumlosen Schlaf.
Akt II
Was mich schlie├člich nach einer ungewiss langen Zeit hochschrecken lie├č, war tats├Ąchlich eine Durchsage: ┬╗Meine werten Damen und Herren, wenn Sie nun zu beiden Seiten aus dem Fenster blicken, k├Ânnen Sie die Realit├Ąt entdecken. Die wundersch├Âne Landschaft, die sich Ihnen hier bietet, ist wahrhaftig! Und doch haben Sie alle sie niemals wirklich zu erfassen versucht, nicht wahr? Ich weise Sie nur darauf hin, weil wir hier leider aus Fahrplangr├╝nden nicht halten k├Ânnen. Nehmen Sie die Bilder in sich auf, werte Fahrg├Ąste. Es sind die sch├Ânsten, die Sie mit Ihren eigenen Augen w├Ąhrend der Fahrt erblicken werden. Vielen Dank!┬ź
Ich runzelte die Stirn. Auch die Dame gegen├╝ber von mir, die scheinbar ebenso von der Durchsage geweckt worden war, tat das. Ich hatte das Gef├╝hl, dass sie mich ansah, doch sie sagte nichts. Und so hielt auch ich meinen Mund und schaute aus dem Fenster, um die wunderbare Landschaft auf mich wirken zu lassen. ├ťber die eigenartige Durchsage dachte ich nicht weiter nach, weil dieser Schlaf irgendetwas mit mir gemacht hatte. Das konnte ich deutlich sp├╝ren, doch ich konnte nicht sagen, was es war. Wenn wir tr├Ąumen, dann wundern wir uns nicht, wenn jemand auf einem Fahrrad an uns vor├╝berfliegt. Und insgeheim wissen wir, dass wir tr├Ąumen, genauso wie wir hin und wieder sp├╝ren, dass wir nicht tr├Ąumen, obwohl uns eine gewisse Situation so erscheint. Und genau so war es: Ich sp├╝rte, dass dies hier kein Traum war, war aber nicht mehr in der Lage, all das, was um mich herum geschah, als seltsam einzustufen. Ich akzeptierte es einfach, so wie es offenbar auch die anderen Leute taten, die ihre fragenden Gesichter recht schnell wieder ablegten. Ich schaute auf meine Armbanduhr, um festzustellen, wie lange ich geschlafen hatte. Die Zeiger waren stehen geblieben, als es 15 Uhr und 19 Minuten gewesen war.
Als ich noch immer zum Fenster rausschaute und dabei zusah, wie saftige Wiesen, auf den St├Ârche anmutig von A nach B staksten, um nach Fr├Âschen zu suchen, lauschige W├Ąldchen, die fast schon gemalt wirkten und kleine Teiche, die liebevoll mit Schilf und Seerosen geschm├╝ckt waren, an uns vorbeizogen, wurde ich von der anderen Seite pl├Âtzlich aufgeschreckt.
┬╗Mein Herr, darf es ein Tee sein?┬ź, fragte der Schaffner, den ich sofort wiedererkannte. Noch immer grinste er sein kussmundrotes L├Ącheln auf mich herab. Er trug ein gro├čes Tablett mit einer einzigen Tasse darauf.
┬╗Tee?┬ź, fragte ich ein wenig missmutig. ┬╗Haben Sie vielleicht auch Kaffee da?┬ź
┬╗Oh, das tut mir leid, mein Herr┬ź, sagte der Schaffner und lachte, dass seine Uniform sich einmal mehr vor seinem ausladenden Bauch spannte. ┬╗Kaffee gibt es bei uns nicht. In der ›Hoffnung‹ gibt es nur Tee.┬ź
Bevor ich gar nichts zu trinken bekam, beschloss ich, dass auch Tee gen├╝gen w├╝rde. ┬╗Gut, dann nehme ich eben einen Tee┬ź, sagte ich also und bekam prompt genau die eine Tasse gereicht, die der Schaffner auf seinem Tablett mitgebracht hatte.
┬╗Bitte sehr, mein Herr┬ź, sagte er.
┬╗Vielen Dank. Welche Sorte ist das, wenn ich fragen darf?┬ź
┬╗Aber mein Herr┬ź, sagte er und lachte abermals. ┬╗Das m├╝ssen Sie schon selbst herausfinden.┬ź
Ich blickte auf die Tasse mit dem dampfenden Tee, als mir einfiel, dass ich den Schaffner auch gleich nach der Uhrzeit fragen k├Ânnte. Ich sah zu ihm hoch und nahm fast unbewusst wahr, dass auf seinem Tablett eine neue Tasse stand. Doch wie gesagt, die Andersartigkeit dieser Situation hatte sich irgendwie als Normalit├Ąt in meinem Kopf manifestiert.
┬╗Entschuldigen Sie, k├Ânnen Sie mir vielleicht die Uhrzeit nennen? Meine Uhr ist stehen geblieben┬ź, sagte ich
┬╗Schauen Sie ruhig auf Ihre Uhr, mein Herr. Dann kennen Sie die Uhrzeit. Hier in der ›Hoffnung‹ sind wir nicht an die Zeit gebunden.┬ź
Darauf wusste ich im Augenblick keine Antwort. Ich sah, wie der Schaffner sich h├Âflich der Frau mir gegen├╝ber zuwandte, doch ich konnte nicht h├Âren, was er sagte. Auch ihre Stimme konnte ich nicht wahrnehmen. Es war, als w├╝rde ich mir einen Stummfilm ansehen. Dieser Vergleich brachte mich auf den Gedanken, dass sie meinen Gru├č vorhin vielleicht ebenso wenig geh├Ârt haben mochte.
Ich hob die Tasse und nippte vorsichtig an dem Tee. Seltsamerweise war er ├╝berhaupt nicht hei├č, obwohl er noch immer so sehr dampfte, dass ich davon ausgegangen war, mir an ihm die Zunge verbrennen zu k├Ânnen. Er schmeckte sehr fade, was die Sorte f├╝r mich nicht gerade erkennbar machte. Genauer gesagt, schmeckte er wie abgestandenes Wasser und damit ├Ąhnlich muffig wie der Geruch in diesem Zugwaggon. Ich stellte mir vor, ich h├Ątte ein Glas lauwarmes Mineralwasser vor mir, w├Ąhrend ich die ganze Tasse hinunterkippte. Als ich sie wieder abstellte, musste ich mit ansehen, wie sie sich von selbst wieder f├╝llte. Der kurze Schreckmoment, der mich dabei ├╝berfiel, verflog jedoch sofort wieder, so als h├Ątte ihn irgendetwas wie Laub aus dem Weg gekehrt.
Im Gegensatz zu den ganzen neumodischen Verkehrsmitteln, fehlte in diesem Zug nat├╝rlich die M├Âglichkeit, Kopfh├Ârer an der Sitzlehne anzuschlie├čen. Und da leider auch der Akku meines iPods ziemlich leergesaugt war, blieb mir nicht viel anderes ├╝brig, als mit aufgest├╝tztem Kopf aus dem Fenster zu schauen. Die sogenannte Realit├Ąt mussten wir scheinbar mittlerweile passiert haben, denn nun zogen triste Sandlandschaften an uns vorbei, die es hier eigentlich ├╝berhaupt nicht geben durfte. Das gesamte Bild wurde dabei in ein zwielichtiges Gelb getaucht, das von dem sepiafarbenen Himmel auszugehen schien. Es war, als blickte ich auf eine alte, vergilbte Fotografie. Und vielleicht war es diese Tristheit, die mich wiederum m├╝de werden lie├č, obwohl ich ja bereits sagte, dass ich etwas anderes vermute. Ich konnte mich nicht dagegen erwehren, meine Augen zu schlie├čen und abermals in einen traumlosen Schlaf zu sinken. Ein gro├čer Anflug an nichts. Welch tolle Fahrt.
Akt III
Dieses Mal war es keine Durchsage, die mich weckte, sondern der Schaffner selbst.
┬╗Es liegt mir mehr als fern, Sie zu st├Âren, mein Herr. Doch ich wollte Sie fragen, ob die Fahrt f├╝r Sie genehm ist und ob ich vielleicht etwas f├╝r Sie tun kann┬ź, sagte er, als h├Ątte er meine Langeweile gerochen.
┬╗Nun ja, mir fehlt ein wenig die Besch├Ąftigung. Wie lange fahren wir denn noch?┬ź, fragte ich, mit verschlafenen Augen zu ihm aufblickend. Dann stellte ich fest, dass er sich ver├Ąndert hatte. Er schien weniger aufgedunsen, und seine zuvor roten Lippen waren dabei, ein verwaschenes Orange anzunehmen. Auch die farbigen Wangen waren verschwunden und wirkten nun aschfahl.
┬╗Machen Sie sich keine Gedanken ├╝ber die Dauer der Fahrt, mein Herr. Die ›Hoffnung‹ nach der Fahrtdauer zu fragen, w├Ąre geradezu blasphemisch. Doch das wissen Sie eigentlich selbst. Kann ich Ihnen vielleicht ein Buch aus unserer Bordb├╝cherei anbieten?┬ź
┬╗Sie haben hier eine Bordb├╝cherei? Seit wann gibt es denn so etwas?┬ź, fragte ich leicht verwundert.
┬╗Oh, dieser Zug hat eine, f├╝rwahr, mein Herr.┬ź
┬╗Sagen Sie, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Sie sehen schlecht aus┬ź, sagte ich.
Nun lachte er wieder, doch seine Uniform spannte sich nicht mehr. Sie hing eher l├Ąssig ├╝ber seinen deutlich d├╝nner gewordenen Bauch. ┬╗Machen Sie sich nur keine Gedanken, mein Herr. Die ›Hoffnung‹ verlangt von uns allen ihren Tribut, nicht wahr?┬ź
Ich beschloss, meine Feststellung auf sich beruhen zu lassen und auf die B├╝cher zur├╝ckzukommen. Lesen erschien mir in diesem Moment als willkommene Abwechslung, und so entschied ich, dieses Angebot nicht auszuschlagen. ┬╗Was haben Sie denn im Angebot?┬ź, fragte ich.
┬╗Wir haben eine reichhaltige Palette, mein Herr. Es kommt darauf an, wonach Ihnen der Sinn steht. M├Âgen Sie Klamauk? Dann empfehle ich Ihnen unsere Sammlung an Timothy Bafflegab-Romanen. Den Autor selbst durften wir schon pers├Ânlich bei uns beehren, wenn ich das anmerken darf.┬ź Er zwinkerte mir zu und fuhr fort: ┬╗Ansonsten h├Ątten wir noch die Glaswelt-Romane von der guten Lady Lydecha. Diese geh├Âren eindeutig zu meinen Favoriten, sind aber schwer verdauliche Kost. Oder steht Ihnen der Sinn nach etwas Seichtem? Dann empfehle ich Ihnen unsere spannende Phylogenese-Reihe vom noch wenig bekannten Daniel R.┬ź Dann beugte er sich zu mir herunter und fl├╝sterte im verspielten Tonfall: ┬╗Der ist ├╝brigens sogar an Bord, was mir eine sehr gro├če Ehre ist, mein Herr.┬ź
Ich musste zugeben, dass ich keines der B├╝cher kannte und entschied mich daher f├╝r eines von jedem der Autoren. Immerhin w├╝rde das ein wenig Abwechslung bringen.
┬╗Sehr gern, mein Herr┬ź, sagte der Schaffner freundlich und holte pl├Âtzlich drei B├╝cher hinter seinem R├╝cken hervor. Ich versuchte erst gar nicht, mich zu fragen, wie er das gemacht hatte und nahm die Romane daher einfach nur dankend an.
Gerade, als ich die B├╝cher auf dem kleinen Tisch vor mir aufgestapelt hatte, ert├Ânte eine neue Durchsage: ┬╗Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie darauf hinweisen zu d├╝rfen, dass sie nun zu Ihrer Linken einige recht gro├če und imposante Bauten erblicken k├Ânnen. Dies sind die ber├╝hmten Traumschl├Âsser, von denen Sie alle – da bin ich mir sehr sicher – bereits einiges geh├Ârt haben.┬ź Die Stimme unterbrach die Ansage, um ein d├╝ster klingendes Lachen ert├Ânen zu lassen, dass mir unter anderen Umst├Ąnden wahrscheinlich das Blut in den Adern gefrieren lassen h├Ątte und sprach anschlie├čend weiter: ┬╗Wenn Sie genau hinsehen, k├Ânnen Sie auch die Abrissarbeiter entdecken. Ich w├╝nsche Ihnen viel Vergn├╝gen beim Zuschauen. Wir fahren derweil weiter und bereiten uns allm├Ąhlich auf einen kleinen Zwischenhalt vor.┬ź
Ein Zwischenhalt? Ich wusste weder, wo wir waren, noch wie lange wir bereits unterwegs waren, wo also w├╝rden wir ├╝berhaupt halten? Doch ich f├╝hlte mich innerlich zu schwach, um aufzustehen und nach dem Schaffner zu suchen und ihn danach zu fragen. Dieser war n├Ąmlich mittlerweile nirgends mehr zu entdecken. Also tat ich es den anderen Leuten im Waggon nach und sah nach drau├čen.
Was ich sah, schockte mich nicht, dennoch lie├č es mich schlucken. Und wieder sp├╝rte ich dieses Hinfortziehen eines aufbl├╝henden Gef├╝hls in meinem Kopf. Drau├čen, inmitten des gelben Lichtschleiers, waren gigantische Bauwerke zu sehen, die teilweise bis in den Himmel zu reichen schienen. Einige waren reich verziert und erinnerten an Schl├Âsser im Stil des Rokoko. Andere wiederum wirkten mit ihren hohen Zinnen und den kleinen Fenstern bedrohlich und kalt. Am Fu├če der Schl├Âsser lie├č sich ein reges Treiben beobachten. Fast unbekleidete M├Ąnner und Frauen schlugen mit Spitzhacken auf die Schlossmauern ein. Sie arbeiteten, als w├Ąre der Teufel pers├Ânlich hinter ihnen her, und gewisserma├čen schien das auch zu stimmen. Denn hinter ihnen standen dunkel gekleidete Gestalten, die mich mit ihren M├Ąnteln und den breitkrempigen H├╝ten frappierend an den Zugf├╝hrer erinnerten und die pausenlos mit Peitschen auf die Arbeiter einpr├╝gelten.
Dieses alles andere als sch├Âne Bild wollte und konnte ich nicht l├Ąnger ertragen. Ich griff eines der B├╝cher, die der Schaffner mir gegeben hatte und versuchte, zu lesen. Erstaunlicherweise gelang mir das sogar. Als h├Ątte mich ein pl├Âtzlich aufflammendes Interesse an die Seiten gefesselt, verschlang ich fast den gesamten Roman um die Phylogenese (ein geschriebener Zombiesplatter) und verga├č dar├╝ber v├Âllig die Zeit.
Was mich letztlich dazu brachte, das Buch wieder zur Seite zu legen, waren die pl├Âtzlich quietschenden Zugbremsen. Ich sah auf und musste feststellen, dass mir schwindelig war. Es dauerte einen Moment, bis meine Augen sich scharf stellten. Ich fuhr mit der Hand ├╝ber mein Gesicht und sp├╝rte kalten Schwei├č. Und erst jetzt stellte ich mit Entsetzen fest, wie mager meine Finger geworden waren. Meine H├Ąnde, meine Arme, alles an mir, schien in sich zusammenzufallen. Doch noch bevor ich in Panik geraten konnte, war diese unsichtbare Macht wieder da, um in meinem Kopf die Normalit├Ąt herzustellen. Pl├Âtzlich fand ich es ebenso wenig erschreckend, dass auch die Menschen um mich herum so furchtbar ausgemergelt waren. Einige waren bereits so d├╝rr, dass sie mich an die furchtbaren Fotos von KZ-H├Ąftlingen in den Geschichtsb├╝chern erinnerten.
Endlich kam der Zug zum Stehen, und wieder ert├Ânte eine Durchsage: ┬╗Meine Damen und Herren, wir haben soeben unseren einzigen Zwischenhalt erreicht. Sofern Sie aussteigen m├Âchten, k├Ânnen Sie dies hier und jetzt gern tun. Wir w├╝nschen Ihnen in diesem Fall einen angenehmen Sturz.┬ź
Hatte er gerade Sturz gesagt, fragte ich mich, als pl├Âtzlich rings um mich Heerscharen von Fahrg├Ąsten aufstanden. Auch die Dame mir gegen├╝ber erhob sich langsam und qu├Ąlend. Sie alle trugen derart eingefallene Gesichter zur Schau, dass es mir schwer fiel, hinter diesen schaurigen Masken menschliches Leben zu entdecken. Mit ihrer kalkwei├čen Haut und den leeren Augen erinnerten sie mich eher an die Zombies aus dem Buch, das ich soeben gelesen hatte. Wo sie hingehen mochten, fragte ich mich gerade, als ich auch schon h├Âren konnte, wie die T├╝ren des Waggons sich schleppend ├Âffneten. Mit dem bisschen Kraft, das mir geblieben war, zog ich mich hoch und schob das Fenster herunter. Ich lehnte mich heraus und erblickte ein Grauen, das die Schlossarbeiter von zuvor ganz klar in den Schatten stellte.
Der Zug stand mitten auf einer schmalen Br├╝cke, die ├╝ber eine steinige Schlucht f├╝hrte. Wie Regentropfen st├╝rzten Menschen dem Boden entgegen. Sie pressten sich geradezu durch die schmalen T├╝ren, um sich in die Tiefe fallen zu lassen. Auf dem Grund konnte ich gerade noch sehen, wie sich mehr und mehr rote Flecken bildeten, tats├Ąchlich fast so, als w├╝rden rot gef├Ąrbte Wassertropfen auf grauem Asphalt aufkommen. Doch so f├╝rchterlich dieses Bild auch war, es fiel mir schwer, die passende Empfindung daf├╝r in mir wahrzunehmen. Ich betrachtete die fallenden und am Boden zerplatzenden Menschen so, als w├╝rde ich vor einem Film sitzen, von dem ich wusste, dass er mithilfe jeder Menge Effekte erstellt wurde. Zudem verlie├č mich die Kraft in den Beinen, und so sackte ich langsam zur├╝ck in meinen Sitz. Kurz darauf sp├╝rte ich sehr deutlich, dass der Schlaf mich augenblicklich wieder ├╝berfallen w├╝rde. Und genau das tat er auch.
Akt IV
Dieses Mal weckten mich keine Worte, sondern das unbehagliche Gef├╝hl, beobachtet zu werden. Langsam ├Âffnete ich die Augen, wobei ich feststellen musste, dass meine Lider sich so schwer anf├╝hlten, als w├╝rden Gewichte an ihnen h├Ąngen. Vor mir stand der Schaffner, der nun kaum mehr wiederzuerkennen war. Aus dem wohlgen├Ąhrten Kauz war ein Skelett mit ├╝bergezogener Haut geworden. Die rote Farbe bl├Ątterte von seinen schmal gewordenen Lippen, die soweit zur├╝ckgezogen waren, dass man die gelbschwarzen Z├Ąhne dahinter sehen konnte. Aus seinen eingefallenen Augenh├Âhlen glotzten mich gro├če Glubschaugen an, die auf mich entweder emotionslos oder aber auf gemeine Art fr├Âhlich wirkten. Genau konnte ich das in diesem Moment nicht sagen, tippe nun aber auf letzteres.
┬╗Mein Herr, wir erreichen gleich das Ende unserer Fahrt┬ź, sagte das Schaffnergerippe in seinem Sack von einer Uniform, deren Blau jetzt sehr verblichen wirkte. Die vormals goldfarbenen Kn├Âpfe waren rostig geworden. ┬╗Ich bin nur angewiesen worden, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie sich nun anschnallen sollten, weil wir unsere Fahrt sogleich beschleunigen werden. Sollten Sie dies nicht tun, mein Herr, so tragen Sie die Gefahr Ihrer eventuellen Verletzungen selbst.┬ź
Ich war irritiert. Gern h├Ątte ich gefragt, was passiert war, weshalb er so mager geworden war, warum ich mich selbst so schwach f├╝hlte und warum all die Leute sich in den Tod gest├╝rzt hatten, doch es kostete mich einiges an Kraft, die Stimme ├╝berhaupt zu erheben. Und so fragte ich nur: ┬╗Weshalb beschleunigen wir denn, wenn wir doch am Bahnhof halten sollten?┬ź
Darauf lachte das Schaffnerskelett h├Âhnisch und so laut, dass es schrill in meinen Ohren nachklang. Dann blickte dieses Ding mich wieder an und sagte: ┬╗Weshalb, so muss ich Sie fragen, mein Herr, sollte die ›Hoffnung‹ denn an einem Bahnhof halten? Was glauben Sie, soll hier noch kommen?┬ź
Ich wusste keine Antwort, doch wahrscheinlich war die Frage ohnehin eher rhetorisch gemeint.
┬╗Aus Ihrer Sprachlosigkeit, mein Herr, entnehme ich, dass Sie keinerlei Anstalten gemacht haben, Ihr Herz zu befragen, wie ich sie angewiesen hatte. Hoffen Sie immer noch auf die wei├č leuchtende Dame, die Sie in Ihrem Kopf mit sich herumtragen wie ein Kehrpaket?┬ź
┬╗Vielleicht tue ich das, ja┬ź, antwortete ich wie von selbst und glaube, dass dies in dem Moment die gr├Â├čte Wahrheit war, die ich ├╝berhaupt von mir geben konnte. Und pl├Âtzlich erkannte ich den Trug, dem ich mich selbst ein Leben lang unterworfen hatte. Wer sagt denn, dass am Ende des Weges auch tats├Ąchlich das wei├če Leuchten wartet? Wer sagt mir, dass es nicht viel mehr ein dunkler Tunnel ist, in den ich mich selbst hineinman├Âvriere, und aus dem es keinen Ausgang mehr gibt? W├Ąre es nicht der richtige Weg gewesen, die ›Hoffnung‹ niemals zu besteigen und stattdessen mit meinen eigenen F├╝├čen hinaus in die Realit├Ąt zu treten?
Wie um meiner eigenen Erkenntnis Nachdruck zu verleihen, schloss der Schaffner an: ┬╗Mein Herr, ich muss Ihnen an dieser Stelle sagen, dass ich nicht einmal glaube, dass Sie ein wei├čes Leuchten von einem wei├čen Rauschen unterscheiden k├Ânnen. Im schlimmsten Fall ist n├Ąmlich genau dieses Rauschen das Ende Ihres Weges.┬ź
Darauf wendete er sich ab, schlurfte langsam und kraftlos ├╝ber den Gang und aus dem Waggon hinaus. Dies sollte sein letzter Besuch gewesen sein. Ich wusste das, weil seine Worte so endg├╝ltig geklungen hatten. Sie waren wie das bevorstehende Ende der Fahrt, doch ich machte keine Anstalten, aufzustehen und dem Schaffner nachzugehen. Meine Beine hatten ihre F├Ąhigkeit, zu laufen, ohnehin l├Ąngst eingeb├╝├čt.
Stattdessen schaute ich aus dem Fenster und entdeckte, ohne dass es mich gewundert h├Ątte, nichts mehr. Alles hatte diese Sepiafarbe angenommen, und es war, als w├╝rden wir ├╝ber eine ├╝berbelichtete Fotografie fahren. Es gab keine Landschaft, kein Wasser, keinen Himmel. Alles war hinfort. Doch hatte nicht lange Zeit, mir diesen Anblick einzupr├Ągen, denn pl├Âtzlich gab es einen heftigen Ruck.
Ich schlug mit dem Kopf auf den Tisch, als der Waggon nach vorn kippte, und sah f├╝r einen Moment Sterne. Vage konnte ich h├Âren, dass die Teetasse auf dem Boden zerschellte. Ich versuchte noch, meine schwachen Arme auf den Tisch zu st├╝tzen, um wieder hochzukommen, doch ich hatte keine Chance. Der Waggon fiel. Der gesamte Zug fiel, denn wir hatten das Ende der Gleise erreicht.
Akt V
Ich wei├č nicht, wie lange wir st├╝rzten, doch es schien mir wie eine Ewigkeit. Es war, als m├╝sste ich mein gesamtes Leben noch einmal im Nichts durchschreiten. Ich war zu schwach, um mich ├╝berhaupt noch bewegen zu k├Ânnen. Und so hing ich ├╝ber den Tisch gebeugt und tat ein weiteres Leben lang gar nichts. Immer wieder wurde mir sehr bewusst, dass dieses zeitlose Nichtstun nichts anderes als eine Metapher auf mein tats├Ąchliches Leben war. Wie zynisch, dachte ich dann zumeist und d├Ąmmerte immer wieder hinfort.
Doch w├Ąhrt nichts ewig, nicht einmal die ›Hoffnung‹, in der ich sa├č. Gerade, wenn man meint, es w├╝rde alles f├╝r immer so bleiben wie es ist, tritt doch eine radikale ├änderung zu Tage, nicht wahr? Ich h├Ârte f├╝r den Bruchteil einer Sekunde ein unertr├Ąglich lautes Krachen und konnte gerade noch denken, dass wir nun wohl endlich, wo auch immer, aufgeprallt waren, als um mich herum alles schwarz wurde.
Nun h├Ątte ich geglaubt, dass dies das wirkliche Ende gewesen w├Ąre. Doch das war es nicht. Aus dem Schwarz wurde allm├Ąhlich ein verwaschenes Grau, das vor meinen sehenden Augen pulsierte. Und mit jedem Schlag hellte es sich auf, bis ich es als grelles Wei├č wahrnahm. Als wei├čes Rauschen. War es das, was der Schaffner gemeint hatte? Das musste es wohl sein. Ich hatte gefunden, wonach ich unbewusst immer gestrebt hatte. Und noch im Zuge der Erkenntnis formte sich aus dem wei├čen Rauschen ein Bild.
Ich schreckte hoch, als sich die Ansage in mein Ohr bohrte: ┬╗Meine werten Damen und Herren, wenn Sie nun zu beiden Seiten aus dem Fenster blicken, k├Ânnen Sie die Realit├Ąt entdecken. Die wundersch├Âne Landschaft, die sich Ihnen hier bietet ist wahrhaftig und doch haben Sie alle sie niemals wahrgenommen, nicht wahr? Ich weise Sie nur darauf hin, weil wir hier leider aus Fahrplangr├╝nden nicht halten k├Ânnen. Nehmen Sie die Bilder in sich auf, meine Damen und Herren. Es sind die sch├Ânsten, die Sie mit Ihren eigenen Augen w├Ąhrend der Fahrt wahrnehmen werden. Vielen Dank!┬ź
Ich schaute mich um, w├Ąhrend der Schlag meines Herzens sich allm├Ąhlich wieder normalisierte, ebenso wie der Schreck, als ich feststellen musste, dass ich wieder am Anfang war. Ich sah den Tisch vor mir, sah die alte Dame, die gegen├╝ber d├Âste und w├╝rde wohl demn├Ąchst meinen Tee bekommen.
Nat├╝rlich k├Ânnte ich noch einmal erz├Ąhlen, was anschlie├čend geschah. Doch es w├╝rde sich nichts ├Ąndern, oder? Ich habe die gesamte Geschichte mittlerweile unendliche Male durchlebt und bin es leid. Ich wei├č nicht, weshalb ich all das jetzt aufschreibe. Vielleicht ist es, weil Papier geduldig ist. Geduldiger als ich, nehme ich an. Dies soll meine letzte Fahrt sein. Und dies meine letzten Worte. Auch ich werde dieses Mal den Zwischenhalt nutzen. Wie hei├čt es in einem Lied, das ich gern mag? ┬╗Ich bin die Hoffnung, und du stirbst mit mir.┬ź Wenn dies die einzige M├Âglichkeit ist, die mir verbleibt, dann sei es so. Wer auch immer das hier lesen mag, dem kann ich nur ans Herz legen, sich nicht an die Hoffnung zu klammern. Ganz egal, ob sie als Zug daher kommt oder im Gewand eines freundlichen Gedankens. Sehen Sie sich die Realit├Ąt nicht durch ein Fenster an, sondern durchwandern Sie sie selbst. Bitte!
gez.: Nemo