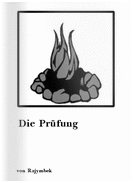Eine grausame Nacht
Die Baustellenbeleuchtung strahlte grell in die Nacht. Männer in schmutzigweißen Helmen gingen zielgerichtet in diesem vermeintlichen Chaos ihrer Tätigkeit nach. Betonmischer rumpelten. Preßlufthämmer ratterten. Hohe, graziöse Krane löschten die Ladung der mit Betonplatten versehenen Schwerlasttrasporter. Gigantische Kipplaster mit riesengroßen Rädern dröhnten wie Ungetüme durch den schlammigen Morast. Eigenartig, trotz dieser Lebendigkeit des Treibens war kein Laut zu vernehmen. Die Szene lief ab wie in einem Stummfilm.
Ein Mann in einem grauen Mantel und mit Hut stolperte aus dem Nichts kommend durch die Szenerie. Wie kam er so plötzlich dort hin? Was hatte er hier zu suchen? Was tut, um Gottes Willen, dieser Irre mitten in der Nacht dort? Ist er eventuell der Bauleiter auf seiner Inspektion? Nein, das konnte er nicht sein! Dieser würde mit Stiefeln und Arbeitsjacke seinen Kontrollgang absolvieren. Sicher würde er sogar im Jeep über die Baustelle rollen. Der Mann bewegte sich auffallend unsicher. Hatte er etwas getrunken? Ging es ihm nicht gut? Der Graubemantelte wirkte auf irgendeine Weise hilflos, orientierungslos, im Stich gelassen. Um ihn herum bewegten sich Schlamm spritzend, die gewaltigen Räder wie Walzen unter sich rotierend, die Laster. Ich wollte ihn rufen, ihn warnen. Doch nur leises Hauchen rann aus meiner Kehle. Der Mann hätte ohnehin nichts gehört. Er tappte weiter wie blind vorwärts.
Ein vor ihm vorbeifahrendes Baustellenfahrzeug mußte ihn mit einer mächtigen Schlammpackung versehen haben. Er schreckte zurück, wankte, drehte sich plötzlich, die Augen wischend, um. In diesem Augenblick erkannte ich den Mann mit dem grauen Mantel. Erschrocken blickte ich in das Gesicht meines Vaters. Er war von oben bis unten mit Matsch bespritzt, so daß er nichts mehr registrieren konnte. Ich schrie, ich brüllte mir fast die Lunge aus dem Leib, so daß mir schon die Augen aus ihren Höhlen zu treten schienen. Kein Ton war zu hören. Es war absolut still. Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn. Ich sah, wie eines von diesen Baustellenmonstren sich auf meinen Vater zu bewegte. Ich ruderte mit den Armen, versuchte auf alle erdenkliche Weisen auf mich aufmerksam zu machen. Er tapste weiter. Er sah nichts. Er hörte nichts.
Doch was war das? Er torkelte in die verkehrte Richtung, fiel Hals über Kopf in eine dieser mit Schmutzwasser gefüllten Schlammspuren und blieb liegen. Er blieb einfach liegen als wollte er schlafen. In diesem Augenblick sah ich diese riesenhaften Räder. Sie kamen direkt auf ihn zu, wurden größer und größer. Bald so groß wie ein Auto, bald so groß wie eine Garage, bald so groß wie ein Haus. Starr vor Angst rollten Tränen und Schweißperlen in Bächen Stirn, Schläfen und Wangen hinunter. Ich hörte noch das Knacken von Knochen.
Völlig verschwitzt wachte ich auf. Ich hatte also doch ein Geräusch gehört. Die Tür hatte geknarrt. Das Licht fiel auf die zarte Figur meiner Mutter. Weinend und mit bebender Stimme brachte sie stockend über ihre Lippen: „Die Polizei war gerade da. Vati hatte einen Unfall. Er ist unter die S-Bahn geraten. Wahrscheinlich ist ihm die linke Hand abgetrennt worden.“ Noch ganz benommen konnte ich gar nicht so recht begreifen, was passiert war. Ich erfaßte nur, daß es etwas Schlimmes sein mußte. Spontan nahm ich Mutti in den Arm. Ich war einfach fassungslos. „Es ist bestimmt nicht so schlimm“, versuchte ich sie zu trösten. Den einzigen Trost, den ich ihr in diesem Augenblick geben konnte, war meine innige Umarmung.
Wir weckten die beiden Kleinen. Frank, der emotionalste von uns Söhnen, bekam einen Weinkrampf. Unser Dicker, der dem Vater charakterlich am nächsten steht, war völlig entsetzt. Den Rest der Nacht bekamen wir kein Auge mehr zu. Ein paar Augenblicke später kuschelte sich der Dicke weinend in Muttis Bett. Unsere Gedanken und Gespräche kreisten nur um Vater. Er lebt. Es hätte also schlimmer kommen können. Aber wie konnte der Unfall überhaupt passieren? Vater ist doch eher der ruhige, besonnene Typ. Er tut doch nichts Unüberlegtes. Die ganze Nacht dachten wir darüber nach, wie das Leben für ihn mit nur einer Hand eingeschränkt würde.
Erst in solch einem Augenblick wird einem bewußt, welches Wunder uns Mutter Natur zur Verfügung gestellt hat, wozu unsere Hände uns dienen. Jeden Handgriff nahmen wir ins Visier. Schreiben kann man sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand, Autofahren, Vaters liebstes Hobby, zur Not auch. Mutti griff zärtlich meine Hände, streichelte sie und meinte immer wieder, daß ich sie vom Vater geerbt hätte. Kaum hatte sie das gesagt, rollten auch schon wieder die Tränen. Wie soll jemand diesen Schmerz begreifen? Wie soll jemand diese Verzweiflung nachempfinden? Was blieb, war die Hoffnung, daß Vati noch lebt; also wird es schon irgendwie weitergehen. Trotz der sich wieder und wieder um Vater drehenden Gespräche und der wundersamen Möglichkeiten der Hände vergingen die Minuten wie Stunden. Völlig entkräftet, entnervt und kaum noch möglich eine Träne zu vergießen bangten wir der Morgendämmerung entgegen.