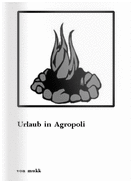Urlaub in Agropoli
Heute noch erfasst mich ein unangenehmes Gefühl, wenn ich an den Urlaub in Agropoli, südlich von Neapel, zurückdenke.
Obwohl inzwischen mehr als 10 Jahre vergangen sind, wird mir immer noch flau im Magen und ich fühle würgende Angst im Hals, sobald mir jener Unglückstag in Erinnerung kommt. Wir fuhren mit einer Gruppe von Freunden und Bekannten im Zug nach Kampanien. Adi und ihr Mann, der wie meiner Franz heißt, waren mit Paulo, dem Hotelbesitzer, gut bekannt. Sie hatten für die ganze Gruppe ein günstiges Angebot erhalten.
Schon die Fahrt war schön und lustig, bis Battipaglia....
Hier blieb der Zug unerklärlicherweise stehen.... eine Viertelstunde, eine halbe Stunde....
aufgeregtes Zugpersonal... Polizei... eine Stunde, zwei Stunden....
Es hatte einen Todesfall gegeben – ein Mann lag auf den Schienen.
War es Selbstmord? War es ein Unfall?
Wir haben es nie erfahren.
Auch nicht, wann der Zug weiterfuhr, denn nachdem Adis Franz und der Bahnhofsvorstand in unserem Hotel angerufen hatten, holten uns der Besitzer und seine Angestellten in vier Autos ab.
Wir waren alle ein bisschen gedrückt – „hoffentlich kein böses Omen!“
Doch dann – das Hotel, direkt am Meer, die weiß schäumenden Wellen, die den steinigen Strand umspülten, der Blick auf das Städtchen Agropoli mit seiner alten Festung auf einem Hügel. Sonne und blauer Himmel – das alles ließ das eben Erlebte schnell vergessen.
Und obwohl es schon Abend war, das Meer unruhig und hochaufschäumende Wellen herein rollten, gingen alle noch baden. Nach der langen Fahrt, nach der Aufregung und der Hitze tat es uns gut, Seele und Körper in den Fluten des Mittelmeers abzukühlen.
Else und ich hielten uns an den Händen und hüpften vergnügt über die Wogen. Zu schwimmen wagte ich, im Gegensatz zu Franz, meinem Mann, in dem aufgewühlten Gewässer nicht. Dazu bin ich zu ungeübt.
Zufrieden und erfrischt, aber dennoch müde, begaben wir uns zeitig zu Bett. Das Rauschen des Meeres wiegte uns sanft in den Schlaf.
Am nächsten Morgen gab es ein kleineres Frühstücksfiasko.
Den Süditalienern ist unsere Art zu frühstücken unbekannt. Sie holen sich an der Bar einen Espresso – in einer winzig kleinen Tasse – dazu ein Croissant. Fertig.
So staunten wir nicht schlecht, dass nichts gedeckt war, kein Brot, kein Kaffee, kein Geschirr, weder Butter noch Marmelade für uns bereit standen.
Adi organisierte alles, was wir brauchten, ging selbst in die Küche, während Else und ich den Kaffee servierten. Bald darauf saßen wir gemütlich an den Tischen im Garten, ließen es uns schmecken und hörten der tosenden Brandung zu.
Am nächsten Tag bereits klappte alles. Das Personal hatte sich schnell auf unsere Wünsche eingestellt.
Am Vormittag unternahmen wir einen Ausflug nach Paestum.
Als griechische Kolonie um 600 v. Chr. gegründet, war es 273 v. Chr. bereits in römischer Hand. Nach Überfällen und Verwüstungen durch die Araber verließen die Menschen im
9. Jahrhundert die Stadt und siedelten in den Bergen. Heute sind nur noch einige Tempel, die Reste einer Basilika, der Stadtmauer und einiger Straßen erhalten. Im antiken Amphietheater, wo noch die Gänge für die Raubtiere in gutem Zustand zu bewundern sind, spielten Hansi und Franz für mich, bzw. für ein Foto, wilde Tiere, die hungrig und kampfeswütig in die Arena stürmen.
Die archeologische Stätte wird durch ein Museum ergänzt, in dem alle möglichen Ausgrabungsfunde gezeigt werden. Am bedeutendsten sind die freskengeschmückten Platten aus dem Grab des Tauchers.
Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit fuhren wir mit dem Bus zurück nach Agropoli und suchten ein Lokal zum Mittagessen. Im „Bella Napoli“, in einem schattigen Garten, bestellten wir Pasta, Lasagne und andere italienische Speisen. Alles war gut.
Beim Zahlen jedoch erlebten wir die nächste Überraschung – der Kellner kam mit einer Sammelrechnung.
„No, no!“ protestierten wir, „no tutti! Solo pagare! Prego!” – Wir wollten unsere Zechen paarweise, jeder selbst bezahlen – ein Ding der Unmöglichkeit!
So nahmen einige Clevere von uns die Mega-Rechnung und suchten mühsam zusammen, wer was konsumiert hatte. Das währte ein schönes Weilchen – sehr zu Gaudium der Italiener. Denn alle, die Chefin des Restaurants, die Kellner, die Köche und Küchengehilfen – sie alle waren in den Garten gekommen und schauten aus zwei bis drei Metern Entfernung dieser Aktion fasziniert zu.
Endlich verließen wir das Lokal. Als wir einige Schritte gegangen waren, setzte sich Adi auf eine Bank am Weg, schürzte neckisch ihr Röcklein und sagte: „Zur Strafe hab´ ich eine Serviette als Souvenir mitgenommen – ich hab´ ja so Rheuma!“ – Und zeigte uns ihr mit der roten Stoffserviette bandagiertes Knie.
Was dann kam, rief die ganze Gasse auf den Plan.
Wir lachten, lachten und lachten. Wir wanden uns vor lauter Lachen, die Tränen traten uns in die Augen und es schüttelte uns wie Epileptiker. Wir konnten einfach nicht aufhören, sodass neben anderen Passanten das komplette Gasthauspersonal auf die Straße eilte und uns staunend beobachtete.
Gerne würde ich einige ihrer damaligen Gedanken kennen.
In dieser ausgelassenen Stimmung – zeitweise durch eine neuerliche „Knieschau“ aufrechterhalten – wanderten wir beschwingt am Meer entlang zu unserem Hotel und zu einer ausgiebigen und wohlverdienten Siesta.
Am Nachmittag war baden, schwimmen und faulenzen angesagt.
Tosende Brandung wühlte das Meer auf. Riesige Wellen rollten herein und brachen sich weiß schäumend. Franz war begeistert von dem hohen Wellengang. Er ließ sich von den Wogen tragen und schaukelte mit ihnen hoch hinauf, ehe er wieder im Wellental versank.
„Schwimm´ mit mir ein Stückerl hinaus“, versuchte er mich zu überreden, „ich bin ja bei dir.“ Doch ich hatte Angst. Ich bin keine so sichere Schwimmerin und traute mich einfach nicht. Statt dessen hüpfte ich mit Else wieder vergnügt über die heranrollenden Wellen. Franz schwamm ein Stückchen weiter draußen.
„Muk“, rief er, „komm her!“
„Nein! Ich trau mich nicht!“
Noch einmal: „Muk, komm´ her!“
Zuerst glaubten Else und ich, er wollte mich unbedingt zum Schwimmen überreden. Es war ja bis weit hinaus seicht, zumindest so, dass man überall gerade noch stehen konnte.
Aber dann merkte ich, dass etwas nicht stimmte.
So schnell ich konnte, arbeitete ich mich mit einer irrsinnigen Angst im Bauch zu Franz hinaus – ein Stückchen schwimmend, dann wieder den Grund kontrollierend. Franz kam nicht von der Stelle. Die Wellen rissen ihn immer wieder zurück.
Ich konnte gerade noch auf den Zehenspitzen stehen.
„Gib mir deine Hand.“, keuchte Franz! Ich merkte, dass auch er Angst hatte und verzweifelt im Wasser kämpfte.
Ich streckte mein Hand aus, erwischte seine und hielt sie fest. –
Da riss uns mit donnernder Gewalt die nächste Welle auseinander und trieb mich noch weiter hinaus als Franz.
Ich fand keinen Grund mehr. Nur Tosen und Brausen und jeden Augenblick eine Welle, die über mir zusammenschlug.
Ich bekam Todesangst, bekam keine Luft, schluckte Wasser und dachte: „Jetzt ertrinken wir beide!“
... Und dann schrie ich. Rief im Wellental aus Leibeskräften: „Hilfe!“ – Welle! Patsch! – Und noch einmal: „Hilfe!“ – Franz trieb einige Meter vor mir. – Noch einmal mein verzweifelter Hilferuf – ob ihn bei diesem Getöse jemand hört?
Dann versuchte ich mit aller Kraft die nächste Welle zu durchschwimmen. Endlich erreichten meine Zehenspitzen wieder den Meeresboden und ich sah Franz nun hinter mir. Aber ich sah – Gottlob – auch schon die Retter ins Wasser laufen. Innerhalb weniger Sekunden waren sie bei mir. „Mein Mann!“, keuchte ich, denn ich hatte mit den Wellen, die mich laufend überrollten, noch schwer zu kämpfen.
Man kann sich die Wucht des Wassers gar nicht vorstellen.
Obwohl ich bald Grund unter meinen Füßen gehabt hatte, kam ich kaum vorwärts und schluckte Mengen von Wasser. Nur noch wenige Meter vom Strand entfernt, glaubte ich, vor Erschöpfung umzufallen. Ich spuckte und prustete, alles drehte sich und mir war schlecht von der Anstrengung und der Angst um Franz – wie geht es ihm?
Die Männer hasteten weiter. Sie waren gleich in ihren Jeans ins Wasser gehechtet.
Sie zogen Franz ans Land, legten ihn auf ein Strandbett und wickelten ihn gegen den Schock in eine Decke ein. Sie fühlten seinen Puls und gaben ihm Zuckerwasser zu trinken. Der eine, ein Hotelgast wie wir, nahm immer wieder die Hand von Franz und betrachtete die Fingernägel, ob sie sich blau oder weiß verfärbten – wegen des Kreislaufs und der Durchblutung – sagte er.
Nach einer Weile konnte mein Mann wieder aufstehen und wir begaben uns auf unser Zimmer.
Fünf Minuten später schlief Franz tief und fest.
Ich lag aufgepeitscht, aufgewühlt und total erledigt neben ihm.
Als ich sicher war, „es ist vorbei, Franz ist über den Berg“, ließen meine Nerven aus und ich bekam einen Weinkrampf.
Damit ich meinen Mann nicht aufwecke, schlich ich ins Badezimmer, wo es mich nur so schüttelte. Ich konnte an diesem Abend mit dem Weinen gar nicht aufhören.
Erna, Rosa und Hansi kamen und erkundigten sich, wie es Franz gehe. Erna weinte gleich mit. Sie hatte meine Hilferufe gehört und Rosa hatte Hansi gleich um Hilfe losgeschickt.
Paulo, der Hotelbesitzer, und ein Gast des Hauses waren sofort in das Wasser gelaufen, um uns heraus zu holen.
Der Urlaubsgast war ein Brückenbau-Ingenieur und Fischer aus Süditalien.
Am nächsten Abend luden wir ihn zu einer Flasche Wein ein und er erzählte uns, dass er schon einige Male Menschen aus dem Wasser gerettet hatte.
Er erklärte uns auch, dass sich die Welle brach, dass sie umkippte und ins offene Meer zurückrollte. Dadurch riss sie Franz immer wieder mit hinaus. Das heißt, er zeichnete es auf und sprach mit Händen und Füßen. Denn er konnte kein Wort deutsch und wir kein Wort italienisch. Trotzdem unterhielten wir uns zwei Stunden lang äußerst angeregt.
Nur zögernd ließ uns der Schreck dieses Nachmittags los.
Natürlich lenkten in den nächsten Tagen viele schöne Eindrücke von diesem schlimmen Erlebnis ab – wie ein Ausflug auf den Vesuv und nach Herkulaneum, oder eine Fahrt mit dem Schiff nach Capri, von wo wir mit dem Bus hoch hinauf fuhren, um Anacapri und San Michele zu besichtigen.
Wunderschön waren auch die Abende auf der Hotelterrasse, wenn wir die Sonnenuntergänge beobachteten. Der Mann, der den Text zu dem Lied: „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt...“ geschrieben hat, muss, so wie wir, an dieser Küste gesessen haben.
Wie wir, sah er die glutrote Sonne im orange-goldenen Meer versinken und am Horizont die Umrisse von Capri schwarz und schemenhaft aus dem Wasser ragen.
Die halbe Stunde des Sonnenunterganges glich jeden Abend erneut einem kleinen Wunder – ich werde es nie vergessen.
Dieses Schauspiel und mancher Ausflug, einzeln herausgehoben, waren wirklich schön und eindrucksvoll. Ich denke heute noch gerne an Capri, an den Marsch auf den Vesuv, an die Spaziergänge in und um Agropoli, an das kleine Hotel „La Darsena“ und an den liebenswerten Paulo, unseren Gastgeber.
Doch wenn ich „insgesamt“ an den Urlaub in Agropoli denke, so ist jenes Bade-Abenteuer die vorherrschende Erinnerung, die mir heute noch das Gefühl jener Angst zurückruft und die immer noch mit würgendem Griff meinen Hals umfasst.
I. H.