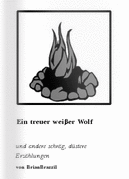Beschreibung
5 etwas ältere Erzählungen
Ein treuer weißer Wolf
„Gott gab mir Mut, Gott gab mir Kraft. Und nun nimmt er sich beides zurück.“ Mit diesen Worten starb einer der größten Abenteurer unserer Zeit an den Ufern des Welve. James A. Nashville war berühmt und gefürchtet als der beste Schütze in ganz West-Amerika.
Trotz großer Bemühungen und weiträumiger Suchaktionen
ist sein Schatz, sein durch Kopf- und Blutgeld angereichertes Vermögen, bis heute nicht gefunden worden. Man wähnt es tief in den Bergen.
Mik erwachte. Sein Gesicht war mit Schweiß bedeckt, sein Atem ging flach, sein Kopf war hochrot angelaufen. Der Wind heulte draußen vor dem Zelt und sein donnerndes Gebrüll erfüllte Miks Herz und Seele mit nicht erkennbarem Grauen. Große Schatten wisperten durch die Nacht und zeichneten sich dunkel auf der Plane des Zeltes ab, zuckten ab und zu wie schwerfällige Peitschen. Mik stand langsam auf, die Decke um sich geschlungen und wankte zur Zelttür. Er öffnete sie und stolperte hinaus in die unruhige Nacht. Ein leichter Nieselregen traf seitlich auf sein Gesicht und der Himmel donnerte jetzt so laut, als wolle er gleich auseinander brechen; er schien sein Antlitz zusammenzuziehen, schien von Schmerzen geplagt. Für einen Augenblick erstarb das Tosen und Mik glaubte ein schwaches Jaulen in der Ferne zu hören, das sich vom Pfeifen des Windes abhob. Er zog die mitgenommene Decke enger um die Schultern und ging ein paar Schritte bis zur nahen Klippe. Seine nackten Füße spürte er schon nicht mehr. Das Tosen begann erneut, noch stärker als vorher und erstickte das ferne Jaulen. Er spürte die raue Erde unter seinen Füßen, er grub die Fußnägel hinein und lauschte angestrengt. Das Zelt hinter ihm zappelte im Wind, riss sich plötzlich aus seiner Verankerung und wurde zur Klippe hingezogen. Es traf Mik am Rücken und zog ihn mit sich in den Abgrund…
Oben auf einem Felsen, stand ein einsamer, weißer Wolf inmitten des tosenden Sturms. Er heulte in die Nacht hinaus und sein Jaulen klang klagvoll und schmerzlich und übertönte sogar noch den rasenden Sturm. Als er sich umdrehte und mit dem Abstieg begann, klimperte es leise, fast unhörbar unter seinen Pfoten und eine einzelne Münze kullerte hinunter…
Am nächsten Tag fand C. K. Thomas die Leiche des unglücklichen Wanderers, zerschellt am Boden der Klippe. Neben seinem Kopf lag, fast gänzlich versteckt in einer Pfütze, eine goldene Münze…
Eisstraum
Ronald wanderte über den schneebedeckten Boden. Er rieb kräftig die Hände aneinander, damit sie warm blieben. Seine Handschuhe waren nass und kalt und kühlten die Hände zusätzlich, statt sie zu schützen. Der Wind pfiff um seinen Kopf und das Schneegestöber vor ihm verschlang jeden Laut, den er zu hören glaubte. Ob Terry noch am Leben war? Mühsam stapfte er weiter. Er erklomm einen kleinen Hügel und versuchte angestrengt in die Kälte hinauszuhorchen. Der Wind pfiff weiter. Tönte da ein schwacher Ruf? Oder war das nur ein Spiel des Windes?
Er runzelte die Stirn. Jemand wisperte plötzlich ganz nah an seinem Ohr. Erschrocken sprang er zur Seite und sah in den Schnee hinaus. „Wer ist da?“ Als Antwort pfiff der Wind kurz etwas schneller und der Atem aus seinem Mund schwebte als Nebel in der Luft und vereinigte sich mit dem Hintergrund. Ronald hielt die Hand über die Augen, aber er konnte niemanden erkennen. Nur vage Schemen. Oder? Sie schienen sich sehr schnell zu verformen und wechselten stetig den Umfang. Ronald schob seine Hände tiefer in die Taschen. Kälte, von anderer Art als die vorherige, kroch seine Körper hinauf. „Hhhaallloo…“, fragte er zitternd. Er schaute sich zögernd nach allen Seiten um. Er versuchte keiner Seite lange den Rücken zuzuwenden. Sein Körper schmerzte jetzt vor Kälte. „ Terry!“, schrie er verzweifelt. Seine Stimme verklang in der Kälte. Ein trauriger Klang. Für einen Moment schienen die Schemen in mitleidiger Geste stehenzubleiben, bevor sie ihren Tanz fortsetzten. „Terry!“, versuchte er es noch einmal. Sein Atem schwebte als Kristallnebel vor ihm. Seine Hände spürte er nicht mehr. Ein Blitzen auf der Schneedecke. Ronald drehte sich um sich selbst und stolperte über eine Schneewehe. Der Schnee war noch kälter als der Wind. Er konnte nicht mehr. Nicht mehr aufstehen. Er sah nur noch den weißen Schnee über sich fliegen. „Wie wunderschön“, dachte er. Sein Atem gefror in der Luft. Ob Terry noch am Leben war…?
Black as the Night
Jim Repoiter stand im Regen. Der Regen lief nass und kalt an seiner Wange herunter. Der Wind frischte dann und wann auf, kräuselte sein Haar und lies ihn kurz erzittern.
„Zittern“, dachte er, „ist irgendwie ein schönes Gefühl. Angenehm fast.“ Er zitterte wieder. Die Blätter der Bäume hinter ihm raschelten leicht im Wind. Es klang beinahe ohrenbetäubend. Seine Schuhe waren durchnässt.
Eine Frau trat ins Laternenlicht auf der anderen Straßenseite. Sie stand nur da und sah ihn an. Ganz in Schwarz war sie. Ohne einen Konturenunterschied zum schwarzen Hintergrund. Einfach Schwarz. Wie die Nacht. Regen tropfte aus ihren Haaren. Auch sie waren schwarz. Der Regen tropfte aus ihnen heraus. Es sah wunderschön aus. Die Bäume raschelten. Schwarz wie die Nacht. Sie überquerte die Straße. Das Rauschen begann abzuebben. Es wurde leiser und leiser. Mit jedem Schritt, den sie näher kam wurde es leiser. Die Welt wurde langsamer mit jedem ihrer Schritte. Farbloser, unwichtiger mit jedem Schritt. Mit jedem Schritt. Die Bäume rauschten nicht mehr, der Regen tropfte nicht mehr. Sie war jetzt da, ganz nah. Ihre Augen, schwarz wie die Nacht. Jim wagte nicht zu atmen. Die Frau beugte sich vor und küsste ihn. Auf den Mund. Einen Augenblick lang blieb die Welt stehen. Schwarz wie die Nacht…
Die Blätter rauschten, der Regen tropfte. Und die Nacht war schwarz…
Der Baum
Havon zog das Gewehr näher an seinen Körper. Es war seine einzige Chance. Sein Atem ging keuchend. Der Helm auf seinem Kopf war bleiern schwer. Das Rattern trieb ihn fast in den Wahnsinn. Rockford kam, tippte ihm auf die Schulter und schrie über den Krach hinweg: „Welche Position?!“ Havon war eigentlich zu müde zum Antworten. Seine Kehle fühlte sich leer und trocken an. Leise krächzte er, die Stimme anstrengend: „Halbrechts…“ Rockford schlug ihm etwas zu heftig auf die Schulter und ging geduckt weiter.
Havon hörte auf gerade zu stehen und lehnte sich an den schützenden Baum. Der starke Stamm gab ihm einen schwachen Trost. Er war kahl und seine knochigen Äste hingen müde herunter, aber sein Stamm war noch kräftig, warm und, wie es Havon schien, voller Leben. Voller Leben. Er schloss für einen Moment die Augen. Fast spürte er wie der Stamm pulsierte. „Bereitmachen!“, ertönte es links von ihm. Havon ließ die Augen geschlossen. „Und…“ Havon packte das Gewehr noch fester. Das Metall schnitt ihm fast in seine Hände. „… LOS!“ Havon drückte sich ein letztes Mal mit dem Kopf gegen den Stamm, dann drehte er sich um die eigene Achse und stürmte vor…
Rockford lehnte erschöpft an einem Baum und riss sich den Helm vom Kopf. Die Sonne schien schwach hinab und vertrieb allmählich den Blutgeruch und den Rauchgestank in der Luft. Ein anderer Soldat, den Helm unter den Arm geklemmt, kam zu ihm. „Wo ist Havon.“ Rockford sah ihn an. Seine Augen waren mit Schatten überzogen. Er schüttelte den Kopf. Der andere nickte stumm. Rockford lächelte plötzlich durch seine wenigen Tränen und sagte: „Dieser Baum hier macht es fast leichter den Schmerz und das Sterben zu vergessen.“ Beide sahen hoch. Die knochigen Äste reckten sich gen Himmel…
Taube auf dem Dach
Taube auf dem Dach. Stürmischer Wind. Passanten laufen über die Straße, die Mantelkrägen hochgezogen. Der Wind kreischt kalt in den Gassen. Leichter Regen setzt ein.
Taube auf dem Dach. Ein Schiff auf der Elbe, wie von Geisterhand gelenkt. Die Elbe schwappt an die Brücke. Ein Mann starrt hinunter ins Wasser. Seine Tränen mischen den Regen.
Taube auf dem Dach. Die Glocke schlägt 4.00 Uhr. Die Möwen kreischen. Ein junges Liebespaar steht auf der Brücke. Ihr Haar flattert im starken Wind. Sie schließt ihre Augen. Ein Auto fährt viel zu schnell vorbei.
Taube auf dem Dach. Er hat den Arm um sie gelegt, seine Gesichtszüge sind entspannt. Die Wolken fliegen über den Himmel. Sekunden, Stunden, nur Momente. „Wir müssen gehen.“ Seine Stimme ist sanft. Seine Hand berührt die ihre. „Nein.“ Sie drückt seinen Arm fester. „Nein.“ Sie lächelt und zittert.
Taube auf dem Dach. Der Wind pfeift stärker. Flügel gebläht.
Taube auf dem Dach. Ein Schiff fährt unter die Brücke. Die beiden sehen nach unten. Die Frau schaut wieder auf. „Sieh nur, da ist eine Taube auf dem Dach.